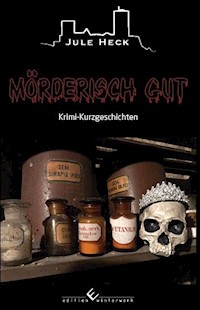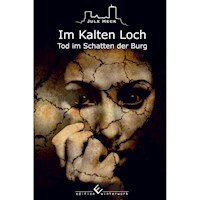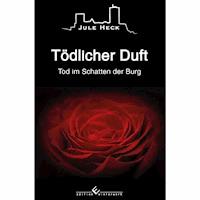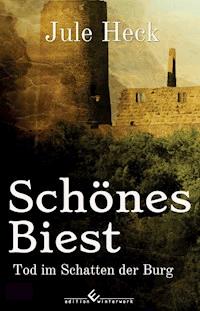Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition winterwork
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Autoren-Paar schreibt seit seiner frühen Jugendzeit. Im Laufe ihrer schriftstellerischen Entwicklung hat sich Jule Heck auf Kriminalromane spezialisiert, die unter dem Titel Tod im Schatten der Burg erscheinen. Gernot Heck bevorzugt den klassischen Gesellschaftsroman, der unter seinem Pseudonym publiziert wird. Beiden gemeinsam ist die Liebe zu Kurzgeschichten, in denen sie sich mit den Begebenheiten des Alltags ebenso beschäftigen, wie mit fantasievollen Stories, fabelhaften Ereignissen oder Geschichten aus der Vergangenheit. Dabei zeigen sie eine verblüffende Wandlungsfähigkeit durch immer wieder neue Themen. Mit diesem Buch haben sie sich erstmals auch als Autoren zusammengetan und bieten ihren Leserinnen und Lesern einen kleinen Überblick über das Spektrum ihres Schaffens. Sie wünschen viel Freude bei der Lektüre von Kurz und gut.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Verlages gestattet. Verwendung oder Verbreitung durch unautorisierte Dritte in allen gedruckten, audiovisuellen und akustischen Medien ist untersagt. Die Textrechte verbleiben bei den Autoren, deren Einverständnis zur Veröffentlichung hier vorliegt. Für Satz- und Druckfehler keine Haftung.
Impressum
Jule Heck und Gernot Heck
»Kurz und gut - Kurzgeschichten«
www.edition-winterwork.de
© 2019 edition winterwork
Alle Rechte vorbehalten.
Satz: edition winterwork
Umschlag: edition winterwork
Druck/E-BOOK: winterwork Borsdorf
Kurz und gut
Kurzgeschichten
Geschichten von Jule HeckTeil 1
Späte Rache
Eigentlich hatte sie noch nicht sterben wollen. Sie hatte immer gesagt, dass sie mindestens 90 Jahre alt werden und dann in ihrer Stammkneipe an der Theke nach einem letzten Drink tot vom Barhocker fallen wolle. Doch das Schicksal hatte es anders mit ihr vorgesehen. Wobei das nicht ganz stimmte. An ihrem vorzeitigen Tod in noch relativ jungen Jahren war sie selbst schuld.
Carina war in einem Stadtteil von Bad Nauheim so etwas wie die Dorfzeitung. Sie saugte Gehörtes auf wie ein Schwamm, ging dem Gesagten auf den Grund, fragte Nachbarn, Freunde und Bekannte auf der Straße aus, so lange, bis sie alles herausgefunden hatte, was sie wissen wollte. Und was sie nicht bis ins kleinste Detail erfahren hatte, schmückte sie mit ihrer eigenen Phantasie aus. Und die war nicht gerade gering.
Natürlich konnte sie das unmögliche, ungeheuerliche Geschehen, von dem sie Kenntnis bekam, nicht für sich behalten. Jedes Gerücht, jeder Tratsch wurde von ihr weitergetragen. Sie nutzte jede Möglichkeit, morgens beim Bäcker oder tagsüber beim Einkauf. Sie traf nie jemanden zufällig, nein, sie passte die Leute regelrecht ab, um die Neuigkeiten in ihrem Stadtteil zu verbreiten. So hatte sie schon manche Ehe in ihren Grundfesten erschüttert, einige Freundschaften zerstört und Hass und Neid zwischen Nachbarn gesät.
An einem sonnigen Nachmittag Anfang Januar verließ sie frühzeitig ihr Haus, das sie, nachdem sie ihren Mann nach langjähriger Ehe als Erbschleicher beschimpft und vergrault hatte, alleine bewohnte. Die Sonne schickte um diese Uhrzeit noch wärmende Strahlen zur Erde. Doch am Abend wurde Frost erwartet, später war mit heftigem Schneefall zu rechnen. Sie eilte durch den Park, den Oberkörper leicht nach vorne gebeugt. Ihr Kopf schaukelte hin und her. Ihre Schritte wurden von einem unaufhörlichen Gelächter begleitet. Sie lachte über ihre eigenen bösartigen Gedanken, die sie alsbald ihren Freundinnen mitteilen wollte.
Für den Obdachlosen, der hinter einem Gebüsch hervorschaute, hatte sie nur ein Gehässiges: „Verschwinde, du Stück Dreck“, übrig. Sie hatte den Mann, der in zerrissenen und dreckigen Kleidern steckte und wahrscheinlich fürchterlich fror, nicht erkannt. Die hass- und wuterfüllten Blicke, die ihr folgten, bemerkte sie nicht. Wenn sie die Gedanken des Penners, wie sie solche Subjekte bezeichnete, hätte erahnen können, wäre sie erschrocken. Ohne weiter über diese Begegnung nachzudenken, näherte sie sich schnellen Schrittes dem Restaurant im Park von Bad Nauheim. Dort wollte sie sich mit ihren Schulfreundinnen zu einem regelmäßig einmal im Monat stattfindenden Stammtisch treffen. Im Restaurant „Teichhaus“ ließen sich die Freundinnen mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen, tranken das eine oder andere Glas Wein zu viel und wurden von Stunde zu Stunde immer lauter und ausfallender.
Carina war in der Auswahl der Getränke nicht kleinlich. Nach dem Essen musste sie nach reichlichem Genuss von Wein, auch noch den einen oder anderen Schnaps trinken. Dabei wusste sie die guten Tropfen gar nicht zu schätzen. Der Bedienung schien sich jedes Mal der Magen umzudrehen, wenn sie mit ansehen musste, wie Carina die lecker zubereiteten Speisen verschlang und den ausgesuchten Wein durch die Kehle jagte.
Carinas Freundinnen hingen an ihren Lippen, denn sie verstand es bestens, die anderen mit den Neuigkeiten zu unterhalten. Dabei spielte es keine Rolle, ob die anderen die Personen, über die sie herzog, kannten. Jede Geschichte beendete sie mit dem Satz: „Das ist doch ungeheuerlich, oder?“, haute dabei mit der flachen Hand auf den Tisch und schickte ein Lachen hinterher, dass an eine gackernde Gans erinnerte.
An einem dieser geselligen, aber sehr einseitigen Zusammenkünfte, hatte die Gute mehr als ein Glas zu viel getrunken. Nachdem sie sich mit schwerer Zunge, die nachdrücklichen Einwände des Gastronoms ignorierend, in ihrem Zustand nicht allein durch den Park zu laufen, von den Freundinnen verabschiedet hatte, schlurfte sie mit schweren Schritten im Zickzackkurs über die mittlerweile vereisten Parkwege. Dicke Flocken fielen vom frostkalten Winterhimmel. Ein weißes Kleid hatte sich über der anmutigen Parklandschaft ausgebreitet. Die Äste der Bäume hingen schwer vom Schnee tief herab. Die Büsche sahen aus, als hätten sie eine weiße Mütze auf. Vom Teich stieg weißer Dampf in den dunklen Winterhimmel auf und sorgte für eine mystische Stimmung.
In Höhe des Gebüschs, an dem sie am Mittag den wohnsitzlosen Mann beschimpft hatte, wurde es Carina plötzlich speiübel. Sie musste sich übergeben, schaffte es gerade noch hinters Gebüsch, bevor ihr der Mageninhalt aus dem Gesicht fiel, geradewegs auf den armen Mann, der sich auf Pappe, die Füße mit Zeitungen umwickelt unter einer Plastikfolie, die über einer dicken Decke ausgebreitet war, auf dem Boden ausgestreckt hatte. Er schreckte auf, konnte sich gerade noch zur Seite rollen, bevor Carina auf ihn fallen konnte. Böse starrte er auf die erbärmliche Kreatur am Boden neben seinen vor Kälte erstarrten Füßen. Sie gab sonderbar glucksende Laute von sich. Ihr Körper verströmte einen üblen Geruch von Erbrochenem und Alkohol.
So lag Carina eine ganze Weile auf dem angefrorenen Untergrund. Der Schnee begann, ihren massigen Körper zu bedecken.
Der wohnsitzlose Mann, dessen schützendes Quartier sie gerade zerstört hatte, hätte ihr helfen, sie aufrichten können. Doch er dachte nicht daran. Er genoss die Situation und betrachtete die vor ihm liegende Frau hämisch. Sie war an seiner Situation schuld, hatte durch ihr dummes Geschwätz seine Ehe zerstört. Seine Frau war ihm davon gelaufen, hatte die Kinder mitgenommen. Seinen Kummer hatte er in Alkohol ertränkt. Schließlich hatte er wegen Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit auch noch seinen Job bei der städtischen Müllabfuhr verloren und war auf der Straße gelandet. Seit dem Sommer hielt er sich unbemerkt hier im Park auf. Nur die ehemaligen Kollegen wussten von seiner Anwesenheit, ließen ihn gewähren, solange er sich an die Abmachung hielt, die Spaziergänger nicht zu belästigen. Ab und zu brachten sie ihm Lebensmittel, Kleidung und Decken, alte Matratzen vorbei. Vor Wintereinbruch hatten sie ihn mit warmer Kleidung und Stiefeln versorgt.
In den letzten Monaten hatte er Carina zu ihren Treffen im „Teichhaus“ gehen sehen und beobachtet, wie sie nachts betrunken nach Hause schwankte. Er hatte sich immer vorgestellt, wie es wäre, wenn sie einmal vor ihn in den Dreck fallen würde. Nun war sein Wunsch Wirklichkeit geworden, sie lag hier, besoffen und hilflos, wie ein gestrandeter Wal vor ihm.
Doch bald hatte er genug von ihrem Gelalle und Gestöhne, trat ihr heftig in die Seite: „Steh auf, du blöde Schlampe, und verzieh dich.“ Carina kam langsam auf alle Viere, griff nach seinen Beinen, um sich daran hochzuziehen. Doch er wich zurück. Alle Versuche sich aufzurichten, scheiterten. Es gelang ihr nicht, auf die Beine zu kommen, sie sackte immer wieder in sich zusammen, blieb schließlich wie ein Häufchen Elend liegen. Aus stumpfen Augen blickte sie den vor ihr stehenden Mann an, nicht ahnend, wer sich unter der muffigen, zerschlissenen Bekleidung verbarg.
Der Obdachlose verharrte einige Zeit, betrachtete Carina von oben herab und sah zu, wie die Wärme aus ihrem Körper entwich, die Kälte von ihr Besitz ergriff. Besser spät als nie, dachte er. Jetzt hatte diese gehässige, Unheil bringende Person endlich bekommen, was sie verdient hatte. Bevor die Morgendämmerung einsetzte, zog er ihren leblosen Körper in eine Senke, bedeckte ihn mit Schnee und wartete von seinem Beobachtungsposten aus ab, was passierte. Es schneite immer noch und ein weißes Tuch breitete sich über den Spuren des Geschehens aus.
Liebe auf den ersten Blick
Die fünfte Jahreszeit neigte sich ihrem Ende zu. Es war Faschingssamstag. In ihrem Ort wurde an diesem Tag jedes Jahr ein Maskenball veranstaltet. Seit ihrem 16. Lebensjahr hatte sie keines dieser Feste ausgelassen. Als kleines Mädchen war sie bei den Funkenmariechen und später trat sie in der Tanzgarde auf. Sie liebte die Faschingsumzüge am Ort und mit dem Aschermittwoch endete für sie die schönste Zeit des Jahres.
In dieser Saison war sie nicht auf einer einzigen Veranstaltung gewesen und würde auch heute nicht am Maskenball teilnehmen, obwohl ihre Freundin sie angefleht hatte, doch endlich ihr Schneckenhaus zu verlassen, wieder fröhlich mit den anderen zu feiern. Doch sie hatte bis heute nicht das Erlebnis überwunden, das ihr auf dem Maskenballe im letzten Jahr widerfahren war, als sie den fremden Mann erblickte, der schon zu fortgeschrittener Stunde den Saal betrat und der ihr sofort aufgefallen war, groß und breitschultrig, mit einem sympathischen Gesicht. Sie glaubte, ihr Herz müsse aussetzen, als sich ihre Blicke über den Köpfen der Tanzenden trafen. Sie war durch die Menge auf ihn zugegangen, hatte ihn ohne ein Wort zu sagen auf die Tanzfläche gezogen und zur Musik von Santana eng umschlungen mit ihm getanzt. Danach hatten sie sich nicht mehr losgelassen. Sie kam sich vor wie in einem Kokon, ganz allein mit ihm. Sie schwebten zur Musik über die Tanzfläche. Seine Blicke hatten ihr Gesicht liebkost, seine Finger zärtlich ihre Wangen gestreift. Noch heute spürte sie den leichten Druck seiner großen Hände in ihrem Rücken. Sein Geruch war noch immer in ihrer Nase, seine Küsse brannten noch auf ihren Lippen.
Als die Musik aufhörte zu spielen, drehten sie sich immer noch im Kreis, bis man sie bat, den Saal zu verlassen. Eingehüllt in ihre Mäntel hatten sie noch stundenlang bei eisigen Temperaturen zusammengestanden und sich aneinandergeschmiegt unterhalten. Sie war damals sicher gewesen, ihr Gegenstück gefunden zu haben, den Mann, den sie ein ganzes Leben lang lieben konnte. Er hatte ihre Gefühle erwidert, wollte sie wieder treffen. Als die Morgendämmerung einsetzte, musste er aufbrechen. Er hatte sich ihre Handynummer auf den rechten Handrücken schreiben lassen, ihr versprochen, sich im Laufe des Tages bei ihr zu melden. Sie hatte darauf vertraut, dass nun eine gemeinsame Zeit mit ihm beginnen würde. Sie war so glücklich, die Schmetterlinge in ihrem Bauch drehten Salti. Die Sondersignale der Polizei- und Krankenwagen, die sie auf ihrem Heimweg begleiteten, hörte sie nicht.
Den ganzen Sonntag hatte sie auf seinen Anruf gewartet. Sie ließ das Telefon nicht aus den Augen, nahm es mit an den Esstisch in ihrem Elternhaus und sogar auf die Toilette. Während des Faschingsumzugs blickte sie immer wieder auf das Display, weil sie befürchtete, sie würde in dem Trubel das Klingeln und Vibrieren ihres Mobilfunkgerätes nicht wahrnehmen.
Doch er rief nicht an. Meldete sich auch nicht in den nächsten Tagen und Wochen. Sie hatte monatelang auf ein Lebenszeichen von ihm gewartet. Vergeblich. Schließlich hatte sie einsehen müssen, dass sie nichts mehr von ihm hören würde. Vor lauter Enttäuschung hatte sie sich zurückgezogen, verkrochen, war traurig, wütend, enttäuscht, kam sich auch getäuscht vor. Alles hatte sich so gut angefühlt, hatte so gut gepasst. Sie hatten die gleichen Gedanken, konnten über das Gleiche lachen, hatten die gleichen Vorstellungen über das Leben gehabt.
Aber sie war wohl einem Scharlatan aufgesessen, der die Situation ausgenutzt, sie zum Narren gehalten hatte. Das passte ja irgendwie zur Faschingszeit. Narren waren dort immer unterwegs.
Nun lag sie am Faschingssamstag, während sich alle anderen auf dem Maskenball amüsierten, auf ihrem Bett in ihrem Zimmer. Der Fernseher lief, aber sie konnte sich nicht auf den Spielfilm konzentrieren. Tränen liefen über ihr Gesicht. Sie hatte gedacht, sie sei endlich über die größte Enttäuschung ihres Lebens hinweg, doch nun holte sie die Erinnerung an den Fremden von damals wieder ein.
Es dauerte eine Weile, bis sie das Klingeln ihres Handys wahrnahm. Sie wollte es ignorieren, doch es vibrierte unaufhörlich auf ihrem Nachttisch. Das Display zeigte ihr die Nummer ihrer besten Freundin. „Was willst Du?“, fragte sie unhöflich, als sie sich endlich überwunden hatte, zu antworten. „Ich bin auf dem Maskenball. Du musst sofort hierher kommen. Er ist hier. Er sucht Dich. Bitte beeile Dich. Dann wirst Du alles verstehen.“
Hastig zog sie sich an, verließ ungeschminkt und ungekämmt das Haus. Die Schmetterlinge tanzten wieder. Das Schneckenhaus öffnete sich.
Immer wieder hatte sie sich vorgestellt, was sie ihm sagen wollte, wenn sie ihm doch einmal begegnen würde. Ihre ganzen Gefühle hatte sie ihm entgegenschleudern wollen. Als sie ihn nun sah, war nichts mehr von Hass, Wut und Enttäuschung zu spüren. Bei seinem Anblick erfasste sie ein Gefühl unendlicher Liebe. Sie stürzte sich in seine Arme, küsste und drückte ihn und war überglücklich, als er sie fest an sich zog und in ihre Haare flüsterte: „Jetzt lasse ich dich nie mehr los.“
Mit Entsetzen hörte sie nun, warum er sich ein Jahr lang nicht gemeldet hatte. Ein tiefes Gefühl der Scham machte sich bei dem Gehörten in ihr breit. Wie hatte sie sich nur so täuschen können. Damals auf dem Heimweg hatte ihm ein betrunkener Autofahrer die Vorfahrt genommen. Jetzt erinnerte sie sich wieder an die vielen Rettungsfahrzeuge, die auf ihrem Heimweg an ihr vorbei gefahren waren. Schwer verletzt war er ins Krankenhaus gekommen. Wochenlang hatte man ihn in ein künstliches Koma versetzt, um ihm die Schmerzen zu ersparen. Danach hatte er alles wieder erlernen müssen, laufen, sprechen, die einfachsten Dinge. Dabei hatte er immer nur an sie gedacht. Die Gedanken an sie und seine tief empfundene Liebe hatten ihm Kraft verliehen, so dass er für seine vollständige Genesung kämpfen konnte. Er hatte nur auf diesen einzigen Tag hingearbeitet, um sie wieder zu sehen. Er war so davon überzeugt, dass sie auf ihn warten würde.
Fasching an der Tanke
Christiane machte sich nichts aus Fasching. Deshalb hatte sie auch die Schicht am Sonntagnachmittag freiwillig mit ihrer Kollegin getauscht, damit diese mit ihren beiden Kindern den Faschingsumzug im Nachbarort besuchen konnte. Heute war sowieso nicht viel los gewesen, nur ein paar Durchreisende hatten ihre Tanks aufgefüllt. Die Einheimischen waren alle am feiern. Das Papiergeld hatte sie bereits gezählt und gebündelt in den Tresor gelegt. Das Münzgeld lag noch in der Kasse. Die meisten Kunden zahlten mittlerweile mit ihrer Bankkarte, so dass die Abrechnung am Ende des Tages nicht allzu lange dauerte.
Sie blickte kurz auf. Zwei kostümierte Gestalten überquerten in gebückter Haltung, immer wieder um sich blickend, die Straße und näherten sich jetzt der Eingangstür. Die offensichtlich erwachsenen Personen steckten in Indianerkostümen. Christiane dachte, dass die Zeit der Indianer längst vorbei sei und man sich heute eher als irgendeine Phantasiefigur auf den Fasching begibt.
Old Shatterhand und Winnetou betraten den Verkaufsraum. „Wo habt Ihr denn Eure Pferde gelassen?“, fragte Christiane keck, die sich nur mühsam ein Lachen verkneifen konnte.
Old Shatterhand riss seinen Arm nach vorne und richtete einen Gewehrlauf auf sie. Er schrie: „Kohle her, aber ein bisschen plötzlich“.
„Wir verkaufen nur Benzin und Diesel. Wenn Sie Kohle wollen, müssen sie zum Kohlehändler gehen“. Obwohl sie sofort bemerkt hatte, dass es sich bei der Waffe um eine Attrappe handelte, drückte sie auf den Notfallknopf unter der Kasse.
„Du blöde Kuh, verarsch uns nicht. Ich meine Zaster, Moneten, Pinke Pinke aus Deiner Kasse. Los mach schon“!
„Ich bin keine blöde Kuh, das verbitte ich mir“, entgegnete Christiane ganz trocken.
„Die macht mich wahnsinnig, die Alte“, rief Old Shatterhand Winnetou zu, der hinter ihm stand und vor Angst schlotterte.
„Alt bin ich auch nicht“, entgegnete Christiane erneut.
„Jetzt pack endlich das Geld in einen Beutel. Ihr habt doch so was“, er fuchtelte wieder wie ein Wilder mit dem Gewehr herum.
„Beutel kosten zwanzig Cent, wegen der Umwelt und so. Haben Sie zwanzig Cent?“
„Nein, wenn ich die hätte, müsste ich nicht die Tankstelle überfallen“. Er nahm eine Papiertüte, die auf dem Tresen lag und hielt sie Christiane hin. „Los jetzt, tu das Geld hier rein.“
„Das Geld ist schon im Tresor“.
„Dann mach ihn auf“.
„Geht nicht. Die Tür schließt automatisch. Ich habe keinen Code“.
Old Shatterhand drückte Winnetou das Gewehr in die Hand und kam hinter den Tresen, blickte in das Kassenfach. „Los, tu die Münzen in die Tüte“, forderte er Christiane auf und hielt sie ihr vor die Nase. Diese ließ sich nicht zweimal bitten und warf mit großer Wucht die Münzen in die Tüte. Winnetou stand zitternd auf der anderen Seite der Verkaufstheke. Der Lauf des Gewehrs zeigte nach unten.
„Warten Sie, ich gebe Ihnen noch ein paar Zigaretten mit“, sagte Christiane freundlich und warf eine Stange einer Billigmarke mit ebensolcher Wucht in den Papierbeutel. Ihr Plan ging immer noch nicht auf. Sie griff zu einer Flasche Whisky und ließ sie in die Papiertüte plumpsen. Endlich riss die Tüte. Mit einem großen Knall fiel der Inhalt auf den Boden. Das Münzgeld lag in einem See aus Whisky. Old Shatterhand sprang wie ein Ziegenbock auf und ab und schrie wie am Spieß. „Da siehst Du, was Du angerichtet hast, Du blöde Kuh“.
„Ich habe Ihnen schon einmal erklärt, dass ich keine blöde Kuh bin“, grinste Christiane frech. Ihr Gesicht wurde plötzlich in blinkende blaue Farbe getaucht.
Old Shatterhand drehte sich ungläubig zu der Fensterfront um und blickte in die Gesichter von zwei Polizeibeamten, die gerade den Raum betraten. „Wolle merr se reilasse?“, rief Christiane lachend. Schließlich war ja Fasching.
Der Despot
Er ging durch die Tischreihen des großen Saales. Die Sitzgelegenheiten waren komplett besetzt. Alle waren sie gekommen zur alljährlichen Mitgliederversammlung. Heute standen die Wahlen des geschäftsführenden Vorstandes an. Er würde wieder für das Amt des Vorsitzenden kandidieren, das er seit vielen Jahren innehatte. Wer sonst? Es gab niemanden, der annähernd so bekannt und gut vernetzt war wie er, der ihm das Wasser hätte reichen können. Dafür hatte er gesorgt, hatte niemanden neben sich hochkommen lassen. Wer ihm nicht folgte, wurde entsorgt. Wer nicht für ihn war, war gegen ihn. Das ließ er jeden spüren, der auch nur den geringsten Zweifel an ihm hegte oder ein Wort der Kritik äußerte.
Ihm war wohl bewusst, dass die Jüngeren gern jemand anderen an der Spitze gesehen hätten, dass man hinter seinem Rücken tuschelte, Pläne schmiedete, ihn durch einen anderen zu ersetzen. Er war sich aber sicher, dass es keiner wagen würde, gegen ihn anzutreten. Und er dachte auch nicht daran aufzuhören. Er vertraute darauf, dass er auch dieses Mal wieder als Gewinner aus der Versammlung herausgehen würde. Er liebte die Macht, die ihm das Amt verlieh und die er zum Spielball seiner Leidenschaften machte. Er hörte schon den Applaus, sah die Mitglieder im Geiste aufstehen und ihm nach der erfolgreichen Wahl zujubeln.
Denn keiner traute sich, ihn anzugreifen, erst recht nicht gegen ihn zu kandidieren. Jeder wusste, was ihm blühte, wenn er sich gegen ihn stellte. Er hatte genug Einfluss, einen Gegner auszuschalten, ein Wort von ihm genügte und die Person wurde ausgegrenzt, in dem man sie ignorierte, einfach nicht mehr einlud oder über wichtige Dinge informierte. Darin hatte er jahrelange Übung. Seinen Vorgänger im Amt hatte er ausgeschaltet, indem er ihn einfach so lange unter Druck gesetzt hatte, bis dieser freiwillig seinen Stuhl geräumt hatte. Dass der eine oder andere es ihm übel nahm, störte ihn nicht. Die Älteren unter den Mitgliedern hatten diese Tatsache mittlerweile verdrängt, die Jüngeren wussten von diesem Vorgang gar nichts. Denn darüber wurde einfach nicht gesprochen.
Gezielt ging er auf die Leute zu, begrüßte sie jovial, aber immer mit einer Berührung der Schulter oder eines Armes, mit Auflegen seiner Linken auf die Grußhand seines Gegenübers, nur um zu zeigen, dass er über ihnen stand. Er sprach sie mit Herr Doktor oder Frau Professor an, obwohl keiner derjenigen einen Titel besaß. Dies tat er nur aus einem einzigen Grund. Er wollt ihnen damit zeigen, wie klein sie für ihn waren, wollte sich selbst damit über sie erheben. Seine vermeintlichen Freundlichkeiten waren in Wirklichkeit gezielte Provokationen. Indem er Menschen erhöhte, degradierte er sie.
Einige der Anwesenden übersah er gezielt, so wie alles was er tat, ganz absichtlich geschah. Aufrecht, mit einem andächtigen Gesichtsaudruck, die Finger beider Hände ineinander gelegt, ging er durch die Menschenmenge zu seinem Platz. Natürlich saß er in der Mitte des Vorstandstisches auf der Bühne. Hier hatte er alle im Blick, obwohl er der Menge keinen einzigen Blick mehr schenkte. Er unterhielt sich angeregt mit seinen Nachbarn, wobei man von einer echten Unterhaltung nicht wirklich sprechen konnte. Er führte das Wort, erzählte wichtigtuerisch von seinen Vorhaben nach der Wahl.
Diese würde wie immer schnell und zügig verlaufen. Im Vorfeld hatte er sich seine Mitstreiter ausgesucht, die sich hinter ihm für die untergeordneten Positionen zur Wahl stellten. Er bevorzugte Leute, die alles abnickten und zu allem, was er von sich gab, ja und amen sagten. Menschen, die selbstständig dachten oder eigene Ideen entwickelten, duldete er nicht.
Natürlich sprach er das Grußwort, erwähnte, wie toll alle waren, weil er sie erfolgreich führte. Das sagt er nicht so direkt, doch er verstand es, die Worte so zu fassen, dass jeder verstand, was er meinte. Am Ende seiner Rede bemerkte er lachend: „Vorzustellen brauche ich mich ja nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass außer mir keiner für das Amt des Vorsitzenden kandidiert. Also lasst uns zur Wahl schreiten.“ Es war jedes Mal das gleiche. Bis heute hatte sich keiner aus der Menge erhoben, um ihm das Amt streitig zu machen. Deshalb glaubte er, sich verhört zu haben und seinen Augen nicht zu trauen, als ein jüngerer Mann in der Mitte des Saales aufstand und ihm zurief: „Doch, ich bewerbe mich ebenfalls um das Amt des Vorsitzenden.“ Der Amtsinhaber stutzte, verschluckte sich fast vor lauter Aufregung. Ein nie gekannter Hitzeschub fuhr ihm durch die Adern. Stotternd sprach er ins Mikrofon: „Das ist Dein gutes Recht. Möchtest Du Dich vorstellen?“ Schnell hatte er sich von seinem Schreck erholt. Was bildete sich dieser Bursche ein? Er würde eine schöne Schlappe erleben, dachte der Vorsitzende. Vielleicht würden ein paar wenige Teilnehmer seinen Mitbewerber wählen, aber er musste sich keine ernsthaften Gedanken machen. Da war er sich sicher. Der Mitbewerber ging zum Mikrofon in der Mitte des Saales und stellte sich kurz aber prägnant vor. Alle lauschten ihm gebannt. Als er fertig war, setzte er sich auf seinen Platz. Niemand klatschte, was dem derzeitigen Amtsinhaber ein süffisantes Lächeln entlockte. Der Name des Mitbewerbers wurde von den Anwesenden auf dem vorbereiteten Wahlzettel vermerkt.
Die Wahlen begannen. Die Wähler suchten die Wahlkabinen auf und warfen die angekreuzten und zusammengefalteten Zettel anschließend in die dafür vorgesehenen Wahlurnen. Während die weiteren Vorstandsmitglieder gewählt wurden, begann der Wahlausschuss mit der Auszählung der Stimmzettel.
Mein Name ist Hase
Wenn man heute junge Leute fragt, was das Osterfest zu bedeuten hat, wissen viele nicht, dass es das höchste christliche Fest ist, an dem die Wiederauferstehung Jesus gefeiert wird. Die meisten verbinden es mit ein paar freien Tagen und die Schüler mit den Ferien. Obwohl sich hinter dem Fest ein tieferer Sinn als Schokoladenhasen und farbenfrohe Eier verbirgt, ist Ostern mittlerweile stark kommerzialisiert und wird mit Geschenken verknüpft.
In früheren Zeiten beschenkten sich die Menschen zum Zeichen der Wiederauferstehung und des Lebens mit Ostereiern. Der Brauch, sich gegenseitig Geschenke zu machen, ist noch sehr jung. Auch der Osterhase hat erst seit dem 19. Jahrhundert einen festen Platz in unserer Gesellschaft. Er gilt wie das Osterei als Symbol für Fruchtbarkeit und Leben.
In unserer Familie war es schon immer Tradition gewesen, Eier auszublasen, sie bunt anzumalen und ein paar Wochen vor dem Fest im Garten an den Forsythienstrauch zu hängen.
An Ostern suchten wir Kinder im Garten nach kleinen Süßigkeiten, die meine Mutter dort im Gras und unter den Büschen versteckt hatte. Dort fanden wir auch bunt bemalte Eier, die unsere Mutter heimlich angefertigt hatte. Nach Ostern schiebelten wir die hart gekochten Eier einen Hang hinunter, damit die Schale aufplatzte. Die Eier selbst wurden dann zum Zubereiten von Grüner Soße genutzt.
Natürlich glaubten wir viele Jahre an den Osterhasen und freuten uns Jahr für Jahr auf dieses Fest. Größere Geschenke gab es nie. Mit der Zeit merkten wir jedoch, dass es den Osterhasen gar nicht gab und es unsere Mutter war, die Süßigkeiten im Garten versteckte. Dennoch suchten wir mit Begeisterung jedes Jahr zwischen den Blumenbeeten danach. Bei meinen Kindern verhielt es sich genauso und sie machten es ebenso mit ihren Kindern, meinen Enkelkindern.
Vor einigen Jahren meldeten sich unsere Töchter mit ihren Familien für die Ostertage zu Besuch an. Ich freute mich riesig und war tagelang damit beschäftigt, zu kochen und zu backen. Für meine dreijährige Enkeltochter Anna und den zweijährigen Karl hatte ich kleine in Goldpapier eingewickelte Osterhäschen, Küken und Hühner besorgt und die hart gekochten Eier mit kleinen Bildchen bemalt. Das Haus hatte ich schön geschmückt. Die Kinder bestaunten den Osterbusch und die Dekoration im Haus. Ihre Gesichter strahlten vor Freude. Sie konnten es kaum erwarten zu sehen, was der Osterhase ihnen bringen würde.
Am Ostersonntag schien die Sonne. Endlich war der Frühling eingekehrt und im Garten blühten die Osterglocken. Am frühen Morgen hörte ich die Tochter der Nachbarn nach ihren Hasen rufen. Sie besaß zwei dieser niedlichen Tierchen mit den Namen Püschel und Hasi. Sie wurden vorwiegend im Haus gehalten, doch bei schönem Wetter setzte das Mädchen sie in ein kleines Gehege aufs Gras.
Im vergangenen Sommer waren die Häschen mehrfach ausgebrochen. Irgendwie hatten sie es geschafft, in unseren Gemüsegarten hinter dem Haus zu gelangen. Zum Ärger meines Mannes hatten sie von den Erdbeeren genascht und den Blattspinat und den Kopfsalat abgefressen. Im Herbst waren sie sogar über den Wirsing hergefallen.
Unser Dackel, der sonst alle Tiere, die im Garten seinen Weg kreuzten, mit wütendem Gebell vertrieb, empfand die frechen Lümmel nicht als störend und näherte sich mit seiner feuchten Nase den hungrigen Häschen. Doch sobald sie unseren Vierbeiner witterten, schlugen sie einen Haken und eilten im Hasengalopp davon.
Unsere Enkelkinder, die den tieferen Sinn von Ostern noch nicht verstehen konnten, schlenderten in froher Erwartung mit ihren Körbchen über den Rasen, lugten in die Blumenbeete und unter die Büsche. Jauchzend nahmen sie jedes einzelne Ei, jedes kleine Häschen und Küken auf und verwahrten es wie ein Schatz in ihren Körbchen.
Plötzlich entdeckten sie Püschel und Hasi, die zwischen den Osterglocken saßen und genüsslich an dem Blattgrün knabberten. Freudestrahlend blieben sie stehen und betrachteten die beiden. „Osterhasen“, rief Anna.
Die kleinen Häschen blieben wie erstarrt sitzen und schauten die Kinder ängstlich an. Ihre kleinen Näschen zitterten vor lauter Aufregung. Minutenlang standen Anna und Karl vor den niedlichen Langohren, ohne sich zu rühren. Als Anna jedoch die Hand nach ihnen ausstreckte, sprangen die Häschen auf und hüpften eilig davon.
„Sie haben heute noch mehr zu tun“, erklärte ich ihnen, „andere Kinder wollen auch noch etwas haben.“ Damit gaben sich die Kinder zufrieden und zeigten ihren Eltern stolz den Inhalt ihrer Körbchen. Im Hintergrund hörte ich immer noch die Tochter der Nachbarn nach Püschel und Hasi rufen. Irgendwann hörte das Rufen auf und die beiden Ausreißer saßen wieder in ihrem Gehege.
Im Jahr darauf bat ich die Nachbarin, Püschel und Hasi am Ostersonntag in eines unserer Blumenbeete zu setzen. Anna und Karl waren begeistert, als sie die Häschen wiederentdeckten.
Das wiederholten wir mehrere Jahre, bis wir glaubten, unsere Enkelkinder seien dem Alter, in dem man noch an den Weihnachtsmann und den Osterhasen glaubt, entwachsen zu sein. Zudem war die Tochter unserer Nachbarn ausgezogen und hatte Püschel und Hasi mitgenommen.
Der Enkeltrick
Margarete war stinkwütend. Man hatte sie bei ihrem Mittagsschlaf gestört. Sie hatte das Bimmeln des Telefons ignorieren wollen. Doch nachdem es nach mehrmaligem Klingeln nicht aufgehört hatte, stand die kleine, zierliche Person auf und hinkte zum Schreibtisch, auf dem sich der Apparat befand. Es war ein grünes Gerät mit einer Wählscheibe, so wie es in den Siebzigern des letzten Jahrhunderts modern gewesen war. Waldi, ihr Rauhaardackel, gab ein tiefes Brummen von sich. Er liebte es gar nicht, wenn sein täglicher Mittagsschlaf unterbrochen wurde.
Margarete war ledig geblieben. Aber sie war mit ihrem Dasein sehr zufrieden. Außer ihrem treuen Vierbeiner hatte sie viele Freunde und ging so oft wie möglich, trotz ihrer Behinderung, aus. In der letzten Zeit war ihr das allerdings immer öfter vermiest worden. Sie ärgerte sich zunehmend über das Benehmen mancher Zeitgenossen, die unhöflich und respektlos ihren Weg kreuzten, nicht grüßten, im Bus keinen Platz anboten oder die Tür vor ihr zuschmissen. Zu ihrem Ärger kamen die Anrufe. Ständig wollte ihr jemand etwas verkaufen, ein Abonnement für eine Zeitschrift andrehen oder eine Umfrage starten. Die Belästigungen von zwielichtigen Handwerkern und ominösen Spendensammlern taten ihr Übriges.
Doch dieser Anruf brachte das Fass zum überlaufen. Ein junger Mann gab sich als ihr Enkel aus, bat sie, ihm zu helfen, ihn mit Geld für eine Studienreise ins Ausland zu unterstützen. Geschickt verwickelte er sie in ein Gespräch. Zum Schein ging sie darauf ein und verabredete mit ihm die Geldübergabe bei ihrer Hausbank in der Stadt zu einer bestimmten Zeit. Als aufmerksame und interessierte Zeitungsleserin war sie ja bestens informiert und wusste, was zu tun war. Trotz ihres Alters konnte man ihr nichts vormachen. Nachdem sie aufgelegt hatte, nahm sie ihr uraltes Handy, das sie nur zu dem Zweck besaß, um im Notfall unterwegs Hilfe zu holen, zur Hand. Sie rief ihre beste Freundin an, erkläre ihr die Situation und bat sie, die Polizei und die Bank zu informieren. Noch während sie sprach, klingelte der Festnetzapparat erneut. Damit hatte sie schon gerechnet. Ihr Enkel war wieder am anderen Ende, um sich zu vergewissern, dass sie bestimmt zur verabredeten Zeit erscheinen würde.
Ein Taxi brachte sie in die Innenstadt und ließ sie vor der Bank aussteigen. Waldi folgte ihr gehorsam. In der Parkbucht gegenüber dem Gebäude erblickte sie den Wagen ihrer Freundin. Der Mitarbeiter der Bank bediente sie ausgesprochen freundlich und zwinkerte ihr zu. Beim Abschied sagte er ganz gegen seine Gewohnheit: „Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, gnädige Frau.“ Den Hinweis verstehend, dachte sie, den werde ich haben und verließ, auf ihren Gehstock gestützt, den Schalterraum, Waldi an ihrer Seite. Im Foyer bemerkte sie einen Kunden vor einem Bankautomaten. Er studierte konzentriert seine Auszüge. Kaum merklich nickte er ihr zu.
Die automatische Tür hatte sich gerade hinter ihr geschlossen, als ein junger Mann auf dem Bürgersteig auf sie zukam: „Hallo Oma, da bist du ja. Hast du das Geld?“ Margarete fixierte ihn mit zusammengekniffenen Augen hinter ihrer Nickelbrille und überreichte ihm den Umschlag mit dem geforderten Geld. Eilig nahm er den Umschlag entgegen und sah hinein. Er lächelte zufrieden. „Danke, Oma. Ich muss dann auch mal wieder.“
Waldi knurrte und bellte abwechselnd wütend. Seine Nackenhaare hatten sich wie ein Kamm aufgestellt. Unter seinen buschigen Augenbrauen sah er den vermeintlichen Enkel böse an. „Nicht so schnell, mein Lieber“, sagte Margarete und hob ihren Gehstock. „Nur damit du es weißt, ich habe gar keinen Enkel.“ Der junge Mann lachte gehässig und machte auf dem Absatz kehrt. Doch er hatte nicht mit Waldi gerechnet. Der Rauhaardackel stürzte sich auf seine rechte Ferse und biss kräftig zu. Der Enkel schrie auf, ging vor Schmerzen in die Hocke. Margarete gab ihm einen kräftigen Schubs mit ihrem Gehstock. Der junge Mann kippte vornüber und haute der Länge nach auf das Pflaster.
Nun konnte Margarete sich nicht mehr beherrschen: „Dir werde ich es geben Bürschchen, alte Damen um ihr sauer verdientes Geld zu bringen.“ Mit ihrem Gehstock schlug sie ihm auf den Hintern. Ihre ganze Wut über das schlechte Benehmen ihrer Mitmenschen entlud sich nun.
Der Kunde aus dem Foyer der Bank kam langsam auf sie zu. Er hatte es nicht eilig, sah belustigt von der alten Dame zu dem am Boden liegenden Enkel.
Der Enkel startete einen erneuten Fluchtversuch, um seiner wütenden Großmutter zu entkommen. Da baute sich Margaretes Freundin plötzlich neben ihm auf und stellte ihm ihren Fuß auf den Rücken. „Du bleibst hier, Freundchen. Sonst fängst du noch eine.“ Waldi hatte sich indessen vor dem Enkel positioniert, beobachtete ihn mit gefletschten Zähnen und wütendem Knurren. Der Enkel hatte keine Chance zu entkommen. Die gerade eintreffenden Schutzbeamten halfen dem Trickbetrüger auf die Beine. Den Umschlag mit dem Geld nahmen sie als Beweismittel an sich.