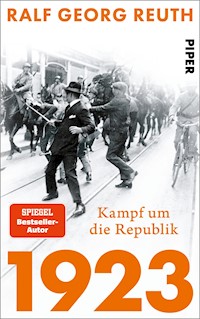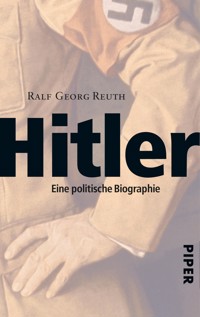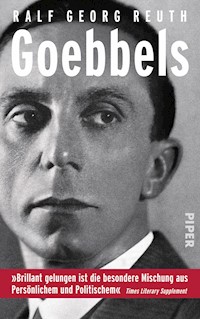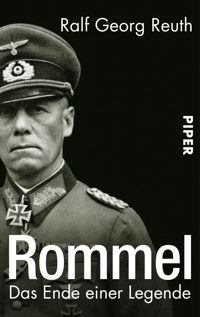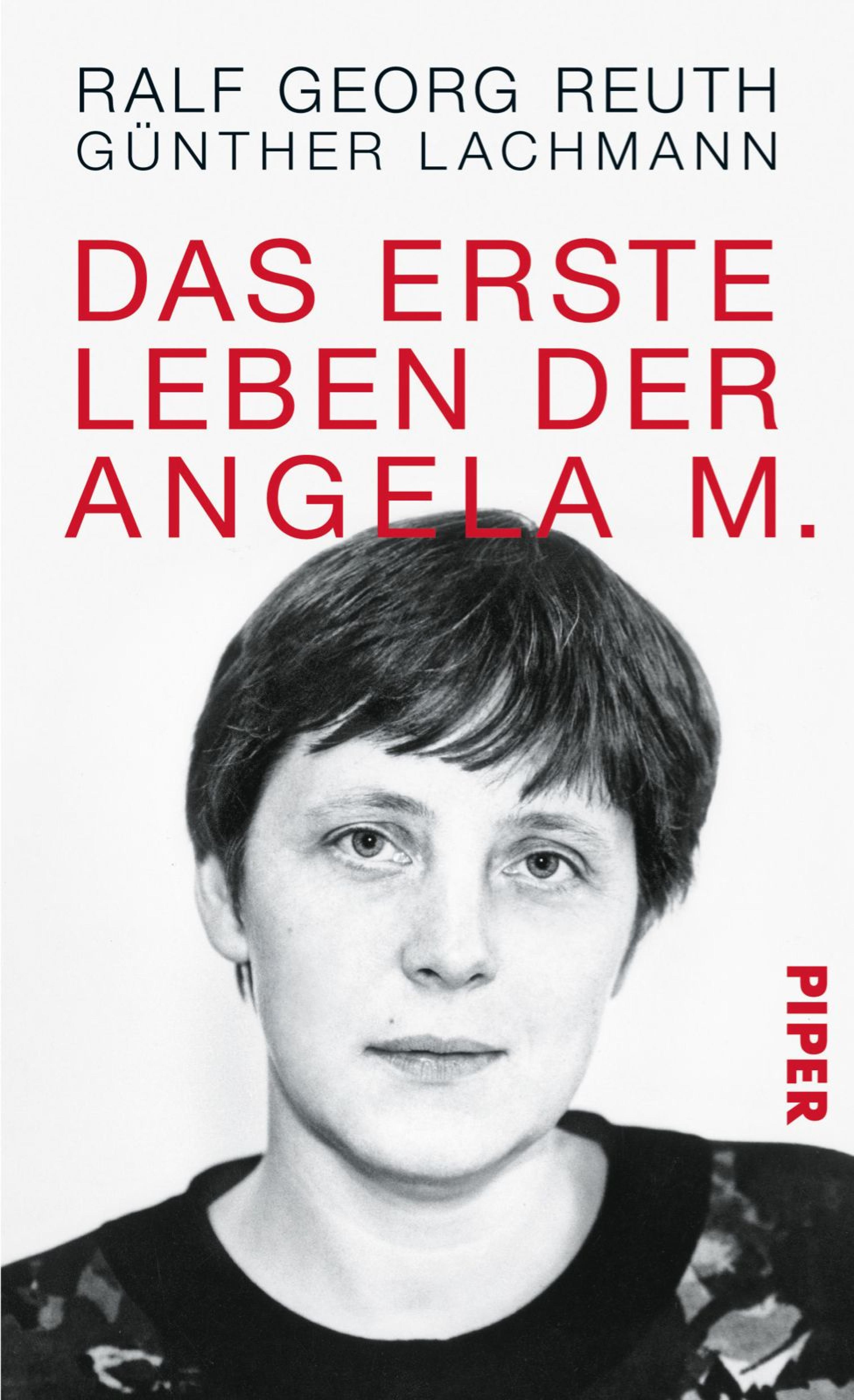12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Zweite Weltkrieg ist der Dreh- und Angelpunkt des 20. Jahrhunderts: Ohne ihn kann man weder retrospektiv den Ersten Weltkrieg und die Weimarer Republik richtig einordnen noch die Nachkriegszeit mit der Zweiteilung Deutschlands und Europas. Es gibt unendlich viele Einzelstudien, und doch schließt dieses Buch eine unübersehbare Lücke, weil es sich auf die Grundlinien des epochalen Geschehens konzentriert und auf die entscheidenden Fragen: War der Zweite Weltkrieg die Fortsetzung des Ersten? Warum haben die alliierten Kriegsgegner Hitler so lange so falsch eingeschätzt? Wie wurde aus dem europäischen Krieg ein Weltkrieg, und wie beeinflusste das den Mord an den Juden? Welche Rolle spielte die angeblich saubere Wehrmacht? Und warum sind die Deutschen ihrem «Führer» bis in den Untergang gefolgt? Eine ebenso fundierte wie zugängliche Darstellung des verheerendsten aller Kriege, der Millionen Menschen das Leben kostete und beispiellose Brutalität hervorbrachte. Ralf Georg Reuth liefert ein Gesamtbild, das verstehen lässt, wie es zu dieser Menschheitskatastrophe kam und welche Folgen sie bis heute hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ralf Georg Reuth
Kurze Geschichte des Zweiten Weltkriegs
Über dieses Buch
Der Zweite Weltkrieg ist der Dreh- und Angelpunkt des 20. Jahrhunderts: Ohne ihn kann man weder retrospektiv den Ersten Weltkrieg und die Weimarer Republik richtig einordnen noch die Nachkriegszeit mit der Zweiteilung Deutschlands und Europas. Es gibt unendlich viele Einzelstudien, und doch schließt dieses Buch eine unübersehbare Lücke, weil es sich auf die Grundlinien des epochalen Geschehens konzentriert und auf die entscheidenden Fragen: War der Zweite Weltkrieg die Fortsetzung des Ersten? Warum haben die alliierten Kriegsgegner Hitler so lange so falsch eingeschätzt? Wie wurde aus dem europäischen Krieg ein Weltkrieg, und wie beeinflusste das den Mord an den Juden? Welche Rolle spielte die angeblich saubere Wehrmacht? Und warum sind die Deutschen ihrem «Führer» bis in den Untergang gefolgt?
Eine ebenso fundierte wie zugängliche Darstellung des verheerendsten aller Kriege, der Millionen Menschen das Leben kostete und beispiellose Brutalität hervorbrachte. Ralf Georg Reuth liefert ein Gesamtbild, das verstehen lässt, wie es zu dieser Menschheitskatastrophe kam und welche Folgen sie bis heute hat.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, November 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt·Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Frank Ortmann
Umschlagabbildung ullstein bild
ISBN 978-3-644-10042-8
Hinweis: Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Prolog
Die Historiker unserer Epoche, die vom Determinismus und dem soziologischen Verständnis der Geschichte besessen sind, übersehen gerne (…) die Rolle, die bestimmte Persönlichkeiten darin gespielt haben.
FranÇois Furet[*]
Über kein historisches Ereignis ist so viel geschrieben worden wie über den Zweiten Weltkrieg. Die Zahl der Publikationen – zumeist Gesamtdarstellungen, Chroniken, Biographien und Abhandlungen militärischer Einzelereignisse – ist kaum noch überschaubar. Das kann nicht überraschen angesichts der ungeheuerlichen Dimension und der weitreichenden Folgen des fünfjährigen weltumspannenden Geschehens. Fünfundfünfzig Millionen Menschenleben forderte es, dazu kamen Völkermord und Verwüstung in nie gekannter Dimension. Hiroshima und Nagasaki leiteten ein neues, atomares Zeitalter ein. Die Welt war eine bipolare geworden, in der die neuen Supermächte, die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion, den Ton angaben. Die großen Kolonialreiche zerfielen. Europa als globales Machtzentrum hatte aufgehört zu existieren. Es wurde für Jahrzehnte durch einen «Eisernen Vorhang» gespalten.
Die Selbstzerstörung des alten Kontinents war ein langer Prozess, der im Sommer 1914 mit dem Ersten Weltkrieg begann, in den die Völker wie «Schlafwandler» hineintaumelten. Die Historiker sprechen von der «Urkatastrophe» des 20. Jahrhunderts, bestätigte sich doch die düstere Ahnung des britischen Außenministers Edward Grey zu Beginn des Krieges, dass in ganz Europa die Lichter ausgingen und «wir sie in unserem Leben nie wieder leuchten sehen»[*]. Denn der erste industrialisierte Krieg hatte Vernichtungsdimensionen mit sich gebracht, die die Vorstellungen der Zeitgenossen gesprengt hatten und unter den Völkern nie da gewesenen Hass säten – einen Hass, der während des Krieges einen Frieden und, als die Waffen schwiegen, eine tragfähige Friedensordnung unmöglich machte.
Der Erste Weltkrieg hatte aber noch ganz andere Folgen. Er brachte eine Entfesselung des Politischen mit sich und verhalf damit den sozialen Bewegungen, die eine Antwort auf die geistigen, politischen und auch ökonomischen Krisen der Zeit waren, zum Durchbruch. Das Kriegsjahr 1917 mit der russischen Revolution, deren Auswirkungen bald ganz Europa und vor allem auch Deutschland erfassten, wurde zur großen Zäsur. Nicht mehr nur Nationen und Imperien, sondern auch widerstreitende ideologische Systeme standen bald einander gegenüber. Vom «Zeitalter der Extreme» ist in diesem Zusammenhang die Rede. Wie immer man diese Zeit benennen mag, ihren Kulminationspunkt stellt der Zweite Weltkrieg dar, der aufgrund der technischen Entwicklung und moralischen Entgrenzung die Vernichtungshorizonte des Ersten Weltkriegs um ein Vielfaches übertraf.
Im Zentrum dieses Geschehens und damit auch dieses Buches steht als Hauptverantwortlicher Adolf Hitler. Dass er das Resultat jenes mit der Urkatastrophe Erster Weltkrieg eingeleiteten Epochenumbruchs war, wird von der heute dominierenden sozialhistorischen Lehrmeinung eher verneint. Hitler ist für sie Konsequenz und Endpunkt eines deutschen Sonderweges – des Sonderweges einer sich spät, unter der Führung Preußens formierenden, zu kurz gekommenen Nation, deren Charakteristikum ein unersättlicher Expansionsdrang, ein ausgeprägter Militarismus sowie ein übersteigerter rassistischer Nationalismus gewesen sei. Hitlers Weltmachtstreben und der Zweite Weltkrieg werden so zur Fortsetzung des wilhelminischen Imperialismus und des Ersten Weltkriegs; die nationalsozialistische Rassenideologie und Ausrottungspolitik letztendlich nur zur Konsequenz des Antisemitismus der Zeit vor 1914.
Wer den Aufstieg Hitlers und die nationalsozialistische Herrschaft ausschließlich von den tradierten gesellschaftlichen Kräften her zu deuten versucht, wird jedoch dem Phänomen nicht gerecht werden. Denn ihn auf das Wirken von Gesetzmäßigkeiten zu reduzieren heißt, ihn aus dem für das Jahrhundert so bedeutsamen historischen Kontext herauszunehmen. Neuere Forschungen belegen dann auch, dass Hitlers rassenideologische Politisierung in der Zeit der Revolution und großen Ungewissheit stattfand. Auch wenn er in seiner Person Teile der Gedankenwelt des 19. Jahrhunderts vereinigte, insbesondere was seine Rassenideologie anlangt, so bedeutet doch Hitler einen tiefen Bruch in der neueren deutschen und europäischen Geschichte.
Hitler war in gewisser Hinsicht aus der Zeit gefallen. Er war kein Antisemit von dem Schlage, wie es sie schon immer und überall gegeben hatte. Sein Judenhass markierte eine neue Dimension. Durch das Fronterlebnis zum Anhänger eines primitiven Sozialdarwinismus geworden, sah er nach dem Ende des Weltkriegs «im Juden» den Urgrund allen Übels. Ihn wähnte er sowohl hinter der roten Revolution als auch hinter dem Versailler Diktat. In der Vorstellungswelt Hitlers wurde so der Kampf gegen das «internationale Judentum» zur existenziellen Zukunftsfrage der Nation. Einem religiösen Eiferer gleich und an der Grenze zum Verfolgungswahn, unterstellte er sein ganzes Dasein dem Ziel, Deutschland und damit den abendländischen Kulturkreis vor dieser «jüdischen Weltverschwörung» zu retten. Diese wahnwitzige rassenideologische Mission war sein entscheidender Beweggrund und eben nicht der bloße Wunsch, Deutschland zur Weltmacht zu führen – auch wenn es im Endergebnis auf dasselbe hinauslief.
Hitler, dessen Krieg 1919/20 begann, hatte damit ein Alleinstellungsmerkmal, das ihn von seinem ideologischen Gegenpart Stalin unterschied. Zwar ignorierten beide die Spielregeln der traditionellen bürgerlich-liberalen Realpolitik. Doch anders als der materialistische Sowjetführer, der bei allem Welterlösungsanspruch des Kommunismus Realist blieb, war der deutsche Führer von irrationalen Faktoren geleitet. Dies ist aus dem Blickwinkel einer aufgeklärten Gegenwart schwer nachvollziehbar und mag die Neigung befördern, Hitlers Hasstiraden gegen alles Jüdische, gegen Börse und Bolschewismus gleichermaßen nur als zusammenhanglose antisemitische Propaganda abzutun. Tatsächlich fügte sich bei ihm aber alles zu einem geschlossenen, um die Lebensraumkomponente ergänzten rassenideologischen Weltbild, aus dem er programmatische Grundzüge einer künftigen deutschen Politik und Kriegführung ableitete. Was er als Münchner Propagandamann, als Landsberger Häftling und als Vorsitzender der NSDAP formulierte, versuchte er als «Führer» und schließlich als oberster Kriegsherr dogmatisch-konsequent umzusetzen. Im Zentrum stand dabei die Vernichtung der Sowjetunion als Hort des «jüdischen Bolschewismus» und, als Voraussetzung dafür, eine Partnerschaft mit dem britischen Weltreich.
Entscheidend für das Verständnis des Phänomens Hitler ist, dass seine wahren Ziele kaum gesehen wurden, was sicherlich nicht der Fall gewesen wäre, wäre er das Ergebnis tradierter gesellschaftlicher Strömungen gewesen. Seine rassenideologischen Auslassungen in den frühen Reden und in «Mein Kampf» waren einfach zu weit vom normalen politischen Diskurs seiner Zeit entfernt. Hinzu kam, dass er – nachdem er am Ende der zwanziger Jahre die große nationale politische Bühne betreten hatte – seine aus dieser Weltanschauung gespeiste (Außen-)Politik allzu lange hinter einem radikalen Revisionismus, der von weiten Teilen der Bevölkerung geteilt wurde, verbergen konnte. So wie Hitler in Deutschland an die Macht gelangt war, weil man ihn nicht für den hielt, der er tatsächlich war, konnte er in den dreißiger Jahren unter dem Jubel der Nation von außenpolitischem Erfolg zu außenpolitischem Erfolg eilen und sich den so lange nachwirkenden Nimbus des unfehlbaren großen Führers verschaffen. Die im Nachhinein kritisierte Politik der Westmächte, vor allem diejenige Großbritanniens, die Hitler gewähren ließen, ob bei der Rheinlandbesetzung, beim Anschluss Österreichs oder in der Sudetenkrise, wäre sicherlich nicht so lange vom Geist des Appeasements getragen gewesen, hätte man seine eigentlichen Ziele gesehen oder auch nur erahnt. Die Londoner Appeasement-Politik gründete aber darauf, dass man es mit einem rationalen Gegenspieler zu tun hatte.
In diesem Buch wird die Strategie Hitlers als Widerpart jeglicher rationalen Politik und Kriegführung herausgearbeitet und dieser gegenübergestellt. Erst ein solches Vorgehen liefert den Schlüssel zum Verständnis der Vorgeschichte und Geschichte des Zweiten Weltkriegs, in dem der deutsche Diktator sozusagen seinen eigenen, völlig anderen Kriterien unterworfenen Krieg im Krieg führte. Letzteres zog teils katastrophale Fehleinschätzungen durch seine Gegner nach sich. Eine solche unterlief zum Beispiel Stalin im Juni 1941. Weil auch er Hitler für einen kalt kalkulierenden Machtpolitiker hielt, war er felsenfest davon überzeugt, dass es trotz des gewaltigen deutschen Aufmarsches keinen Angriff auf die Sowjetunion geben würde, solange dessen Kampf gegen England nicht beendet war.
Hitlers Krieg im Krieg hatte auch Auswirkungen auf das Verhältnis zu den Verbündeten, etwa zu den Dreierpakt-Partnern Italien und Japan, erschwerten doch dessen unverstandene Wendungen in der Kriegführung die Zusammenarbeit. Bedeutsamer waren die Verwerfungen innerhalb der deutschen Führung. Das Auswärtige Amt entwarf zum Beispiel Bündniskonstellationen, die mit Hitlers eigentlichen Vorstellungen nicht im Ansatz vereinbar waren. Die deutsche Seekriegsleitung sah sich nach wie vor ganz der Tirpitz’schen Tradition verpflichtet. Der niederzukämpfende Feind hieß für sie deshalb England – dasselbe England, das sich Hitler so sehr als strategischen Partner wünschte. Und selbst in den Oberkommandos der Wehrmacht und des Heeres, also in unmittelbarer Nähe Hitlers, verstand man dessen Strategie nicht, auch wenn sie dort sklavisch umgesetzt wurde. Symptomatisch in diesem Zusammenhang der hilflose Tagebuch-Eintrag von Hitlers oberstem Militärstrategen im Vorfeld des Russlandfeldzuges: «Sinn nicht klar (…)». Nur selten in der Geschichte war eine militärische Führung so wenig vertraut mit dem, was ihren Obersten Befehlshaber wirklich antrieb und wohin er wollte – was sie freilich nicht von ihrer Mitschuld sowohl an dem verbrecherischen Krieg wie auch am Völkermord freispricht.
Das gesamte Wesen von Hitlers Krieg hatte seinen Ursprung in dessen aberwitzigem Irrationalismus. Erst die Dimension seines Weltkampfes der Rassen, dessen Bestätigung er immer wieder aus dem faktischen Verlauf des Krieges herauslas, und nicht irgendeine Tradition deutscher Außenpolitik, erklärt den von ihm geführten Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, aber auch den Völkermord an den europäischen Juden. Dieser war in Hitlers pervertierter Logik von einem gewissen Zeitpunkt an nicht nur unumgänglich, sondern auch legitim. Anders ausgedrückt: Die Größe seiner Aufgabe rechtfertigte es für ihn nicht nur, tradierte zivilisatorische Normen außer Kraft zu setzen, sondern machte es sogar zur Pflicht. Und das Ende des Zweiten Weltkriegs mit dem Untergang des deutschen Staates war ebenfalls durch Hitlers rassenideologische Vorstellungen determiniert – auch wenn die Verständigung der Anti-Hitler-Koalition auf die Forderung nach der bedingungslosen Kapitulation gar keinen anderen Ausgang mehr ermöglichte. So hatte er bereits im Zweiten Band von «Mein Kampf» geschrieben, «Deutschland wird entweder Weltmacht oder überhaupt nicht sein»[*].
Nachdem er seine Prophezeiung hatte wahr werden lassen und die Nation ihm in den Untergang gefolgt war, trat Hitler aus dem Leben. Er tat dies nicht ohne in seinem politischen Testament spätere Generationen zur Fortsetzung seines Rassenkampfes zu verpflichten. Sein Tod bedeutete aber unweigerlich das Ende seiner mörderischen Ideologie, während es den «traditionellen» Antisemitismus trotz der grauenhaften Erfahrungen des Völkermords weiterhin gab. Stalin sagte einmal im Verlauf des Krieges, die Hitler kämen und gingen. Er irrte sich. Denn der deutsche Diktator war eine singuläre Gestalt. Und erst sein selbst erteilter Auftrag, mit dem er aus der Zeit fiel, hatte ihn zur geschichtsmächtigsten Figur des 20. Jahrhunderts werden lassen und den Zweiten Weltkrieg zur nie da gewesenen Katastrophe.
I.Weimar, Hitler und der Zweite Weltkrieg
November 1918 bis Januar 1933
Werden unser Volk und unser Staat das Opfer dieser blut- und geldgierigen jüdischen Völkertyrannen, so sinkt die ganze Erde in die Umstrickung dieses Polypen (…).
Adolf Hitler in «Mein Kampf», 1926
Dass der Zweite Weltkrieg die Konsequenz des Ersten war, ist falsch. Dennoch beginnt seine Geschichte mit dem Waffenstillstand und der Revolution im November 1918. Beide Ereignisse bedingten einander. Denn die Revolution war auch das Resultat der verworrenen und undurchsichtigen Umstände, die das Ende der Feindseligkeiten in Deutschland begleiteten. Soeben war noch die Rede von einem Siegfrieden gewesen, als es plötzlich hieß, dass der Krieg verloren sei, obwohl das Heer noch tief in Frankreich und Belgien stand und erst vor wenigen Monaten dem bolschewistischen Russland der demütigende Brest-Litowsker Frieden diktiert worden war. Dies stand in einem schroffen Widerspruch zur im Reich kaum wahrgenommenen Wirklichkeit, dass die Westfront zusammengebrochen war. Tatsächlich wusste die mit diktatorischen Vollmachten ausgestattete Dritte Oberste Heeresleitung unter Ludendorff und Hindenburg nicht mehr weiter. Die beiden Generale entzogen sich der Verantwortung, indem sie nun ausgerechnet von der Reichsregierung, auf die sie bislang recht wenig gegeben hatten, eine politische Lösung forderten. Ein Waffenstillstand sollte her, und zwar innerhalb von 24 Stunden. Als dieser wegen der für unerfüllbar gehaltenen Bedingungen nicht zustande kam und nun als verzweifelte Reaktion darauf die seit dem Skagerrak-Unternehmen in ihren Häfen dahinrostende Flotte zu einer letzten Schlacht gegen die überlegenen Briten auslaufen sollte, meuterten Anfang November die Matrosen. Aus ihrer regionalen Revolte wurde eine Revolution, die, von der Küste ausgehend, bald ganz Deutschland erfasste.
Im Unterschied zu den Ereignissen in Russland handelte es sich trotz mancher äußerer Parallelen hierbei weniger um eine soziale als um eine Friedensrevolution. Sie bereitete der Monarchie ein rasches Ende, denn diese wurde von den kriegsmüden Deutschen – ob an den Fronten oder in der Heimat – verantwortlich gemacht für die Lage, in die das Land geraten war. Am 9. November 1918 rief der Mehrheitssozialdemokrat Philipp Scheidemann von einem Fenster des Berliner Reichstagsgebäudes den Menschen zu: «Das Alte, das Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen (…) Es lebe das Neue, es lebe die deutsche Republik.»[*] Mit ihrer Ausrufung musste die Mehrheitssozialdemokratie in die Verantwortung treten. Sie lenkte nun die Revolution in gemäßigte, kontrollierte Bahnen.
Vorrangigste Maßnahme war es jedoch, den Krieg zu beenden. Denn neben dem menschlichen Leid, das dieser mit sich gebracht hatte, hungerte die Bevölkerung seit Jahren, und eine Verbesserung der Versorgung war nicht zu erwarten, dauerte doch die alliierte Seeblockade an. Da von der Führung des Militärs nichts mehr zu hören und zu sehen war, unterschrieb der Zivilist und Zentrumspolitiker Matthias Erzberger am 11. November 1918 als Bevollmächtigter der Reichsregierung und Leiter der deutschen Verhandlungsdelegation im Wald von Compiègne einen Waffenstillstand, der einer Kapitulation gleichkam. So konnte später der falsche Anschein entstehen, als sei die Politik für das unrühmliche Ende des Krieges verantwortlich gewesen.
Die deutsche Revolution war eine gespaltene. Die Mehrheitssozialdemokraten (MSPD) um Philipp Scheidemann und Friedrich Ebert wollten eine parlamentarische Demokratie. Die äußerste Linke um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, der nur wenige Stunden nach Scheidemann eine «Freie sozialistische Republik Deutschland» ausgerufen und sich mit den Bolschewiki solidarisiert hatte, trat mit Teilen der Unabhängigen Sozialdemokraten (USPD) für eine Räterepublik nach russischem Vorbild ein. Und die Gräben zwischen den Gemäßigten und den Radikalen, die sich unter Führung der MSPD zu einer provisorischen Regierung, dem Rat der Volksbeauftragten, zusammengefunden hatten, sollten immer tiefer werden. Im Dezember 1918 kam es dann zum Bruch. Die USPD kündigte der MSPD die Zusammenarbeit auf, indem sie den Rat der Volksbeauftragten verließ und sich gegen die schnelle Wahl einer Nationalversammlung aussprach. Die zum Jahreswechsel 1918/19 aus Teilen der USPD und anderen linken Gruppierungen gegründete KPD verweigerte sich den Wahlen vollends und ging den Weg der revolutionäraußerparlamentarischen Opposition – denselben Weg, den Lenin 1917 in Russland beschritten hatte, nachdem er erkannt hatte, dass seine Bolschewiki auf demokratischem Weg nicht die Macht erringen konnten. Die Folge: In Deutschland zogen bürgerkriegsähnliche Zustände herauf. Der Berliner Spartakisten-Aufstand war der Auftakt.
Dennoch fasste die parlamentarische Demokratie unter Führung der MSPD Tritt, indem sie den Pakt mit dem alten Heer schloss, dessen neuer Chef Wilhelm Groener sich auf die Seite der Republik geschlagen hatte. Was hätten die Mehrheitssozialdemokraten auch anderes tun können, zumal Teile der Marine mit den Radikalen im Bunde standen? Sie warben daher um Millionen teils entwurzelter Kriegsheimkehrer und banden sie ein. Besonders der Vorsitzende des Rates der Volksbeauftragten und baldige Reichspräsident Ebert, der selbst zwei Söhne im Weltkrieg verloren hatte, wollte den Heimkehrenden das Gefühl geben, dass eben doch nicht alles umsonst gewesen sei. Wider besseren Wissens rief er ihnen zu, dass sie im Felde unbesiegt seien. Er dankte ihnen für ihren Einsatz für das Vaterland und gab ihnen das Gefühl, dass sie bei Aufbau und Selbstbehauptung der Republik gebraucht würden.
Es war das historische Verdienst der deutschen Mehrheitssozialdemokratie, dass am 19. Januar 1919 eine Nationalversammlung gewählt werden konnte. Sie musste wegen des Spartakisten-Aufstandes in der Reichshauptstadt ins abgelegene Weimar einberufen werden. Die Wahl war eine Sternstunde der Demokratie in Deutschland, handelte es sich doch um die erste freie, gleiche und geheime Abstimmung im Lande, an der jetzt auch Frauen teilnehmen durften. Die sogenannte Weimarer Koalition aus MSPD, Zentrum und Deutscher Demokratischer Partei (DDP), die die Regierung stellen sollte, erreichte dabei 76,2 Prozent der abgegebenen Stimmen. 37,9 Prozent davon entfielen auf die MSPD. Die Kräfte der Reaktion waren vernichtend geschlagen. Die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) erhielt gerade einmal 10,3 Prozent. Die Deutsche Volkspartei (DVP) 4,4 Prozent. Die USPD erhielt 7,6 Prozent der Stimmen. Es war dies ein beeindruckendes Zeugnis der Deutschen für eine demokratisch-republikanische und damit friedfertige Zukunft ihres Landes, ein Zeugnis aus der Geburtsstunde der deutschen Demokratie, das heute nahezu in Vergessenheit geraten ist. Und es ist ein Zeugnis dafür, dass zu Beginn des Jahres 1919 nichts auf einen Hitler und einen weiteren Weltkrieg hindeutete.
Dass die Uneinigkeit der Linken und das Bündnis der Mehrheitssozialdemokratie mit der Armee und den Freikorps dem Nationalsozialismus den Weg geebnet habe, ist eine Legende. Denn erst eine vereinigte Linke hätte das schnelle Wiedererstarken der Reaktion nach sich gezogen. Die radikalen Revolutionäre, die sich mit Teilen der USPD zur KPD zusammengeschlossen hatten, wurden nämlich als Vorhut der von Moskau entfachten proletarischen Weltrevolution angesehen. Noch Anfang November 1918 waren sie aus der russischen Botschaft in Berlin unterstützt worden, worauf die damalige Reichsregierung die diplomatischen Beziehungen mit Moskau abgebrochen hatte. Jetzt, im beginnenden Frühjahr 1919, dauerten in der Hauptstadt die revolutionären Unruhen an, während im Rheinland eine «Rote Armee» aufgestellt wurde, die die Region mit Terror überzog. In fast zwanzig Städten entstanden, über ganz Deutschland verteilt, Räterepubliken, die von denen, die sie ausriefen, als Teil der bolschewistischen Weltrevolution begriffen wurden. Die russischen Bolschewiki, die mit Rat und Tat halfen, sahen das nicht anders. Begeistert telegraphierte Grigori J. Sinowjew, der Vorsitzende der Komintern, nach München, nachdem linke Revolutionäre dort die Macht übernommen hatten, dass nunmehr «drei Sowjetrepubliken (existieren): Russland, Ungarn und Bayern». Und er fügte noch hinzu, dass in einem Jahr Europa kommunistisch sein werde.[*] Selbst Lenin richtete eine Grußbotschaft an die Führer der Räterepublik und bat darum, informiert zu werden, «welche Maßnahmen sie zum Kampf gegen die bürgerlichen Henker Scheidemann und Co. durchgeführt haben»[*].
Die Angst ging damals in Deutschland um, die Angst vor den «russischen Verhältnissen», also vor nie da gewesener Gewalt und Grausamkeit, mit der der Bürgerkrieg im Osten geführt wurde. Dahinter verbargen sich wiederum alte, diffuse Ängste vor dem so fremden, unheimlichen Koloss im Osten. All diese Ängste, die später in Hitlers Bolschewisten-Hass mündeten, erklären dann teilweise die Härte der Regierungstruppen und die mörderischen Exzesse der verbündeten Freikorps, denen auch Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im Zuge der Niederschlagung des Spartakisten-Aufstandes zum Opfer gefallen waren. Dass die von der «Roten Fahne», dem Organ der KPD, groß herausgestellten Einflussmöglichkeiten der Bolschewiki tatsächlich gar nicht so groß waren, mag die Erkenntnis späterer Historiker sein. Zeitgenossen wie Thomas Mann, Harry Graf Kessler oder Ernst Troeltsch sahen jedenfalls die Arme des «bolschewistischen Kraken» nach dem Herz Europas greifen. Sie alle und das Gros der Deutschen wähnten darin eine Bedrohung des Kulturkreises, die es mit allen Mitteln abzuwehren galt.
Folgenschwerer für den Fortgang der Geschichte war der Ausgang der Friedensverhandlungen, die seit Januar 1919 in den Pariser Vororten stattgefunden hatten. Da die Deutschen als Kriegsverlierer lange von diesen ausgeschlossen blieben, hatten zunächst die Illusionen geblüht. Genährt wurden sie nicht zuletzt auch durch die Reden führender MSPD-Politiker. Sie sahen, geleitet von den Ideen des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson, den künftigen Platz Deutschlands als gleichberechtigten Partner in der Gemeinschaft der westlichen Demokratien. Wilson hatte noch im Krieg, im Januar 1918, in seinen 14 Punkten eine künftige Neuordnung Europas umrissen und weiterentwickelt. Sie beruhte auf den Grundsätzen der Demokratie und des Rechts sowie auf dem Selbstbestimmungsrecht der Völker. Mit dem Ende der Monarchie und der Einführung der parlamentarischen Demokratie entsprach die Reichsregierung den Vorstellungen und Forderungen Wilsons.
Deutschland hatte zudem die überaus harten Waffenstillstandsbedingungen von Compiègne akzeptieren müssen. So musste Deutschland die besetzten Gebiete räumen, seine Truppen hinter den Rhein zurückziehen und darüber hinaus beträchtliche Sachleistungen erbringen. Aus dem Blickwinkel der sozialdemokratisch geführten Reichsregierung, die auch darin eine vertrauensbildende Maßnahme für die bevorstehenden Verhandlungen in Versailles sah, stand einem gerechten Frieden wenig im Wege. Sie appellierte dann auch an die Alliierten, den europäischen Frieden auf der Grundlage der Wilson’schen Forderungen und vor allem auf der Basis eines gerechten Interessensausgleichs auszuhandeln. Wenn sie das mit einem gewissen Selbstvertrauen tat, dann aus dem Bewusstsein heraus, die für den Krieg Mitverantwortlichen aus der politischen Verantwortung gejagt zu haben und für das Neue, für die Demokratie zu stehen. Und als deren Vertreter waren sie von dem ehrlichen Willen getragen, dass sich eine Katastrophe wie der Erste Weltkrieg nie mehr wiederholen dürfe. Reichsministerpräsident Scheidemann sagte im Verlaufe seiner Regierungserklärung: «Der Frieden, den abzuschließen, die schwere Aufgabe dieser Regierung ist, soll kein Frieden werden von jener Art, wie ihn die Geschichte kennt, keine mit neuen Kriegsvorbereitungen ausgefüllte Ermattungspause eines ewigen Kriegszustandes der Völker, sondern er soll das harmonische Zusammenleben aller zivilisierten Völker begründen auf dem Boden einer Weltverfassung, die allen gleiche Rechte verleiht.»[*] Wie wäre wohl die europäische Geschichte verlaufen, wären diese Hoffnungen Wirklichkeit geworden?
Doch die Wunden waren zu tief, die der furchtbare Krieg geschlagen hatte, der Hass noch zu jung und der Wunsch nach Abrechnung noch zu brennend. So hatte das, was Anfang Mai 1919 in Versailles und Saint-Germain den inzwischen dort zugelassenen Kriegsverlierern diktiert wurde, nichts mit den Vorstellungen der Reichsregierung von einer künftigen Friedensordnung zu tun. Es hatte auch nichts mehr mit den Prinzipien eines Wilson zu tun. Und es hatte auch nur sehr bedingt mit den Vorstellungen des britischen Premierministers David Lloyd George zu tun, der Deutschland im Zuge der Londoner Gleichgewichtsdoktrin als wirtschaftlichen und politischen Faktor im Spiel der kontinentaleuropäischen Mächte halbwegs erhalten wissen wollte. Beide beugten sich den Vorstellungen des französischen Ministerpräsidenten Georges Clemenceau, der einen weiteren Waffengang gegen die Deutschen als unvermeidbar ansah. Deshalb kam es für den Franzosen darauf an, den Erbfeind durch die Friedensbedingungen so nachhaltig wie möglich zu schwächen.
Dies implizierte, dass das Selbstbestimmungsrecht und Nationalitätenprinzip, auf die der amerikanische Präsident einen besonderen Wert gelegt wissen wollte, nicht mehr für die Kriegsverlierer gelten sollten. So wurde ihnen eine Vereinigung des Deutschen Reiches mit Deutsch-Österreich untersagt, wie sie die demokratisch gewählten sozialdemokratisch geführten Parlamente in Berlin und Wien mehrheitlich beschlossen hatten. Außerdem mussten beide Kriegsverlierer eine Reihe fast ausschließlich deutschsprachiger Gebiete abtreten, ein Sachverhalt, vor dem Lloyd George gewarnt hatte, könne er sich doch «keinen stärkeren Grund für einen künftigen Krieg denken»[*]. So kam Südtirol zu Italien, das Sudetenland zur neu entstandenen Tschechoslowakei, das Memelland zu Litauen, und Danzig wurde Freie Stadt unter Kontrolle des Völkerbundes. Nicht nahezu ausschließlich von Deutschen besiedelte Reichsgebiete wie Posen, Westpreußen sowie Teile Oberschlesiens gingen an das wiedererstandene Polen; Eupen-Malmedy an Belgien, Nordschleswig an Dänemark. Hinzu kamen Gebiete, die, wie etwa das Saarland, erst nach Volksabstimmungen bei Deutschland blieben. Am Ende ging ein Siebtel des Reichsgebietes verloren, auf dessen Fläche sich wichtige Schlüsselindustrien (50 Prozent der Eisen- und 25 Prozent der Steinkohlevorkommen) befanden und sechseinhalb Millionen Menschen lebten.
Doch damit nicht genug. Die Vertragsbedingungen sahen vor, Deutschland, das auch sämtliche Kolonien abzutreten hatte, militärisch zu einer Quantité négliable zu machen. Das Heer, der einstige Stolz der Nation, sollte hierzu auf 100000 Mann, die Marine auf 15000 Mann abgebaut werden. Die Kriegsflotte, das Lieblingskind des Kaisers, war größtenteils abzuliefern. In der Bucht von Scapa Flow versenkten sich dann im Juni 1919 74 Kriegsschiffe selbst, worauf die Entente die Ablieferung fast der gesamten deutschen Handelsflotte verlangte. Ergänzend zu all dem sah der Vertrag von Versailles die Entmilitarisierung der linksrheinischen Gebiete und eines 50 Kilometer breiten Streifens rechts des Rheins vor, samt der Schleifung der dortigen Festungen sowie der Auflösung sämtlicher Garnisonen.
Darüber hinaus wurden Deutschland in dem monströsen Vertragswerk mit seinen 440 Artikeln gewaltige Sachleistungen abverlangt. Die Entente-Vertreter beließen es jedoch nicht dabei: Deutschland, dessen Verhandlungsdelegation der Zutritt zum Versailler Schloss nur durch einen Nebeneingang gestattet worden war, sollte auch noch finanzielle Wiedergutmachung leisten. Auf deren Größenordnung hatten sich die Siegermächte noch nicht geeinigt. Doch das war bedeutungslos, denn die Besiegten mussten sowieso jegliche Entschädigungssumme im Voraus akzeptieren. Denn gegen alle historische Wirklichkeit verfügte Artikel 231, «dass Deutschland und seine Verbündeten als alleiniger Urheber des Krieges für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, welche die Alliierten erlitten haben»[*]. Deshalb hieß es in der Präambel des Vertrages, dass die Aufnahme in den Völkerbund der zivilisierten Nationen Deutschland bis 1926 verwehrt sei.
Die Schuld einer Nation an einem Krieg zu bestimmen und diese damit einhergehend weltweit zu ächten war ein Novum in der Geschichte. Das galt auch für die Forderung, den Kaiser als Obersten Kriegsherrn und achthundert seiner Getreuen auszuliefern, um sie von einem alliierten Tribunal aburteilen zu lassen. Was die achthundert Getreuen anging, so saß die Reichsregierung die Angelegenheit aus. Was den Kaiser in seinem Doorner Exil betraf, verweigerten sich die neutral gebliebenen Niederlande hartnäckig gegen die massiv vorgetragenen Auslieferungsersuchen der Entente. Dort gab es nicht wenige, die angesichts des Versailler Diktates ihre Stimme erhoben. Das Mitglied der britischen Verhandlungsdelegation, der Nationalökonom Keynes, schrieb von einer «Politik der Versklavung Deutschlands für ein Menschenalter, die Erniedrigung von Millionen lebender Menschen und die Beraubung eines ganzen Volkes»[*]. Die weitsichtigen unter den Konferenzteilnehmern warnten vor einem neuen Waffengang, wie der Ministerpräsident der Südafrikanischen Union, Jan C. Smuts, der der Delegation des britischen Empires angehörte. Er schrieb an Wilson: «Dieser Friede könnte (…) ein noch größeres Unheil für die Welt bedeuten, als es der Krieg war.»[*] Doch der durchsetzungsschwache amerikanische Präsident sah sich selbst als Opfer seiner Verbündeten.
Versailles, das die territorialen Interessen der Siegermächte regelte und in Folge dessen das ausgegrenzte bolschewistische Russland durch einen «Cordon sanitaire» mittlerer und kleinerer Staaten von Finnland über die baltischen Länder und Polen bis hinunter nach Rumänien von Europa fernhielt, war in seinem Ergebnis für die Deutschen ein Schock. Sie waren bis ins Mark getroffen. All die Hoffnungen auf eine bessere, friedfertige Zukunft, auf ein Ende des Hungers, die mit dem Waffenstillstand aufgekommen waren, mündeten in schiere Verzweiflung. Was als noch schlimmer empfunden wurde: Die Nation, die aus Kriegen entstanden war und für die das Militärische zum Selbstverständnis dazugehörte, war zutiefst gedemütigt.
Das geschlagene Deutschland rückte nun in dem Bewusstsein zusammen, dass dieser Vertrag niemals akzeptiert werden könne und auch nicht akzeptiert werden würde. In den Reichstagsprotokollen dokumentiert ist Scheidemanns berühmter Auftritt in der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität, wo am 12. Mai 1919 das Parlament tagte. Darin wird der Reichsministerpräsident mit den Worten wiedergegeben: «Ich frage Sie, wer kann als ehrlicher vertragstreuer Mann solche Bedingungen eingehen? Welche Hand müsste nicht verdorren, die sich und uns in solche Fesseln legt? Dieser Vertrag ist nach Auffassung der Reichsregierung unannehmbar. Minuten langer brausender Beifall im Hause und auf den Tribünen. Die Versammlung erhebt sich.»[*] Dieser 12. Mai 1919 – in München war zu Beginn des Monats eine bayerische Sowjetrepublik blutig niedergeworfen worden – war die letzte große Artikulation des parlamentarischen Konsenses im Deutschland der Weimarer Republik.
So wie die Nation unter dem Eindruck des in Versailles Diktierten zusammengestanden hatte, so jäh wurde sie nun durch den Fortgang der Ereignisse zerrissen: Die Sieger des Weltkriegs stellten am 16. Juni 1919 der Reichsregierung ein Ultimatum. Wenn Deutschland die Friedensbedingungen nicht innerhalb von fünf Tagen annähme, würden sie den Krieg fortsetzen. Berlin hatte nun die Wahl zwischen Skylla und Charybdis. Ließ man das Ultimatum verstreichen, würde das kriegsmüde Deutschland, das durch die akzeptierten Waffenstillstandsbedingungen von Compiègne kaum noch eine Chance hatte, das Reichsgebiet zu verteidigen, vollends im Chaos versinken. Die Folge wäre angesichts der von Frankreich nach Kräften beförderten Separatismus-Bewegung im Rheinland und in Bayern womöglich nicht nur der Zerfall des Landes gewesen, sondern auch ein erneutes Aufflammen der Revolution. Nähme Berlin die alliierten Bedingungen an, schien dies einem Verrat an den Weltkriegskämpfern und aus der Sicht nicht nur der Rechten einer «Ehrlosmachung» der Nation gleichzukommen. Aus der Sicht der noch ganz unter dem Eindruck des furchtbaren Weltkriegs stehenden Reichsregierung war die Entscheidung, sich dem Ultimatum zu beugen, das kleinere Übel. Aus Protest und in dem Bewusstsein, nur falsch handeln zu können, trat Scheidemann, gefolgt von seinem Kabinett, zurück, nachdem er, seine Partei und nur Teile des Koalitionspartners vom Zentrum für eine Annahme des Diktats gestimmt hatten. Alle Übrigen, der andere Teil des Zentrums, die DDP, die DNVP, die DVP und die USPD, stimmten dagegen.
Die Spaltung des Parlamentes, in dem die Mehrheit der Weimarer Koalition fortan der Vergangenheit angehörte, fand ihr Äquivalent in der deutschen Bevölkerung. Während die Bolschewiki weiterhin der Revolution zum Durchbruch verhelfen wollten und überall im Lande die Revolten der äußersten Linken unterstützten, keimten Hass und Revanchegedanken. Die MSPD galt nicht mehr als die Partei der ehemaligen Frontsoldaten. Vom großen Verrat der Sozialdemokraten war nun die Rede – im Heer, besonders aber bei den Perspektivlosen in Freikorps und Wehrverbänden. Einer von ihnen, die Marinebrigade Ehrhard, putschte später unter der Führung des erzreaktionären Wolfgang Kapp und scheiterte nach nur hundert Stunden kläglich. Vom «Dolchstoß» der Heimat in den Rücken der Front fabulierten jetzt ausgerechnet jene, die für das Weltkriegsdesaster die Verantwortung trugen und traditionsgemäß die jetzt erstarkende DNVP als ihre Partei ansahen. Und antisemitische Verschwörungstheorien, wie sie in den «Protokollen der Weisen von Zion» oder in Henry Fords Bestseller «Der internationale Jude» weltweit eine riesige Verbreitung gefunden hatten, befeuerten völkische Sektierer-Zirkel und Gruppen, die sich jetzt eines erhöhten Zulaufs erfreuten.
Zu diesem Zeitpunkt begann auch die Ideologisierung und Radikalisierung Adolf Hitlers. Der entwurzelte österreichische Gefreite war nach vier Jahren an der Westfront mit einem primitiven Sozialdarwinismus zurückgekehrt. Die Gesetzmäßigkeit allen Lebens war für ihn der Kampf. Nun, in der Heimat, in der nichts mehr so war wie zuvor, suchte der Mann mit dem Eisernen Kreuz Erster Klasse nach Orientierung. Man hatte ihn in der Trauergesellschaft für den im Februar 1919 ermordeten bayerische Ministerpräsidenten, den unabhängigen Sozialdemokraten und Juden Kurt Eisner, gesehen. Während der Räteherrschaft im April 1919 tauchte er dann als Soldatenrat auf, genauer gesagt, als Ersatzbataillonsrat der 2. Kompanie des Demobilisierungsbataillons des in die «Rote Armee» integrierten 2. Bayerischen Infanterie-Regiments. Ein orientierungsloser Hitler als ahnungsloser Kleinfunktionär im Räderwerk der bolschewistischen Weltrevolution – derselbe Hitler, der bald nach dem Ende der Räterepublik im «jüdischen Bolschewismus» seinen Todfeind erblicken sollte! Dies passt nicht zu den Thesen, denen zufolge für die Person Hitlers vermeintliche Linien vom Wiener Antisemiten zum Judenhasser der Nachkriegszeit aufgezeigt werden. Der wurde er, als er in den Tagen nach dem Ende der bayerischen Räterepublik und dem Bekanntwerden des Versailler Diktats einer Einheit zugeteilt wurde, die Aufklärungsarbeit über Ungeist des Bolschewismus und den «Börsenkapitalismus» leisten sollte, einen Kapitalismus, der nach den Vorstellungen der Zeit angeblich genauso jüdisch-dominiert war wie der Bolschewismus.
In seiner Funktion als Propagandist und Spitzel geriet Hitler dann auch mit der unmittelbar nach Kriegsende gegründeten Deutschen Arbeiterpartei in Kontakt. Die nur wenige Mitglieder zählende DAP, aus der die NSDAP hervorgehen sollte, hatte es sich zum Ziel gesetzt, Sozialismus und Nationalismus miteinander zu versöhnen. Aus der Sicht des kleinen, bedeutungslosen Häufleins um den Sportjournalisten Karl Harrer und den Arbeiteraktivisten Anton Drexler, zu denen sich bald auch ein Ingenieur namens Gottfried Feder gesellte, war es das Gegeneinander beider Strömungen, das zur Niederlage im Weltkrieg geführt hatte. Letzterer sann über eine Wirtschaftsordnung nach und schrieb ein «Manifest», wonach die Herrschaft der «Zinsknechtschaft» gebrochen werden sollte. Geld sollte nicht mehr mit Geld verdient werden dürfen, sondern ausschließlich durch Arbeit. Feders Thesen bildeten den Diskussionsstoff in der frühen Splitterpartei NSDAP.
Adolf Hitler um 1920/21. Von seinen nach dem Weltkrieg entwickelten Vorstellungen vom «Weltkampf der Rassen» rückte er bis zu seinem Tod nicht ab.
Der nationale Sozialismus war demnach das eine, die Rassenideologie, die Hitler in der zweiten Hälfte des Jahres 1919 zu verinnerlichen begann, das andere, das Eigentliche. Eröffnet wurde diese Welt dem halbgebildeten österreichischen Gefreiten von einem gescheiterten Schriftsteller namens Dietrich Eckart, der zu seinem weltanschaulichen Mentor werden sollte. Eckart gehörte zu jenem Kreis völkischer Sektierer, die in der Münchner ThuleGesellschaft organisiert waren und in dem «parasitären Juden» den Zerstörer jeglicher völkischen Gemeinschaft sahen. Der Lauf der Welt war für sie ein gigantischer Rassenkampf, der im Aufeinanderprallen von Juden und Ariern entschieden werde. Dies war aus der Sicht der Thule-Leute ein erbarmungsloser Kampf um Sein oder Nichtsein, ein Kampf zwischen der nordischen Rasse mit ihren «Seelenmenschen» und ihrem großen Widerpart, dem «materialistischen Juden». Dies machte für die Männer und Frauen der Thule-Gesellschaft das Wesen der Geschichte aus.
Doch erst die Ereignisse um Deutschland sollten für Hitler dies zur großen jüdischen Verschwörung werden lassen. Erst jetzt war es für ihn nicht mehr nur ein theoretisches Welterklärungsmodell, sondern vermeintlich erlebte und erlittene Wirklichkeit. Hitler war von da an vollkommen besessen davon, dass der russische Bolschewismus und der westliche Börsenkapitalismus in Gestalt der bayerischen Räterepublik und des Versailler Diktates die verderblichen Instrumente ein und derselben jüdischen Macht seien, durch deren systematische «Wühlarbeit» bereits der Erste Weltkrieg verloren gegangen war. «Der Versailler Friedensvertrag und der Bolschewismus sind zwei Köpfe eines Monsters. Wir müssen beide abschlagen», sagte er einmal.[*]
Aus der Überzeugung heraus, zu den wenigen zu gehören, die die eigentlichen Zusammenhänge des Weltenlaufs verstanden hätten, unterstellte Hitler künftig sein ganzes politisches Handeln dieser Sicht. Daraus entsprang eine Form des Politischen mit pseudoreligiösen Elementen. Die rassenideologische Weltanschauung Hitlers wurde damit zu einer Art «politischer Religion», deren Kern eine Art «heiliger Krieg» gegen «den Juden» war und der aus dem Verständnis dessen, der ihn führte, nur mit dem Sieg, also mit der Rettung der Welt, oder dem Untergang enden konnte. «Deutschland wird entweder Weltmacht oder überhaupt nicht sein», schrieb er später in «Mein Kampf»[*].
Hitlers fanatischer Weltkampf begann Ende 1919 und richtete sich zunächst vor allem gegen den «Diktatfrieden», aber auch immer wieder gegen die Revolution. Er geißelte die mit Moskau im Bunde stehende KPD, die Deutschland in die Herrschaft «Alljudas» überführen wolle. Er verunglimpfte die Sozialdemokraten als willfähriges Werkzeug «jüdischer Drahtzieher», seitdem sie die von den «Börsen-Juden» diktierten Friedensbedingungen der Feinde Deutschlands hingenommen hätten. Bereits im September 1919 – noch ganz am Anfang seiner Ideologisierung – hatte er aus seinem vermeintlichen Wissen über das Wesen seines Feindes eine ungeheuerliche Konsequenz abgeleitet, wenn er schrieb: «Letztes Ziel aber muss unverrückbar die Entfernung der Juden überhaupt sein.»[*] Es war wohl noch nicht dezidiert der Völkermord, der von ihm angedacht wurde, aber die Juden mussten verschwinden, wie immer auch das geschehen mochte.
Die Auseinandersetzung mit Versailles und dem Ausgreifen der bolschewistischen Revolution in Gestalt der Münchner Räterepublik, unter deren Protagonisten sich zahlreiche Juden befanden, hatten also in der zweiten Hälfte des Jahres 1919 einen entscheidenden Anteil am Werden von Hitlers wahnwitziger Ideologie. Zuspruch zu seinen rassenideologischen «Wahrheiten» erhielt er jedoch bestenfalls in antisemitischen Sektierer-Kreisen Münchens. Und was sein konkretes, zentrales politisches Ziel anlangte, das er in seinem 25-Punkte-Programm vom Februar 1920 groß herausstellte, so unterschied sich dieses nicht von dem des gesamten Parteienspektrums der Republik. Die Aufhebung der Verträge von Versailles und Saint-Germain wollten alle, von ganz links bis ganz rechts.
Die Reichsregierungen kämpften auf diplomatischem Weg für die Beseitigung der Reparationszahlungen, die im Juni 1920 auf die astronomische Summe von 269 Milliarden Goldmark festgelegt wurden. Sie strebten aber auch eine Aufhebung der als besonders ehrabschneidend empfundenen Rüstungsbeschränkungen an. Nicht zuletzt davon erhofften sie sich, dass Deutschland längerfristig seine verlorene Großmachtstellung würde zurückgewinnen können. Als Chance für die Außenpolitik wurde es dabei angesehen, dass die Umklammerung der seit der Kaiserzeit verbündeten Mächte Großbritannien – Frankreich – Russland nicht mehr fortbestand. Die kommunistische Macht im Osten war isoliert und bot sich als Partner der deutschen Politik an, besonders ihres liberal-bürgerlichen-konservativen Lagers, wo ideologische Gegensätze – anders als bei den Sozialdemokraten – ohne oder nur von untergeordneter Bedeutung waren.
In der Reichswehrführung wurden sogar Kriegsszenarien durchgespielt, die ein gemeinsames Vorgehen mit Russland gegen Polen zur Rückgewinnung der verlorenen Ostgebiete und einen anschließenden Feldzug gegen Frankreich mit russischer Rückendeckung zum Gegenstand hatten. Es waren dies Studien, wie sie überall in den Generalstäben der europäischen Mächte angefertigt wurden, denn der Krieg wurde – trotz des Grauens von 1914/18 – nach wie vor als die legitime Fortsetzung von Politik angesehen. Entscheidend dabei war eine rationale Einschätzung der Lage und vor allem der eigenen militärischen Möglichkeiten. Im Deutschland der frühen zwanziger Jahre war eine gewaltsame Revision von Versailles freilich eine Option, die in weiter Ferne lag, denn mit einem Hunderttausend-Mann-Heer war kein Krieg zu machen.
Die vom Zentrumspolitiker Joseph Wirth geführte Reichsregierung nutzte dann die Möglichkeiten für die deutsche Politik, die das kommunistische Russland eröffnete. Im April 1922 unterschrieben Außenminister Walther Rathenau (DDP) und der Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten Georgi Tschitscherin in Anwesenheit Adolf Joffes, des im November aus Berlin ausgewiesenen sowjetrussischen Botschafters, den Vertrag von Rapallo. Worin Hitler das Zusammenwirken der verhassten, jüdisch dominierten Systempolitiker mit den jüdischen Bolschewisten des Kremls und damit eine Bestätigung seiner Weltsicht von der großen Verschwörung sah, wirkte in Europa wie ein Paukenschlag. Die Kriegsverlierer, die Habenichtse, schickten sich an, aus der politischen und ökonomischen Isolation auszubrechen und ihre Position gegenüber den Westmächten zu stärken. Vereinbart wurde, die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen wiederaufzunehmen. Besonders Letztere waren für Deutschland wichtig, denn seine Waren wurden von den westeuropäischen Staaten boykottiert. Der brisanteste Punkt des Vertrages war freilich die Fixierung einer geheimen militärischen Zusammenarbeit zwischen beiden so gegensätzlichen Ländern, die bereits begonnen hatte. In Russland wurden Soldaten der Reichswehr an Panzern und Flugzeugen ausgebildet, an modernen Waffen also, die laut Versailler Vertrag den Deutschen zu besitzen untersagt war.
Es entsprach dabei der Außenpolitik der Moskauer Führung, weiterhin auch die weltrevolutionäre Komponente im Blick zu behalten. So erhoffte sich der Kreml, mit Rapallo den Klassenkampf seiner deutschen Gefolgsleute in der KPD vorantreiben zu können. Der Vertrag – so wurde kalkuliert – würde nämlich den Konflikt Deutschlands mit den Siegermächten des Weltkriegs eskalieren, was nicht ohne Auswirkung auf dessen innere Stabilität bleiben würde. Und für die Revolution bedurfte es der Krise. Rapallo rief dann tatsächlich die Westmächte auf den Plan. Besonders in Paris fürchtete man eine Veränderung der europäischen Kräfteverhältnisse und damit der Versailler Nachkriegsordnung. Ministerpräsident Raymond Poincaré brachte öffentlich eine militärische Intervention ins Gespräch.
Anfang Januar 1923 marschierten dann französische und belgische Truppen ins Ruhrgebiet, ins Herz der deutschen Schwerindustrie, ein. Die Besatzer, die den Schritt, den sie schon vor Rapallo erwogen haben sollen, mit nicht rechtzeitig erfüllten Reparationsleistungen begründet hatten, verhängten dort den Ausnahmezustand und übten ein brutales Regiment aus. Die Reichsregierung Cuno (DVP) – es war die fünfte seit der Januarwahl 1919 – antwortete mit dem passiven Widerstand. Doch die Produktionsausfälle ruinierten die deutsche Wirtschaft vollends. Die Arbeitslosigkeit überstieg die Vier-Millionen-Grenze. Das von der Hyperinflation gebeutelte Deutschland – im November 1923 entsprach ein Dollar 4200000000000 Mark – drohte endgültig im Chaos zu versinken.
Der Kreml versuchte nun (auch um innenpolitische Schwierigkeiten zu überwinden), die Gunst der Stunde zu nutzen und der «zweiten Welle der Weltrevolution» in Deutschland, ausgehend von Thüringen und Sachsen, in denen Volksfrontregierungen an der Macht waren, zum Durchbruch zu verhelfen. «Revolutionäre Hundertschaften», nach dem Vorbild der Petersburger Roten Garden, wurden aufgestellt und angeleitet von eingeschleusten schlachterprobten russischen Revolutionsführern. Flankierend dazu sollte in Hamburg der Aufstand erfolgen. Doch damit nicht genug. Es existierte ein mit der KPD-Führung in Moskau beratener Plan der Militärkommission des Zentralkomitees der KPR, der vorsah, bis zu 2,3 Millionen Rotarmisten durch Polen marschieren zu lassen, um «dem deutschen Proletariat (…) militärisch zu Hilfe (zu) eilen». Mit dessen Sieg werde sich das «Zentrum der Weltrevolution aus Moskau nach Berlin verlagern», schrieb Josef Stalin, seit 1922 Generalsekretär des Zentralkomitees der KPR, in der «Roten Fahne»[*], dem Organ der KPD, war er doch der Überzeugung, dass erst der revolutionäre Umbruch in Deutschland der Weltrevolution den alles entscheidenden Impuls verleihen würde.
Noch ehe der von den Kommunisten propagandistisch groß herausgestellte «deutsche Oktober» kläglich scheiterte, weil es nicht gelungen war, die Arbeiterschaft zu mobilisieren, hatte sich der selbst ernannte bayerische Weltenretter entschlossen zu handeln – fanatisch und ebenso irrational in seiner Zielsetzung. Um zu verhindern, dass Deutschland die Beute des «jüdischen Bolschewismus» und des «jüdischen Großkapitals» und seiner Helfer im Reichstag werden würde, wollte er die Macht in Bayern, um von dort aus nach Berlin zu marschieren. Der Hitler-Putsch vom 8./9. November, der vor der Münchner Feldherrnhalle unter dem Gewehrfeuer der bayerischen Landpolizei endgültig zusammenbrach, war aber eher eine Posse, wenn auch eine blutige: 16 tote Nationalsozialisten, die später als «Blutzeugen der Bewegung» verherrlicht werden sollten, ein geflohener Putschist, der sich das Leben nehmen wollte, es aber dann doch nicht konnte, und ein Prozess, der für ihn mit einer überaus milden Gefängnisstrafe von fünf Jahren Festungshaft endete. Man ließ ihn aber bereits nach einem Jahr wieder frei, denn eine patriotische Gesinnung wollte man dem Weltkriegsgefreiten mit dem Eisernen Kreuz Erster Klasse nicht absprechen.
Hitler und seine NSDAP, die er 1920 übernommen hatte, waren nach menschlichem Ermessen damit gescheitert. Seine Agitation hatte ihm nicht die Resonanz der Massen gebracht. Wie sollte sie auch? Nur einmal, bei den Reichstagswahlen vom Mai 1924, erreichte seine Partei in einem Wahlbündnis mit der Deutsch-völkischen Freiheitspartei 6,6 Prozent der Stimmen. Bei den darauf folgenden Wahlen im Dezember 1924, als sich die politische Lage im Reich zunehmend konsolidierte, waren es nur noch drei Prozent – Tendenz fallend. Daran änderte auch sein in einer Komfortzelle der Festung Landsberg unter dem späteren Titel «Mein Kampf» zusammengeschriebenes, programmatisches Weltanschauungsbuch nichts, in dem er die «jüdische Weltverschwörung» thematisierte. Alles deutete darauf hin, dass Hitler, der Mann mit dem verklemmt ungelenken Habitus, als antisemitischer Sektierer in Vergessenheit geraten und lediglich eine Randnotiz der bayerischen Geschichte bleiben würde.
Die junge deutsche Demokratie, in der bis Januar 1925 zwölf Kabinette regierten, hatte sich trotz denkbar schlechter Startbedingungen behauptet. Die Gefahr einer Revolution war gebannt. Dazu beigetragen hatte vor allem, dass die Republik ökonomisch allmählich die Talsenke – nicht zuletzt mit Hilfe amerikanischer Kredite – durchquert hatte und damit die ohnehin ungünstige Voraussetzung für die Mobilisierung des Proletariats entfallen war. Mit der Einführung der Rentenmark war eine stabile Verrechnungseinheit zur Mark geschaffen worden, die bald durch die Reichsmark ersetzt werden sollte. Der Dawes-Plan vom August 1924 regelte die Reparationszahlungen neu. Danach sollten sich diese mit 5,4 Milliarden Goldmark bis 1928 an der Leistungsfähigkeit des Landes orientieren. Die durchschnittliche Jahresrate sollte bei etwa zwei Milliarden Reichsmark liegen, was nur noch einem Bruchteil der ursprünglich eingeforderten jährlichen Zahlungen in Goldmark entsprach. Einschränkungen der deutschen Souveränität, wie die ausländische Kontrolle über Reichsbank und Reichsbahn, wurden aufgehoben. Ein erster Schritt zur Revision von Versailles war damit getan.
Im Oktober 1925 – im vorangegangenen April war der 77-jährige Paul von Hindenburg Reichspräsident geworden – gelang in Locarno die Rückkehr des bis dahin geächteten Landes in die Staatengemeinschaft. Die Konferenz in dem schweizerischen Ort, an der führende Staatsmänner Italiens, Frankreichs, Großbritanniens, Belgiens, der Tschechoslowakei, Polens und eben Deutschlands in Person von Reichskanzler Hans Luther und seines Außenminister Gustav Stresemann (beide DVP) teilnahmen, galt als eine entscheidende Etappe auf dem Weg zur Friedenssicherung in Europa, die Stresemann als Voraussetzung zur Rückkehr Deutschlands ins Konzert der Mächte ansah. Besiegelt wurde mit dem Vertrag von Locarno der Verzicht auf eine gewaltsame Veränderung der in Versailles festgelegten deutschen Westgrenze und die Bestätigung der ebenfalls dort verankerten Entmilitarisierung des Rheinlandes. Überdies war der Beitritt Deutschlands zum Völkerbund vereinbart worden, der dann im September 1926 erfolgte.
In Moskau wurde Locarno als Umorientierung des Reiches nach Westen gedeutet. Dort hatte man die doppelgleisige Politik mit Deutschland – also eine offizielle und eine inoffizielle – fortgesetzt. 1926 unterzeichneten Stalins Außenminister Tschitscherin und Stresemann einen Freundschaftsvertrag zwischen beiden Ländern, mit dem die Sowjetunion wie schon in Rapallo ihre Isolation unterlaufen wollte. Was die inoffizielle Deutschlandpolitik anlangte, sah Stalin nach dem Scheitern des Umsturzes vom Oktober 1923 die künftige Linie in einer weiteren Sowjetisierung der KPD und damit in der Schaffung eines schlagkräftigen Instruments im Dienste der außenpolitischen Interessen der Sowjetunion.
Für Stresemann, der durchaus die sozialrevolutionäre Komponente der sowjetischen Politik in Deutschland sah, stellte die Berliner Ostpolitik immer auch ein Druckmittel für seinen friedlichen Revisionskurs dar. Seine Ziele waren hierbei ambitioniert. Dazu gehörte die staatliche Vereinigung mit Österreich. Vorrangig waren für ihn jedoch die endgültige, für Deutschland erträgliche Lösung der Reparationsfrage und vor allem die Korrektur der deutschen Ostgrenzen – der Wiedergewinnung Danzigs und des polnischen Korridors sowie die Verschiebung der Grenze in Oberschlesien. Erreichen wollte er dies durch eine Kooperationspolitik mit Frankreich, bei der eine enge Wirtschaftsverflechtung auf europäischer Basis im Mittelpunkt stehen sollte. Der französische Außenminister Aristide Briand, der zusammen mit Stresemann für Locarno mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, entwickelte in diesem Kontext später eine Konzeption einer «Europäischen Föderalen Union».
Viel Euphorie war nach Locarno nicht zuletzt durch den Nobelpreis im Spiel. Doch der Wirklichkeit konnte sie nicht standhalten. So wollte Briand mit der «Europäischen Föderalen Union» letztendlich nur den territorialen Status quo nach Versailles festigen und die Berliner Revisionspolitik durchkreuzen. Paris verweigerte die von Stresemann geforderte Rückgabe Eupen-Malmedys ebenso wie die Vorverlegung der in Versailles auf 1935 festgelegten Saarabstimmung. Erst im Juni 1930 zogen die Besatzungstruppen aus dem Rheinland ab, das damit entmilitarisiert wurde. Und was die Frage der deutschen Ostgrenzen anlangte, stellte sich die französische Regierung hinter Warschau, das jegliche Modifikation derselben ohne Wenn und Aber ablehnte. Stresemanns anfänglich so gefeierte wirtschaftsliberale Revisionspolitik war letztendlich gescheitert.
Und dennoch schien Locarno Deutschland auf den Weg in eine bessere Zukunft zu führen. Not und Elend der Nachkriegszeit, der Jahre der Revolution und der nationalen Demütigungen traten im Bewusstsein der Menschen zurück. Mit der Wirtschaft ging es weiter bergauf, der Lebensstandard stieg. Nicht von ungefähr wurden jene Jahre der Rückkehr zur Normalität zu den «Goldenen Zwanzigern». An einem neuen großen Krieg dachte in der deutschen Öffentlichkeit und in den demokratischen Parteien des Landes niemand, auch wenn in den Sandkästen der Reichswehr weiterhin Krieg gespielt wurde.
Wenn Hitler es dennoch auf die große nationale Bühne schaffte, dann lag der Grund in einem Ereignis, auf das die deutsche Politik keinen Einfluss hatte. Der Tod Stresemanns im Oktober 1929 schien dieses Ereignis wie ein Menetekel anzukündigen: die Weltwirtschaftskrise. Nachdem der Young-Plan soeben einen neuen Zahlungsmodus vorgelegt hatte, der dem deutschen Wunsch nach einer Senkung der Reparationszahlungen auf 112 Milliarden Reichsmark entgegengekommen war, beendete sie jäh die guten Jahre der Republik. Im rasanten Tempo kam nun die Not der frühen Nachkriegszeit zurück. Denn die große ökonomische Krise, die mit dem New Yorker Börsencrash in Folge einer Spekulationsblase auf dem völlig überhitzten amerikanischen Aktienmarkt begann und den Kollaps der internationalen Aktienmärkte nach sich zog, traf Deutschland wegen seiner vielen Kredite aus den Vereinigten Staaten besonders hart. Amerikanisches Geld wurde abgezogen, was für unzählige Unternehmen den Bankrott bedeutete und den Zusammenbruch großer Banken nach sich zog.
Die Antwort der Reichsregierung unter ihrem Präsidialkanzler Heinrich Brüning war die Deflation, die er durch eine konsequente Haushaltssanierung und staatlich verordnete Niedriglöhne und Preissenkungen herbeiführen wollte. Deutschland sollte sich gesundschrumpfen, um auf dem Weltmarkt konkurrenzfähiger zu werden. Außerdem glaubte Brüning, durch diese Wirtschaftspolitik die Reparationszahlungen ad absurdum führen zu können, denn der völlige Zusammenbruch Deutschlands konnte nicht im Interesse der Weltwirtschaft liegen. Die große Krise bot demnach auch Chancen, an der labilen Ordnung von Versailles zu rütteln. Während die Reichsregierung also ein Ende der Reparationen sowie eine formale militärische Gleichberechtigung Deutschlands anstrebte, ging die Reichswehrführung weiter. Sie wollte die geheime Aufrüstung in eine offene umgewandelt wissen. Die deutsche Außenpolitik blieb bei alldem nicht ohne Erfolg. Vom Kabinett Papen wurde auf der Lausanner Konferenz im Juni/Juli 1932 dann tatsächlich ein faktisches Ende der Reparationen erreicht. Doch der Preis für die Politik der Reichsregierungen sollte sich als zu hoch erweisen.
Die Arbeitslosigkeit stieg in Deutschland von 1,9 Millionen im Sommer 1929 auf 6,14 Millionen im Februar 1932. Endlose Schlangen vor den Arbeitsämtern, in denen die «Stempler» für ihre nicht einmal zum Überleben ausreichende Arbeitslosenunterstützung anstanden, prägten das Bild der deutschen Städte. Die damit einhergehende Not entfachte eine gewaltige soziale Sprengkraft und radikalisierte die politische Auseinandersetzung. Die Schuld an der Lage wurde jetzt nicht mehr so sehr einzelnen Parteien und den schnell wechselnden Regierungen gegeben, sondern vor allem dem «System» als solchem. Es erwies sich in den Augen vieler als unfähig, mit den Herausforderungen der Zeit fertig zu werden. Der Ruf nach dem Neuen, nach dem Rückwärts, wurde laut. Das hatte die schon fast vergessene NSDAP unter Hitler, die bei den Reichstagswahlen vom Mai 1928 gerade einmal 2,6 Prozent der Stimmen erhalten hatte, mit einem Schlag in die Sphären der Macht katapultiert. Bei den Septemberwahlen des Jahres 1930 erhielt sie vor den Kommunisten, die auf 13,1 Prozent kamen, sensationelle 18,3 Prozent und stellte damit hinter der SPD (24,5 Prozent) die zweitstärkste politische Kraft im Deutschen Reichstag.
Was war geschehen, hatte doch die frühe Hitler-Partei aus der Krise der Anfangsjahre der Republik so gut wie kein Kapital schlagen können? Warum konnte sie es jetzt? Freilich, die NSDAP, die von Hitler nach seiner Entlassung aus der Haft neu gegründet worden war, hatte eine moderne Parteiorganisation erhalten. Sie bediente sich neuer Propagandamethoden und -mittel wie etwa des Rundfunks. Und sie sollte bald gebetsmühlenartig hervorheben, legal die Macht erobern zu wollen. Doch da war noch etwas, etwas, das entscheidend war: Hitler hatte nämlich begriffen, dass mit seiner geradezu manischen rassenideologischen Obsession kein Staat zu machen war. Er hatte verstanden, dass er mit seinem «Herrschaftswissen» nicht die breiten, aus seiner Sicht dumpfen Volksmassen für sich und seine Partei würde mobilisieren können.
Im zweiten Band von «Mein Kampf», der im Dezember 1926 und damit knapp eineinhalb Jahre nach dem ersten erschien, war von Hitler einmal mehr die Gefahr einer jüdischen Weltverschwörung umrissen worden. «Die Gedankengänge des Judentums» – so schrieb er – «sind dabei klar. Die Bolschewisierung Deutschlands, d.h. die Ausrottung der nationalen, völkischen deutschen Intelligenz und die dadurch ermöglichte Auspressung der deutschen Arbeitskraft im Joche der jüdischen Weltfinanz, ist nur als Vorspiel gedacht für die Weiterverbreitung der jüdischen Welteroberungstendenz. Wie so oft in der Geschichte, ist in dem gewaltigen Ringen Deutschland der große Drehpunkt. Werden unser Volk und unser Staat das Opfer dieser blut- und geldgierigen jüdischen Völkertyrannen, so sinkt die ganze Erde in die Umstrickung dieses Polypen (…).»[*] Im Sommer 1928 skizzierte Hitler die sich daraus ergebenden konkreten Folgerungen seiner künftigen Politik und Kriegführung in einem zweiten, nicht veröffentlichten Buch, in dem die Vernichtung des bolschewistischen Russland und die Freundschaft mit Großbritannien im Mittelpunkt stehen.
Von einer «jüdischen Weltverschwörung» und den daraus zu ziehenden Konsequenzen sprach Hitler bei seinen öffentlichen Auftritten seit 1927/28 deshalb nicht mehr so häufig. Wenn er die Juden attackierte, geschah dies nur noch mit knappen Seitenhieben und Anspielungen. Und was die NSDAP anlangte, so hing die antisemitische Agitation von der jeweiligen Einstellung von Hitlers Satrapen ab. Anders als Julius Streicher in Franken oder Robert Ley im Rheinland standen Gauleiter wie Wilhelm Murr in Württemberg oder Albert Krebs in Hamburg dem Antisemitismus doch recht indifferent gegenüber. Die norddeutsche Fraktion in der NSDAP um die Gebrüder Otto und Gregor Strasser etwa hielt von einem «kollektiven» Antisemitismus nichts und eine «jüdische Weltverschwörung» für baren Unsinn. Selbst der «Centralverein deutscher Bürger jüdischen Glaubens» konnte 1932 nach Auswertung des braunen Schriftguts zwar viel Antisemitismus – besonders in Bereichen und Gruppen, die sich von jüdischer Konkurrenz bedroht sahen – ausmachen, wollte aber, welche Ironie der Geschichte, der NSDAP keine klare antisemitische Linie nachweisen.
Überhaupt war das Erscheinungsbild der Hitler-Partei jetzt so vielgestaltig, dass eine eindeutige ideologische Festlegung für die Zeitgenossen nahezu unmöglich war. Der norddeutsche Strasser-Flügel stand eher links, während man Hitler und die süddeutsche Partei eher rechts verortete. Joseph Goebbels, der Berliner Gauleiter, hielt diese Flügel durch seine hündische Ergebenheit gegenüber Hitler und seiner eher linken Grundhaltung lange zusammen. Die Agitation der Gesamtpartei richtete sich entsprechend in populistischer Weise gegen fast alles: gegen das Weimarer System, das Versailles ermöglicht habe, gegen die «System-Parteien», gegen Konservative, Liberale, Sozialdemokraten und vor allem gegen die Kommunisten und ihre Moskauer Hintermänner. Was die Ziele der NSDAP und ihres Führers anlangte, so schienen sich diese – einmal abgesehen von der Revision von Versailles – doch sehr im Verschwommenen zu bewegen, so wie es Populisten und Protestparteien eben eigen ist.
Hitler, dessen NSDAP bei den Reichstagswahlen im Juli 1932 auf 37,4 Prozent der Stimmen kam und damit zur stärksten Partei aufstieg, wurde somit in der Wahrnehmung der Deutschen zu einem Politiker, der anders als die «System-Politiker» die Dinge beim Namen nannte. Er schien damit der Mann für Millionen notleidende Arbeits- und Perspektivlose aus dem gesamten Wählerspektrum zu sein, die sich nach einem handlungsfähigen Staat sehnten, der die große Wirtschaftskrise meistern würde im Gegensatz zu einer Regierung, die ob der Frage nach einer Erhöhung der Arbeitslosenbeiträge um Pfennige zerbrach. Er war auch der Mann jener Millionen Deutschen, die in den abgetretenen oder von den Siegern des Weltkriegs besetzten Gebieten lebten und die nur ihm zutrauten, dass er sie «heim in Reich» holen würde. Und er war vor allem der Mann für all jene, die noch in der autoritären Gesellschaft der Kaiserzeit zu Hause waren und mit der Vielgestaltigkeit der Republik nichts anfangen konnten und sich nach Ordnung sehnten. Dies war umso mehr der Fall, da die bürgerkriegsähnlichen Zustände der frühen Jahre zurückgekehrt waren und Schießereien und politisch motivierte Morde zum Alltag in den deutschen Großstädten gehörten.
Stalins KPD hatte den Kampf gegen die Republik in vollem Umfange aufgenommen. Dies war vor allem ein Kampf gegen die SPD, der unter dem Signum des Sozialfaschismus geführt wurde. Die Partei, die Deutschland gegen die von Moskau unterstützten kommunistischen Umsturzversuche in die Demokratie geführt hatte, galt als «Hauptorganisator einer kapitalistischen antisowjetischen Einheitsfront»[*]. Um die Republik zu destabilisieren, schreckte man nicht einmal vor nationalistischen Tönen und partiellen Bündnissen mit der Hitler-Partei zurück, wie beim Streik der Berliner Verkehrsbetriebe. Jede auf «Revolutionierung» ausgerichtete Position brächte nur Vorteile für diejenigen, die einen Bruch mit der Sowjetunion wünschten, lautete die Vorgabe Stalins.
Die KPD, die am Ende der Weimarer Republik 16,9 Prozent der Stimmen erreichte, wurde von den übrigen Parteien als die «Fünfte Kolonne» Moskaus angesehen. Sie war die Partei einer fremden Macht, anders als die NSDAP. Im Bürgertum führte das dazu, dass die dort schon fast manischen Ängste vor dem Bolschewismus von neuem erwachten. Es war letztendlich das Szenario der frühen Nachkriegszeit. Nur gab es nun mit der Hitler-Partei einen neuen Mitspieler. Und so wie die Sozialdemokraten auf die Freikorps zurückgegriffen hatten, um die parlamentarische Demokratie zu retten, so spukte es nunmehr in manchem konservativen Politikerhirn herum, mit Hilfe der Hitler-Partei dieser Republik und damit auch den Kommunisten ein Ende zu bereiten. Dies schien umso angebrachter, da seit den Präsidial-Kabinetten Brünings ein Regieren ohnehin nur noch mit den Notverordnungen des Reichspräsidenten möglich war.
Dass einige maßgebliche Konservative dachten, Hitler benutzen zu können, hing dann mit einer groben Fehleinschätzung zusammen – der wohl folgenschwersten in der Weltgeschichte. Verächtlich sprach Hindenburg von dem «böhmischen Gefreiten». Säße er erst einmal an der Tafel der Mächtigen, wäre mit den Insignien und Privilegien der Macht ausgestattet, dann wäre es rasch vorbei mit seinem aufwieglerischen Revoluzzertum, wurde angenommen. Man maß ihn also mit eigenen Maßstäben, von oben herab, arrogant und ebenso ignorant. Außerdem wolle man ihn ja in einem Kabinett der «nationalen Konzentration» «einrahmen», wie Franz von Papen es gesagt hatte, der Exreichskanzler und Wortführer jener, die Hitler und seine Partei instrumentalisieren wollten.
So wie später die Appeasement-Politiker, so glaubten viele Konservative irrtümlich, Hitler verfolge – etwas aggressiver und gröber – die gleichen Ziele wie sie selbst, also eine Außenpolitik zur Revision von Versailles und damit der Wiedererrichtung der alten Stärke Deutschlands. Dabei hätten auch die «Barone» um die wahre Intention Hitlers wissen können. Doch das, was dieser in «Mein Kampf» zu Papier gebracht hatte, nahm niemand ernst. Wie hätte es auch jemand ernst nehmen können, wenn dort zum Beispiel davon die Rede war, dass im Falle eines Sieges «des Juden» mit «Hilfe seines marxistischen Glaubensbekenntnisses» über die Völker dieser Welt dessen «Krone der Totenkranz der Menschheit» sein würde und «dieser Planet wieder wie einst vor Jahrmillionen menschenleer durch den Äther ziehen» würde[*]. Solches schien einfach zu bizarr. So führte die Lektüre des rassenideologischen Irrsinns und das Szenario von der «jüdischen Weltverschwörung» bei denen, die Hitler benutzen wollten, bestenfalls zu einem milden Lächeln, sofern man es überhaupt gelesen hatte, was für die allermeisten ohnehin nicht zutraf. Und dass er Antisemit war, irritierte niemand, denn davon gab es viele in Deutschland, in Europa und in der Welt, nicht zuletzt auch seit der Weltwirtschaftskrise.
Das Kabinett der «nationalen Erneuerung». Sitzend (v.l.): Göring, Hitler und von Papen. Die Barone glaubten, ihn «einrahmen» zu können.
So erhielt Hitler am 30. Januar 1933 seine Ernennungsurkunde als Reichskanzler, nachdem dem greisen und auch ein wenig senilen Reichspräsidenten seine Abneigung gegen den Mannschaftsdienstgrad ausgeredet worden war. Es war dann auch keine Machtübernahme, sondern eine Machtübergabe an einen Parteiführer, der seinen Zenit bereits überschritten zu haben schien, wie die zwei Millionen verlorenen Stimmen bei der Reichstagswahl des Novembers 1932 verdeutlichten. Wenn man Hitler dennoch zum Reichskanzler machte, dann, weil die letzten Hemmungen einer konservativen Clique gefallen waren, nun mit seiner Hilfe einen Staat nach ihren Vorstellungen zu schaffen. Und es schien zunächst, als würde er dem gerecht werden, stellte er sich doch beflissen, wie etwa beim Tag von Potsdam, in eine Kontinuität deutscher Tradition – in eine Reihe mit Friedrich dem Großen, Bismarck und Wilhelm II. Alles war ein grandioser Schwindel eines Besessenen, der sämtliche Mittel für legitim hielt, sein Ziel zu erreichen, eines Besessenen, der sich außerhalb jeglicher Normen bewegte. Von einer historischen Zwangsläufigkeit infolge der Urkatastrophe Erster Weltkrieg kann keine Rede sein, auch wenn in dessen Folgen der Urgrund seiner wahnwitzigen rassenideologischen Weltanschauung liegt.
II.Der Weg in den europäischen Krieg
Januar 1933 bis September 1939
Es ist Frieden für unsere Zeit.
Neville Chamberlain, 30. September 1938
Als Hitler am 30. Januar 1933 an die Macht gelangte, war ein weiterer Weltkrieg determiniert. Wenn seine Gegner jetzt davon sprachen, dass der neue Reichskanzler Krieg bedeute, meinten sie allerdings einen ganz anderen Krieg. Sie dachten dabei nicht an jenen rassenideologisch motivierten Kampf gegen das Weltjudentum und seine Exponenten, den Hitler zielstrebig anging. Wenn dieser jetzt die Kommunisten verfolgen ließ, dann war das in der öffentlichen Wahrnehmung und in der seiner Partner eben nicht ein allererster Schritt zur Realisierung eines großen Plans, sondern «nur» die Abrechnung mit dem schärfsten politischen Gegner. Der Boykott der jüdischen Geschäfte im April 1933 und die beginnende Entfernung der Juden aus dem Staatsdienst, die von Teilen der Bevölkerung mit Schadenfreude aufgenommen wurde und manch niedrigen Instinkt bediente, wurde als Zurückdrängung des jüdischen Einflusses in Deutschland gesehen. Selbst viele Juden glaubten trotz aller Besorgnis, dies sei nur eine neue Welle des Antisemitismus, die auch wieder vorübergehen würde.
In der politischen Landschaft war die Sicht auf Hitler sehr unterschiedlich. Für die äußerste Linke stand er für die Errichtung