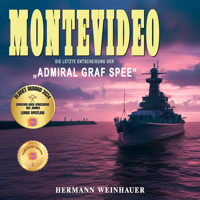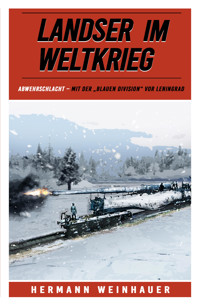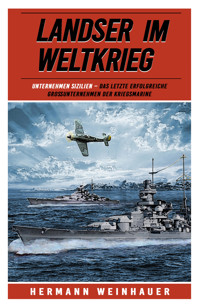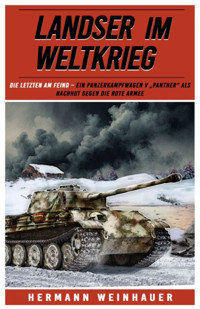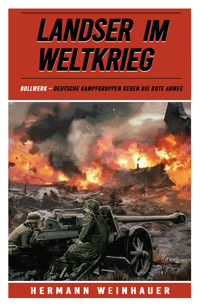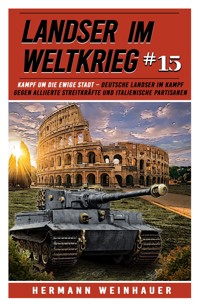
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EK-2 Militär
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Fesselnde Landser-Geschichten in Romanheft-Länge
Der vorliegende Band „Kampf um die Ewige Stadt” lässt Sie in die Schlacht um Rom eintauchen. Die wenigen deutschen Divisionen müssen sich einem an Material und Menschen weit überlegenen Feind und einem hinterhältigen Gegner in Gestalt von italienischen Partisanen stellen. Erleben Sie durch die Augen des Ostfront-Veteranen Leutnant Sanders und des erfahrenen Panzerkommandanten Oberleutnant Moldenmann mit seinen Tiger-Panzern die schicksalsschweren Stunden im Kampf um die italienische Hauptstadt.
Wird es den erschöpften deutschen Landsern gelingen, sich der gegnerischen Übermacht zu erwehren?Über die Reihe „Landser im Weltkrieg“
„Landser im Weltkrieg“ erzählt fiktionale Geschichten vor historischem Hintergrund realer Schlachten und Ereignisse im Zweiten Weltkrieg. Im Zentrum stehen die Erlebnisse deutscher Landser fernab der großen Strategien am grünen Tisch.Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Hermann Weinhauer
Landser im Weltkrieg 15
Kampf um die Ewige Stadt – Deutsche Landser im Kampf gegen alliierte Streitkräfte und italienische Partisanen
EK-2 Militär
Über die Reihe Landser im Weltkrieg
Jeder Band dieser Romanreihe erzählt eine fiktionale Geschichte, die vor dem Hintergrund realer Ereignisse und Schlachten im Zweiten Weltkrieg spielt. Im Zentrum der Geschichte steht das Schicksal deutscher Soldaten.
Wir lehnen Krieg und Gewalt ab. Kriege im Allgemeinen und der Zweite Weltkrieg im Besonderen haben unsägliches Leid über Millionen von Menschen gebracht.
Deutsche Soldaten beteiligten sich im Zweiten Weltkrieg an fürchterlichen Verbrechen. Deutsche Soldaten waren aber auch Opfer und Leittragende dieses Konfliktes. Längst nicht jeder ist als glühender Nationalsozialist und Anhänger des Hitler-Regimes in den Kampf gezogen – im Gegenteil hätten Millionen von Deutschen gerne auf die Entbehrungen, den Hunger, die Angst und die seelischen und körperlichen Wunden verzichtet. Sie wünschten sich ein »normales« Leben, einen zivilen Beruf, eine Familie, statt an den Kriegsfronten ums Überleben kämpfen zu müssen. Die Grenzerfahrung des Krieges war für die Erlebnisgeneration epochal und letztlich zog die Mehrheit ihre Motivation aus dem Glauben, durch ihren Einsatz Freunde, Familie und Heimat zu schützen.
Prof. Dr. Sönke Neitzel bescheinigt den deutschen Streitkräften in seinem Buch »Deutsche Krieger« einen bemerkenswerten Zusammenhalt, der bis zum Untergang 1945 weitgehend aufrechterhalten werden konnte. Anhänger des Regimes als auch politisch Indifferente und Gegner der NS-Politik wurden im Kampf zu Schicksalsgemeinschaften zusammengeschweißt. Genau diese Schicksalsgemeinschaften nimmt »Landser im Weltkrieg« in den Blick.
Bei den Romanen aus dieser Reihe handelt es sich um gut recherchierte Werke der Unterhaltungsliteratur, mit denen wir uns der Lebenswirklichkeit des Landsers an der Front annähern. Auf diese Weise gelingt es uns hoffentlich, die Weltkriegsgeneration besser zu verstehen und aus ihren Fehlern, aber auch aus ihrer Erfahrung zu lernen.
Nun wünschen wir Ihnen viel Lesevergnügen mit dem vorliegenden Werk.
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!
Liebe Leser, liebe Leserinnen,
zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein kleines Familienunternehmen aus Duisburg und freuen uns riesig über jeden einzelnen Verkauf!
Unser wichtigstes Anliegen ist es, Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis zu bieten.
Damit uns dies gelingt, sind wir sehr an Ihrer Meinung interessiert. Haben Sie Anregungen für uns? Verbesserungsvorschläge? Kritik?
Schreiben Sie uns gerne: [email protected]
Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!
Heiko und Jill von EK-2 Militär
Kampf um die Ewige Stadt
Die Sonne brennt mit erbarmungsloser Glut vom Himmel herunter.
Der Himmel leuchtet in einem strahlenden Blau über der Ewigen Stadt.
Die dunklen Bänder der Straßen, die sich durch die Hauptstadt Italiens schlängeln, flimmern vor Hitze.
Die mittägliche Stille über Rom macht hörbar, wonach viele sich seit langem sehnen und wovor viele sich ebenso lange gefürchtet haben.
Von Süden her, vom Colli Albano, von der päpstlichen Sommerresidenz Castelgandolfo, dringt ein dumpfes, noch fernes Wummern und Dröhnen an das Ohr jedes aufmerksam Lauschenden.
Vom alliierten Landekopf Anzio-Nettuno her nähert sich der Krieg.
Besonders sensible Ohren vermeinen schon von der Via Appia und der Via Casilina her das quietschende Rattern von Panzerketten zu hören.
In einer Straße nicht weit vom Colosseum, der antiken Stätte der Zirkusspiele und Christenmorde, hält ein deutscher VW Kübelwagen.
Er ist schmutzig und staubbedeckt, aber das ist kaum zu sehen, denn der stumpfe Lack des Fahrzeuges hat ohnehin die gleiche Farbe.
Leutnant Sanders macht sich nicht erst die Mühe, die Tür des offenen Wagens aufzustoßen. Mit den Händen an der hochgeklappten Windschutzscheibe, schwingt er seine langen Beine nach draußen auf den breiten Bürgersteig.
Die Straße wirkt wie ausgestorben.
Der Leutnant zuckt zusammen, als seine Füße auf dem Bürgersteig aufkommen. Mit einem unterdrückten Fluch fasst er nach seinem linken Knie. Nachdem er sich aufgerichtet hat, angelt er nach dem als Krücke genutzten Wolchow-Knüppel, der an die Wolchow-Kämpfe in Russland erinnert. Er hängt zwischen der Beifahrertür und der Windschutzscheibe in einer Halterung, die eigentlich für einen Karabiner bestimmt ist.
„Fahren Sie einstweilen zur Dienststelle des Militärbefehlshabers Rom“, sagt er mit schmerzverzerrtem Gesicht zu seinem Fahrer. „Ich komme zu Fuß nach. Ist ja nicht mehr weit. Aber erst muss ich mal was Kaltes trinken.“
Der Gefreite sieht den jungen Leutnant mit väterlichem Kopfschütteln an.
„Menschenskind!“, sagt er sehr unmilitärisch. „Das ist doch viel zu gefährlich, Herr Leutnant. Sie können doch nicht allein in Rom herumspazieren!“
Der Leutnant hebt mit einer abwehrenden Bewegung den Knüppel.
„Ach, was“, sagt er gleichgültig. „Mir tut schon keiner was. Warum denn auch?“
„Ich bitte Sie, Herr Leutnant. Sie kommen von der Ostfront. Sie kennen das hier nicht. In Russland die Partisanen…“
„Die waren so zahlreich wie die Läuse!“, ergänzt Leutnant Sanders. „Aber nicht am helllichten Tage mitten in einer Großstadt und noch dazu in der Hauptstadt des christlichen Abendlandes, Verehrtester!“
„Du lieber Himmel!“, sagt der Gefreite, dem der Leutnant sympathisch ist, obwohl er ihn heute Morgen erst kennengelernt hat. „Hier sind seit dem vergangenen Jahr schon die tollsten Sachen passiert, auch bei hellstem Sonnenschein!“
„Schon gut“, sagt der Leutnant.
Er hebt noch einmal den Krückstock zum Gruß, dann humpelt er zu dem Ristorante, dessen Anblick ihn veranlasst hat, den Volkswagen anhalten zu lassen.
Er glaubt schon zu wissen, was der Fahrer meint. Sicher war seit dem vergangenen Jahr, nachdem der italienische Staatschef Mussolini auf Befehl des Königs verhaftet worden war und bald darauf Italien unter der Führung des Marschalls Badoglio dem bisherigen Bundesgenossen Deutschland den Krieg erklärt hatte, viel passiert. Aber zugleich war es auch so, dass diese Partisanen kaum gegen Deutsche kämpften. Sie brachten bisher meist italienische Faschisten um und bekämpften sich auch gegenseitig, weil jede Gruppe hoffte, nach dem Sieg der Alliierten selbst die Macht in Italien übernehmen zu können. Der Kampf gegen die deutsche Wehrmacht war dazu nicht notwendig, denn den führten die alliierten Truppen.
Leutnant Sanders lächelt noch leicht über die Besorgnis seines Fahrers, als er das Ristorante betritt, das er noch von einem Studienurlaub vor dem Krieg her kennt.
Nein, von Partisanen hat er nichts zu befürchten und schon gar nicht hier in Rom – glaubt er.
Doch wenn er gewusst hätte, was sich im Land und in der Stadt bereits abspielt, hätte es ihn wohl zu einer vorsichtigeren Lageeinschätzung bewogen.
Aber er ahnt von alldem nichts, als er aufatmend die glutheiße Straße verlässt und den schattigen, kühlen Raum des Ristorante betritt. Eine blaue Wolke aus Zigarettenrauch schlägt ihm entgegen.
Als der deutsche Leutnant die Tür hinter sich schließt und den ersten Schritt in den Raum hineingeht, verstummt mit einem Schlag das temperamentvolle Stimmengewirr, das eben noch den Raum beherrscht hatte.
Das plötzliche Schweigen wirkt so kühl wie die Temperatur in der kleinen Gaststätte.
Sanders entgeht die feindselige Stimmung nicht. Aber er lässt sich nichts anmerken und geht mit ruhigen Schritten bis zur Theke.
Der Wirt sieht ihn nicht an, als Sanders einen Campari Soda mit Eis bestellt.
„Uno momento, signore“, murmelt er nur und widmet sich weiter seinen anderen Gästen.
Der eine Moment ist nun schon zu vollen fünf Minuten angewachsen, bis der Leutnant sich mit seiner Bestellung noch einmal meldet, da der italienische Wirt keine Anstalten macht, den fremden Gast zu bedienen.
Der Wirt sieht Leutnant Sanders mit hochgezogenen Augenbrauen an, als staune er darüber, dass plötzlich ein Fremder vor ihm steht. Er bedient erst noch zwei weitere Gäste, die weit nach Sanders bestellt hatten, bevor er dem Offizier endlich mit mürrischem Gesicht das gefüllte Glas über die Theke schiebt.
Sanders findet den geforderten Preis unverschämt hoch, aber er bezahlt sofort und ohne zu reklamieren. Im gleichen Augenblick wird die bisher nur geflüsterte Unterhaltung wieder so natürlich laut, wie sie vor dem Eintreten des Leutnants war.
Sanders tut so, als ob er die Flaschen im Regal hinter der Bar interessiert betrachtet. Die bunten Etiketten erinnern ihn daran, dass er als Junge etwas Ähnliches gesammelt hatte: Aufkleber von Streichholzschachteln, Zigarettenbilder. Er muss lächeln, als er daran denkt.
Jemandem scheint sein Lächeln jedoch sehr zu missfallen.
„Porcho bacco di nazi!“, brüllt eine betrunkene Stimme von irgendwo aus dem rauchgeschwängerten Hintergrund.Sanders versteht Italienisch. Es ist klar, dass nur er mit dem verdammten Nazischwein gemeint sein kann.
Aber er reagiert nicht. Sollen die Anwesenden ruhig glauben, dass er nichts von ihren Unterhaltungen verstehe.
Der Wirt sieht ihn unter gesenkten Lidern hervor an.
Sanders hat ihn gleich wiedererkannt. Es ist noch der gleiche Wirt wie damals in glücklicheren Zeiten.
„Ob er mich wohl auch wiedererkannt hat?“, überlegt der junge Leutnant.
Immerhin war Sanders ja für ihn nur einer von vielen vielleicht tausend Touristen, die im Lauf der Jahre bei ihm zu Gast gewesen waren. Allerdings hatte der Student Hans Sanders auch zwei Wochen in einem der drei kleinen Gästezimmer über dem Ristorante gewohnt.
„He, Emilio! Gib dem Tedesco nichts mehr. Der soll gefälligst Bier saufen!“, brüllt eine andere Stimme jetzt dem Wirt zu.
Die Menge grölt.
Sanders dreht sich um und lächelt die Gäste an, als hält er in Unkenntnis der Sprache das Ganze für einen freundlichen Witz. Danach sieht er den Wirt wieder an. Sein Lächeln wird dabei etwas härter.
„Buon giorno, signor Maletti.“
Er spricht laut genug, dass auch andere Gäste ihn hören können und als es allmählich wieder still wird, spricht er weiter auf Italienisch.
„Das mit dem Bier ist eine gute Idee. Haben Sie welches, signore Maletti? Vor sechs Jahren hat es mir bei Ihnen ausgezeichnet geschmeckt, primissima!“
Emilio Maletti sieht ihn nun mit weitgeöffneten Augen an. Dann schimmert ein Hauch von Erinnerung in seinen Augen.
„Maledetto, oh, madonna mia! Signor – ähm, signor Sanders? Il studioso?“
„Si, si!“, bestätigt Sanders.
Ein strahlendes Lächeln breitet sich über Malettis dickem Rotweingesicht aus. Es ist zu sehen, dass dieses Lächeln echt ist und von Herzen kommt. Die fleischige, kurze Hand knallt auf die Theke, so dass die Gläser klirren.
„Silencio, silencio!“, schreit Maletti nun seine Gäste an, obwohl die schon längst still sind. „Il tedesco…“, er blickt schnell auf die Schulterstücke, um den Rang Sanders festzustellen, „il tedesco tenente, der deutsche Leutnant ist ein guter Freund von mir, capito? Und er ist hier Gast genau wie ihr. Verstanden?“
Bevor noch irgendjemand zu dieser Erklärung Malettis Missfallen oder Zustimmung äußern kann, öffnet sich die Eingangstür zur Straße.
Leutnant Sanders und die anderen Gäste Emilio Malettis sehen im Türrahmen die Gestalt einer jungen Frau, die sich wie in einem Schattenspiel gegen das glühend heiße Sonnenlicht auf der Straße abhebt.
Die Tür schlägt wieder zu.
Für einen Moment ist die junge Frau vor der nun verschlossenen Tür nicht mehr zu sehen, so sehr hat das Straßenlicht die Gäste des Ristorante geblendet.
Der Frau scheint es in dem kühlen Schatten des Gastraumes ebenso zu gehen. Sie zögert eine ganze Weile, bis sie auf die Theke zugeht.
„Buon giorno, Emilio“, sagt sie mit aufgeregter Stimme zum Wirt.
Sie atmet schwer.
Dann erst fällt ihr Blick auf die Uniform des Mannes, der neben ihr steht. Verblüfft tritt sie wieder einen Schritt zurück, als sie den deutschen Offizier erkennt. Sie scheint zutiefst erschrocken.
Doch dann hat sie sich wieder gefasst.
In der Annahme, der Deutsche würde sie sowieso nicht verstehen, sagt sie laut: „Ich werde verfolgt! Schnell, helft mir! Faschistische Milizen und deutsche Polizei!“
Die junge Frau starrt die Männer an. Doch niemand rührt sich. Eine lähmende Wand aus tödlicher Stille liegt zwischen ihr und den anderen Gästen.
Der Wirt erfasst die Situation als erster richtig. Er schiebt seinen dicken Bauch eilends um die Theke, fasst das Mädchen am Arm, zerrt sie durch den Raum zu einer Tür im Hintergrund.
Er reißt die Tür auf und schiebt die junge Frau hinaus auf den Hausflur.
„Schnell, die Treppe hinauf!“, zischt er ihr noch zu.
Als auf der Straße vor dem Ristorante laute Stiefelschritte zu hören sind, steht er bereits wieder mit gleichgültigem Gesicht hinter der Theke.
Aber der Blick, mit dem er nun wieder unter den halbgeschlossenen Augenlidern hervor Leutnant Sanders mustert, ist misstrauischer geworden.
Sanders sieht ihm an, was er denkt.
Der Deutsche war hier vor Jahren ein lieber und netter Gast gewesen, aber jetzt ist Krieg. Der Student von damals ist nun Offizier. Was würde er nun tun?
Sanders hebt seinen Wolchow-Knüppel und legt ihn quer vor sich auf die Theke. Diese Geste ist mehr als zweideutig. Sie kann ebenso gut als Bereitschaft gegen einen Angriff der italienischen Gäste wie als Bereitschaft zur Neutralität gedeutet werden.
Wieder fällt ein dicker Balken glühend goldenen Sonnenlichtes in den Raum.
Schwarze und graue Stahlhelme, Läufe von Maschinenpistolen und Gewehrläufe schimmern matt im hellen Schein des Tages von der Tür her – Macht verkörpernd und tödlich drohend.
Der Führer der Streife aus faschistischer Miliz und deutscher Polizei ist ein Hauptwachtmeister der deutschen Ordnungspolizei. Der silberne Hoheitsadler im silbernen Eichenlauboval am linken Ärmel glänzt hell auf, als er sich bewegt.
„Alles bleibt auf den Plätzen!“, befiehlt er in mühsamem Italienisch.
„Wer sich bewegt, wird erschossen!“
Dann fällt sein Blick auf den deutschen Offizier an der Theke. Er hebt den rechten Arm.
„Heil, Herr Leutnant!“
Er zieht die Augenbrauen verwundert hoch.
„Was machen Sie denn hier?“
Leutnant Sanders hebt uninteressiert die Schultern.
„Campari trinken. Ich habe Durst.“
Der Hauptwachtmeister macht eine befehlende Handbewegung.
Die zu seiner Streife gehörenden beiden anderen deutschen Polizisten und die drei faschistischen Milizionäre verteilen sich an der Wand links und rechts von der Eingangstür.
„Darf ich um Ihr Soldbuch bitten und um Ihren Marschbefehl, Herr Leutnant?“, fragt der Ordnungspolizist in strengem Ton.
„Bitte, selbstverständlich“, meint Sanders.Er weiß, dass in Rom nicht nur Feldgendarmerie, Geheime Feldpolizei oder Offiziersstreifen der deutschen Wehrmacht das Recht haben, deutsche Soldaten und Offiziere zu kontrollieren, sondern auch die Polizei. Die italienische Hauptstadt ist verbotenes Gebiet für deutsche Soldaten, da die deutsche Führung über das Internationale Rote Kreuz bemüht ist, Rom zur offenen Stadt erklären zu lassen.
Um alliierten Generalen und Politikern entgegenzutreten, die Europas alte Kulturstädte verächtlich als postcard plunder bezeichnen, dürfen deutsche Soldaten Rom, die Hauptstadt der Christen, nur aus besonders wichtigen Gründen betreten, die aber nichts mit ihrem unmittelbaren militärischen Einsatz zu tun haben dürfen.
Die Papiere des Leutnants rascheln in den Händen des Hauptwachtmeisters. Mit geübter Geschwindigkeit blättern die Finger des Polizisten, gleiten seine Augen über die Seiten.
Als er den Marschplan überfliegt, in dem zu lesen ist, dass Leutnant Hans Sanders zu einer Nachuntersuchung seiner schweren Beinverletzung in das Hauptlazarett von Rom befohlen ist, hebt er den Blick. Er mustert die Auszeichnungen, sieht den Wolchow-Knüppel, der noch auf der Theke liegt. Dann reicht er die Papiere zurück.
Er nimmt Haltung an.
„Danke, Herr Leutnant!“
Der Hauptwachtmeister zögert einen Augenblick.
Dann setzt er hinzu: „Sie sollten sich lieber nicht allein in ein Ristorante wagen!“
Seine Stimme wird etwas leiser, so dass ihn nur der Leutnant verstehen kann.
„Die Front soll schon zusammengebrochen sein. Angeblich stehen die Amis mit ihren Panzern schon zehn Kilometer vor dem südlichen Stadtrand. Wird nicht lange dauern, dann ist hier in Rom die Hölle los – Partisanen, Sie verstehen? Also Vorsicht, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist.“
Er hebt wieder die rechte Hand, grüßt und wendet sich ab.
Was der Ordnungspolizist andeutet, ist tatsächlich bittere Realität. Der deutsche Widerstand vor der Ewigen Stadt ist schwach, beinahe nicht vorhanden. Denn die deutsche Führung hat sich bereits dazu entschieden, Rom kampflos zu räumen.
Umso heftiger wird jedoch ostwärts der italienischen Hauptstadt gekämpft, um den zurückgehenden deutschen Truppen den Marsch bis zu den vorbereiteten Auffangstellungen zu ermöglichen.
Auch Oberleutnant Moldenmann, ein erfahrener Panzersoldat, befindet sich mit seinen Kampfwagen auf dem Rückmarsch. Der Oberleutnant steht im Turm und hebt das Zeiss-Glas an die Augen.
Die beiden Kreise, die von der Optik des Glases aus dem Ufer des Flusses herausgeschnitten werden, glänzen in der Sonne. Die schwankende Pontonbrücke direkt vor den Zeisslinsen schwankt und knarrt in den kurzen Wellen, die gegen sie schlagen.
Der Bohlenbelag der auf- und abwogenden Brücke glänzt vor nassem, schmierigem Dreck, den die Lastkraftwagenkolonnen dort hinterlassen haben, als sie vor fast zwei Stunden als letzte deutsche Einheit das andere Ufer erreicht haben. Zumindest haben die Landser und ihre Offiziere geglaubt, die letzten Deutschen hier zu sein.
Oberleutnant Moldenmann setzt das Glas ab. Er wundert sich, dass die Pontonbrücke noch existiert. So viel Glück hat er gar nicht erwartet. Er stützt sich mit beiden Armen auf den Kranz des Turmluks seines Tiger-Panzers und gähnt laut und herzhaft. Noch nie in seinem Leben, so meint Klaus Moldenmann, war er so entsetzlich müde wie jetzt gerade.
In diesem äußersten Stadium der Müdigkeit kommt er sich vor, als sei er völlig ausgedörrt und ausgehungert. Der Staub, den er schon seit Stunden durch Mund und Nase einatmet, verklebt ihm den Rachen und hat seiner Zunge das Gefühl verschafft, als sei sie ein Kilo schwerer, dick geschwollener Sandstein.
Mit mühsamer Geste hebt Oberleutnant Moldenmann noch einmal das Glas vor die Augen. Die kreisrunden Ausschnitte der Brücke und des gegenüberliegenden Ufers flimmern für einen Moment vor seinen Augen. Er weiß, dass das nicht an der drückenden Hitze liegt, die die Luft zum Flimmern bringt, sondern an seiner eigenen Ermüdung. Es hat keinen Sinn, die Arme auf den Turmkranz aufzustützen. Das Bild wackelt nur noch mehr, weil seine Arme vor Erschöpfung zittern.
Als er die Hände mit dem Glas frei an die Augen nimmt, geht es besser – der Kopf zittert im gleichen Rhythmus, das Bild wird etwas klarer. Und nun sieht Moldenmann auch, weshalb die Pontonbrücke nicht zerstört ist, wie er eigentlich fest angenommen hatte.
An der rechten Seite sind zwei kreisrunde Stücke aus den Belagbohlen herausgebrochen und die darunter befindlichen Pontonkörper hängen rechts deutlich tiefer in das Wasser als die anderen. Und auf beiden Seiten des anderen Ufers, rechts und links von der Brückenauffahrt, sieht Moldenmann tiefe Trichter. Er erkennt, dass es sich dabei um Einschläge von kleineren Fliegerbomben handelt und nicht um Granattrichter.
Also war die deutsche Einheit, die vor ihm und seinen Panzern die Brücke als letzte passiert hat, während des Übergangs von feindlichen Jagdbombern angegriffen worden. Entweder sind die Kameraden in berechtigtem Entsetzen getürmt – froh, die gefährliche Stelle hinter sich zu haben – oder ein Kommandeur hat dem eigenen Sprengtrupp befohlen, sich in Sicherheit zu bringen, weil der Gegner anscheinend selbst dabei war, den Übergang zu zerstören.
Rücksicht auf nachfolgende Einheiten hat die Kameraden jedenfalls nicht an der Zerstörung der Brücke gehindert. Dass Moldenmann mit seinen vier Tiger-Panzern noch kommen würde, hat auch niemand wissen können.
Der Oberleutnant setzt das Glas wieder ab und spricht in das Kehlkopfmikrophon.
Der 700 PS starke Maybach-Motor des Panzerkampfwagens VI brummt laut auf. Die Laufrollen zu beiden Seiten des Panzers beginnen sich zu drehen und das Stahlungetüm über die breiten Gleisketten nach vorn zu ziehen.
Hinter dem Panzer des Oberleutnants gleiten noch drei andere Tiger aus den Büschen des südlichen Flussufers auf die Pontonbrücke zu.
Das dumpfe Bersten von Artilleriegranaten, das heisere Bellen von Maschinengewehren und das Peitschen einzelner Gewehrschüsse, das bisher in verworrener Vielfalt zu hören war, geht jetzt im Panzerlärm unter.
Moldenmann betrachtet aus zusammengekniffenen Augen misstrauisch den strahlendblauen Himmel. Im Moment ist er leer, kein Feindflugzeug ist zu sehen. Aber das hat nicht viel zu heißen. Hinter den Bergkuppen, hinter den Biegungen des Flusses können jederzeit feindliche Maschinen auftauchen und blitzschnell zuschlagen.
Oberleutnant Moldenmann entsichert das Flugabwehrmaschinengewehr, das vor ihm auf der Kreuzlafette befestigt ist, die außerhalb des Luks rund um den Turm verläuft.
Fliegerabwehr ist die unangenehme Aufgabe des Kommandanten, der als einziger der Besatzung vom Turm aus die Übersicht über den Luftraum hat.
Moldenmann gibt durch das Kehlkopfmikrophon noch einmal einen Befehl nach unten in den Kampfraum.
Der Richtschütze unter ihm zieht einen Hebel herunter. Der klotzige Verschluss der 8,8-cm-Kampfwagenkanone klappt auf. Der Ladeschütze nimmt eine Granate mit gelbem Ring aus der Halterung und schiebt sie in das Rohr.
Der Verschluss rastet klickend ein.
Die Feder hinter dem Schlagbolzen spannt sich. Als der Tiger über den ersten Ponton rumpelt, der ächzend hin und her schaukelt, ist der Panzer kampfbereit.
Im gleichen Augenblick sieht der Oberleutnant von seinem leicht schwankenden Turm die amerikanische Lightning. Sie kurvt über den Bäumen von rechts den Fluss entlang. Sie braust über ihn hinweg und steigt steil in den Himmel empor.
Danach kommt sie in steilem Sturzflug aus dem hellen Blau auf ihn zugeschossen. Und eine weitere Lightning kommt ebenfalls von rechts und danach noch eine.
Moldenmanns Tiger ist noch nicht auf der Mitte der Brücke, als eine panzerbrechende Rakete wenige Meter vor ihm in den Brückenbelag schlägt.
„Gott sei Dank kein Sprenggeschoss. Das wäre für die Brücke schlimmer gewesen!“, denkt sich der Panzeroffizier.
Doch dann sieht er, dass sein Optimismus verfrüht war. Während er in ohnmächtiger Wut hinter dem Gabelschwanzteufel her sieht und ihm einige Salven nachschickt, spürt er schon, dass sein Panzer verloren ist.
Die Rakete hat nur ein kleines Loch in die Balken gerissen, aber zugleich auch in den Pontonkörper darunter. Es ist die gleiche Stelle, deren Beschädigung Moldenmann schon vom Ufer aus gesehen hat.
Verzweifelt brüllt er in das Mikrophon: „Stopp!“
Aber es ist bereits zu spät. Der schwere Kampfwagen rutscht zur Seite, zwei oder drei Pontons sind bereits durchlöchert und tragen nun die schwere Last nicht mehr.
Die zweite Lightning stößt herunter. Wieder fährt eine Rakete in die Brücke. Einige Stücke des Belags wirbeln durch die Luft, klatschen aufs Wasser und fliegen Moldenmann um die Ohren. Ein Regen aus Schlamm und Steinen prasselt gegen den Panzerkampfwagen.
Die Brücke berstet in der Mitte auseinander. Sie reißt entzwei wie ein überdehntes Gummiband.
Der Panzer rutscht in grotesker Schräglage trotz der nun gebremsten Ketten nach vorn auf die Lücke zu.
„Raus! Aussteigen!“, schreit der Panzerkommandant.
Er sieht, wie die Brücke vor ihm immer mehr unter Wasser verschwindet, während der andere unbelastete Teil wie ein riesiges Uhrenpendel in der Strömung hin und her schwingt.
Der Panzer kippt immer mehr nach links vorn. Die Männer der Besatzung zwängen sich eilig durch die Luken ins Freie.
Oberleutnant Moldenmann sitzt noch auf dem Turmkranz, als der Tiger mit gewaltigem Gurgeln im Wasser versinkt.
Zwei, drei große Luftblasen brodeln nach oben. In einer davon taucht Moldenmann wieder auf. Er versucht vergeblich, die schwere Uniformjacke loszuwerden. Der Offizier schafft es nicht einmal, das Koppel mit der Pistole zu lösen. Er braucht beide Arme und Hände, um sich mit Schwimmbewegungen über Wasser zu halten.
Moldenmann sieht, dass sich die restlichen vier Männer seiner Besatzung an die Überreste der Brücke klammern und in einem Strudel von Balken und Pontonkörpern abgetrieben werden.
Über ihm fahren Rauchgeschosse in den blauen Himmel hinauf. Die anderen drei Tiger, die noch am Flussufer stehen, feuern auf die P-38. Es sind vier Lightnings, die jetzt in einer Kette hintereinander herabgestürzt kommen.
Der Oberleutnant sieht, wie das Wasser um ihn herum von den Einschlägen der Bordwaffen aufspritzt. In einem Moment panischer Angst will er wegtauchen. Aber dann behält die Vernunft die Oberhand. Die Explosivgeschosse wirken unter Wasser noch verheerender. Vor allem aber würde er kaum je wieder nach oben kommen, wenn er mit seiner schweren Kleidung erst einmal unter Wasser ist.
Eine Serie von Zwozentimetergranaten prasselt und trommelt mit zerschmetternder Wucht in die abtreibenden Brückenteile. Moldenmann hört Schreie, sieht, wie die Männer plötzlich verschwunden sind – sieht, dass der Wasserschwall vor ihm sich blutrot verfärbt.
Hinter ihm flammt ein greller Blitz auf. Mit Donnergetöse wird einer der tonnenschweren Panzer auseinandergerissen.
Irgendwo klatscht etwas Riesiges ins Wasser – der Turm samt Kanone des Tigers.
Oberleutnant Moldenmann schlägt wild mit den Armen und Beinen um sich, den Sog des strudelnden Wassers abwehrend.
Ein Feuerball erscheint am Himmel, Flugzeugteile regnen herab. Die beiden Panzer am Südufer feuern unentwegt weiter und haben tatsächlich eine der Lightnings erwischen können.
Dies ist das letzte, was Oberleutnant Moldenmann noch bewusst wahrnimmt. Dann hebt ihn irgendetwas hoch, eine riesige Faust presst ihm die Luft aus den Lungen und die Welt versinkt in einem grauen, nassen Wirbel.
Auf dem Buffet stehen wie zu einer Parade ausgerichtet die Flaschen mit weißem Cinzano, rotgold funkelndem Hennessy, rauchfarbenem Beute-Whisky, perlendem Champagner. Weißgekleidete Ordonanzen tragen auf Silbertabletts kaltes Huhn mit Ananas, geräucherte Salami und Hummer-Mayonnaise auf.
Leutnant Sanders schluckt. Er kommt sich vor wie in einer Filmkulisse.
Träumt er?
„Das kann doch nicht wahr sein!“, denkt er.
Er sieht sich staunend im Ärzte- und Offizierskasino des Hauptlazaretts um, das, weiß Gott, eine andere Welt als die vor Dreck und Blut starrende Front im Osten ist.
Ein junger Unterarzt bemerkt den Leutnant und winkt ihn neben sich auf einen freien Stuhl an der weiß gedeckten Tafel.