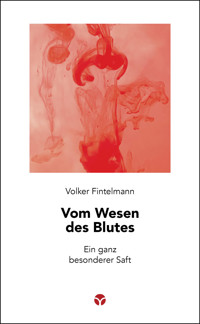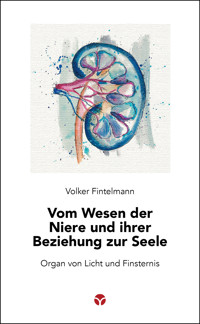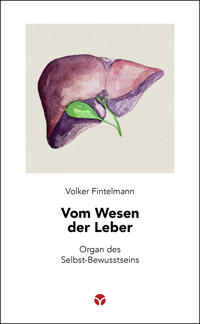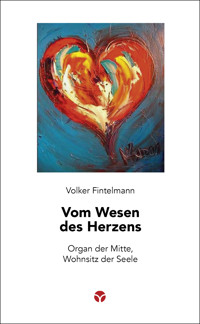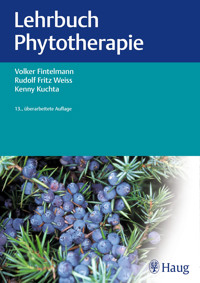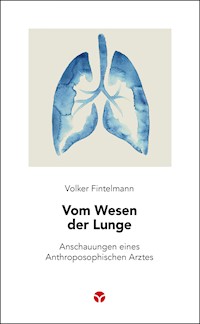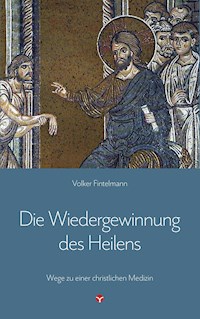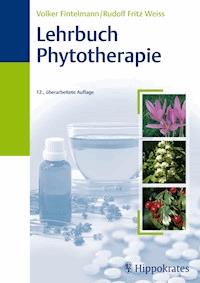
99,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl F. Haug
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Standardwerk der modernen Phytotherapie mit hohem praktischem Nutzwert. Systematisch aufgebaut nach Indikationen, Heilpflanzen, Zubereitungsformen und Fertigpräparaten. Mit aktuellen pharmakologischen und klinischen Studien, Fertigarzneimitteln sowie Hinweisen auf Pflanzenmonografien nach den Kommissionen E, ESCOP, WHO und HMPC. Ihr Plus: Mit konkreten Therapiekonzepten der 14 wichtigsten Indikationsgruppen und therapeutischen Empfehlungen aus der langen persönlichen Erfahrung des Autors.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 865
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Der Autor
Prof. Dr. med. Volker Fintelmann, geb. 1935 in Berlin. Studium der Medizin von 1955–1960 in Tübingen, Berlin, Heidelberg und Hamburg. Promotion 1961, Arzt für Innere Medizin 1968, Teilgebietsbezeichnung Gastroenterologie 1977. 1973 Leitender Arzt der DRK-Klinik Helenenstift Hamburg, seit 1977 zusätzlich Leitender Arzt der Medizinischen Abteilung des DRK-Krankenhauses Beim Schlump Hamburg, seit 1980 Leitender Arzt der Medizinischen Abteilung B am Krankenhaus Rissen der DRK-Schwesternschaft Hamburg e. V., dessen Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer 1986–1996. 1996 Verleihung des Ehrentitels Professor durch den Senat der Freien und Hansestadt Hamburg. Ab 1997 freiberuflich tätig, Vorstand der Carl Gustav Carus Akademie Hamburg e. V., einer Aus-, Fort- und Weiterbildungsstätte für alle medizinischen Berufe; Fortführung einer privatärztlichen Praxis. Seit 2007 Präsident der Niedersächsischen Akademie für Homöopathie und Naturheilverfahren in Celle. Wissenschaftliche Arbeiten in der Hepatologie, im Besonderen zu toxischen Leberschäden und chronisch-aktiven Hepatitiden; praktische und methodische Ausarbeitung einer modernen Phytotherapie und einer anthroposophisch ergänzten Medizin. Mitglied der Zulassungs- und Aufbereitungskommission für Phytotherapie beim ehemaligen Bundesgesundheitsamt Berlin (Kommission E) von 1978–1989, deren Vorsitzender seit 1983. 1989–1991 1. Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Phytotherapie. Zahlreiche Publikationen, Vorträge und Seminare zu den o. g. Wissenschaftsgebieten.
Kontakt Prof. Dr. med. Volker Fintelmann Carus Akademie Rissener Landstr. 193
Volker Fintelmann Rudolf Fritz Weiss
Lehrbuch Phytotherapie
12., überarbeitete Auflage
134 Abbildungen 7 Tabellen
Vorwort
Die 12. Auflage erfuhr erneut eine gründliche Überarbeitung der Inhalte besonders im Hinblick auf eine Aktualisierung. So konnten weitere Pflanzendrogen aufgenommen werden, da für sie neues Erkenntnismaterial vorliegt, das wissenschaftlichen Kriterien und Ansprüchen genügt. Sämtliche aufgenommenen Fertigarzneimittel sind der Roten Liste Online (Stand: März 2009) entnommen und stellen nur eine Auswahl praktisch bewährter Präparate dar, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.
Daneben ist jedem Hauptkapitel eine kurze Anmoderation vorangestellt, die den Leser auf die wesentlichen Aspekte der folgenden Abschnitte hinweist. Wichtige Warnhinweise sind deutlich hervorgehoben, um ein Übersehen so weit wie möglich zu vermeiden. Dem Fort- und Weiterbildungstrend, das neu aufgenommene Wissen durch gezielte Fragen sofort zu überprüfen, wurde Rechnung getragen, indem am Ende der großen Kapitel eine Anzahl Fragen zu finden sind, deren Antworten sich aus dem Text ergeben und die außerdem im Anhang systematisch aufgeführt werden. Das vorherige Stichwortverzeichnis ist jetzt unterteilt in ein Pflanzen-, Arzneimittel- und Sachwortverzeichnis, um das Auffinden spezifischer Begriffe zu erleichtern. Auch werden in dieser neuen Auflage zum ersten Mal farbige Abbildungen der Arzneipflanzen gezeigt, die – da die „ganze“ Pflanze fotografisch kaum abbildbar ist – die für sie typischen Charakteristika herausstellen. Die ursprünglichen Zeichnungen wurden aber nicht ganz eliminiert, gehören sie doch zur langen Tradition dieses Lehrbuchs. Und schließlich wurde die farbliche Gesamtgestaltung und Typografie neu gefasst. Insgesamt also doch eine ganze Anzahl von Neuerungen, die diese Auflage prägen.
Unverändert bleibt das Anliegen dieses Lehrbuchs, welches ich selber nun seit 20 Jahren verantwortlich betreue. Rudolf Fritz Weiss hat bereits die Phytotherapie aus ihrer sehr alten, einer ganz anderen Erkenntnisart entstammenden Methodologie, die Empirie genannt wird, in die neuere medizinische Wissenschaftlichkeit statistischer Bewertung von Ergebnissen kollektiv geführter Studien und entsprechender experimenteller Pharmakologie überführt. Ihm war wichtig, dass die Phytotherapie Bestandteil einer naturwissenschaftlich definierten Medizin ist. Darüber hinaus, und das verbindet uns, bestand er auf der Unverzichtbarkeit der Beobachtung als Ausgangspunkt aller Naturwissenschaft, sei es gegenüber der Pflanze, dem menschlichen Organismus (Physiologie) sowie seiner Krankheiten (Pathologie). Hinzu kommt die Besonderheit jedes konkreten Menschen, der uns als Patient begegnet. Diese Betrachtungs- und Herangehensweise erfordert eine jeweils individualisierte Therapie, was sich z.B. in der großen Anzahl charakteristischer Rezepturen ausdrückt. Entscheidend wichtig bleibt, dass Phytopharmaka ein unverzichtbarer Bestandteil einer zu Recht so bezeichneten Humanmedizin bleiben, was durch die äußere Reglementierung des Arzneimittelmarkts national und europaweit immer schwieriger wird, werden doch beispielsweise Phytopharmaka so gut wie überhaupt nicht mehr von den gesetzlichen Krankenversicherern erstattet. Dieser uns unverzichtbaren Integration der Phytotherapie in die moderne Medizin möchte auch diese Auflage des Lehrbuchs dienen.
Diesmal hat Frau Stefanie Teichert das Lektorat übernommen und die neue Auflage mit größter Achtsamkeit, Sorgfältigkeit und eigenständiger Wahrnehmung von Ungenauigkeiten oder Vorschlägen zur besseren Präzisierung begleitet. Dafür sei ihr an dieser Stelle ein großer Dank ausgesprochen.
Möge auch die 12. Auflage von den vielen treuen Lesern und Begleitern des Lehrbuchs zustimmend aufgenommen werden und dazu viele neue Leser finden.
Hamburg, 1. Juli 2009Volker Fintelmann
Rudolf Fritz Weiss (1895–1991)
Prof. Dr. med. Rudolf Fritz Weiss wurde am 28. Juli 1895 in Berlin-Charlottenburg geboren. Er fühlte sich nach seinen eigenen Worten schon von früher Jugend an der „Botanik, Floristik und Pflanzenbiografie“ verbunden. Er war schon in dieser Zeit ein eifriger Sammler der heimischen Flora und legte ein eigenes, umfangreiches Herbarium an. Dadurch erwarb er sich früh eine gefestigte Pflanzenkenntnis aus der unmittelbaren Anschauung in der Natur. Nach dem Abitur studierte er Humanmedizin und Botanik an der Universität Berlin. 1922 erhielt er seine Approbation und begann die Weiterbildung zum Arzt für Innere Medizin an der berühmten Charité. Seit 1931 lehrte Weiss als Dozent für Pflanzenheilkunde an der Akademie für Ärztliche Fortbildung in Berlin. 1939–1945 war er Leitender Arzt der Abteilung für Innere Medizin und als Sanitätsoffizier d. R. verantwortlich für die angegliederte Lazarettabteilung für Rehabilitation im Krankenhaus Berlin-Britz. Sieben Jahre, von 1945–1952, war Rudolf Fritz Weiss in russischer Kriegsgefangenschaft. Er hat in dieser Zeit seine Mitgefangenen intensiv ärztlich betreut, wobei ihm seine große Pflanzenkenntnis zugute kam, sammelte er doch alle nur irgend verfügbaren Heilkräuter im Bereich der verschiedenen Lager und setzte sie in einfachster Form als Arzneimittel ein. Der dabei unermüdliche, große ärztliche Einsatz wurde 1987 durch die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse vom damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker gewürdigt.
Weiss ließ sich 1952 als Internist in Hannover in eigener Praxis nieder, die er bis 1961 ausübte. Dann siedelte er nach Aitrach im Allgäu über, um sich nun ganz seiner wissenschaftlichen Arbeit widmen zu können. Von 1978–1990 war er ständiges Mitglied der Zulassungs- und Aufbereitungskommission für die phytotherapeutische Stoffgruppe (Kommission E) beim ehemaligen Bundesgesundheitsamt in Berlin. 1984 übernahm er im Alter von 88 Jahren einen Lehrauftrag der pharmazeutischen Fakultät der Universität Tübingen und lehrte „Neuzeitliche Phytotherapie in der Praxis“.
Weiss’ Anliegen war die wissenschaftliche Begründung der Pflanzenheilkunde, die er selber später in Anlehnung an den französischen Arzt Henri Leclerc „Phytotherapie“ nannte. Für ihn war entscheidend, dass diese wissenschaftliche Ausarbeitung einer modernen Phytotherapie durch den praktisch und klinisch tätigen Arzt erfolgte, auch wenn er die mehr theoretischen Ausarbeitungen von Pharmazeuten oder Medizinhistorikern durchaus schätzte. Sein Lebensziel war die Anerkennung der Phytotherapie als ein unverzichtbarer Bestandteil der gesamten Medizin. Dafür hat er sich sein fast 100-jähriges Leben lang intensiv und unermüdlich eingesetzt.
Aus den über viele Jahre fortgesetzten Vorlesungen an der Berliner Akademie für Ärztliche Fortbildung entstand auf drängenden Wunsch seiner Hörer das Buch Die Pflanzenheilkunde in der ärztlichen Praxis, welches 1944 erstmals im Hippokrates-Verlag Marquardt & Cie, Stuttgart, erschien. Er verwandelte dieses Buch im Laufe der Jahre zu seinem Lehrbuch der Phytotherapie, das als der Klassiker der phytotherapeutischen Literatur bezeichnet wird, und betreute es bis zur sechsten Auflage 1985.
Er selber spricht im Vorwort der Erstauflage davon, dass es sich um ein „rein ärztliches Blickfeld als Grundlage dieses Buches handele“, und dass die praktische ärztliche Erfahrung in der Behandlung seiner Patienten in Übereinstimmung mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen den Inhalt dieses Buchs ausmache. 1980 gründete Weiss die Zeitschrift für Phytotherapie, die er lange als Herausgeber betreute. Er publizierte mehr als 100 Originalarbeiten und verschiedene Monografien, von denen beispielhaft Das neue große Kneippbuch und die Fortführung von Das große Kräuterheilbuch des Pfarrers Künzle erwähnt sein sollen.
Es ist neben der intensiven wissenschaftlichen Arbeit einiger Hochschulpharmazeuten das große Verdienst von Rudolf Fritz Weiss, dass die Phytotherapie ihren Weg in eine moderne, rationale Medizin gefunden hat. Er war der bei Weitem profundeste Kenner dieser Therapierichtung, wobei er immer aus gesättigter praktischer Erfahrung vortrug oder schrieb und sich im Konsens mit der naturwissenschaftlich orientierten Medizin („Schulmedizin“) wusste, als deren Bestandteil er auch die Phytotherapie sah. Seine bahnbrechenden Arbeiten, sein unermüdlicher Kampf für die Phytotherapie, sein großer Fleiß in der ärztlichen Fort- und Weiterbildung mündeten 1985 in der ehrenvollen Verleihung des Titels „Professor“ durch Lothar Späth, den damaligen Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg. Bis in sein höchstes Alter und auch bis kurz vor seinem Tod war er körperlich ungewöhnlich rüstig und seelisch-geistig aktiv. Schon halb erblindet konnte er mich 1988 durch seinen Garten im „Vogelherd“ führen und mir alle seine Pflanzenschätze zeigen, die dort ohne spezifisch-botanische Ordnung wild, aber außerordentlich gesund wuchsen. Rudolf Fritz Weiss starb am 27. November 1991 in Memmingen.
Die Geschichte der Medizin wird in ihm einen der bedeutenden Ärzte des 20. Jahrhunderts ehren.
Inhalt
Grundlagen
1 Was ist Phytotherapie?
1.1 Definition
1.2 Geschichte
1.3 Phytotherapie – eine besondere Therapierichtung?
1.4 Bedeutung des Wirksamkeitsnachweises
1.5 Nebenwirkungen
1.6 Wechselwirkungen
2 Spezifische Aspekte
2.1 Qualitätssicherung
2.2 Richtlinien für die Rezeptur
2.3 Medizinische Teezubereitungen (Species)
2.4 Phytobalneologie
Praxis
3 Krankheiten der Verdauungsorgane und des Stoffwechsels
3.1 Schleimhauterkrankungen des Mund- und Rachenraums
3.1.1 Akute Stomatitis, akute Pharyngitis, nicht eitrige Angina tonsillaris
3.1.2 Chronische Stomatitis, chronische Pharyngitis
3.1.3 Herpes labialis
3.2 Magenkrankheiten
3.2.1 Akute Gastritis
3.2.2 Reizmagen
3.2.3 Chronische Gastritis, Inappetenz
3.2.4 Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre
3.3 Darmkrankheiten
3.3.1 Colon irritabile (Reizkolon)
3.3.2 Meteorismus, Roemheld-Syndrom
3.3.3 Morbus Crohn
3.3.4 Durchfallkrankheiten (Diarrhöen)
3.3.5 Chronische Darmträgheit, Obstipation
3.3.6 Proktitis
3.3.7 Hämorrhoiden
3.4 Leber- und Gallenkrankheiten
3.4.1 Leberkrankheiten
3.4.2 Gallenwegsdyskinesien
3.4.3 Postcholezystektomiesyndrom
3.5 Funktionelle Dyspepsie
3.6 Endokrine und Stoffwechselkrankheiten
3.6.1 Zuckerstoffwechselerkrankung (Diabetes mellitus)
3.6.2 Fettstoffwechselstörungen (Hyper- und Dyslipoproteinämien)
3.6.3 Überfunktion der Schilddrüse (Hyperthyreose)
4 Krankheiten des Herzens und der Kreislauforgane
4.1 Degenerative Herz- und Gefäßkrankheiten
4.1.1 Koronare Herzkrankheit
4.1.2 Herzinsuffizienz
4.1.3 Periphere und zerebrale Gefäßerkrankungen
4.2 Rhythmusstörungen des Herzens
4.3 Funktionelle Herzbeschwerden
4.4 Kreislaufdysregulationen
4.4.1 Arterielle Hypertonie
4.4.2 Arterielle Hypotonie
4.5 Erkrankungen des Venensystems
5 Krankheiten der Atmungsorgane
5.1 Akute und chronische Entzündungen der Atemwege
5.2 Sinusitis
5.3 Asthma bronchiale
5.4 Grippale Infekte und Erkältungskrankheiten
6 Krankheiten der Nieren, ableitenden Harnwege und Prostata
6.1 Harnwegsinfekte
6.2 Dysurische Beschwerden
6.3 Nieren- und Harnleitersteine
6.4 Funktionelle Beschwerden
6.4.1 Bettnässen
6.4.2 Reizblase und Prostatopathie
6.4.3 Benigne Prostatahyperplasie
7 Rheumatische Erkrankungen und Gicht
7.1 Rheumatische Erkrankungen
7.2 Gicht
8 Krankheiten des Nervensystems und der Psyche
8.1 Nervöse Unruhezustände und Schlafstörungen
8.2 Depressive Verstimmungen
8.3 Psychophysische Erschöpfung
8.4 Vegetative Dysregulation, vegetative Dystonie
8.5 Degenerative Erkrankungen des zentralen Nervensystems – Hirnleistungsstörungen
8.6 Vasomotorische Kopfschmerzen, Neuralgien
9 Hautkrankheiten
9.1 Dermatitis und Ekzem
9.1.1 Akutes, nässendes Ekzem
9.1.2 Trockenes Ekzem
9.2 Atopisches Ekzem (Neurodermitis)
9.3 Ulcus cruris
9.4 Furunkulose
9.5 Frostbeulen
9.6 Lymphödem
9.7 Wunden, Kontusionen, Distorsionen
10 Frauenkrankheiten
10.1 Hormonale Dysfunktionen
10.1.1 Prämenstruelles Syndrom, Mastodynie
10.1.2 Klimakterische Beschwerden
10.2 Funktionelle Regelstörungen
10.2.1 Amenorrhöe, Oligomenorrhöe
10.2.2 Dysmenorrhöe
10.3 Fluor albus
10.4 Parametropathia spastica
11 Alterskrankheiten
11.1 Sklerotische Herz- und Gefäßkrankheiten
11.2 Verdauungsschwäche
11.3 Atemwegserkrankungen
11.4 Krankheiten der Nieren, der ableitenden Harnwege und der Prostata
11.5 Stoffwechselstörungen
11.6 Unruhezustände, Schlaflosigkeit, Depression
11.7 Erschöpfungszustände, Antriebslosigkeit
12 Kinderkrankheiten
12.1 Krankheiten der Verdauungsorgane
12.1.1 Dyspeptische Beschwerden
12.1.2 Appetitlosigkeit
12.1.3 Blähungen
12.1.4 Durchfall
12.1.5 Obstipation
12.2 Atemwegserkrankungen
12.2.1 Katarrhe
12.2.2 Krampfartiger Husten und Keuchhusten
12.3 Erkältungskrankheiten
12.4 Krankheiten der Nieren und der Harnwege
12.5 Nervosität, Unruhe, Schlafstörungen, Depression
12.6 Erkrankungen der Haut
12.6.1 Dermatitiden
12.6.2 Prellungen, Hämatome, Stauchungen
12.6.3 Verbrennungen, Verbrühungen
12.6.4 Herpes simplex
13 Onkologische Erkrankungen
14 Behandlungs konzepte nach R. F. Weiss – kritisch bewertet
14.1 Krankheiten der Verdauungsorgane und des Stoffwechsels
14.1.1 Hämorrhoiden
14.1.2 Diabetes mellitus
14.2 Krankheiten des Herzens und der Kreislauforgane
14.2.1 Degenerative Herz- und Gefäßkrankheiten
14.2.2 Erkrankungen des Venensystems
14.3 Atemwegserkrankungen
14.3.1 Husten
14.3.2 Keuchhusten
14.3.3 Bronchialasthma
14.3.4 Lungentuberkulose
14.4 Erkrankungen der Nerven und der Psyche
14.4.1 Nervosität, Unruhe
14.4.2 Antriebslosigkeit
14.4.3 Neuralgien
14.4.4 Nikotinabhängigkeit
14.5 Hauterkrankungen
14.5.1 Chronische Ekzeme
14.5.2 Schuppenflechte (Psoriasis)
14.5.3 Warzen (Verruca vulgares)
14.5.4 Haarausfall (Alopezie)
14.6 Augenkrankheiten
14.6.1 Akute und subakute Augenentzündungen
14.6.2 Erkrankungen des inneren Auges
14.6.3 Beschwerden am äußeren Auge
14.7 Frauenkrankheiten
14.7.1 Gebärmutterblutungen
14.7.2 Hormonstörungen
14.8 Krebserkrankungen
Anhang
Bewährte Indikationen im Überblick
Heilpflanzen im Überblick
Antworten
Hinweise zur Aus- und Weiterbildung
Pflanzenverzeichnis
Arzneimittelverzeichnis
Sachverzeichnis
Grundlagen
1 Was ist Phytotherapie?
2 Spezifische Aspekte
1 Was ist Phytotherapie?
Phytotherapie umfasst den Nutzen pflanzlicher Heilmittel zur Prävention, Behandlung und Heilung von Krankheiten. Die zugrunde liegenden Prinzipien erschließen sich aufgrund der vielfältigen Wirkungsweisen von Phytopräparaten oftmals schwer, zumal die kombinatorischen Effekte ihrer Bestandteile wissenschaftlich nach wie vor nicht hinreichend erfasst werden können, oder mit den Worten von Goethes ausgedrückt (Faust I, vierte Szene): „Wer will was Lebendigs erkennen und beschreiben, sucht erst den Geist herauszutreiben, dann hat er die Teile in seiner Hand; fehlt, leider, nur das geistige Band.“
Dieses Kapitel vermittelt Ihnen die grundlegenden Anforderungen an eine „moderne“ Phytotherapie, die auf Basis neuer Erkenntnisse die von Goethe postulierte Unmöglichkeit aufzubrechen sucht, den Geist in Beziehung mit seinen Teilen zu setzen, der die Phytotherapeutika zu so bedeutsamen Heilmitteln macht.
1.1 Definition
Der Begriff Phytotherapie beschreibt die Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten und Befindensstörungen durch Pflanzen sowie Pflanzenteile wie Blatt, Blüte, Wurzel, Frucht oder Samen und deren Zubereitungen. Hierfür geeignete Pflanzen werden traditionell auch als Heilpflanzen bezeichnet. Von entscheidender Bedeutung ist, dass die arzneilich verwendete Pflanze oder ihre Teile als jeweils stoffliche Ganzheit gebraucht werden. Pflanzliche Arzneimittel stellen insofern immer Mehrstoff- oder Vielstoffgemische dar. Sie müssen den Grundforderungen des Deutschen Arzneimittelgesetzes (AMG) im Hinblick auf Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit genügen.
Die Anwendung von aus Pflanzen isolierten, chemisch definierten Inhaltsstoffen beschreibt einen Grenzbereich der Phytotherapie, den der Slogan „Arzneimittel aus Naturstoffen“ des Arzneimittelherstellers Madaus treffend charakterisiert. Nach der Definition der für die Phytotherapie zuständigen Kommission E beim ehemaligen Bundesgesundheitsamt in Berlin zählt jedoch die Anwendung von aus Pflanzen isolierten Inhaltsstoffen nicht mehr zur Phytotherapie. Weiss hatte dieses Vorgehen noch als der Phytotherapie zugehörig akzeptiert und isolierte Wirkstoffe als Forte-Phytotherapeutika klassifiziert. So hat man beispielsweise durch Extraktion direkt aus dem Fingerhut (Digitalis purpurea, Digitalis lanata) gewonnene Digitalis-Glykoside wie Digoxin oder Digitoxin der Phytotherapie zugeordnet. In Form chemischsynthetisch veränderter Derivate wie Azetyl- oder Methyldigoxin können sie dagegen nicht mehr zur Phytotherapie gerechnet werden, da sie solcherart nicht „natürlich“ vorkommen. Hinzu kommt, dass ehemals aus der Pflanze isolierte Wirkstoffe heute überwiegend chemisch-physikalisch synthetisiert werden, wobei die Ausgangsstoffe häufig keinerlei Bezug mehr zu der ursprünglichen Heilpflanze haben. Das gilt beispielsweise auch für sog. rückgestellte ätherische Öle.
Stoffliche Zusammensetzung und strukturelle Komposition
Für das Verständnis der Phytotherapie scheint es unabdingbar, die spezifische Kombination von Stoffen der eingangs erwähnten Ganzheit Pflanze als ein jeweils kompositorisches Geheimnis zu verstehen. Was Johann Wolfgang von Goethe als „offenbares Geheimnis“ erkannte, gilt auch für das Verständnis der Heilpflanzen. Wir können heute durch chemisch-physikalische Verfahren eine Pflanze oder ihre Teile bis in letzte Einzelheiten analysieren, erfahren auf diese Weise allerdings nicht, wodurch die oft unglaubliche Vielfalt der Stoffe jeder einzelnen Pflanze in der charakteristischen, sich durch Jahreszeiten, Wachstumsbedingungen, geologische Gegebenheiten und weitere Faktoren fortlaufend ändernden Zusammensetzung als ständig erhaltene Ganzheit bedingt wird. Neben der quantitativ beweisbaren Zusammensetzung begegnen wir einer qualitativen Natur der Pflanze, die sich reiner Beweisbarkeit entzieht und nur beschreibbar ist.
Das von Goethe im oben aufgeführten Zitat angesprochene, den Dingen zugrunde liegende geistige Prinzip wird heute im Bereich der Naturwissenschaften meist auf die Genetik reduziert. Zweifellos stellen die Gene eine wichtige physische Voraussetzung für die Erhaltung einer Art dar. Darüber hinaus gilt es aber zu bedenken, dass sie im Hinblick auf Spezifität und Art der Zusammenfügung „kompositorisch“ geschaffen wurden. Auch der Musiker komponiert seine Sinfonie nach Gesetzmäßigkeiten wie Intervallen, Tonarten, Rhythmen, und obwohl diese für jeden Komponisten identisch sind, ist jedes fertige Werk einmalig und individuell geprägt. Wie der Musikkenner beim Anhören des Werks um den geistigen Urheber, den Komponisten, weiß, kann der Pflanzenkenner im Rahmen der Pharmakognosie die Pflanze aus ihrer Ganzheit bis zur jeweils spezifischen stofflichen Zusammensetzung identifizieren.
Gegenstand der Phytotherapie ist – außer der Pflanze selbst, ihren Lebensbedingungen und ihrer stofflichen Zusammensetzung – die Komposition und damit die Besonderheit zu entdecken, durch welche sie sich von allen anderen unterscheidet. Die detaillierte Kenntnis der stofflichen Zusammensetzung einer Pflanze muss mit dem Ergründen des kompositorischen Geheimnisses, des „geistigen Bandes“ verbunden sein.
Phytotherapie und Heilpflanzenkunde
Phytotherapie ist nur ein Anteil der umfassenden Heilpflanzenkunde, welche die Phytochemie, Phytopharmazie, Phytopharmakologie und Phytotherapie beinhaltet.
Die Phytochemie beschäftigt sich ausschließlich mit den Inhaltsstoffen der Pflanzen. Ihr Anliegen ist es, die chemische Zusammensetzung zu identifizieren sowie die Pflanzenart in dieser Hinsicht zu kontrollieren (Fingerprint) und mögliche Inhaltsstoffe zu beschreiben, die auf ihre Wirkung hin pharmakologisch untersucht werden können. Im Zuge der atomistischen Betrachtungsweise interessieren hier nur die Teile und nicht das Ganze. Von der Phytochemie gehen die Impulse aus, die als für die Wirkung verantwortlich deklarierten Inhaltsstoffe daraufhin zu prüfen, inwieweit ihre Synthese möglich ist, um unabhängig von der Naturernte zu werden.
Gegenstand der Phytopharmazie ist vor allem die Droge, d. h. das für die jeweilige Arznei notwendige Ausgangsprodukt, das beispielsweise als Tee direkt oder in verschiedenen Extraktionsformen pharmazeutisch zubereitet angewendet wird. In den einzelnen Pflanzendarstellungen wird die jeweils zugehörige pharmazeutisch gebrauchte Droge benannt.
Ein wichtiger Anteil der Phytopharmazie ist die Pharmakognosie, die jeweilige Bestimmung der Droge durch Inaugenscheinnahme. Früher wurde die Droge durch Sinneswahrnehmungen des Pharmakognosten identifiziert, indem er sie ansah, befühlte, schmeckte oder roch. Ein solches Vorgehen zur Identifikation und Qualitätsbestimmung kann immer noch wichtig sein, doch stehen inzwischen hoch spezialisierte chemisch-physikalische Untersuchungsmethoden für die Bestimmung der Droge an erster Stelle. So ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Pharmazeut zwar den genauen Fingerprint einer Heilpflanze kennt und jederzeit differenzieren, die Pflanze in der Natur allerdings nicht mehr identifizieren kann.
Im Zusammenhang mit pharmazeutischen Lehrstühlen gibt es inzwischen auch eine große Zahl von Pharmakologen, die unter primär pharmazeutischen Gesichtspunkten die Pharmakokinetik und Pharmakodynamik pflanzlicher Arzneimittel untersuchen.
Eine spezifische Phytopharmakologie im Bereich der medizinischen Fakultäten ist nur in Anfängen erkennbar. Zwar beschäftigen sich zunehmend viele Pharmakologen mit Pflanzeninhaltsstoffen, jedoch wird die spezifische Aufgabe, die Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von Mehrstoff- oder Vielstoffgemischen zu untersuchen, kaum praktiziert. Offenbar erschwert die monokausale Denk- und Vorgehensweise ein Umdenken. Sicherlich hätte das Stiefkind der Pharmakologie, die klinische Pharmakologie, einen besonderen Stellenwert für die Wirksamkeitsbeurteilung von Phytotherapeutika. Gerade diese Arzneimittel, die mehr auf übergreifende Wirksamkeit als auf spezialisierte Wirkungen ausgerichtet sind, müssten unmittelbar am Menschen untersucht werden, da ihre Übertragbarkeit aus dem Tierexperiment auf den Menschen wesentlich problematischer ist als die chemisch definierter isolierter synthetischer Wirkstoffe. Das gilt in gleicher Weise für vielfältige Fragen der Toxikologie, in der häufig gänzlich unwissenschaftlich auf rein theoretischem Hintergrund oder einem selbst gewählten Paradigma folgend Risiken für Arzneimittel aus Pflanzen benannt werden, ohne dass entsprechende Ergebnisse beim Menschen selbst beobachtbar waren.
Die Phytotherapie als viertes Glied der umfassenden Heilpflanzenkunde beschreibt Möglichkeiten und Grenzen der Behandlung mit pflanzlichen Arzneimitteln bei Indikationen der Humanmedizin. Sie gehört primär in die Hand des Arztes und anderer Therapeuten wie Heilpraktiker, Physiotherapeuten oder Angehöriger pflegender Berufe, die Pflanzenheilmittel verwenden. Schließlich eignen sich viele Phytotherapeutika zur Selbstmedikation, vor allem auch im präventiven Sinne.
Hier hat der Offizinapotheker eine wichtige Beratungsfunktion. Möglichkeiten und Grenzen einer Phytotherapie sollten deshalb in der Ausbildung zum Pharmazeuten wieder viel umfassender dargestellt werden. Die eigene Beobachtung zeigte immer wieder, wie häufig für sog. Bagatellerkrankungen ein chemisch-synthetisches Arzneimittel empfohlen wird, für die ein vergleichbar wirksames Phytopharmakon aufgrund besserer Verträglichkeit Mittel erster Wahl hätte sein können. Oft fehlt jedoch die entsprechende Kenntnis mangels hinreichender Darstellungen in der Ausbildung.
1.2 Geschichte
Die Therapie mit Pflanzenheilmitteln findet sich weltweit in oft jahrtausendealten Medizinsystemen, so beispielsweise in der chinesischen, tibetanischen oder indisch-ayurvedischen Medizin. Auch die Medizinmänner sog. Naturvölker Afrikas, Nord- und Südamerikas und Ozeaniens verwendeten immer auch Pflanzen, von denen viele zu Standarddrogen der Phytotherapie unserer Zeit zählen; so der Purpurfarbene Sonnenhut (Echinacea purpurea) oder die Teufelskralle (Harpagophytum procumbens). Die Priester des alten Ägyptens oder Griechenlands, Galen als Leibarzt des römischen Kaisers, Marc Aurel, die heilkundige Äbtissin Hildegard von Bingen oder auch Paracelsus: Sie alle wussten um die Heilkraft bestimmter Pflanzen und verwendeten sie in ihren Heilsystemen.
Auch in neuerer Zeit haben berühmte Ärzte wie Hufeland oder Carus ebenso wie Pfarrer Kneipp Heilpflanzen, die oft auch Heilkräuter genannt wurden, geschätzt und verwendet. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Benennung der Indikationen vor allem im Mittelalter oder noch früheren Zeiträumen. Für unser medizinisches Wissenschaftsverständnis scheinen die meisten der dort genannten Indikationen ungenau, unwissenschaftlich oder gar unverständlich, weil wir die damalige medizinische Denkart nicht mehr entschlüsseln und übersetzen können. Das gilt in besonderer Weise für den großen Wegbereiter der Medizin, Paracelsus. Immer wieder staunen wir aber auch darüber, dass bestimmte, uns heute in Wirkung und Wirksamkeit gut bekannte Heilpflanzen schon in viel früheren Zeiten mit ähnlicher Indikation erfolgreich eingesetzt wurden. So zeugt es von großem Unverständnis, die in früheren Zeiten häufig außerordentlich breite Indikationsfülle der Heilpflanzen als „Indikationslyrik“ abzutun: Der Zusammenhang von Krankheit, Mensch, Natur und Kosmos wurde in der Regel ganz anders erlebt als in einer immer mehr abstrahierenden Wissenschaftsmedizin des 20. Jahrhunderts. Dennoch sollte kein „Zurück zur Natur“ (Rousseau) im Sinne einer Rückkehr zu alten, scheinbar besseren Zeiten propagiert werden.
In die Wissenschaft eingeführt wurde der Begriff Phytotherapie durch den französischen Arzt Henri Leclerc (1870–1955), der in Paris lebte und praktizierte. Er verfasste zahlreiche Aufsätze über die Anwendung von Heilpflanzen, die größtenteils in der führenden französischen medizinischen Zeitschrift La Presse médicale erschienen. Seine Erfahrungen fasste Leclerc in dem Leitfaden Précis de Phytothérapie zusammen.
Ihre Renaissance hat die Phytotherapie der Neufassung des AMG zu verdanken, das am 01. Januar 1978 in Kraft trat und seither mehrfach novelliert und ergänzt wurde. Dieses Gesetz schrieb den Pluralismus von Therapierichtungen in der gesellschaftlich akzeptierten modernen Medizin fest und rechnet die Phytotherapie zu den besonderen Therapierichtungen. Sie verdankt ihren Übergang in eine moderne, zeitgemäße Form aber auch dem Nestor der Phytotherapie in Deutschland, Rudolf Fritz Weiss (1895–1991), der bis ins hohe Alter die Lehre von der medizinischen Anwendung von Heilpflanzen in Wort und Schrift aktiv vertrat und bereits 1944 die erste Auflage dieses Lehrbuchs der Phytotherapie veröffentlichte.
Die Aktualisierung der Phytotherapie beruht im Weiteren auf den Bemühungen zahlreicher Hochschulpharmazeuten, die sich ohne Furcht vor Diskriminierung intensiv mit den Heilpflanzen unter modernen pharmazeutischen, pharmazeutisch-pharmakologischen und letztendlich auch klinischen Fragestellungen beschäftigten. Sie gaben viele therapeutische Anregungen und Rezepturen weiter, wurden aber vielfach zu Grenzgängern bezüglich ihrer Darstellungen, da sie ihre Erkenntnisse nicht direkt am Patienten anwenden konnten.
Die Geschichte der Phytotherapie ist auch eine Geschichte unserer modernen Medizin, die sich seit ihrer Entstehung in der Mitte des 19. Jahrhunderts als naturwissenschaftlich orientierte Medizin definiert. Es ist nicht Aufgabe dieses Buchs, das dadurch Erreichte zu preisen und die Irrwege zu verdammen. Der Duktus dieses Buchs wird aber deutlich machen, dass Phytotherapie von einer modernen Medizin fordert, die sehr eng gesteckten Grenzen der Wissenschaftlichkeit zu sprengen und nach neuen Erkenntnis- und Verständnismöglichkeiten Ausschau zu halten. Es ist richtig und notwendig, dass die aus uralter Tradition stammende Therapie mit Pflanzen als moderne Phytotherapie mittels naturwissenschaftlicher Methodik auf ihre Wirksamkeit und Unbedenklichkeit hin geprüft wird. Sich dabei ergebende negative Ergebnisse fortgesetzter Untersuchungen und Behandlungen müssen allerdings innerhalb der Phytotherapie akzeptiert und konsequent umgesetzt werden. Als Beispiel sei hier das Gänsefingerkraut (Potentilla anserina) genannt, dem früher eine antidysmenorrhoische Wirkung zugesprochen wurde. In Tierversuchen waren krampfstillende Wirkungen auf den Uterus nachweisbar, die Anwendung am Menschen bestätigte dieses Ergebnis nicht. Trotzdem findet sich die Anserine auch heute noch vielfach als Bestandteil von Frauentees und ähnlichen Präparaten; ein Zeichen dafür, wie hartnäckig sich Verordnungen erhalten können, die sich schon längst als überholt erwiesen haben. Wir dürfen uns also nicht scheuen, Altgewohntes zu revidieren.
1.3 Phytotherapie – eine besondere Therapierichtung?
Laut AMG zählt die Phytotherapie – neben der Homöopathie und anthroposophischen Medizin – zu den besonderen Therapierichtungen und nimmt somit eine Sonderstellung im Gesundheitswesen ein. Die Hintergründe hierzu sollen in den folgenden Abschnitten näher erläutert und diskutiert werden.
Phytotherapie und Schulmedizin
Die meisten Vertreter der modernen Phytotherapie verstehen diese als Anteil der naturwissenschaftlich orientierten Medizin (Schulmedizin). Ihren Anspruch, auf Phytotherapeutika die gleichen Wissenschaftsmethoden wie auf synthetische Arzneimittel anzuwenden und Phytotherapie als integralen Bestandteil einer modernen Pharmakotherapie zu betrachten, gilt es zu unterstützen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass für die Phytotherapie im Gegensatz zur Homöopathie und anthroposophischen Medizin keine eigene Erkenntnistheorie und damit Wissenschaftsmethode existiert. Sie war und ist im wirklichen Sinne Naturwissenschaft, wenn auch im umfassenderen Zusammenhang als heute gemeint. Für ihr Verständnis musste der Arzt „durch der Natur Examen gehen“ (Paracelsus). Der überwiegende Anteil aller Anwendungsgebiete entstammt der jahrhunderte-, ja jahrtausendealten Erfahrung mit pflanzlichen Arzneimitteln. Dabei bleibt für unser Verständnis offen, wie diese Erkenntnisse zustande kamen. Die Anwendungsgebiete wurden der jeweiligen Zeit entsprechend immer neu benannt, ohne dadurch grundsätzlich neu definiert zu werden.
Die Abgrenzung der Phytotherapie von der Homöopathie zeigt sich beispielsweise auch bei der Frage des Anwendungsbereichs. Den homöopathisch verwendeten Heilpflanzen, wie sie von Hahnemann beschrieben wurden, werden nicht selten ganz andere Indikationen zugeordnet als in der Phytotherapie.
Eine mögliche Erkenntnismethode, die von Goethe vorgeschlagen und selber praktiziert hat, stützt sich auf die „anschauende Urteilskraft“. Diese Fähigkeit entstehe in dem Beobachter, wenn er sich der Pflanze vorurteilslos gegenüberstellt und so ihr ureigenes Wesen erfährt. Im Streitgespräch mit dem nach heutiger naturwissenschaftlicher Denkart argumentierenden Kantianer Schiller vertrat von Goethe die These, seine Methode führe zur sinnlichen Wahrnehmung der zugrunde liegenden Idee.
Weiss schließlich vertrat die Meinung, die intime, im Sinne einer vertrauensvollen Beziehung gestaltete Beschäftigung mit der Pflanze und die daraus gewonnene Kenntnis sei eine entscheidende Voraussetzung für ihre erfolgreiche therapeutische Anwendung. Eine derartige Auffassung sprengt zweifellos die engen Grenzen, die sich die naturwissenschaftliche Medizin selbst gesteckt hat: Gerade jeder nicht stoffliche Anteil der Therapie soll um der Wissenschaft willen eliminiert werden (doppelter Blindversuch). Selbst große Vertreter der naturwissenschaftlichen Medizin des 20. Jahrhunderts akzeptierten diese Trennung von Wissenschaft und Erfahrung nicht. So nannte Martini die jahrtausendealte praktische therapeutische Erfahrung eine Realerfahrung und bezeichnete sie als der pharmakologisch-experimentellen Erfahrung wissenschaftlich gleichwertig. Der Heidelberger Physiologe Hans Schäfer (1979) kommentiert diese Problematik wie folgt: „Intuition und Wissenschaft sind keine Gegensätze. Ein Teil der ärztlichen Diagnostik und Therapie, der Einfühlungsvermögen benutzt und Anteilnahme (Sympathie mit dem Kranken) voraussetzt, ist intuitiv. Unsere gegenwärtige Medizin ist intuitionsfeindlich. Sie ist das zum Schaden aller. Die Ärzte sollten das wissen – und ändern.“
Als maßgeblicher Standard der naturwissenschaftlichen Medizin wird heute die sog. evidenzbasierte Medizin (evidence based medicine, EBM) proklamiert, die nach Sackett „eine gewissenhafte, vernünftige und bestmögliche Nutzung der gegenwärtig besten externen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur medizinischen Versorgung von Patienten“ darstellt (Perlett 1998). Er formulierte die in ▶Tab. 1.1 dargestellten Stufen der Evidenz.
Loew hat in seiner kritischen Übersicht der EBM eine auf Erfahrung gegründete Medizin (experience based medicine) gegenübergestellt. Er akzeptiert EBM auch für die Phytotherapie, solange sie „die Umsetzung von aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen aus experimentellen Daten, klinisch-pharmakologischen Untersuchungen und klinischen Studien in Entscheidungshilfen für eine rationale diagnostische und therapeutische Medizin“ beinhaltet. EBM ist also durchaus eine Entscheidungshilfe auch für die praktische Medizin, muss aber aufgrund ihrer selbst gesteckten Grenzen als Hilfsmittel für die bestmögliche Findung von Diagnostik und Therapie und nicht als der dafür ausschließlich gangbare Weg gesehen werden. Zu viele Aspekte der praktischen Wirklichkeit in der Medizin und im Besonderen der Einfluss der Individualität werden durch EBM gar nicht oder nur unvollständig erfasst. Wird EBM zu einem „neuen Paradigma“ und einzig zulässigen Erkenntnisweg in der Medizin ernannt, droht nach dem Medizinhistoriker Keil „ein aufklärerischer Absolutismus, der keinen Fortschritt, sondern einen Rückschritt in die Zeit der blindwütigen Aufklärung bedeutet“. Mit Blick auf die Besonderheit von Phytopharmaka schlägt Loew deshalb eine andere Gewichtung der zur Evidenz führenden Kriterien vor (▶Tab. 1.2).
▶Tab. 1.1 Evidence based medicine (EBM) – Stufen der Evidenz nach Sackett (Perlett 1998).
Studienbelege
Stufe 1
systematischer Review, Basis: randomisierte, kontrollierte Studien
Stufe 2
mindestens eine genügend große randomisierte kontrollierte Studie/Interventionsstudie
Stufe 3
nicht randomisierte bzw. nicht prospektive Studien, z. B. Kohorten-, Fallkontrollstudien
Stufe 4
mindestens eine nicht experimentelle Beobachtungsstudie
Stufe 5
Meinungen von Experten; Konsensusverfahren
Die entscheidende Frage im Zusammenhang mit der Diskussion um die Wissenschaftlichkeit der Medizin ist, ob sie sich von der Wirklichkeit und den Bedürfnissen der Erkrankten oder nach Gesundheit strebenden Menschen leiten lässt oder aus einem Elfenbeinturm heraus die Beschaffenheit dieser Komponenten festlegt. Ein bedeutender Vertreter der psychosomatischen Medizin des 20. Jahrhunderts, Thure von Uexküll (1999), sprach mit Blick auf diese Fragestellung auch in Ergänzung einer EBM von einer „patientenorientierten Medizin“. Meyer (1999) verwies zusätzlich auf die großen Unterschiede der verschiedenen Mentalitäten und kulturellen Einflüsse auf die jeweils praktizierte Medizin und forderte eine kulturell begründete Medizin (culture based medicine). Kiene schließlich hat 2001 den Begriff einer erkenntnisbasierten Medizin (cognition based medicine) geschaffen. Diese fußt auf der erkenntnisgestützten Individualbetrachtung und -erfassung eines Krankheitsgeschehens in Polarität zur systemischen kollektiven Auswertung.
Die kurz skizzierte Diskussion um Stellenwert und Bedeutung der EBM lässt erkennen, dass diese einen wesentlichen Aspekt einer wissenschaftlichen Medizin beschreibt, ohne allerdings die Wirklichkeit der Medizin im Ganzen zu erfassen. Insofern werden die Charakteristika einer EBM auf die Phytotherapie zutreffen, die jedoch mit Blick auf die Aussagen Schäfers deren zu eng gesteckte Grenzen sprengt. Eine gute Zusammenfassung dieser Wissenschaftsfrage der Phytotherapie erfolgte 2006 durch Kraft u. März. Sie betonen besonders die Synergieeffekte von Phytopharmaka als Vielstoffgemische, die ihre therapeutische Überlegenheit gegenüber ihren isolierten Einzelwirkstoffen auch experimentell gezeigt haben. Ihr Fazit ist, dass Evidenz ein wichtiger Faktor einer Wirksamkeitsbeurteilung ist, aber keinesfalls ihr einziger: „The lack of evidence of efficacy is not the evidence of the lack of efficacy“, frei übersetzt: Das Fehlen eines Wirksamkeitsnachweises ist kein Nachweis mangelnder Wirksamkeit.
Unabdingbare Voraussetzung für eine menschengerechte Entwicklung der modernen Medizin ist, den intuitiven Anteil der zugrunde gelegten Erkenntnismethode als Ergänzung der analytischnaturwissenschaftlichen wiederzugewinnen. Dabei kann die Heilpflanze, das Phytotherapeutikum, eine wichtige vermittelnde Rolle spielen. Hierauf wies Asklepios, der Gott des Heilwesens, schon vor etwa 3 000 Jahren seinen Schüler Hippokrates mit der Sentenz hin: „Zuerst das Wort – dann die Pflanze – zuletzt das Messer!“ Weiss modifizierte diesen Anspruch für die heutige Zeit wie folgt: „Zuerst das Wort – dann das pflanzliche Heilmittel – dann das große synthetische Chemotherapeutikum – und zuletzt das Messer!“
Die Bedeutung des Worts, das an die erste Stelle jeder Therapie gestellt wird, verweist auf weitere wichtige Aspekte. Heute wird zwischen stummer, wissenschaftlicher und sprechender, alternativer Medizin unterschieden, wodurch beispielsweise die Forderung provoziert wird, die Gebühren für die sprechende Medizin gegenüber einer vorwiegend technischen Medizin zu erhöhen. Welche Bankrotterklärung einer modernen Medizin! Daneben ist das Wort Mittelpunkt des Christentums und als ethische, überkonfessionelle Grundlage der Therapie zu verstehen, worauf Weiss wie folgt verweist: „Wohl aber dürfte es, gerade in heutiger Zeit, angebracht sein, mit Nachdruck darauf zu verweisen, daß das ‚Wort’ an den Anfang aller heilkundlichen Bemühungen gestellt ist. Das galt schon damals, und heute beginnt man sich wieder bewußter darauf zu besinnen. Das ‚Wort’ ist ein spirituelles Heilmittel und wendet sich daher zunächst an die Psyche, von der aus es dann aber auch gewichtige Wirkungen bis in die körperliche Sphäre auszuüben vermag. Das hat uns die neue Lehre von der Psychosomatik wieder deutlich gemacht. Das ‚Wort’ in der richtigen Weise gesprochen, ist eine Kraft, deren Wirkung und Reichweite weit größer ist, als man in einer materialistisch eingestellten Welt anzunehmen geneigt war. Verbindet sich die Kraft des Wortes in einfachster Weise in einem intensiven ärztlichen Gespräch mit der gleichzeitigen Darreichung eines pflanzlichen Heilmittels, so haben wir eine ideale Heilform, die für die große Mehrzahl aller Erkrankungen bereits ausreichen dürfte. Vor allem trifft dies für die vielen Fälle zu, die der Arzt täglich in seiner Praxis sieht. Aber auch die Klinik sollte sich, bewußt geworden durch die Ergebnisse der Psychosomatik, an diese Grundtatsache allen Heilens mehr erinnern. Sie wird es nicht zu bereuen haben.“
▶Tab. 1.2 Experience based medicine – Stufen der Evidenz nach Loew (2000).
Studienbelege
Stufe 1
systematische und aktualisierte Übersichten auf der Basis von prospektiven Kohorten-/Fallkontrollstudien
Stufe 2
prospektive Kohorten-/Fallkontrollstudien ohne studienbedingten Eingriff in die Arzt-Patienten-Interaktion
Stufe 3
retrospektive, prolektive Kohorten-/Fallkontrollstudien
Stufe 4
gepoolte, strukturierte Experteninterviews
Stufe 5
Meinungen von Experten, Konsensusverfahren
So verstanden kann auch aus unserer Sicht die Besonderheit einer Therapierichtung Phytotherapie im Grundsätzlichen Hinweis auf eine notwendige Ergänzung der naturwissenschaftlichen Methode in der Medizin durch Erfassen von Ganzheiten bestehen, um die Einseitigkeit ausschließlich chemisch-physikalischer Vorgänge zu klären und möglichst auch zu überwinden. Einmal mehr treffen wir auf die geistige Gesetzmäßigkeit des Sowohl-als-auch, die das streng analytische Entweder-oder überwindet. Die pharmakologisch definierte, stets reproduzierbare, meist monokausale Wirkung wird ergänzt durch eine therapeutische Wirksamkeit, die nach eigener Erfahrung im Bereich der Befindlichkeit bzw. des Gesamtbefindens angreift und den ganzen Menschen in seinen verschiedenen Seinsebenen Körper, Seele und Geist individuell erfasst.
Wirkung und Wirksamkeit
Eine besondere Gesetzmäßigkeit der Phytotherapie betrifft die Breite des Indikationsbereichs. In der arzneilichen Verwendung der ganzen Pflanze oder „ganzer“ Teile derselben über durch Extraktion gewonnene spezielle Stoffgemische bis hin zum isolierten Einzelstoff findet sich eine Spezialisierung, die von der umfassenden therapeutischen Wirksamkeit bis zur pharmakologisch definierbaren Wirkung reicht. Je mehr Wirkstoffe ein Phytotherapeutikum enthält, desto breiter ist sein Indikationsbereich. Die therapeutische Wirksamkeit von Vielstoffgemischen ist breiter als diejenige bestimmter Inhaltsstoffe in standardisierter Extraktform oder gar die eines definierten Monostoffs, meist bereits in Form eines synthetischen Derivats. Aus dieser Abstufung ergibt sich für den praktisch tätigen Arzt eine Vielfalt von Indikationsmöglichkeiten gerade für Phytotherapeutika.
Diese Gegebenheit lässt sich am Beispiel der Mariendistel (Silybum marianum) gut demonstrieren. Mariendistelfrüchte wurden seit Jahrhunderten arzneilich genutzt, wobei eine außerordentlich große Indikationsfülle den heute bekannten speziellen Bezug zur Leber nur andeutungsweise erkennen lässt. Erst Rademacher entdeckte im 19. Jahrhundert die Wirksamkeit bei Leberkrankheiten, damals undifferenziert als Hepatopathien bezeichnet, und benannte diese Indikation für die von ihm benutzte Mariendistelfrüchtetinktur, die Tinctura Rademacheri. Um das Jahr 1930 beschrieb Hörhammer das mittels Extraktion aus Mariendistelfrüchten gewonnene Silymarin, ein – wie wir heute wissen – Flavongemisch mit den drei Anteilen Silicristin, Silidianin und Silibinin. Moderne pharmakologische und klinische Untersuchungen haben gezeigt, dass Silymarin protektiv und kurativ bei toxischen Lebererkrankungen (Hepatosen) wirksam ist. Das synthetische Derivat des wasserlöslichen Silibinins (Silibinin-C-2’,3-dihydrogensuccinat, Dinatriumsalz) wurde schließlich zum Antidot für eine spezifische, akut lebensbedrohliche Leberintoxikation, die Knollenblätterpilzvergiftung. Von einer ganz unspezifischen, breiten Anwendungsweise über die noch allgemeine, aber organbezogene bis zur engeren Indikation toxischer Leberkrankheiten gehende Spezialisierung, d. h. zugleich Einengung der Wirksamkeit, geht der Schritt über die Grenze zum Synthetikum, das dann spezifisches Antidot für eine einzige bestimmte Krankheitssituation ist.
Jegliche Ideologie, man heile nur mit ganzheitlichen Modellen angemessen, ist somit einseitig und damit ebenso zu hinterfragen wie die zurzeit dominierende Anschauung, therapeutisch gesicherte Ergebnisse könnten ausschließlich mit chemisch-definierten Einzelstoffen erzielt werden. Die Krankheitssituation selbst bestimmt, welche der hier vorgestellten Möglichkeiten am ehesten zur Heilung führt.
Phytotherapie und Prävention
Nach einer vom Institut für Demoskopie Allensbach durchgeführten Studie „Naturheilmittel 2002“ verwendeten von den präventiv Medikamente einnehmenden Erwachsenen 38 % ausschließlich, weitere 41 % unter anderem Naturheilmittel (IfD 2002). Diese Akzeptanz, ja Bevorzugung hat in den Folgejahren weiter zugenommen. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid, der „Pascoe-Studie 2004“, waren 81 % der Befragten von der Heilkraft von Naturheilmitteln überzeugt und 80 % würden sich, hätten sie die Wahl, für diese anstelle eines synthetisch-chemischen Arzneimittels entscheiden (Pascoe 2004). In einer Folgestudie 2007 wurden diese Ergebnisse bestätigt.
Insbesondere die Gesundheitspolitik fordert immer häufiger, den Schwerpunkt von der Behandlung manifester Krankheiten auf die Prävention zu verlagern. Ursache dafür ist allerdings weniger das Aufgreifen des alten medizinischen Lehrsatzes „Vorbeugen ist besser als Heilen“, sondern die Kostenentwicklung des Gesundheitswesens. In der Tat entspricht es der ärztlich-ethischen Verantwortung, eine Krankheit in ihrer Entstehung oder in sog. Latenzstadien zu erfassen und nach entsprechender Behandlung zu suchen. Im Gegensatz dazu wurde meist gewartet, bis die Krankheit manifest und damit auf einer vielfach objektiv beweisbaren Ebene der Befunde angelangt war. Ob sich Krankheiten in Frühstadien in gestörter Funktionalität äußern, ob sich das Entstehen, die Disposition zur Krankheit möglicherweise noch deutlicher und früher in Veränderungen der Ebenen Gestimmtheit und Präsenz äußert (▶S. 15), wurde bisher von der Medizin nicht diskutiert. Eine angemessene Bewertung der Phytotherapeutika innerhalb einer modernen, ganzheitlichen Pharmakotherapie erfordert jedoch die Berücksichtigung der Behandlung von Frühformen oder Latenzstadien vor allem der Krankheiten, die zum chronischen Verlauf tendieren.
Selbst in medizinischen Lexika ist eine klare Unterscheidung von Prophylaxe und Prävention kaum zu finden. Im Folgenden bedeutet Prophylaxe das Verhindern möglicher Krankheiten, wie es sich beispielsweise im Impfwesen manifestiert, Prävention das Verhindern manifester und chronischer Krankheitsverläufe durch Behandlung der latenten Vor- und Frühstadien. Auch familiäre und konstitutionelle Dispositionen können präventive Maßnahmen erfordern. Die Hypothese, dass effektivere Prävention mit großen Einsparpotenzialen verbunden wäre, entspricht der eigenen Überzeugung.
Persönliche jahrzehntelange ärztlich-praktische Erfahrungen verweisen darauf, dass für eine solche Präventivmedizin Phytotherapeutika besonders geeignet sind. Beispiele dafür werden sich in den speziellen Kapiteln immer wieder finden. Im Hinblick auf die vielfach durchgeführte Langzeitanwendung spielt die gute Verträglichkeit solcher Arzneimittel eine nicht unerhebliche Rolle. Der früher hier benutzte Begriff der Umstimmungstherapie verdeutlicht, dass hier nicht einzelne Funktionen oder intermediäre Stoffwechselschritte blockiert und damit rein symptomatische Effekte erzielt werden sollen; Prävention bedeutet vielmehr, die körpereigenen Ordnungsund Regulationssysteme zu lehren, ihre gesunde Funktion auszuüben. Das kann substitutiv, anregend oder auch dämpfend geschehen; schließlich kann das pflanzliche Arzneimittel auch eine Art Vorbild oder Modell für die gestörte Funktion bilden. Das Heilmittel wird somit zum „Erzieher“ des Organismus, korrespondiert mit diesem, erzeugt Begegnung. Es gehört zur Heilkunst des Arztes, im Einzelfall festzustellen, wann dieser „Erziehungsprozess“ seine Funktion erfüllt hat, und die Therapie zum richtigen Zeitpunkt zu beenden. Eine unnötige Fortsetzung trägt möglicherweise ein nun steigendes Risiko unerwünschter Wirkungen in sich. Erfahrungsgemäß steht das Ausmaß unerwünschter Wirkungen offensichtlich auch im Zusammenhang mit der Tatsache, inwiefern der Organismus auf eine Therapie zustimmend oder ablehnend reagiert. Dies setzt voraus, dass er über ein Wahrnehmungspotenzial (Immunsystem) verfügt, das den Nutzen und Schaden entsprechender stofflicher Vermittlung (Arznei) beurteilen kann.
Die restriktiv ausgerichteten Bereiche Physiologie und Pathologie, letztlich auch die Pharmakologie, welche alle Abläufe im Organismus als selbstgesteuerte Automatismen verstehen, lehnen die hier vorgestellten Gedanken ab oder stehen ihnen zumindest skeptisch gegenüber. Auch für manchen Leser mögen sie ungewohnt sein. Die Medizin des 21. Jahrhunderts wird jedoch immer häufiger auf die beschriebenen Gesetzmäßigkeiten, Funktions- und Regulationssysteme stoßen, um sie dann wissenschaftlich zu erfassen. Der praktische Umgang mit Phytopharmaka und ihrer Wirksamkeit wird den Arzt von deren Existenz überzeugen (Fintelmann 2007).
1.4 Bedeutung des Wirksamkeitsnachweises
Die Frage nach dem Nachweis der Wirksamkeit von Arzneimitteln wurde in den letzten Jahrzehnten sehr intensiv und kontrovers, aber ohne endgültige Aussage diskutiert. Das Dogma von der ausschließlichen Beweiskraft doppelblinder, randomisierter, kontrollierter Studienanordnungen wurde schon durch Kienle (1977) erschüttert, deshalb jedoch keineswegs aufgegeben. Kiene (1994) hat diese Fragestellung erneut aufgegriffen und deren erkenntnistheoretische Dimension bearbeitet. Es geht einerseits um den Versuch, innerhalb einer Therapie die Wirkung eines isoliert betrachteten Arzneimittels zu bewerten und alle anderen möglichen Einflüsse zu eliminieren, andererseits um die Objektivierbarkeit der dabei gewonnenen Ergebnisse. Das wissenschaftlich gesicherte Plazeboproblem besteht darin, dass die Entstehung von Plazebowirkungen nicht geklärt ist. Eine ausführliche Darstellung und wissenschaftliche Erörterung des Plazeboeffekts hat Kienle (1995) veröffentlicht.
Als wissenschaftlich indiskutabel muss der Versuch bezeichnet werden, therapeutische Erfahrung zu diskriminieren. Kein Patient hat den Wunsch, von einem ohne jede Erfahrung handelnden, seine Kenntnis ausschließlich auf doppelblind gewonnene Ergebnisse stützenden Arzt therapiert zu werden. Auf den Stellenwert der Erfahrung verwies schon Abraham Lincoln mit den Worten: „Man kann eine kleine Zahl von Leuten eine lange Zeit und eine große Zahl von Leuten eine kurze Zeit täuschen. Es ist aber unmöglich, eine große Zahl von Leuten eine lange Zeit zu täuschen!“ Auf das Feld der Pharmakotherapie übertragen heißt das: Die langfristige Anwendung einer Droge, die von Patienten immer wieder verlangt und von Ärzten verordnet wird, bezeugt ihre Wirksamkeit – auch ohne Doppelblindversuch.
Rechtliche Grundlagen in Deutschland
In Vorbereitung des neuen AMG, das am 01. Januar 1978 in Kraft trat und seither mehrfach überarbeitet und ergänzt wurde, kam der das Gesetz vorbereitende Ausschuss für Jugend, Familie und Gesundheit in seinem Bericht vom 28. April 1976 zu folgender Aussage: „Nach einmütiger Auffassung des Ausschusses kann und darf es nicht Aufgabe des Gesetzgebers sein, durch die einseitige Festlegung bestimmter Methoden für den Nachweis der Wirksamkeit eines Arzneimittels eine der miteinander konkurrierenden Therapierichtungen in den Rang eines allgemein verbindlichen ‚Standes der wissenschaftlichen Erkenntnis’ und damit zum ausschließenden Maßstab für die Zulassung eines Arzneimittels zu erheben. Der Ausschuß hat sich vielmehr bei der Beschlußfassung über die Zulassungsvorschriften, insbesondere bei der Ausgestaltung der Anforderungen an den Wirksamkeitsnachweis, von der politischen Zielsetzung leiten lassen, daß sich im Zulassungsbereich der in der Arzneimitteltherapie vorhandene Wissenschaftspluralismus deutlich widerspiegeln muß.“
Diese Aussage wurde im AMG nachdrücklich bestätigt: Nach § 26, Abs. 2, Satz 2, stellt auch das nach wissenschaftlichen Methoden aufbereitete medizinische Erfahrungsmaterial wissenschaftliches Erkenntnismaterial dar. Entsprechend § 25, Abs. 6 und ▶7, wurden Kommissionen berufen, welche die eingereichten Zulassungsunterlagen der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes am Markt vorhandenen und zugelassenen Arzneimittel zu bewerten hatten, vor allem aber, um das wissenschaftliche Erkenntnismaterial nach § 22, Abs. 3 und § 23, Abs. 3, Satz 2, aufbereiten zu lassen. Für pflanzliche Arzneimittel wurde die Zulassungs- und Aufbereitungskommission für den humanmedizinischen Bereich, phytotherapeutische Therapierichtung und Stoffgruppe, die sog. Kommission E, berufen, die im Frühjahr 1978 erstmals zusammentrat und seither in jeweils dreijährigen Arbeitsperioden in wechselnder Zusammensetzung arbeitete. Das verfügbare wissenschaftliche Erkenntnismaterial wurde von externen Gutachtern zusammengestellt und in Arbeitsgruppen der Kommission bewertet, um dann im Plenum beraten und nach ausgiebiger Diskussion verabschiedet zu werden. Nach einer Phase der Vorpublikation erfolgte eine erneute Beratung in der Kommission, wobei jedes Mitglied Änderungen vorschlagen konnte, die wiederum bearbeitet und dem Plenum vorgestellt wurden. Danach wurde die endgültige Bewertung der Arzneipflanze in Form einer Monografie verabschiedet und anschließend vom Bundesgesundheitsamt (BfArM) im Bundesanzeiger publiziert.
Inzwischen existieren annähernd 250 solcher Monografien, die teilweise bereits wieder überarbeitet wurden und neue Erkenntnisse enthalten; ergänzt auch um Monografien für typische Kombinationsarzneimittel und Standardmonografien. Neben den positive Bewertungen enthaltenden Positivmonografien vieler Arzneipflanzen entstanden auch sog. Negativ- oder Nullmonografien, wenn der Wirksamkeitsbeweis aus dem vorliegenden Erkenntnismaterial nicht ableitbar war oder dem Nutzen ein zu großes Risiko gegenüberstand. Die Risikobewertung war speziell bei toxikologischen Fragen außerordentlich schwierig, da schon ein relativ geringes Risiko zu negativer Bewertung führte; der Nutzen der entsprechenden Pflanze wurde leicht zu gering eingestuft.
In der Frage des Wirksamkeitsnachweises war sich die Kommission E bewusst, Phytotherapeutika nicht einseitig nach den Kriterien beurteilen zu können, wie sie sich inzwischen im Sinne des kontrollierten Versuchs mit statistischer Bewertung für die synthetischen Arzneimittel etabliert hatten. Sie musste insbesondere dem Auftrag des Gesetzgebers entsprechen, auch die ärztliche Erfahrung als Erkenntnismaterial bei der Bewertung von Arzneimitteln gelten zu lassen.
Die Wirksamkeit von Phytotherapeutika wurde bei Vorliegen mindestens einer der im Folgenden angeführten Bedingungen als sicher oder ausreichend wahrscheinlich beurteilt:
Wirkung und Wirksamkeit sind durch Aufnahme in angesehene Übersichtsartikel, Handbücher oder Lehrbücher belegt. Ergebnisse von kontrollierten Studien imVergleich mit Plazebo- oder Referenzsubstanzen liegen vor.Klinische Prüfungen sind dokumentiert, die für eine Zulassungsempfehlung nicht ausreichen; es sind aber in gleiche Richtung weisende experimentelle Untersuchungsergebnisse bekannt.Wissenschaftlich aufbereitetes Erkenntnismaterial liegt vor.Es liegt Erfahrungswissen vor, das allein für eine Zulassungsempfehlung nicht ausreicht; bekannt sind aber in gleiche Richtung weisende aussagekräftige experimentelle Untersuchungsergebnisse oder weitere auswertbare Beobachtungen oder Hinweise.Für die Phytotherapie stellt das AMG einen Wendepunkt auch im Hinblick auf eine moderne, nach wissenschaftlichen Kriterien bewertete Therapie dar. War sie noch im Jahr 1978 recht unbekannt und wurde nur von wenigen Ärzten praktiziert, ist sie heute mit ihren Arzneimitteln Bestandteil öffentlichen Bewusstseins; diese gelten als unverzichtbarer Anteil einer modernen Medizin und finden in der Bevölkerung und auch bei praktizierenden Ärzten immer größere Zustimmung. Dazu haben auch ihre besonders gute Verträglichkeit und die immer deutlicher werdenden Risiken der modernen synthetischen Arzneimittel und ihre begrenzte Möglichkeit, besonders im Bereich chronischer Krankheiten Heilung zu vermitteln, wesentlich beigetragen.
Internationale Standards
Inzwischen ist für Europa das Arzneimittelrecht nicht mehr ausschließlich eine nationale Frage, zumal in der Europäischen Union (EU) die Bewertung der Arzneimittel und die darauf bezogene Gesetzgebung eine Vereinheitlichung erfahren wird. Um auch hier gemeinsame Voraussetzungen für Phytopharmaka zu schaffen, hat die European Scientific Cooperative on Phytotherapy (ESCOP) eigene Monografien erstellt, auf die im Anhang dieses Buchs verwiesen wird (▶S. 397 ff.). Sie stützen sich auf die Monografien der Kommission E, haben diese jedoch um Besonderheiten anderer Länder ergänzt und sind wesentlich ausführlicher verfasst.
Wir werden neue Wege suchen müssen, um die Frage nach dem Wirksamkeitsnachweis angemessen beantworten zu können. Die von Davies proklamierte sog. Delphi'sche Methode knüpft an Verfahren an, welche die weisen Priester im altgriechischen Delphi praktizierten. Dabei wird das vorliegende Beweismaterial, einschließlich bibliografischer Unterlagen, zunächst drei Fachleuten zugeleitet, die nichts voneinander wissen und allen anderen Beteiligten mit Ausnahme einer Zentralstelle unbekannt sind. Diese erhält die „Urteile“, stellt sie ohne Namensnennung zusammen und leitet sie drei weiteren Fachleuten zu, die ebenfalls unbekannt bleiben. Reichen sie ihre Ausführungen zurück und zeigt sich dabei Einstimmigkeit oder ein eindeutiges Überwiegen einer bestimmten Meinung, so kann damit die Prüfung als abgeschlossen gelten. Andernfalls wird dieser Vorgang fortgesetzt. In den USA gelten zwölf solcher Wechsel als die Regel, insgesamt 14 als wünschenswert. So erhält man schließlich ein anerkannt positives oder negatives Resultat. Dieses Vorgehen ähnelt im Übrigen der Arbeit der Kommission E bei der Erstellung der Monografien.
Neu definiert und praktiziert wurde das Instrument der Anwendungsbeobachtung, vor allem seit der Publikation der Empfehlungen zur Durchführung von Anwendungsbeobachtungen der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS 1997). In Form einer offenen Studie werden die Erkenntnisse in der Anwendung bereits zugelassener, registrierter oder fiktiv zugelassener Arzneimittel gesammelt, überprüft und ausgewertet. Charakteristisch ist, dass das individuelle Arzt-Patienten-Verhältnis in Bezug auf Indikationsstellung, Wahl und Durchführung der Therapie kaum beeinflusst wird.
Grundlage einer neuen, in den USA entwickelten Studienform, der sog. Outcome-Studie, ist das Kriterium, dass Therapie nie aus einem einzigen Mittel oder Vorgang besteht, sondern umfassende Konzepte verlangt. Hierbei werden therapeutische Konzepte gegeneinander geprüft und bewertet. Dieses Vorgehen findet mittlerweile auch in Deutschland Anklang.
Ob und welche neuen Wege zur Wirksamkeitsfindung einer Therapie akzeptiert werden, ist offen. Sicher wird es weiterhin kontrollierte Versuche geben müssen. Auch die gut dokumentierte Einzelfallbeobachtung, welche sich bezüglich unerwünschter Arzneimittelwirkungen praktisch bewährt hat, verdient wieder mehr Beachtung. Bei seltenen Krankheitsbildern sind große kontrollierte Fallstudien gar nicht möglich; hier muss dann eine bisherige Standardtherapie zum Vergleich dienen. Auch können therapeutische Konzepte miteinander verglichen werden, wobei Zielkriterien und statistische Bewertung identisch sein müssen.
Alle mit kontrollierten Versuchen zusammenhängenden ethischen Fragen wurden in neuerer Zeit wieder vermehrt bewusst und haben zu der ständigen Einrichtung von Ethikkommissionen geführt. Darüber hinaus gilt es aber vor allem zu erkennen, dass eine ausschließliche Wirksamkeitsbetrachtung auf der Befundebene den Möglichkeiten und Realitäten von Phytotherapeutika und der Ganzheit Mensch nicht gerecht wird. Ein angemessener Wirksamkeitsnachweis muss vielmehr alle Anteile menschlichen Seins berücksichtigen.
Befund und Befindlichkeit
Gegner pflanzlicher Arzneimittel verweisen oft darauf, diese seien lediglich dazu geeignet, Befindlichkeitsstörungen zu bessern. Schon die hier vorgenommene Abwertung zeigt das Unvermögen solcher Wissenschaftler, die Realität des kranken Menschen zu begreifen. Auf dem Hintergrund ideologischer Einseitigkeit konstruierte eine sich immer mehr dogmatisierende naturwissenschaftliche Medizin das Abstraktum einer Therapiebewertung, die sich ausschließlich an objektiv beweisbaren Befunden orientiert. In der täglichen Praxis erlebt der Arzt fortgesetzt, dass der Erkrankte seine Befindlichkeitsstörung viel unmittelbarer erlebt und erleidet als die pathologischen Befunde. Allerdings ist es der modernen Medizin gelungen, immer mehr Patienten auch auf Befunde zu fixieren, sodass sie den Wert einer Therapie oft an diesen festmachen und für ihre Befindensstörung dann zusätzlich einen anderen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen.
Jedoch steht außer Zweifel, dass jeder Kranke grundsätzlich danach strebt, im Bereich von Befund und Befindlichkeit zu gesunden. Eigenartigerweise existiert die Kritik der wissenschaftlichen Medizin an therapeutischer „Befundkosmetik“ schon lange. So konnte gezeigt werden, dass bei der Behandlung chronischer Hepatitiden mit Glukokortikosteroiden zwar dramatische Verbesserungen beispielsweise der Transaminasen eintraten, das eigentliche Krankheitsgeschehen der chronisch-destruierenden Entzündung im Leberorgan, histologisch kontrolliert, aber keineswegs entsprechend gebessert wurde, sich sogar häufig unter der Therapie dramatisch verschlechterte. Man sprach deshalb von einem „whitewash effect“. Als Konsequenz gilt heute die Kortisontherapie chronischer Hepatitiden als obsolet.
Als Vertreter einer Anthropologie, die beispielsweise das Thema „Befinden“ in seiner Wertigkeit richtig einordnete, ohne den Befund oder die Befunde zu ignorieren, äußerte der Heidelberger Kliniker Plügge im Jahr 1962: „Obwohl jede Konsultation damit beginnt, daß der Kranke dem Arzt von seinem Befinden berichtet, die Erscheinungsweisen des Leib-Erlebens also ein unabdingbares Moment in dieser Begegnung zwischen Arzt und Patient bilden, fehlt in der Medizin noch völlig eine Theorie des Befindens. Das Befinden des Kranken ist uns ein diagnostischer Wegweiser, es ist nicht zuletzt Gegenstand unserer Therapie; es steht eigentlich immer zwischen dem Arzt und objektiven Krankheitsbefund, als Vermittler, als Weg zum Patienten, oft auch als Störenfried in dieser Beziehung. Trotz dieser doch recht interessanten und, wie mir scheint, dominanten Rolle, welche die Befindlichkeiten des Menschen spielen, ist alles das, was wir als Befinden, Wohlbefinden, Missbefindensweisen antreffen, ein Stiefkind der Medizin geblieben. Wir Ärzte interessieren uns eigenartigerweise nicht für eine Theorie der Befindensweisen, die natürlich eine Theorie der Arten des Leib-Erlebens sein müsste. Das liegt an dem Charakter unserer heutigen Medizin: Wir pflegen uns nicht unnötig lange bei dem Befinden unserer Patienten aufzuhalten, weil wir hinter dem Befinden immer gleich schon den Befund suchen und im Auge haben. Extrem ausgedrückt: Wir halten den objektiven Befund für das ‚Eigentliche’, das Wichtige, für das, dem wir uns verpflichtet fühlen. Der objektive Befund ist die vermeintliche ‚Wahrheit’. Wir neigen zu der Ansicht, Befinden könne trügen, der Befund jedoch nicht. Die objektiven Befunde seien es, die unser Wissenschaftssubstrat ausmachen, der subjektiven Seite dagegen komme keine bestimmende Bedeutung zu; ja, im Idealfall sei sie entbehrlich.“
Diese Aussage ist unverändert gültig, obwohl auch den wissenschaftlich orientierten Medizinern zunehmend bewusst wird, dass die subjektive Sicht der Befindlichkeit gerade im Zusammenhang mit Diagnostik und Therapie nicht länger vernachlässigt werden kann. So wurde die Frage nach Lebensqualität beispielsweise im Zusammenhang mit einer Therapie in der Onkologie wieder bewusst.
Wie schon im Zusammenhang mit der Besonderheit der Phytotherapie erwähnt, kann nach eigener praktischer Erfahrung zumindest hypothetisch formuliert werden, dass pflanzliche Arzneimittel offensichtlich primär dort angreifen, wo im menschlichen Organismus Befindlichkeit entsteht und in Krankheiten Veränderungen erfährt. Dabei sei Befindlichkeit Ausdruck des Gesamtbefindens, im Ideal also Wohlbefinden, Befinden dagegen die einzelne Symptomatik wie beispielsweise lokaler Schmerz, Völlegefühl im Oberbauchbereich, Missempfindungen einer Extremität oder Dysurie. Die objektivierbare Ebene der Befunde entsteht aus der analytischen Denkweise, die vom Ganzen immer auf die Teile schließt und in deren immer größerer Differenzierung ihre Erkenntnisse sucht. Das Befinden fordert eine eher synthetisierende Denkart, die den Blick vom Symptom als Ausdruck der Ganzheit Mensch auf diese lenkt. Die Welt des Befindens ist Ausdruck der Subjektivität des Individuums und im Allgemeinen nicht beweisbar, sondern lediglich beschreib- und nachvollziehbar (▶Abb. 1.1). Es gibt Krankheiten, die entweder ganz vom Befund dominiert sind, beispielsweise eine sich in der Befindlichkeit überhaupt nicht äußernde Hypertonie oder die symptomlose Hypercholesterinämie, oder ganz von der Befindensstörung getragen sind, ohne dass sich ein relevant objektivierbarer Befund erheben lässt, wie beispielsweise die Migräne. Beide nosologischen Einheiten eines Krankheitsgeschehens sind nicht danach zu unterscheiden, welche „richtiger“, anerkennenswerter oder im wissenschaftlichen Sinne existent ist. Noch häufiger sind Krankheiten, bei denen gestörte Befindlichkeit und pathologisch veränderter Befund gemeinsam auftreten.
Hier sei die Arbeitshypothese vorgestellt, dass Phytotherapeutika primär auf die Befindlichkeit einwirken, weil sie mit körpereigenen Regulations- und Ordnungssystemen kommunizieren und diese entweder substituieren, dämpfen oder anregen. Es wird vor allem mit dem Organismus gearbeitet (geheilt), auf der objektivierbaren Ebene der Befunde mehr gegen denselben. Deshalb heißen viele unserer modernen Arzneimittel auch z. B. Antidiabetika, Antihypertensiva, Antidepressiva. Man hüte sich aber, die Wortwahl als Bewertung für erstrebenswerte oder unbefriedigende, wenn auch notwendige Mittel zu betrachten. Der moderne Arzt muss sich vielmehr von dem gewohnten Entweder- oder trennen und zu einem Sowohl-als-auch übergehen, weil beides zusammen erst die Wirklichkeit der Ganzheit Mensch in der Medizin erfasst: In vielen Bereichen, so denen der Notfall- und Intensivmedizin, soll ein Arzneimittel eine sofortige und absolute Wirkung entfalten. Bei vielen Krankheiten, vor allem chronischen und den sog. Bagatellerkrankungen mit einem hohen Anteil an Befindlichkeitsstörung, müssen jedoch organische Dysfunktionen wieder zur normalen Funktion und damit zur Befindensnormalisierung zurückgeführt werden.
▶Abb. 1.1 Ganzheitliche Sicht des Menschen aus objektiver und subjektiver Betrachtungsebene.
Der Phytotherapie praktizierende Arzt kann im Übrigen häufig die geradezu aufregende Beobachtung machen, dass die Befundebene zeitlich nicht mit primärer Befindensbesserung korreliert, in einem zeitlich deutlich versetzten Rahmen dann aber doch auch zur Normalisierung tendiert. Das wird aus den dargestellten hypothetischen Vorstellungen verständlich.
Die nebeneinander existierenden Welten der Befunde und des Befindens erfordern also unterschiedliche Arzneimittel, je nachdem, welche Seite der Krankheit dominiert. Manche Krankheiten erfordern ausschließlich die Verordnung von Synthetika, andere sind ausschließlich mit Phytotherapeutika behandelbar. Wieder andere fordern beide Therapiemöglichkeiten, die sich ergänzen. Konsequenz dieser Gegebenheiten sind die in ▶Tab. 1.3 dargestellten vier Kategorien.
Die Ganzheit Mensch ist durch die Ebenen Befunde und Befindlichkeit sowie die Kriterien Gestimmtheit und Präsenz geprägt.
Verweisen Befunde auf die chemisch-physikalische Dimension des Körpers, ist die Befindlichkeit vor allem Ausdruck seiner Funktionalität, seines Lebens, so beschreibt Gestimmtheit die psychosomatische Ebene, d. h. das Einssein von Seele und Körper. Die Ausdrücke „psychisch“ und „psychogen“ werden heute überwiegend ungenau benutzt. Vieles, was damit bezeichnet wird, entstammt der Ebene der Funktionalität oder des Lebens, nicht unmittelbar der seelisch-leiblichen Beziehungen. Diese schaffen sich ganzheitlich Ausdruck in der Gestimmtheit, die sich wiederum in die unterschiedlichsten Stimmungen differenziert. Dass dieses auch einer modernen Medizin bewusst ist oder zumindest war, kann aus der pathologisch orientierten Anwendung des Begriffes „Verstimmungen“ erschlossen werden.
▶Tab. 1.3 Therapeutische Kategorien für Phytotherapeutika (nach Fintelmann et al. 1993).
Charakteristika
Kategorie 1
Indikationen, bei denen Phytotherapeutika Mittel erster Wahl sind und keine synthetischen Alternativen haben, z. B. toxische Lebererkrankungen.
Kategorie 2
Indikationen, bei denen Phytotherapeutika alternativ zu Synthetika eingesetzt werden können, z. B. Unruhezustände/leichte bis mittelschwere Depressionen, funktionelle Dyspepsie, unspezifische Harnwegsinfektionen.
Kategorie 3
Indikationen, bei denen Phytotherapeutika adjuvant zu einer Basistherapie eingesetzt werden, z. B. adjuvante Therapien von Herz-, Leber- und Atemwegserkrankungen.
Kategorie 4
Indikationen, bei denen der Einsatz von Phytotherapeutika nicht angemessen oder als Kunstfehler erscheint, da eine rationale Therapie mit Synthetika verhindert oder verzögert wird.
Objektivierbar zugängliche Bereiche dieser psychosomatischen Dimension wird man vor allem in der Endokrinologie und der Immunologie finden. So existiert eine wissenschaftlich akzeptierte Psycho-Neuro-Immunologie, und kein noch so wissenschaftlich eingestellter Arzt wird den hohen Anteil psychischer Symptome im Zusammenhang mit endokrinen Erkrankungen verdrängen können. Hier sei der Hinweis gestattet, dass die Begriffe Gestimmtsein oder Gestimmtheit auch im musikalischen Bereich ihren Platz haben. Der harmonische Zusammenklang eines Orchesters oder eines Kammermusikensembles setzt voraus, dass die Instrumente gleich gestimmt sind. Würde ein entsprechendes Miteinander aller Organe, Organsysteme und ihrer vielfältigen Funktionen im Gesamtorganismus nicht folgerichtig Gesundheit bedeuten?
Präsenz schließlich, die Geistesgegenwart, beschreibt die geistige Dimension des Menschen in seinem Körper. Er ist das Instrument, durch welches sich die Individualität Mensch der Welt gegenüber äußert, an welchem sie aber auch sich selbst als Ich erfährt. Hier stoßen wir auf die spirituelle Dimension der Medizin, wie sie Carl Gustav Carus im 19. Jahrhundert noch als selbstverständlich voraussetzte und die Rudolf Steiner im 20. Jahrhundert neu beschrieb.
Ein Wirksamkeitsnachweis, der einer Humanmedizin gerecht wird, wird seine Fragestellungen gegenüber der reinen Befundorientierung auf die charakterisierten Ebenen von Befindlichkeit, Gestimmtheit und Präsenz erweitern müssen (Fintelmann 2007). Allerdings existiert noch ein großer Bedarf an wissenschaftlichen Grundlagen.
1.5 Nebenwirkungen
Häufig wird behauptet, Phytotherapeutika könnten „nicht schaden“. Derartig unsinnige Aussagen proklamieren unterschwellig immer zugleich die Meinung der Gegner einer Phytotherapie gemäß dem Motto: „… weil sie eben auch nicht wirken!“ Freilich betonen auch die Befürworter der Phytotherapie oft die angebliche Unschädlichkeit dieser Arzneimittel.
Laut Feststellung der modernen Pharmakologie sowie der mit ihr verbundenen Toxikologie haben alle Arzneimittel zugleich auch Nebenwirkungen, weisen also erwünschte und unerwünschte Wirkungen auf. Diese fast paradigmatische Aussage ist dann berechtigt, wenn ein Arzneimittel über große kollektive und Mittelwerterhebungen untersucht und damit kein direkter Bezug zu dem individuellen Patienten hergestellt wurde. Im Grunde genommen widerspricht sie aber der alten, ärztlich-ethischen Forderung des „nil nocere“ und provoziert so eine fundamentale Frage: Kann eine ethisch fundierte Humanmedizin wirklich weiterhin dulden, dass die Schädigung des einzelnen Menschen billigend in Kauf genommen wird, weil die Therapie nicht auf das Individuum bezogen wird, sondern auf der Basis statistisch ermittelter, kollektiver Erhebungen erfolgt?
Eines der Anliegen dieses Buchs ist es, den Arzt wieder in die Lage zu versetzen, auf die einzelne Patientenpersönlichkeit stärker einzugehen und auch durch freie Rezeptur die für die jeweilige Konstitution und Krankheit angemessene Therapie zu finden. Eine wirklich moderne Phytotherapie wird vor allem eine Individualtherapie sein und jedem Therapieschematismus eine Absage erteilen.
Dennoch kann und muss akzeptiert werden, dass auch bei einer individuellen Vorgehensweise die Reaktion des Individuums auf die gewählte Therapie nicht absolut sicher voraussagbar ist. Insofern kann nie davon gesprochen werden, dass eine Therapie, welcher Natur sie auch sei, a priori unschädlich sei. Schon das Potenzial allergischer Reaktionen, das gerade für Phytotherapeutika nicht unterschätzt werden darf, steht als Beweis für diese Aussage. Insbesondere müssen hier aber die oben dargestellten vier Dimensionen Befunde, Befindlichkeit, Gestimmtheit und geistige Präsenz berücksichtigt werden. Der Arzt wird lernen müssen, die Auswirkungen seiner Therapie auf diese unterschiedlichen Seinsebenen angemessen zu bewerten, und dabei feststellen, dass hier unerwünschte Wirkungen häufiger als bisher angenommen eintreten.
Hinsichtlich der Nebenwirkungen unterscheiden sich Phytotherapeutika von den Synthetika in Häufigkeit und Intensität, nicht aber grundsätzlich. Zweifellos sind Phytotherapeutika besser verträglich als die mit einem erheblichen Potenzial an Nebenwirkungen versehenen Synthetika. Die Erklärung scheint einfach: Auf dem Hintergrund einer langen gemeinsamen Evolution der Natur, hier von Pflanze und Mensch, sind adaptive Vorgänge im Metabolismus viel länger und erfolgreicher vorgebildet als für synthetische Stoffe, die z. T. erst im 20. Jahrhundert entdeckt und angewendet wurden. Der Fremdstoffmetabolismus im menschlichen Organismus, der vor allem durch die Leber vollzogen wird, weist quasi archaische Züge auf. Folgerichtig wählt der Organismus bei der Verarbeitung synthetischer Fremdstoffe (Xenobiotika) Stoffwechselschritte, die beispielsweise zu Radikalen führen und damit aus einem zunächst indifferenten Stoff eine aggressive Noxe entstehen lassen. Eines der bekanntesten Beispiele ist der Tetrachlorkohlenstoff, der erst als Trichlorkohlenstoff seine lebertoxischen Wirkungen entfaltet.
Risiken und unerwünschte Wirkungen
In seiner 1990 verfassten Arbeit über Risiken und unerwünschte Wirkungen pflanzlicher Arzneimittel unterscheidet Frohne
Pflanzen mit stark wirksamen Inhaltsstoffen und entsprechend hohem Risikopotenzial, die weitgehend aus dem modernen Arzneischatz verschwunden sind oder von denen nur noch isolierte Reinsubstanzen Verwendung finden,pflanzliche Arzneimittel mit wirksamen Inhaltsstoffen, bei denen nach Überdosierung oder chronischem Gebrauch (Missbrauch) unerwünschte Wirkungen auftreten können,pflanzliche Arzneimittel mit nicht nachgewiesener oder kontrovers beurteilter therapeutischer Wirkung, bei denen aber durchaus unerwünschte Wirkungen möglich sind, undpflanzliche Arzneimittel, die aufgrund nicht deklarierter Zusatzstoffe gefährliche Nebenwirkungen haben können.Lange Zeit wurde die Diskussion um Für und Wider der Phytotherapeutika vor allem im Hinblick auf ihre Wirksamkeit geführt. Mittlerweile geht es vor allem um die Risikobeurteilung, wobei nachgewiesene mutagene und kanzerogene, sehr viel seltener auch teratogene Wirkungen betont werden. Den Anfang machte die Osterluzei (Aristolochia clematitis), nachdem für isolierte Aristolochia-Säure im Langzeittiermodell die Entstehung maligner Tumoren nachgewiesen wurde. Seither wurden für verschiedene Heilpflanzen solche mutagenen oder kanzerogenen Potenziale aus Experimenten abgeleitet, wobei die größte Diskussion um Pyrrolizidinalkaloide, Anthrachinone und Querzetin entstand. Die solcher Einschätzung zugrunde liegenden Vorstellungen sind freilich stark infrage zu stellen. So wurde bereits auf die Problematik der Übertragbarkeit von Tierversuchen oder bestimmten Zelllinien auf den Gesamtorganismus Mensch verwiesen. Die Fülle von Repair-Mechanismen des menschlichen Immunsystems und die individuelle Reaktion bleiben hier außer Betracht. Das Tier reagiert viel grundsätzlicher artgemäß, wird allerdings auch auf die gleichmäßige Reaktion durch Inzucht (Wistar-Ratte) spezialisiert.
Vogel (1984) verweist auf das Problem der Mutagenität und Kanzerogenität, das intensiv am Beispiel pyrrolizidinalkaloidhaltiger Arzneipflanzen wie Symphytum, Tussilago, Petasites u. a. diskutiert wird. Der Gehalt an potenziell mutagenen bzw. kanzerogenen Pyrrolizidinalkaloiden wurde mittlerweile für entsprechende Arzneimittel auf eine maximal verabreichbare Dosis begrenzt.
Auch allergische Reaktionen werden als typische Nebenwirkungen pflanzlicher Arzneimittel thematisiert. Hier haben vor allem Hausen u. Vieluf (2001) entscheidende wissenschaftliche Arbeit geleistet, die bereits in zweiter Auflage in ihrem Buch Allergiepflanzen – Pflanzenallergene veröffentlicht wurde.
Dosis-Wirkungs-Beziehung
Äußerst problematisch ist im Übrigen die Ignoranz von Dosis-Wirkungs-Beziehungen. Fast alle Tierexperimente, die den Verdacht auf Kanzerogenität von Phytotherapeutika auslösten, unterscheiden sich im Hinblick auf die therapeutischen Dosen extrem von entsprechenden Experimenten, bei denen Menschen im Mittelpunkt standen. Hinzu kommt die völlig abnorme Fütterungssituation solcher Versuchstiere, die über Monate oder Jahre durch Schlundsonden die zu untersuchende Droge einverleibt bekommen und damit in eine unnatürliche Situation versetzt werden, die allein schon pathologische Organveränderungen auslösen kann. Ein toxikologisches Paradigma lautet, dass ein potenziell mutagener oder kanzerogener Stoff bereits durch ein einziges Molekül eine entsprechende Zellmutation auslösen könne und insofern keinerlei dosisabhängige Verordnung zuzulassen sei. Besonders schwer wiegt schließlich das Argument, dass gerade bei diesen Fragestellungen keine Humantoxikologie existiert und diese auch nicht durch entsprechende epidemiologische Untersuchungen ersetzt worden ist. Am Beispiel der Pyrrolizidinalkaloide kann belegt werden, dass bei sog. Komfrey-(Symphytum-)Essern bzw. bei Komfrey-Fütterung von Tieren mit extrem hohen Tages- und Langzeitdosen, verglichen mit der therapeutischen Anwendung von Symphytum, weder beim Menschen noch beim Tier vermehrt Karzinome auftraten (▶S. 286 f.). Dennoch wurde das theoretisch formulierte Risiko aufrechterhalten.
Wie tendenziell mit – vor allem am Markt erfolgreichen – Phytopharmaka umgegangen wird, zeigt ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 23. Februar 2000 (Nr. 45, S. 1). Die Überschrift „Tückisches Johanniskraut“ nimmt Bezug auf aktuelle Veröffentlichungen zu Wechselwirkungen von Johanniskraut z. B. mit dem AIDS-Mittel Indinavir, dessen Wirkung ebenso vermindert wurde wie die von Zyklosporin. Dies wurde bei zwei Patienten mit Herztransplantationen nachgewiesen, die ein Johanniskrautpräparat wegen depressiver Verstimmungen einnahmen. Gemäß dem oft postulierten Satz „Keine Wirkung ohne Neben- (oder eben Wechsel-)wirkung“ müssten diese Beobachtungen eher dazu führen, hierin einen weiteren Beleg der Wirkung von Johanniskraut zu sehen. Stattdessen wird es als „tückisch“ bezeichnet, ein tendenziöser Ausdruck, der nach unserer Erfahrung für synthetische Arzneimittel mit ihren überwiegend obligaten Wechselwirkungen völlig ungebräuchlich ist. Im Übrigen sind solche Beobachtungen von großer Bedeutung und sollten bei der Verordnung unbedingt berücksichtigt werden.