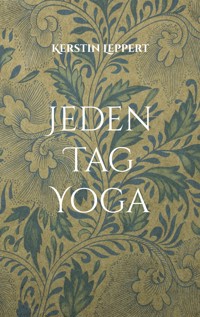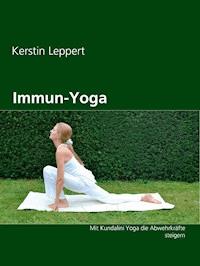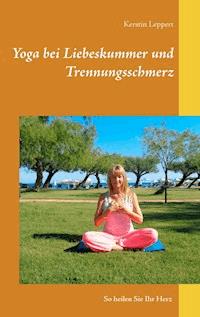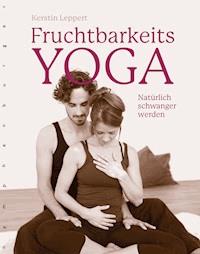9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur MensSana eBook
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Ein befreiender Yoga-Roman für alle, die in Krisenzeiten einen Neuanfang wagen und ihrer inneren Stimme folgen wollen. Die Hamburgerin Britta Winterberg ist Ende vierzig und zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich allein. Als sie im Flieger nach Bali sitzt, ahnt sie nicht, dass sie nie mehr nach Hamburg zurückkehren wird. Eigentlich wollte sie sich nur für eine Zeit zurückziehen, um in der Nähe ihres spirituellen Lehrers zu sein. Nach der Trennung von ihrem Mann steht sie jedoch vor einer noch größeren Herausforderung, als sie ahnt. In der Weisheit des Yoga und der zarten Liebe zu Yogameister Guru Kirpal Singh findet sie allmählich zu ihrer wahren Bestimmung. Vieles muss sie lernen, aber eine wachsende innere Stärke lässt sie selbst mit ihrem schwersten Schicksalsschlag Frieden schließen. Im Laufe der Zeit kann sie die Lehren des Kundalini Yoga immer mehr leben. Schafft sie es, die alten Muster und traumatischen Ereignisse loszulassen und sich selbst zu lieben? Kerstin Leppert begleitet ihre Protagonistin einfühlsam und humorvoll. Man ist berührt von Brittas Straucheln, leidet mit ihr und ist inspiriert von ihrer Sehnsucht, innerlich zu wachsen. Alle, die "Eat, Pray, Love" geliebt haben haben, werden dieses Buch verschlingen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Kerstin Leppert
Lektionen des Herzens
Ein Yoga-Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Eine spirituelle Reise zum Sehnsuchtsort Bali – berührend, ergreifend, inspirierend!
Die Hamburgerin Britta Winterberg beginnt ein neues Leben auf Bali. Während eines Retreats bekommt sie eine Ahnung von ihrem wahren Potenzial und entschließt sich zu bleiben. In Yoga-Meister Kirpal Singh findet sie einen wirklichen Freund und Wegbegleiter. Er hilft ihr, alte Muster und traumatische Ereignisse loszulassen. Nachdem sie die Schatten der Vergangenheit bewältig hat, wächst sie in ein neues Selbstbewusstsein hinein und erkennt ihre tiefe Berufung ...
Ein befreiender Roman für alle, die in Krisenzeiten einen Neuanfang wagen und ihrer inneren Stimme folgen wollen. Kerstin Leppert gelingt in den "Lektionen des Herzens" eine wundervolle Synthese von Yoga, spiritueller Sinnsuche und der Geschichte einer liebenswert menschlichen Protagonistin. Alle, die "Eat, Pray, Love" verschlungen haben, werden dieses Buch lieben.
Inhaltsübersicht
Widmung
»Oh, ich lache, wenn [...]
Prolog
1. Wenn du glücklich bist, kommt das Glück zu dir. Denn Glück wird immer von Glück angezogen.
2. Sobald ich in mir zu Hause bin, bin ich überall zu Hause.
3. Dieser Hokuspokus, einen äußeren Gott zu finden, ist vorbei. Wir sind hier, um Gott in uns selbst zu finden.
4. Es ist dein Geburtsrecht, glücklich zu sein.
5. Yoga wurde entwickelt, damit Menschen gesund, glücklich, heilig und bewusst werden.
6. Im Lieben gibst du, ohne die Fehler der anderen zu beachten – so wie die Sonne ihr Licht und ihre Wärme jedem Wesen gewährt.
7. Der Weg gehört denen, deren Herzen nicht aus Stein und deren Köpfe nicht so aufgeblasen sind, dass sie die Stimme ihrer Seele nicht mehr hören können.
8. Befreie dich vom Ego, damit du Liebe empfangen und sie mit allen teilen kannst.
9. Liebe ist Liebe. Es gibt keine Bedingung. Liebe kann nur aus der Fülle des befreiten Herzens empfangen – und gegeben – werden.
10. Wir sind nicht menschliche Wesen, die eine spirituelle Erfahrung machen, sondern spirituelle Wesen, die eine Erfahrung als Mensch machen.
11. Yoga schenkt dir Lebensfreude. Diese Freude findest du nur in dem Licht in dir.
12. Du bekommst ein Kind, um es darauf vorzubereiten, seine Lebenszeit bis in die Unendlichkeit zu meistern.
13. Wir sind Atma, die Seele, gekommen, um eine menschliche Erfahrung zu machen.
14. Liebe ist eine immerwährende Erinnerung. Sie kommt mit jedem Atemzug, lebt in dir und erhebt dich.
15. Halte durch und du wirst gehalten.
16. Wenn du meditierst, beginnt dein Unterbewusstsein, den ganzen Müll loszuwerden. Mantra ist die Seife, die ihn wegwäscht.
17. Verliere dich nicht im Außen und werde zum Opfer. Richte dich nach innen und erlange Meisterschaft.
18. Yoga schenkt den Mut, das eigene Licht zu erkennen und zu leben.
19. Zu lieben ist der eigennützigste Akt überhaupt. Die Liebe gibt dir Schutz, Würde und Ausstrahlung.
20. Du kannst überall, auf der ganzen Welt, nach Befriedigung suchen, aber die Erfüllung muss von innen kommen.
21. Hasse niemanden, liebe jeden. Es kostet dich nichts. Liebe kostet nie etwas.
22. Werde weder so verbittert, dass man dich loswerden will, noch so süß, dass man dich verspeisen möchte.
23. Freiheit ist, wenn die Dinge zu dir kommen, anstatt dass du ihnen nachjagst.
24. Wenn dein inneres Licht dich führen kann, wirst du dich selbst übertreffen.
25. Folge niemandem und höre auf niemanden. Finde deine eigene Heiligkeit in dir.
26. Es ist deine Hingabe an die Unendlichkeit, die dich befreit.
27. Der höchste Wunsch ist es, wunschlos zu werden – zugleich der einzige Wunsch, der es wert ist.
Schlussbemerkung
Für Laura, in Liebe
»Oh, ich lache, wenn ich höre, dass der Fisch, der von Wasser umgeben ist, durstig ist. Ohne Rast irrst du durch die Wälder, obwohl die Wirklichkeit in deinem eigenen Sein liegt. Doch ob du nach Benares oder Mathura wanderst – bis du Gott nicht in deinem eigenen Sein gefunden hast, wird die ganze Welt ohne Bedeutung für dich bleiben.«
(Kabir 1440–1518)
»Den in Liebe und Hingabe treu Unerschütterlichen gebe ich spirituelle Weisheit, sodass sie zu mir gelangen können. Aus Mitleid vernichte ich die Finsternis ihrer Unwissenheit. Aus ihrem Inneren heraus zünde ich die Leuchte der Weisheit an und vertreibe alle Finsternis aus ihrem Leben.«
(Aus der Bhagavad Gita)
Prolog
Lovina, Bali.
Es ist so viel Zeit vergangen und doch bist du immer noch da. Ganz nah, bei mir. Ich trage dich in meinem Herzen. Für immer. Du bist ein Teil von mir, so wie ich ein Teil von dir bin. Wir gehören zur Unendlichkeit. Ich bin du, du bist ich und wir sind eins.
Das Meer ist warm. Sanft plätschert es an den Strand. Die Sonne versinkt blutrot im Wasser. Ich kann mich an diesem Schauspiel nie sattsehen. Es führt mir das Wunder der Existenz vor Augen. Jeder Tag ist ein Geschenk von vollkommener Schönheit. Ich verneige mich demütig, lachend und weinend zugleich. Und ich erinnere mich an die Worte meines Lehrers, als er aus dem Anand Sahib rezitierte: »Meine liebende Seele, erinnere dich an den wahren Gott. Tue nichts, für das du am Ende Reue empfinden wirst. Höre stattdessen ihm zu, der immer mit dir sein wird. Er ist überall und in allem. Jene, die seine Gegenwart wahrnehmen, sind gesegnet.«
Ich bin hier. Jetzt. Ganz.
1.Wenn du glücklich bist, kommt das Glück zu dir. Denn Glück wird immer von Glück angezogen.
Ich habe es getan. Ich bin in ein Flugzeug gestiegen, das mich nach Amsterdam gebracht hat, dann in ein weiteres nach Singapur und schließlich in ein drittes, das mich nach Denpasar, die Inselhauptstadt Balis, befördert hat. Es war ein endloser Flug, rund 22 Stunden habe ich auf klimatisierten Flughäfen und in engen, abwechselnd stickigen und heruntergekühlten Flugzeugkabinen verbracht, eingezwängt wie eine Sardine zwischen übergewichtigen, nach Schweiß müffelnden Mitreisenden, betäubt von Kinofilmen, die über einen Minibildschirm flimmerten, und etlichen Gläsern saurem Wein. Mein erster Flug nach Südostasien ist zugleich mein erster Flug ganz allein. Angesichts der vielen Paare – egal ob glücklich oder unzufrieden – ist es schwer, sich nicht wie amputiert zu fühlen. Zu Hause hatte ich drei Monate Zeit, mich an mich selbst zu gewöhnen, an eine Britta, die nicht mehr zu Stefan gehört. Eine Getrennte. Aber das hier ist eine neue Situation, die mich auf mich selbst zurückwirft. Als Kind bin ich mit meinen Eltern in den Urlaub geflogen, später dann mit Freundinnen, aber nie allein. Mein ganzes Erwachsenenleben über ist Stefan an meiner Seite gewesen, natürlich reisten wir in der Businessclass. Eine Selbstverständlichkeit wie die Tatsache, nur in den besten Hotels zu logieren.
Bei der Buchung im Internet bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass ich woanders sitzen könnte als in dem abgetrennten vorderen Bereich, wo die Sitze breit und bequem sind, das Essen besser und die Abstände zu den anderen Passagieren größer. Ich habe nicht einmal gewusst, was so ein Flug kostet. Um alles hat Stefan sich gekümmert oder jemand, der von ihm beauftragt wurde. Ich Luxusweibchen musste immer nur meinen Rimowa-Koffer packen und zur richtigen Zeit ins Taxi steigen. Umso überraschter war ich über meinen Sitzplatz in der Economyclass.
Ich taumle durch die Gänge des Flughafens von Denpasar zum Gepäckband. Völlig übermüdet, denn im Flugzeug konnte ich kaum schlafen, trotz weininduzierter Benommenheit. Hinzu kommt die Zeitverschiebung. Hier ist es sechs Stunden später als in Hamburg, aber man hätte mir auch irgendeine Fantasiezeit nennen können – ich bin vollkommen aus der Zeit gefallen. Bei der Zwischenlandung in Singapur ist mir aufgefallen, dass die Asiaten eine Vorliebe für chemisch-süße Düfte hegen, die sie überall versprühen, und für bunte Teppichböden. Im Ankunftsbereich liegt ein braun-orange-gelber Bodenbelag mit psychedelischem Muster, der fast Halluzinationen hervorruft. Es ist erstaunlich leer. Wenige Menschen stehen um ein Gepäckband, das sich lustlos in Gang setzt und vereinzelte Gepäckstücke befördert, die niemandem zu gehören scheinen. Die Luft ist klebrig-warm. Nach einer gefühlten Ewigkeit taucht mein Rimowa-Koffer auf. Ich zerre ihn vom Band. Er wiegt Tonnen. Meine Erschöpfung bringt mich gefährlich nahe an den Rand des Selbstmitleids, an diesen riesigen Krater, in den ich jederzeit stürzen könnte. Ich nehme mich zusammen, schließlich bin ich nicht bis ans andere Ende der Welt geflogen, um zu heulen. Wie weit Bali entfernt ist, wurde mir bewusst, als wir Thailand überflogen, Indien streiften und uns auf Australien zubewegten. Ich bin nicht nur in alltäglichen Angelegenheiten, sondern auch in geografischen Belangen naiv. Erst einmal muss ich zur Toilette und dort meine Strumpfhose ausziehen, die Strickjacke loswerden. Über der – einigermaßen europäisch aussehenden Schüssel – hängt ein lustiges Schild: Es stellt eine Person dar, die mit den Füßen auf der Klobrille steht und durchgestrichen ist. Ich fotografiere es und schicke es Nickie.
Es folgt die offizielle Einreiseprozedur. Im Flugzeug musste ich eine winzige Karte ausfüllen, die »Arrival Card«, in die die Aufenthaltsadresse eingetragen wird. Dreißig Tage dürfte ich ohne Visum bleiben, doch mein Rückflug geht in zweieinhalb Wochen. Ein freundlich lächelnder Beamter begrüßt mich mit einem »Welcome to Bali!«. Nachdem ich den Zoll passiert habe, wo mein Gepäck durchleuchtet wird und ich bestätigen muss, weder Waffen noch Pornos, Tiere oder Pflanzen dabeizuhaben, bewege ich mich auf den Ausgang zu. Hinter einer Glaswand stehen mindestens fünfzig Balinesen und halten Schilder mit Namen von Passagieren oder Resorts hoch. Ich habe keinen Transfer gebucht, das winzige Hotel hat das nicht angeboten, und muss erst einmal Geld tauschen. Nach dem Duty-free-Shop, den alle Ankommenden zwangsweise durchqueren, finde ich mehrere Wechselstuben und entscheide mich für eine, die mir seriös erscheint. Ich schiebe dem ebenfalls freundlich lächelnden Balinesen einen Hunderteuroschein über den Tresen und erhalte die aberwitzige Summe von knapp 1,6 Millionen Rupiah – ein Packen bunter, teilweise fast zerfledderter Scheine, die wie Spielgeld aussehen.
Das Flughafengebäude ist halb offen, es scheint keine abgetrennten Räume zu geben. Überall wuchern Pflanzen. Plötzlich stehe ich draußen und die Luft erschlägt mich beinahe in ihrer Dichte und Feuchtigkeit, legt sich wie ein Saunatuch auf mich. Sofort begreife ich, was tropische Hitze ist. Ich beginne augenblicklich zu schwitzen. Um mich herum haben alle irgendein Ziel. Einige dunkelhäutige Männer in rockähnlichen Gewändern, die bislang plaudernd herumgestanden haben, entdecken mich und schreien um die Wette »Taxi, Taxi!«. Stefan hat mir stets eingeschärft, dass solche Schreihälse Abzocker sind, also gehe ich schnell weiter. Tatsächlich entdecke ich kurz darauf einen Taxistand, wo ich zu einem festgelegten Preis einen Coupon erwerbe. Ich ziehe meinen Koffer hinter mir her zur Warteschlange der Wagen. Obwohl er vier Rollen hat, wird er immer schwerer, hinzu kommt der Bordtrolley, den ich mit Utensilien für zwei Nächte gefüllt habe, für den Fall, dass mein Gepäck nicht ankommen sollte.
Der Fahrer des ersten schäbigen Gefährts steigt aus, verstaut die Koffer und redet in einem unverständlichen Englisch auf mich ein. Ich zeige ihm den Coupon mit dem Ziel »Seminyak« und versuche ihm begreiflich zu machen, wo ich dort genau hinwill, er nickt und steigt ein. Ich nehme auf der Rückbank Platz. Die Plastiksitze saugen sich schmatzend an meinen Schenkeln fest.
»Casa Seminyak«, versuche ich ihm zu verdeutlichen. Bevor das Retreat losgeht, will ich eine Woche am Indischen Ozean verbringen. Ich bin stolz auf mich, dass ich die Buchung allein geschafft habe, Booking.com sei Dank. Der Taxifahrer schüttelt den Kopf. Ich reiche ihm mein Handy, wo ich das Ziel bei Google Maps markiert habe. Er beugt sich darüber, murmelt etwas und fährt los.
Der Verkehr ist höllisch. Ich brauche einen Moment, um zu begreifen, dass Linksverkehr herrscht, da das Chaos aus schrottreifen Autos und Mofas vollkommen unübersichtlich ist. Aus Gassen und Einfahrten schießen mit mehreren Personen beladene Mofas heraus, flitzen vorbei, um dann scharf abzubremsen. Meinen Taxifahrer lässt das anscheinend kalt. Anders als andere Angehörige seiner Zunft regt er sich nicht auf, die Hupe betätigt er jedoch wie die anderen ununterbrochen als eine Art Verständigungsmittel. Mir bleibt schleierhaft, was sie sich damit sagen wollen. Es wird gehupt, wenn sie überholen wollen, wenn der andere sie überholen kann oder nicht überholen soll, wenn sie abbiegen wollen oder jemanden vorlassen oder nicht vorlassen wollen. Komischerweise scheinen alle Verkehrsteilnehmer die Signale zu verstehen.
Denpasar ist nicht nur die größte Stadt der Insel, sondern auch die Hauptstadt Balis, wie ich meinem Reiseführer entnehme. Es soll angeblich einen mehrtägigen Aufenthalt wert sein, obwohl das, was ich davon sehe, mich nicht dazu animiert. Nachdem wir erst gut vorangekommen sind, geht es nun meterweise Richtung Zentrum. Entlang der Hauptstraße stehen blinkende, schreiend bunte Schilder nebeneinander, weisen auf Unterkünfte, Bars und Restaurants hin. Idyllisch ist das nicht, sondern erinnert an ähnliche Amüsiermeilen in Touristenzentren auf der ganzen Welt. Es kommt mir so vor, als wäre ich nicht auf Bali, sondern am Ballermann. Hier schlendern vorwiegend europäisch aussehende Touristen in zu knapper Bekleidung und mit hummerroter Haut herum. Derweil herrschen im Inneren des Taxis mittlerweile arktische Temperaturen. Ich vermisse meine Strickjacke und die Strumpfhose, wickle mich fester in meinen Schal und versuche den Fahrer zu bitten, die Klimaanlage zu drosseln. Er versteht mich nicht.
Schließlich lassen wir das Zentrum Denpasars hinter uns und der Verkehr fließt wieder. Ich kann mich nicht sattsehen an all dem, was vorbeizieht. Es ist skurril. Auf manchen der motorisierten Zweiräder sitzen vier oder fünf Menschen – Vater und Mutter sowie zwei bis drei Kinder, höchstens eine Person, meist der Fahrer, trägt einen Helm. Körbe mit undefinierbarem Inhalt werden transportiert, manchmal sogar auf dem Kopf balanciert, alle sind leicht bekleidet, tragen Flip‑Flops. Ich mag mir nicht vorstellen, was passiert, wenn eine solche Familienkutsche in einen Unfall verwickelt wird. Falls es Verkehrsregeln geben sollte, verstehe ich sie nicht. Dennoch scheint es mir, dass die Fahrer mehr aufeinander achten als in Deutschland, wo jeder auf sein Recht pocht. Das Geschehen auf den Straßen erweckt den Anschein eines organischen Miteinanders. Selbst fahren käme für mich jedoch nicht infrage.
Seminyak liegt links unten, wenn man auf die Karte von Bali schaut, knapp über Kuta, das als Amüsiermeile Balis keinen besonders guten Ruf hat. Überwiegend Australier sollen hier zum Surfen, Feiern und Flirten herkommen. Nichts, wonach mir der Sinn steht, daher habe ich mich für das ruhige Seminyak entschieden. Es soll idyllischer sein, dabei immer noch an der fantastischen Sunset-Seite liegen.
Die Straßen werden schmaler. Teilweise sind es nur zwei Meter breite Gassen. Um etwaigen Gegenverkehr scheint der Fahrer sich keine Sorgen zu machen. Wenn plötzlich Scheinwerfer vor uns auftauchen, fährt er rückwärts in eine Einfahrt hinein oder so dicht an den Rand, dass die Autos sich in Millimeterarbeit aneinander vorbeischieben.
Wir kommen an einigen kleinen Hotels oder Privatunterkünften vorbei, aber meines ist nicht dabei. Der Fahrer bedeutet mir, ihm noch einmal die Adresse zu zeigen. Ich schaue auf mein Handy, laut Google Maps sind wir daran vorbeigefahren. Kein Problem – im Rückwärtsgang rasen wir die Gasse entlang. Das Adrenalin schießt mir durch die Adern. Was, wenn jetzt jemand abbiegt oder von hinten kommt? Ich bin es, die das winzige Schild entdeckt.
»It is there! Casa Seminyak!« Ich zeige auf den verblichenen Schriftzug, rosa auf einem weißen Blechschild. Wir biegen in eine unbefestigte Auffahrt ein. Rechts und links stehen unbeleuchtete Häuser, mir kommen Zweifel, was habe ich da nur gebucht? »Schnuckeliges Boutique-Hotel unter deutscher Leitung, sympathisches Hide-away« hieß es im Internet. Am Ende des Weges hält das Taxi an. Über dem Eingang des Hauses, das im Halbdunkel vor mir liegt, verkündet ein ähnlich rostiges Schild, dass ich angekommen bin. Ich fühle mich so allein wie noch nie zuvor.
Er zog einen voluminösen Blumenstrauß hinter dem Rücken hervor wie ein Zauberkünstler, der ein Kaninchen aus dem Hut zauberte. Rote Baccara-Rosen, bestimmt zwanzig Stück. Solche Gesten beherrschte er und ich wurde sofort schwach, obwohl ich wusste, dass es überkandidelt war.
»Rosen, aha, vom Flughafen und bestimmt überteuert.«
»Sie sind jeden Euro wert, sie duften sogar, riech mal …« Stefan trat näher und mir wurde schwindelig vom atemberaubenden Duft der Rosen – aromatisierten sie die neuerdings?
Ich wollte ihm die Blumen abnehmen, aber er bestand darauf, selbst die Stiele zu kappen und sie in der Vase zu drapieren. Jede einzeln, sorgfältig und liebevoll.
»Ich fände es schön, wenn wir uns mehr austauschen.« Es konnte nicht sein, dass ich mich von ein paar Rosen einwickeln ließ.
»Austauschen? Du meinst, reden? Oder schreiben?«
»Ja. Du schaust doch sonst ständig auf dein Handy.«
»Hmm, ja. Wir können auch anders kommunizieren. Ich finde das besonders aufschlussreich.«
Er schaute mir in die Augen, hob mein Kinn an und küsste mich zart auf die Lippen. Es war ein Kuss, der sich bei aller Vertrautheit seltsam fremd anfühlte. Stefan küsste mich wieder, leidenschaftlicher, inniger. Die Härchen auf meinen Unterarmen stellten sich auf. Er zog mich in seine Arme und das Spiel, tausendfach gespielt, begann. Ein Spiel von Stärke und Schwäche, Macht und Unterwerfung oder Schutz und Verführung, unsere körperlichen Gegensätze hatten uns immer verbunden. Er hob mich hoch, trug mich ins Schlafzimmer, legte mich aufs Bett. Dann zerrte er sich das Sakko vom Leib. Ich half ihm leicht atemlos, das Hemd aufzuknöpfen, am Kragen war ein roter Fleck, den ich sofort wieder vergaß. Es schien ihm nicht schnell genug zu gehen, er riss das Hemd auf, sodass die Knöpfe flogen, dann widmete er sich mir mit der Hingabe, die ich an ihm liebte. Wie vermutlich alle Langzeitpaare folgten wir unserer speziellen Choreografie, wir konnten den Verlauf verlangsamen oder beschleunigen, kannten einander in- und auswendig. Und trotzdem gab es den Überraschungsmoment, die Fremdheit, die jedes Mal überbrückt wurde. Stefan roch heute anders. Und er fasste mich anders an als sonst, fester. Ich war irritiert. Und mochte es.
Unser Sex war von Anfang an atemberaubend gewesen. Wir schienen unsere Ergänzung gefunden zu haben, das fehlende Puzzleteil, wir waren Yin und Yang, zumindest im Bett. Nie gab es komische Momente mit ungeschickten Händen oder unerträglichen Fummeleien an Stellen, die nicht berührt werden wollten. Mir war sofort klar, dass wir etwas Außergewöhnliches hatten. Und es blieb so. Mehr als zwanzig Jahre lang. Während meine Freundinnen jammerten, dass sie nie zum Orgasmus kamen und sich über unsensible, egoistische Begattungen ihrer Ehemänner beschwerten, waren wir Team, Eltern und Liebespaar gewesen.
»Madame?« Der Fahrer hat sich zu mir umgedreht und mustert mich besorgt.
Ich lächle, zahle und steige aus. Irgendwo in der Nähe bellen Hunde. Mir stellen sich die Nackenhaare auf. Seit der Kindheit, als einmal ein Schäferhund geifernd vor meinem Kinderwagen stand, habe ich Angst vor Hunden. Mein übermüdeter Geist suggeriert mir einen Köter, der sich aus der Dunkelheit auf mich stürzt.
Der Fahrer hebt die Koffer aus dem Kofferraum und klopft mir beruhigend auf die Schulter: »Dogs here everywhere. No danger.« Eine nicht sehr angenehme Vorstellung, dass hier überall Hunde patrouillieren und ihr Revier verteidigen. Ich hätte ein Pfefferspray mitnehmen sollen.
Die Tür zur Lobby steht offen, aber es ist niemand zu sehen. Nach Ortszeit ist es zehn Uhr abends. Ein wunderschöner halbrunder Raum präsentiert sich mir, der Boden mit schwarzen und weißen Fliesen schachbrettartig gekachelt, die Wände zartgelb gestrichen, geschmackvolle Rattanmöbel, Tische und Stühle im Bistrostil. In der Mitte eine runde Tanzfläche, offenbar wird der Saal noch anderweitig genutzt. Ich läute das Glöckchen auf dem Schreibtisch, das den Empfangstresen darstellt. Nach einigen Minuten erscheint ein Balinese, der kaum Englisch versteht. Sabine aus Bremen, der laut Website das Hotel gehört, scheint nicht da zu sein. Die Buchungsbestätigung, die ich vorlege, wird verstanden, und der schmächtige junge Mann bedeutet mir, ihm zu folgen. Er lässt es sich nicht nehmen, mein Gepäck die Treppe hinunter in eine Art Innenhof zu wuchten. Vor uns glitzert ein rechteckiger Pool im Mondlicht, links erstrecken sich die Zimmer über zwei Etagen. Es gleicht einem amerikanischen Südstaatenhaus, zumindest stelle ich mir die so vor. Jedes Zimmer hat entweder einen Balkon oder eine Terrasse, in üppige Vegetation eingefasst. Pflanzen, die ich aus Deutschland nur in Töpfen vor sich hin mickernd kenne, blühen hier meterhoch. In der schummrigen Beleuchtung wirken sie gigantisch.
Mein Raum ist im Erdgeschoss. Als Erstes drehe ich die Klimaanlage herunter, die süßlich-muffige Kälte verströmt. Neben einem Kingsize-Bett steht noch ein weiteres Doppelbett im Zimmer. Vier Personen, eine ganze Familie hätte hier Platz. Kurz werde ich sentimental, atme einige Male tief durch und nehme das Bad in Augenschein. Es ist riesig. Größer sogar noch als das Zimmer. Rechts hängt ein lang gezogenes Waschbecken, an dem sich eine halbe Schulklasse die Zähne putzen könnte, links eine etwas einsam wirkende Toilettenschüssel, hinten die Dusche. Daran, dass der Raum halb offen ist und man beim Duschen nach draußen schauen kann, werde ich mich erst gewöhnen müssen. Was ist mit all den Insekten, Tigermücken, Käfern, Kakerlaken, oder was hier alles kreucht und fleucht, haben die freien Zutritt? Über dem Bett hängt immerhin ein Moskitonetz. Ich beschließe, erst einmal zu duschen.
Nackt und verschwitzt stelle ich mich unter die Dusche, drehe an den Armaturen – doch es kommt kein Wasser. Der Hahn quietscht, irgendwo in der Leitung rauscht es, aber aus dem runden Duschkopf tropft es nur. Als ich nach oben greife und leicht daran rüttle, fällt er ab, ein Schwall grünes Moderwasser ergießt sich auf mich. Angeekelt schreie ich auf, springe zurück. Nur ins Duschtuch gewickelt, renne ich zur Rezeption, auf mein Dauerläuten erscheint der junge Mann. Er sieht mich besorgt an. Mir ist egal, was er von mir denkt, von der Touristin vom anderen Ende der Welt, die ihn fast nackt in ihr Zimmer lotst. Kopfschüttelnd beäugt er den Zustand der Dusche, befestigt den Duschkopf wieder und ruckelt leicht am Gestänge. Es sieht wenig vertrauenerweckend aus. Skeptisch und nach Schweiß riechend schaue ich ihm dabei zu. Dann demonstriert er mir lächelnd die Funktionsfähigkeit – es kommt warmes Wasser heraus. Nachdem er unter Verbeugungen gegangen ist, dusche ich vorsichtig, immer bereit, notfalls beiseitezuspringen. Als ich mich abtrockne, sehe ich einen Riesenkäfer blitzschnell durch das Bad rennen. Trotz meines Ekels suche ich ihn, aber er bleibt verschwunden.
Die Aufregung hat die Müdigkeit weggeblasen. Außerdem habe ich Hunger und Durst, doch abgesehen von Mineralwasser mit Kohlensäure scheint es hier nichts zu geben. Eine ungeahnte Unternehmungslust überkommt mich. Ich bin auf Bali! Das muss ich wiederholen, um es zu glauben. Ich werde doch jetzt nicht brav schlafen gehen! Stattdessen sprühe ich mich mit »No Bite« ein, einem heftig stinkenden Mückenschutzmittel, ziehe eine dünne Hose und eine langärmlige Bluse an und nehme Handy, Reisepass und einen Teil der Rupiah mit. An der Rezeption versuche ich dem jungen Mann klarzumachen, dass sich ein Monsterkäfer in meinem Zimmer versteckt. Ich fürchte, er versteht mich nicht. Aber dass ich noch zum Strand möchte, kann ich ihm begreiflich machen. Er staunt, erklärt mir den Weg mit Händen und Füßen. Ich verstehe nur die Hälfte und habe diese bereits vergessen, als ich draußen bin und die lange Auffahrt hinuntergehe. Zum Glück gibt es dafür Routenplaner auf dem Handy. Noch immer ist es unglaublich warm und schwül. Überall tschilpt, surrt und pfeift es, ich bin mitten im Dschungel, in einer tropischen Landschaft, auch wenn das Meer in unmittelbarer Nähe ist. Mein Herz klopft, als ich die von Schlaglöchern übersäte Straße entlanggehe. Einen Fußweg gibt es nicht, aber »Straße« ist auch nicht das richtige Wort für den sandigen Weg. Er führt im Zickzack an engen Mauern entlang, hohen Zäunen, unbeleuchteten Grundstücken; plötzlich taucht ein neonhell erleuchteter Carrefour auf, 24 Stunden geöffnet. Ab und zu knattert ein Mofa an mir vorbei. Die wenigen Fußgänger, die unterwegs sind, beachten mich nicht. Ich habe gelesen, dass Bali ein sicheres Reiseziel für allein reisende Frauen ist. Es scheint zu stimmen. Erleichtert atme ich auf. Immer wieder checke ich mein Handy für die Route. Google Maps führt mich durch eine Art schmalen Privatweg und plötzlich stehe ich im Sand.
Der Strand ist breit, flach, dunkel und kaum erhellt von Lichtern. Aber das Meer ist nicht da! Kurz steigt Panik in mir auf – ist das ein sich ankündigender Tsunami, beginnt das Wasser sich zurückzuziehen, um als Wasserwand geballt alles zu überfluten? Das Schild am Durchgang kennzeichnete diesen als »Tsunami Evacuation Route«, versehen mit einem eindeutigen Piktogramm: eine hohe Welle, ein flüchtendes Strichmännchen. Es wird schon nichts passieren, warum ausgerechnet jetzt, sage ich mir und gehe weiter. Ich bin wahrscheinlich nur übermüdet durch den Jetlag. Ich streife die Ballerinas ab. Der Sand ist überraschend kühl unter meinen nackten Fußsohlen. In der Ferne glitzert eine Ansammlung von Lichtern, die sich am Strand entlangziehen. Beim Näherkommen sehe ich, dass es sich um Strandbars handelt. Es sind offene Holzbaracken mit fantasievollen Namen, bunten Laternen, die von Balken herabhängen oder im Sand aufgebaut sind, rote, gelbe, blaue und grüne Lichter. Auf simplen Hockern oder Sitzsäcken hingefläzt tummelt sich ein junges bis mittelaltes Publikum, hauptsächlich Asiaten, ins Gespräch vertieft. Sie nehmen keine Notiz von der blonden Frau, die ziellos zwischen den improvisierten Tischen herumläuft. Einige Gäste trinken Bier, andere halten Schraubgläser mit pastellfarbigem Inhalt in der Hand, den sie durch Strohhalme schlürfen. Ich schlendere weiter, bis ich ein Lokal finde, das anscheinend noch Essen serviert, denn auf den Tischen stehen Teller mit halb aufgegessenen Speisen.
Ich lasse mich auf einen roten Sitzsack plumpsen. Das Meer rauscht in der Ferne vor sich hin, vielleicht ist Ebbe. Die Barbeleuchtung strahlt nur wenige Meter weit, sodass der Ozean im Dunkeln liegt. Der Indische Ozean! Wow! Ich bekomme trotz der Hitze eine Gänsehaut.
»To drink?« Der Kellner reicht mir die Karte und ich bestelle eine hausgemachte Limonade aus allerlei Früchten mit unbekannten Namen. Auf die Frage, ob ich etwas zu essen bestellen kann, schüttelt er bedauernd den Kopf. »Kitchen closed!« Dann muss ich mich eben bis morgen früh gedulden. Die Limonade kommt, sie ist grün, außerordentlich lecker und süß genug, um das Hungergefühl zu besänftigen. Ich genieße den Moment, die bunten Lichter, die surreale Wärme. Es ist wundervoll hier. Wie schön es wäre, dieses Erlebnis mit Stefan und Nickie zu teilen. Oder nur mit einem der beiden. Ich wäre so glücklich, hätte ich meinen Mann oder meinen Sohn an der Seite, jetzt und hier. Warum haben wir so eine Reise nie zusammen gemacht, am Geld hat es ja nicht gelegen? Nun sind sie fort, Nickie in Rotterdam, Stefan im Raubtiergehege. Tränen steigen auf, durch den Schlafmangel bin ich noch rührseliger als sonst. Mit Nickie kann ich mal hierherkommen, tröste ich mich. Im Juni besuche ich ihn, dann lade ich ihn für die nächsten Semesterferien ein, mit oder ohne Viviana, wir werden es gemeinsam genießen. Ich trinke die Limonade aus, bestelle eine weitere Sorte und beschließe, mit mir selbst anzustoßen, auf meinen Mut, mich auf diese Reise gemacht zu haben.
2.Sobald ich in mir zu Hause bin, bin ich überall zu Hause.
Als Kind musste ich regelmäßig mit meinen Eltern in die Kirche gehen. Obwohl ich mich zierte, hat es mich innerlich aufgerichtet. Jeden Sonntag saßen wir in den harten Kirchenbänken, sangen Lieder in zu hoher Tonlage und lauschten dem Pfarrer, der Erbauliches über das Leben Jesus Christus von sich gab. Ich konnte die Geschichten nur schwerlich mit dem hageren Jüngling in Einklang bringen, der fast nackt und offensichtlich leidend über dem feierlich gewandeten alten Mann hing, welcher Richtlinien über christliches Leben formulierte: »Du sollst dies nicht tun und das nicht, und wenn du es doch tust, kommt die Strafe Gottes über dich. Du sollst ein Leben führen, das Gott gefällt, dann belohnt er dich.« Ich hockte zwischen meinen Eltern und beobachtete unter halb geschlossenen Lidern die Gläubigen. Wie sie faltete ich die Hände und betete zu Gott. Glaubte ich an ihn? Ja und nein. Es schien sicherer, es zu tun, denn anscheinend verfügte er über die Macht, mir in den Kopf zu schauen und mich zu bestrafen, würde ich etwas Böses denken oder tun. Und er konnte mich bei der Erfüllung meiner Wünsche unterstützen. Also bat ich ihn um Hilfe und wenn ich etwas Schlimmes getan hatte, erflehte ich mir Vergebung. Nicht, dass die Vergehen groß waren: Mal hatte ich schlecht über eine Schulkameradin geredet, mal zu einer Notlüge gegriffen.
Später habe ich vor jeder Operation rituell um das Leben meines Kindes gebetet. »Lieber Gott, mach, dass Niklas überlebt. Nimm mir nicht mein Kind weg. Ich tue alles, wenn du ihn nur beschützt.« Letztlich hat er ja meine Gebete erhört, aber ich konnte nicht begreifen, wie einem kleinen unschuldigen Wesen ein so hartes Schicksal auferlegt werden konnte. Und so verlor ich meinen Glauben, der nie wirklich in mir verankert gewesen war. Er war Fassade wie so vieles in meinem Leben.
Der Gedanke an den Monsterkäfer – mindestens vier Zentimeter lang und wieselflink – hat mir einen unruhigen Schlaf beschert. Ich habe das Moskitonetz sorgfältig festgesteckt und das Licht angeknipst, als ich nachts zur Toilette musste. Mit Schuhen bin ich ins Bad getapst, den Blick furchtsam auf den Boden gerichtet. Natürlich habe ich ihn nicht gesehen. Zurück unter den Decken verfolgte er mich bis in meine Träume, katzengroß auf dem Bett sitzend.
Es ist Tag, als ich erwache. Ich fühle mich leicht erschlagen und wie in Watte gehüllt, aber nicht schlimmer als sonst. Jegliches Zeitgefühl ist mir abhandengekommen – eigentlich kein unangenehmer Zustand. Ich dusche, schminke und ziehe mich an. Als ich aus der Glastür auf meine Miniterrasse hinaustrete, erschlägt mich die Hitze beinahe. Die Sonne brennt mitten vom Zenit auf meinen Scheitel. Ich muss mir unbedingt einen Sonnenhut kaufen.
Im Tageslicht sieht der Innenhof noch anheimelnder aus. Eine plätschernde Oase, überall tropische Pflanzen. Vor den Zimmern sitzen Gäste, plaudern leise und frühstücken. Ich gehe durch den schwarz-weiß gefliesten Barbereich und suche die Küche. Ein junges Mädchen, traumschön in einem mit Paradiesvögeln bedruckten Sarong, den balinesischen Tüchern, die man zu allem Möglichen nutzt, kommt mir lächelnd entgegen.
»American or balinese breakfast?«, fragt sie.
Ich entscheide mich für die einheimische Variante, ohne zu wissen, was mich erwartet. Mir wird bedeutet, auf meiner Terrasse Platz zu nehmen. Während ich warte, beobachte ich das zwitschernde Treiben über mir. Sehr kleine Vögel wohnen in dem mit silbrigen Blüten übersäten, verästelten Baum. Aufgeregt fliegen sie hin und her. Allmählich erkenne ich ein Nest, in dem noch winzigere Vogelbabys sitzen und gierig den Miniaturschnabel aufsperren, um von ihren Eltern gefüttert zu werden.
Lächelnd serviert mir das schöne Mädchen – oder ist es ein anderes? – das Frühstück. Kaffee, einen milchig hellrosa Saft mit Stracciatella-artigen Sprengseln, Obstsalat aus Papaya, Melone, Mango, Kiwi, Ananas sowie unbekannten Früchten, darauf Joghurt und etwas Müsli. Es sieht toll aus und schmeckt großartig. Ich genieße jeden Bissen. Die Früchte sind derart saftig, lecker und reif – nicht zu vergleichen mit dem Obst in Deutschland. Der Smoothie hat ein eigenartiges, säuerlich-scharfes, dennoch köstliches Aroma.
»Das ist rote Drachenfrucht, die Pitaya«, erläutert mir später Sabine, die deutsche Inhaberin des Boutique-Hotels. Sie hat lange rotblonde Haare, ist etwa Mitte fünfzig und lebt seit einem Vierteljahrhundert auf Bali, wie sie mir bei einem weiteren Smoothie aus Papaya und Mango erzählt. Ich höre staunend, wie sie als 25-Jährige auf die Insel kam. Damals gab es wenig Tourismus und die Insel war ein schwer zu erreichender Geheimtipp unter Hippies. Nur die holländische Fluggesellschaft KLM flog nach Badung, wie Denpasar früher genannt wurde, oder man musste über Java mit dem Schiff kommen. Sabine studierte Jura, langweilte sich aber dabei. Sie verfiel der Insel sofort, kam wieder, jobbte, blieb länger, vernachlässigte ihr ungeliebtes Studium und verliebte sich stattdessen in einen Balinesen. Ein paar Jahre pendelte sie, dann brach sie die Brücken nach Deutschland ab und beschloss, ganz hierzubleiben. Sie heiratete den Balinesen und bekam zwei wunderhübsche Kinder mit ihm. Die Ehe hielt im Gegensatz zur Bali-Liebe nicht.
»Die Mentalität ist zu fremdartig, so viele Riten und Überlieferungen spielen in Denken und Verhalten der Menschen hinein. Wir haben uns nicht verstanden«, erklärt sie bedauernd. Ich lächle. Es ist ja schon schwer genug, einander zu verstehen, auch wenn man dieselbe Sprache spricht und aus derselben Kultur stammt.
Heute nennt sie das Anwesen ihr Eigen, das in den Jahren immer weiter organisch gewachsen ist, außerdem hat sie eine Eigentumswohnung in Bremen und eine in Rio de Janeiro, wie sie mir erzählt. Wie und womit ihr das gelungen ist, verrät sie nicht. Hat sie sich das selbst aufgebaut oder Kapital geerbt, durch Scheidung erhalten, stammt ihr Ex-Mann aus einer reichen balinesischen Familie? Fragen, die ich nicht stellen mag.
»Ich bin während der Übergangszeit hier. Im balinesischen Sommer ist es mir zu heiß, in der Regenzeit zu nass. Dann überlasse ich das Hotel meinen Angestellten und besuche Brasilien oder die alte Heimat«, sagt sie lächelnd.
Ich bin voller Bewunderung und Ehrfurcht. So ein selbstbestimmtes Leben würde ich auch gern führen. Sabine spricht eine der Angestellten in der Landessprache an.
Ich staune. »Du sprichst Balinesisch?«
»Natürlich. Das ist unerlässlich, wenn man hier lebt, ansonsten bleibt man fremd. Meine Angestellten würden mich nicht respektieren, hinter meinem Rücken über mich reden.«
Ich nicke. Stefan hat immer gesagt, dass man alle und jeden verstehen und deren Sprache sprechen müsse, wenn man ein Unternehmen führen wolle.
»Balinesisch ist nicht besonders schwierig. Bis auf ein paar Ausnahmen wird alles gesprochen, wie es geschrieben wird.«
Ich denke an die unverständlichen Schriftzeichen, die ich bislang gesehen habe. »Du kannst das auch lesen?«
Sie lacht. »Nicht die alten Zeichen. Aber Balinesisch wird heute mit dem lateinischen Alphabet geschrieben. Die frühere balinesische Schrift ähnelt der alten javanischen Schrift. Dann gibt es noch Hoch-, Mittel- und Niederbalinesisch, drei Sprachebenen, die sich am Kastensystem orientieren. Und es existieren Regeln, wer mit wem wie spricht.«
Puh, das scheint mir nicht besonders einfach zu sein. Meine Bewunderung für diese Frau, die sich in einem fremden kulturellen Kontext behauptet, steigt. Hinzu kommt, dass sie nicht mit einem Wort erwähnt hat, dass oder warum ich allein reise. Für sie mag vollkommen selbstverständlich sein, was für mich exotisch und schmerzhaft ist. Ich war es gewohnt, mich mit Stefan über das auszutauschen, was wir erlebten.
»Was möchtest du dir hier anschauen? Du bleibst eine Woche, oder?«
»Sechs Tage. Dann fahre ich nach Ubud zu einem Yoga-Retreat.« Es fühlt sich gut an, irgendwie erwachsen, das auszusprechen. Als wäre ich eine erfahrene spirituell Suchende, die um den Erdball reist.
»Okay, dann wünschst du dir hier in erster Linie Strand und Erholung? Oder willst du surfen lernen?«
»Oh Gott, nein.« Ich habe nicht nur Angst vor Hunden, sondern ebenso vor hohen Wellen, davor, dass mir Wasser über dem Kopf zusammenschlägt.
»Gut, ansonsten hätte ich dir ein paar Surfschulen in Kuta genannt.«
»Vielen Dank, aber das ist nicht meins.«
Sabine rät mir, einen hohen Sonnenschutzfaktor zu benutzen und mir eine Liege mit Schirm am Strand von Seminyak zu suchen, in der Nähe eines Warungs, dessen Lage sie mir beschreibt. Ein Warung bezeichne einen einfachen Strandimbiss, doch laut ihr bieten viele Warungs erstklassige Currys und andere balinesische und indonesische Gerichte zu Spottpreisen an.
Voller Vorfreude mache ich mich auf den Weg, vorschriftsmäßig mit Sonnenschutzfaktor 50 eingecremt, dazu habe ich Mückenschutz aufgetragen, der furchtbar stinkt. Es soll hier tag- und nachtaktive Mücken geben, von den dämmerungsaktiven ganz zu schweigen – und alle können im Zweifelsfall Krankheiten übertragen. In meinen Rucksack habe ich ein Strandlaken, Wasserflasche, Handy, Buch und Geld gepackt. Als ich dieselbe Straße hinuntergehe, die ich bereits gestern Abend erkundet habe, sehe ich viele kleine Geschäfte, Wohnhäuser, Mofa-Verleiher und Unterkünfte. Alles wirkt behelfsmäßig und provisorisch zusammengezimmert. Manches ist hübsch und idyllisch, Blumen, bunt bemalte Schilder und anheimelnde Dekoration, dann wieder zieht mir der beißende Gestank eines verrottenden Müllhaufens oder brackiger Abwässer in die Nase. Gackernde Hühner rennen frei herum, Hähne müssen in Käfigen hocken. Hunde ohne sichtbaren Besitzer nehmen zum Glück keine Notiz von mir. Ich trage Turnschuhe und Sonnenbrille und fühle mich leicht, als hätte ich trotz des schweren Rucksacks Ballast abgeworfen. Unter der gleißenden Tropensonne scheinen Hamburg und die Traurigkeit der letzten Monate weit weg.
Den Durchgang zum Strand finde ich problemlos und mache mit dem Handy Fotos vom Tsunami-Schild und der üppigen Vegetation, die ich später Nickie schicken will. Das Meer ist heute da. Es brandet in ambitionierten Wellen, schätzungsweise zwei Meter hoch, ans Ufer. Schilder warnen vor gefährlicher Unterströmung. Sabine hat mich darauf hingewiesen, dass man nicht ins Meer hinausschwimmen sollte. Aber das habe ich sowieso nicht vor. Mir reicht es völlig, am Wasser zu sein. Ich ziehe meine Flip-Flops aus und tauche die Zehen ins Wasser. Es ist badewannenwarm. Wenn es zurückströmt, zerrt es kraftvoll an meinen Knöcheln.
Ich wandere am Saum des Meeres entlang. Rechts von mir tauchen große, luxuriöse Hotels auf. Ihre Gartenanlagen erstrecken sich bis zum Strand, allerdings sind diese ein bis zwei Meter höher gelegen und wirken wie aufgeschüttet. Auf knallgrünem Rasen stehen Holzliegen besetzt mit Urlaubern, die leicht, aber schick bekleidet Drinks aus Strohhalmen schlürfen, dösen oder sich unterhalten. Auffallend viele Angestellte im gleichen Sarong wuseln umher und bemühen sich, Gästewünsche schon zu erfüllen, bevor diese ausgesprochen werden. Vor den Eingängen stehen Wachleute, deren abweisende Miene sich vom dienstbaren Lächeln ihrer Kollegen im Servicebereich unterscheidet. Unbefugte scheinen die elitären Hotels nicht betreten zu dürfen – anscheinend will aber auch keiner hinaus und die Luxusenklave verlassen.
Nachdem ich eine halbe Stunde am Strand entlangspaziert bin, komme ich zu dem von Sabine empfohlenen Warung. Ein klapperiges Holzschild trägt den Namen »Warung Cantina«, ein komischer Name, klingt spanisch, mitten in Seminyak. Oben auf der Böschung stehen Tische und Stühle aus Holz unter Schirmen, unten ein paar Liegen. Ich wähle eine massive Holzliege und mache es mir im Schatten gemütlich. Das Meer rauscht so laut, dass es meine ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Eigentlich wollte ich lesen, ein Sachbuch zur Aufarbeitung meiner gescheiterten Ehe, aber das Buch bleibt im Rucksack. Stattdessen schaue ich den Wellen zu, die unermüdlich anrollen, sich auftürmen, brechen. Ab und zu kommt ein vorwitziges Exemplar gefährlich nahe, umspült auslaufend die Liege, sodass ich ihr gerade noch meine Flip-Flops entreißen kann. Ich muss kichern. Seit Ewigkeiten habe ich mich nicht so wohl gefühlt, so frei und unbeschwert.
Ich war fast noch ein Kind, als ich Stefan kennenlernte. Ein junges Mädchen von Anfang zwanzig, voller Naivität und unbeschwerter Lebensfreude, das Kunstgeschichte studierte, weil es nicht wusste, was es sonst mit seinem Leben anfangen sollte. Zwanzig Jahre später hatte sich eine gitternetzartige Struktur feiner Falten über mein Gesicht gelegt. Meine blauen Augen blickten nicht mehr lächelnd in die Welt, sondern ängstlich-besorgt, in ständiger Erwartung der nächsten Katastrophe.
»Nun schau nicht so!«, bekam ich öfter von Stefan zu hören. Dabei lächelte er, aber es war sein Fassadenlächeln, das auch für seine Kunden bestimmt war.
»Wie denn?«
»Na, so angespannt. Es ist doch alles in Ordnung!«
Wir lebten in einem wunderbaren Haus mitten im Alstertal. Eine Backsteinvilla mit zweihundert Quadratmetern Wohnfläche auf einem Grundstück von mehr als tausend Quadratmetern in einer der begehrtesten Straßen des Wohnviertels. Im Winter fuhren wir zum Skilaufen in die Schweiz, im Sommer an die Côte d’Azur. Stefan war fest verankert in der materiellen Welt, während ich mich nach mehr sehnte. Nein, nicht nach einem anderen Mann. Sondern nach etwas, das mich hielt und trug und ebenso erhob. Ich wusste nicht, was das sein könnte, aber die Sehnsucht danach war da und wuchs. Ich fühlte mich wurzellos, gleichzeitig hatte ich über die Jahre an Leichtigkeit verloren. Stefan spürte es und warf es mir manchmal vor, kleine Andeutungen, die mir zeigten, dass er die unbeschwerte Britta von früher vermisste. Mir fehlten Wurzeln und Flügel. Ich trudelte irgendwo dazwischen herum, war orientierungslos. Die Jahre hatten mir kleine Verletzungen zugefügt, aber ich war nicht an ihnen gereift, sondern fühlte mich beschädigt.
Zum Glück hatte ich meine Familie. Stefan war mein Anker, mein Fundament. Und dann natürlich Niklas, unser wunderbarer Sohn, er stellte meine Flügel dar. Der Tag, an dem er sein Abiturzeugnis verliehen bekam. Nie hätte ich gedacht, dass er eines Tages die Schule beenden würde. Und doch hatte er es geschafft – noch dazu mit Bravour. Wir hatten es geschafft, wir alle zusammen.
Im Schlafzimmer stand Stefan im grauen Dreiteiler vor dem Spiegel und band sich die Krawatte. Der Anzug war maßgeschneidert und saß perfekt, das Hemd blütenweiß. Mein Mann seit über zwanzig Jahren. Er drehte sich zu mir um und breitete die Arme aus. Ich sank in seine Umarmung, klammerte mich an ihn. Es tat so gut. Sein Duft und seine körperliche Präsenz erinnerten mich daran, was wir alles zusammen durchgestanden hatten. Wir hatten einander getröstet und gehalten, wenn es hoffnungslos schien. Gemeinsam hatten wir die harten Zeiten überlebt.
Ich schlüpfte in das dunkelblaue Kleid, das ich mir zu diesem Anlass gekauft hatte. Es war nicht so kurz wie die Kleider, die ich als Studentin getragen hatte, und auch nicht so tief dekolletiert, sondern gut geschnitten, hochwertig und vielleicht etwas bieder. Dafür war es zehnmal so teuer. Die Haare steckte ich hoch, schminkte mich dezent, sprühte Parfum auf.
Stefan, der inzwischen auf der Bettkante gesessen und Mails gecheckt hatte, trat hinter mich.
»Wunderschön«, sagte er. »Meine wunderschöne Frau. Ich danke dir für alles. Dafür, dass du immer an meiner Seite warst, und besonders dafür, dass du mir Niklas geschenkt hast.«
Er zog ein kleines Päckchen aus der Innentasche seines Jacketts und überreichte es mir. Ich blinzelte gerührt.
»Was ist das?«
»Eine Kleinigkeit zu Niklas’ Abitur. Ohne dich hätte er es nie geschafft.«
Tränen liefen mir die Wangen hinunter.
»Nicht weinen«, flüsterte er und reichte mir ein Taschentuch. »Komm schon. Mach es auf.«
Ich löste die rote Schleife, öffnete das Kästchen und hielt die Luft an. Es waren filigrane Ohrringe mit blauen Edelsteinen, die perfekt zu meinem Kleid passten. Das Blau der Steine funkelte fast überirdisch.
»Wow! Die sind wunderschön. Ich danke dir.« Ich umarmte und küsste ihn.
»Blauer Saphir aus Sri Lanka. Die Einfassung ist aus Platin, du brauchst also keine Bedenken wegen deiner Silberallergie zu haben.«
»Du sollst mir doch keine so teuren Geschenke machen.«
»Schmuck ist eine Wertanlage – und was gibt es Schöneres für einen Mann, als die Mutter seines Kindes zu beschenken und glücklich zu machen?«
Ich legte die Ohrringe an. Sie glitzerten majestätisch und werteten meine Erscheinung so auf, dass mein Kleid nun keine Spur mehr bieder wirkt.
»Danke dir. Ich liebe dich.«
»Und ich liebe dich.« Er küsste mich zärtlich auf den Mund. Dann klingelte sein Handy. Er schaute aufs Display und signalisierte mir, dass es ein wichtiger Anruf war, den er entgegennehmen musste.
Während er den Raum verließ, erneuerte ich meinen Fassadenanstrich. Ungeschminkt fühlte ich mich nackt und bloß, als könnte jeder mein schutzloses, unattraktives Ich sehen. Mit einem geschickt aufgetragenen Make-up gelang es mir, die Augen größer wirken zu lassen und von den Schwächen abzulenken. Das Gitternetz meiner Fältchen konnte ich zwar nicht wegschminken, es aber durchaus etwas mildern.
Später bekomme ich Hunger. Der Warung hat sich allmählich mit Menschen gefüllt, dabei mischen sich Einheimische und Touristen.
Ab und zu kitzeln Wolken verführerischer Essensdüfte meine Nase so lange, bis ich nicht mehr widerstehen kann. Ich klettere zu der behelfsmäßigen Holzplattform hinauf und stehe schüchtern zwischen den Tischen herum, weiß nicht, wo ich mich hinsetzen soll. Alle sind in Gruppen, Familien oder als Paar unterwegs. Neben der Konstellation »älterer weißer Mann und junge Balinesin« sieht man auch häufiger »älterer weißer Mann und junger Balinese«, jedoch nie »ältere weiße Frau und junger Balinese«. Meinesgleichen scheint hier keine Zukunft zu haben. Sollte ich irgendwann innerlich mit Stefan abgeschlossen haben, werde ich mir keinen neuen Mann zulegen.
Niemand nimmt Notiz von mir, bis ein freundlicher Mitarbeiter mich lächelnd an einem Tisch mit Blick aufs Meer platziert. Wie fast alle Balinesen – mit Ausnahme der Taxifahrer am Flughafen – strahlt er Zufriedenheit aus. Obwohl er eine abgerissene Jeans – keine künstlich und teuer verschlissenen, wie sie in Deutschland Mode sind – und Turnschuhe trägt, die fast auseinanderfallen, scheint er mit seinem Leben zufrieden zu sein. Seine Augen, dunkel und mandelförmig, schauen mich voller Verständnis und Güte an. Er legt mir die Menükarte vor. Sie ist auf Englisch gehalten und verspricht indonesisches und balinesisches Essen, es gibt Salate und Sandwiches sowie viel Fisch und Meeresfrüchte. Ich bestelle ein Seafood Curry und ein Wasser. An den Nebentischen werden exquisite Kreationen aus Gemüse, Reis und gegrilltem Fisch oder Fleischspieße serviert, alles hübsch angerichtet, mit Blüten dekoriert und von Schalen mit Soßen begleitet. Mein Magen knurrt, das Frühstück liegt schon sechs Stunden zurück, wie ich erstaunt feststelle – ich muss viel Zeit damit verbracht haben, aufs Meer zu starren. Dabei habe ich vergessen, nachzucremen. Mein rechter Arm und die Schulter sind gerötet, das Gesicht spannt, und das, obwohl ich unter dem Schirm gelegen habe.
Der Kellner stellt ein Glas Wein vor mir ab. Ich schüttle den Kopf, er deutet auf zwei Männer am Nebentisch. Dem Aussehen nach zu urteilen, Australier oder Neuseeländer, sie prosten mir zu. Sie sind wettergegerbt, um die fünfzig und tragen Tropenhüte sowie Bermudas zu Bierbäuchen unter schmuddeligen T-Shirts. Ich lächle verhalten zurück, hebe das Glas, ich will niemanden zu mir an den Tisch einladen, aber auch nicht vor den Kopf stoßen. Man weiß ja nie, wie Männer auf eine Abfuhr reagieren. Unauffällig drehe ich mich ein wenig weg, sodass ich sie nicht mehr im Blickfeld habe. Zum Glück kommt dann auch schon mein Essen. Eine Küche habe ich hier nicht gesehen. Ein emsiger Mopedfahrer schafft die Gerichte, in Alufolie verpackt, herbei. Vor Ort scheinen nur Säfte gepresst, Kokosnüsse aufgeschlagen und Getränke gelagert zu werden. Das Curry, heiß und pikant, wird in einer Schale serviert, der Reis auf einem Teller daneben ist zu einer Halbkugel geformt. Hungrig mache ich mich darüber her. Das Gemüse hat Biss, der Fisch ist saftig. So lecker habe ich in Hamburg selten gegessen – auch in weitaus teureren Restaurants nicht. Ich ertappe mich dabei, wie ich kleine Laute des Wohlgefallens von mir gebe. Der Wein steigt mir bei den Temperaturen schneller zu Kopf als gewöhnlich.
Wie wunderbar es hier ist! Wenige Meter entfernt donnert das Meer ans Ufer, die Sonne scheint, Stimmen und Lachen dringen mir ans Ohr, ich bin inmitten Fremder an einem exotischen Ort und fühle mich wohl. Ich weiß nicht, ob es der Indische Ozean ist, der meine Lunge befreit, aber zum ersten Mal seit Silvester, seitdem ich Stefan mit Eileen in inniger Umarmung ertappt habe, kann ich wieder atmen. Als ich bezahle, gebe ich dem Kellner ein üppiges Trinkgeld.
»No, Madam, too much!«, wehrt er die Rupiah ab, in Euro umgerechnet immer noch ein lächerlich geringer Betrag.
Er schiebt mir die Hälfte des Geldes zurück und lässt sich nicht überreden, es zu nehmen. Ich beharre nicht darauf, denn vielleicht verstößt das gegen irgendeinen mir unbekannten Höflichkeitsritus.
Vom Wein benommen, stolpere ich zur Liege zurück und falle augenblicklich in einen Verdauungsschlaf. Als ich erwache, grummelt mein Bauch. Binnen Minuten wächst das Grummeln zu ausgemachten Bauchkrämpfen an. Das hat mir noch gefehlt. Ich nehme meinen Rucksack und klettere in gekrümmter Haltung zu dem Warung hoch, wo es eine Toilette geben muss. Die Australier hocken immer noch dort, nuckeln am wer-weiß-wievielten-Bier, zum Glück beachten sie mich nicht, als ich an ihnen vorbeischleiche. Das stille Örtchen erweist sich als Klosettschüssel ohne Brille oder Deckel hinter einem Bretterverschlag, zum Glück nicht direkt neben den Tischen, wo die leckeren Speisen serviert werden. Ich schiebe den Riegel vor und bin froh, Papiertaschentücher dabeizuhaben, denn Toilettenpapier gibt es keins. Mittlerweile steht mir der Schweiß auf der Stirn und ich entleere mich unter Krämpfen. In Gedanken checke ich die Reiseapotheke: Habe ich Mittel gegen Bauchkrämpfe, Blähungen und Durchfall dabei? Ja, aber natürlich nicht hier.
Doch als ich mir – peinlich berührt, weil ich die einzige Toilette verpestet habe – unter dem Kaltwasserhahn die Hände wasche, geht es mir schon besser. Mein Bauch fühlt sich an, als wäre nichts gewesen. Ich horche noch etwas in mich hinein, aber es bleibt ruhig. Schließlich, die Sonne ist in Richtung Meer gewandert, mache ich mich auf den Rückweg. Der Sand, der mir heute Morgen beinahe die Fußsohlen verbrutzelt hat, ist nun angenehm kühl. Die Warungs und Hotels bereiten sich auf den Sonnenuntergang vor. Sie stellen Stühle auf, werfen bunte Sitzsäcke in den Sand. Der breite Strand füllt sich mit Menschen. Es ist Ebbe. Das Wasser hat sich zurückgezogen. Man kann endlos weit hinausschauen und sieht die Silhouetten von Frauen und Männern, Kindern und Familien übers Watt gehen. Das Licht wird weicher, eine Art Schleier oder Dunst scheint sich über die Sonne zu legen. Es herrscht eine sanfte und warme Stimmung, die auch mich ergreift.
Kurz vor der Abbiegung zu meinem Hotel beschließe ich, noch ein Stück weiter zu gehen. Warum nicht den Sonnenuntergang erleben? Niemand wartet auf mich. Ich lasse mich in einen hellgrünen Sitzsack in vorderer Reihe fallen und bestelle nach einem Blick auf die Getränkekarte ein Bintang Radler. Die meisten trinken das einheimische Bier; dass die leichtere Variante mit Limonade einen deutschen Namen trägt, finde ich lustig. Im Hamburg würde man es Alsterwasser nennen, aber es schmeckt süßlicher. Während ich an meiner Flasche nuckle, strömen von überallher immer mehr Balinesen, in farbenprächtige Sarongs gekleidet, mit Blusen, Brusttüchern und Blüten in den Haaren. Die Sonnenuntergangszeremonie entwickelt Volksfestcharakter. Und tatsächlich gibt die Sonne alles, sie taucht den Himmel in ein Farbenspiel von zartrosa über leuchtend orange bis hin zu blutrot. Kaskaden von Farben, ein Schauspiel, das extra für die Zuschauer aufgeführt zu werden scheint, die es entsprechend kommentieren.
»Ooooh!« und »Beeeeh!«, macht es um mich herum und ich staune, dass etwas, das die Balinesen doch täglich zu Gesicht bekommen, solche Begeisterungsstürme auslöst. Handys werden gezückt und die Sonne in jeder Millisekunde ihres Verschwindens abgelichtet, mal alleine, mal als Selfie-Beiwerk, mal mit dem oder der Liebsten an der Seite.
Ich habe schon manch stimmungsvolle Sonnenuntergänge erlebt, in Hamburg an der Elbe oder auf Ibiza, wo wir jahrelang auf einer Finca nahe dem berühmten Café del Mar Urlaub machten. Nie jedoch war ich allein, nie so weit fort und egal, ob es daran liegt oder an der ganz speziellen Schönheit dieses Moments, jedenfalls zwingt mich etwas in die Knie. Ich, die ich seit Jahren in keiner Kirche war und meinen Kinderglauben nicht vermisse, bin kurz davor, auf den Strand zu sinken und mein Gesicht in den Sand zu legen, voller Anbetung für Gottes Schöpfung, die mich und all meine Sorgen lächerlich aussehen lässt. Was bin ich schon, ein vernachlässigbarer Teil des Ganzen, ein Staubkorn, ein Nichts.
3.Dieser Hokuspokus, einen äußeren Gott zu finden, ist vorbei. Wir sind hier, um Gott in uns selbst zu finden.
Ich träume, dass ich endlose Krankenhausflure entlangrenne. Türen öffnen und schließen sich, doch ich finde Stefan nicht. Irgendwo muss er sein, er hat doch versprochen zu kommen und mir beizustehen. Mein Bauch schmerzt, er ist so dick, dass ich beinahe platze, und ich spüre, dass das Kind jetzt geboren werden will. Die Wehen sind so heftig, dass ich mich an der Wand abstützen muss, ich ringe um Atem, die Beine geben nach. Keine Menschenseele sieht mich, obwohl ich Ärzten und Krankenschwestern begegne, sie anflehe, meinen Mann zu suchen, sie schauen durch mich hindurch, ich scheine unsichtbar zu sein. Als ich um die nächste Ecke biege, bin ich im Garten und da liegt er im Liegestuhl, liest eine Zeitschrift, was er sonst nie tut, lächelt mir entgegen, aber er meint nicht mich, sondern jemanden, der hinter mir steht, ich drehe mich um, aber da ist niemand, doch, ein Käfer, größer als der, der vergangene Nacht in meinem Zimmer war. Was hat Stefan mit ihm zu schaffen, sieht er nicht, wie hässlich er ist? Ich gehe auf meinen Mann zu, aber der Boden ist morastig, schwerfällig wate ich durch den Schlamm, immer tiefer wird das Moor, das mich zu verschlingen droht, nun steht er auf und geht weg, bei ihm ist der Boden trocken, er pflückt einen Blumenstrauß, bricht die Rosen ab, die ich sorgfältig gepflegt habe, beide Hände um den Leib geschlungen rufe ich nach ihm, aber er hört mich nicht, schon bin ich bis zur Hüfte versunken, das Moor saugt mich glucksend und gierig ein, es steht mir bis zum Hals.
Ich erwache mit einem Schrei, kurz bevor ich verschwinde, mein Bauch schmerzt und ich bin schweißgebadet. Einen Moment weiß ich nicht, wo ich bin, dann fällt es mir wieder ein. Bali, ich bin auf Bali und allein. Stefan ist weit weg, Nickie ebenfalls. Ich schleppe mich zur Toilette, habe schreckliche Bauchkrämpfe, schaffe es gerade noch, meinen Slip herunterzuziehen. Es fühlt sich an, als würden meine Gedärme nach außen gestülpt, wie Geburtsschmerzen. Zitternd strauchle ich zum Bett zurück, mir ist erbärmlich kalt. Mein Bauch beruhigt sich etwas, aber nicht sehr, es rumort und arbeitet in mir, als hätte ich einen Dämon verschluckt. Ich dämmere vor mich hin und nach einigen Minuten oder Stunden schwitze ich wieder, werfe die Decken ab und muss erneut zur Toilette, der Weg kommt mir unendlich lang vor und ich bin so schwach. Was habe ich nur gegessen, was ist los mit mir? Eine fremde Macht knetet meine Bauchorgane durch, Krämpfe schütteln mich. Übergeben muss ich mich nicht, obwohl mir so schlecht ist wie noch nie zuvor und ich wünschte, ich könnte es, stecke mir sogar, vor der Kloschüssel auf dem Boden kauernd, von Riesenkäfern beobachtet, den Finger in den Hals, aber nichts geschieht. Ich habe furchtbaren Durst und trinke das letzte bisschen Wasser, dann rolle ich mich auf der Matratze zusammen. Die Käfer sitzen in den Ecken und beobachten mich mitleidlos, sie klappern mit ihren Zangen, ich höre sie wispern. Sie beratschlagen, was sie mit mir anfangen sollen, diesem Eindringling. So geht das weiter, ich verliere jedes Zeitgefühl, irgendwann kommt nichts mehr aus mir heraus, aber der Dämon ist nicht zufrieden, sein Schmerzhunger auf mich ist nicht gestillt und zerkaut weiter meine Eingeweide.
Ich habe nicht bemerkt, dass es hell wurde. Es klopft, aber ich bin zu schwach, um zu antworten, habe mich an einen winzigen Ort in mir zurückgezogen, wo ich Frieden zu finden hoffe. Später klopft es eindringlicher und die Tür wird geöffnet. Ein freundliches Mädchengesicht schaut besorgt hinein: »Everything okay, Madam?«
Ich schüttle den Kopf und versuche, sie auf die Käfer hinzuweisen. Zwei sitzen mit übereinandergeschlagenen Beinen in der Ecke und beobachten mich mit amüsiertem Gesichtsausdruck. Nie zuvor ist mir aufgefallen, welch ausdrucksvolle Mimik Käfergesichter haben.
»Madam, are you sick?« Das Mädchen steht in der Tür, zögert jedoch, das Zimmer, das sich seit gestern in eine stinkende Höhle verwandelt hat, zu betreten. Ich kann es ihr nicht verübeln.
Als ich nicht antworte, geht sie, kehrt kurz darauf mit Sabine zurück, die resolut an mein Bett tritt und mir die Hand auf die Stirn legt. Ich schäme mich für den Gestank und meinen Zustand. Die Balinesin, schön wie eine frische Blüte und genauso wohlriechend, beugt sich über mich, streicht mir sanft das schweißverklebte Haar aus der Stirn, ich könnte weinen, weil sie so zärtlich ist. Dann öffnet sie die Fenster, beginnt aufzuräumen.
»Du bist heiß. Tut dir etwas weh?«, fragt Sabine.
»Bauchschmerzen. Durchfall«, röchle ich. Mehr kann ich nicht sagen. Sabine nickt, verschwindet.
Die Balinesin, oder ist es eine neue, ich kann sie nicht auseinanderhalten, eine ist schöner und zarter als die andere, bringt frisches Wasser und würzigen Tee. Sie flößt mir ein paar Teelöffel ein.
Sabine kommt mit einem Mann wieder, den sie mir als »Balian« vorstellt. Oder ist das seine Berufsbezeichnung? Er untersucht mich, schaut mir in die Augen, fühlt den Puls und tastet den Bauch ab. Seine Hände sind sanft und trocken.
»Bali belly«, stellt er fest. Er entnimmt der Tasche Pulver und Kräuter, gibt dem Mädchen auf Balinesisch Anweisungen. So schnell, wie er gekommen ist, verschwindet er wieder.
»Das haben viele, die zum ersten Mal nach Bali kommen«, erklärt Sabine. »Der Magen-Darm-Trakt rebelliert, er muss sich erst an die veränderte Bakterienlage gewöhnen. Gegen Cholera bist du geimpft? Und gegen Typhus?«
»Ja.«
»Dann ist es nichts Schlimmes. Eine Magen-Darm-Grippe. Sobald das Fieber sinkt, wird es dir besser gehen.«
Nichts Schlimmes? Ich hatte gelegentlich einen Magen-Darm-Infekt, aber nie hat es sich annähernd so angefühlt, als würde mein Innerstes nach außen gestülpt.
Irgendwo in den vernebelten Windungen meines Gehirns erinnere ich mich an meine Reiseapotheke. »Loperamid?«, flüstere ich schwach.
»Klar, das kannst du nehmen. Es wird den Durchfall vielleicht stoppen, aber die Ursache nicht beseitigen. Willst du das?«
Ich schüttle den Kopf. Dann eben Pulver und Kräuter. »Wer ist Balian?«
»Ein Balian ist ein traditioneller Heiler, wie es sie viele auf Bali gibt. Ein Medizinmann, wenn du so willst. Ich habe gute Erfahrungen mit ihm gemacht.« Sie lächelt mir aufmunternd zu und entfernt sich in ihrem weitschwingenden, geblümten Trägerkleid, nachdem sie dem Mädchen, das wohl meine persönliche Pflegerin ist, weitere Anweisungen erteilt hat.