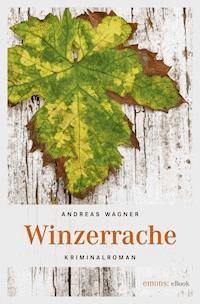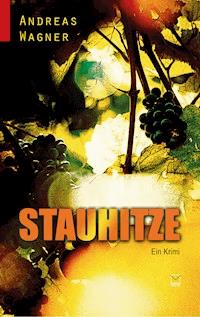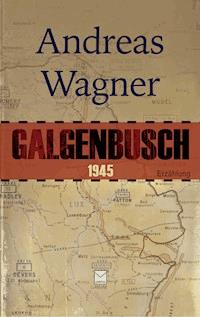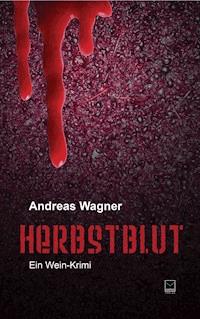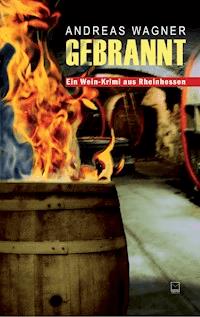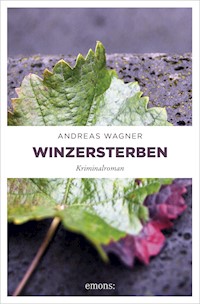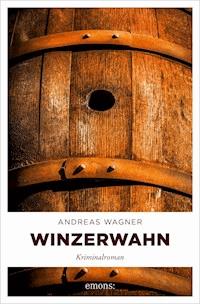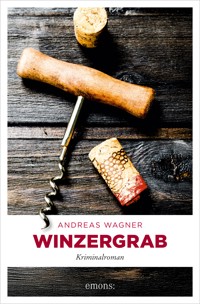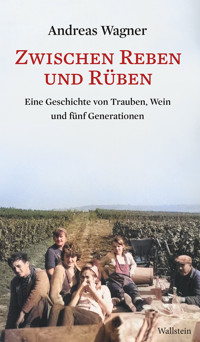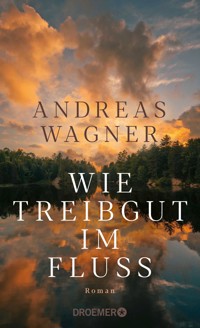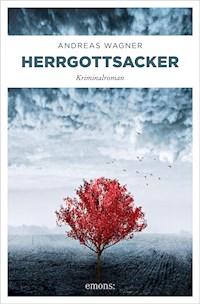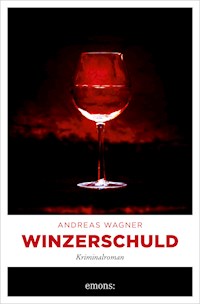Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Leinpfad Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kendzierski-Krimi
- Sprache: Deutsch
Der kälteste Winter seit langem. Tiefschnee-Alarm im Selztal. Und der Nieder-Olmer Bezirkspolizist Paul Kendzierski, der einen Außentermin wegen einer Ortserweiterung wahrnehmen muss, ist mal wieder vollkommen falsch angezogen.Aber nicht nur die sibirischen Temperaturen machen Kendzierski bei seinem vierten Fall zu schaffen. Sein Chef bekommt eine vergiftete Weinflasche mit einer Drohung. Bürgermeister Erbes ist fassungslos: Ein dummer Streich? Oder ein Racheakt? Hat das womöglich mit dem Neubaugebiet zu tun?Auf jeden Fall total unpassend, so kurz vor der Kommunalwahl. Deshalb heißt die Parole zunächst einmal: keine Polizei! Paul Kendzierski soll sich diskret des Falles annehmen. Aber als ein Winzer tot im eigenen Haus aufgefunden wird, muss auf einmal alles sehr schnell gehen.Denn sonst wird der erste Abstich des Jahres auch für andere zum letzten Abstich ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Letzter Abstich
Für Nina, Phillip, Hanna und Fabian
Andreas Wagner
Letzter Abstich
Ein Weinkrimi
Die Handlung und alle Personen sind völlig frei erfunden;Ähnlichkeiten wären rein zufällig.
© Leinpfad VerlagHerbst 2010
Alle Rechte, auch diejenigen der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung des Leinpfad Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: kosa-design, Ingelheim, nach einem Foto von Christian Wagner, EssenheimLektorat: Angelika Schulz-Parthu, Alexandra Rat
www.leinpfadverlag.com
ISBN E-Book 978-3-942291-53-8
Die Rache ist mein.
Ich will vergelten, spricht der Herr.
Römer 12,19
Prolog
Diesmal musste es klappen. Er spürte das. Die Routine stellte sich ganz langsam ein. Auch in seinem Alter konnte man noch etwas dazulernen. Auch etwas ganz Neues. Warum denn nicht? Vielleicht brauchte es etwas länger. Das schon, aber dafür hatte er ja auch mehr Zeit. So viele Jahre schon hatte er mehr Zeit. Und die wollte er endlich nutzen.
Vorsichtig zerrieb er die getrockneten Blätter zwischen den Fingerkuppen. Ein Knacken, Brechen und Rascheln, ein Geräusche, die seine Ohren erfreuten. Ein Kribbeln, das zart zwischen seinem Daumen und den anderen Fingerspitzen kitzelte, fast so, als ob die Fingerspitzen eingeschlafen wären, feine Stiche.
Mit dem weißen Porzellanstößel bearbeitete er die zerriebenen Blätter im Mörser weiter. Jeder Arbeitsschritt verwandelte sie immer ein Stückchen weiter. Vom Großen zum Kleinen. An ihr ursprüngliches Aussehen erinnerte kaum noch etwas. Die Ernte des Frühlings, des Sommers und des Herbstes. Grüne saftige Blätter waren das gewesen. Die Dauerfeuchte in den Wiesen am Fluss tat ihnen gut.
Auf seinem Speicher hatten sie in langen Reihen an den knorrigen Balken des alten Dachstuhls gehangen. Die Luft und die Wärme dort oben hatten sie getrocknet. Hart, aber zerbrechlich. Seine Ernte eines ganzen Jahres.
Einen großen Teil hatte er zum Üben verbraucht. Das richtige Zerkleinern, die verschiedenen Arbeitsabläufe, die Routine der einzelnen Schritte und vor allem das Extrahieren der wichtigen Inhaltsstoffe brauchte einiges an Erfahrung.
Aus den zerbröselten Blättern war mittlerweile unter den gleichmäßigen Bewegungen des Stößels im Mörser ein feiner Staub geworden. Ein kleines grün-graues Häuflein im weißen Porzellan. Er schüttete es vorsichtig zum Rest in das große Becherglas, das er sich extra angeschafft hatte. Es gab seinen Bemühungen etwas Wissenschaftliches und unterstrich, dass es ihm ernst war mit dem, was er vorhatte. Ein ansehnliches Häuflein war das schon. Jetzt noch die Samen. Die mussten getrennt bearbeitet werden. Sie waren sonst nicht klein zu kriegen, zumindest nicht so klein, wie er sie haben wollte. Gleichmäßig zerrieben, zu feinem Staub wie die Blätter auch. Kleine Schweißtropfen traten auf seine Stirn. Es war anstrengend, die festen Samen in feines Mehl zu verwandeln. Der Jüngste war er nicht mehr, in solchen Situationen war das deutlich zu spüren. Schweißtreibende Anstrengung, die nicht umsonst sein sollte.
Zufrieden betrachtete er das Ergebnis seiner Mühen.
Zwei Stunden Arbeit für dieses bisschen Staub in dem Becherglas. Ein Staub, der bei richtiger Anwendung für reichlich Aufregung sorgen würde. Fünfzig Gramm Angst und Schrecken hinter Glas. Das wärmte auch von innen. Die kleinen Schweißtropfen auf seiner Stirn waren jetzt getrocknet.
Mit ruhiger Hand goss er Wasser, Ethanol und ein paar Tropfen Essigsäure in das Becherglas. Die richtige Mischung, um das Scopolamin und das Hyoscyamin aus dem Schwarzen Bilsenkraut zu extrahieren. Mit dem Becher in der Hand machte er sich auf den Weg in sein Wohnzimmer. Das, was jetzt kam, brauchte Ruhe und Musik. Den Becher musste er auf dem Wohnzimmertisch kurz abstellen. Für die Auswahl der richtigen Platte brauchte er beide Hände. Prinzip Zufall. Nicht immer war er damit einverstanden, aber diesmal ging das in Ordnung. Friedrich Smetana. Mein Vaterland, Ma Vlast. Karajan und die Berliner Philharmoniker. Irgendwie passte das ganz gut. Zufall eben. Knackend lief die Platte an. Zu den ersten Klängen der Harfe sank er in seinen Sessel. Seine Rechte griff nach dem halb vollen Becherglas. Langsam bewegte er es hin und her. Zweimal würde er die Platte durchhören müssen. Zweimal durch Smetanas Böhmen und seine Geschichte hindurch. So lange brauchte es in ruhiger Bewegung, bis die Alkaloide extrahiert waren. Der Rest ging dann fast von selbst. Zwei- oder dreimal durch den Kaffeefilter, immer einen neuen, um die Feststoffe herauszuholen. Danach ein wenig Geduld. Die hatte er bei den ersten Versuchen nicht gehabt. Das Extrakt musste konzentriert werden. Nicht ganz einfach mit seinen bescheidenen Mitteln. In der Literatur wurde empfohlen, das Lösungsmittel unter Vakuum zu verdampfen. Davon hatte er keine Ahnung. Seine ersten Versuche waren daher kläglich gescheitert. Die Hitze war das Problem gewesen. Wenn man die Flüssigkeit einkochte, wurde sie zu bitter, und ganz bestimmt gingen dabei auch die wichtigen Inhaltsstoffe kaputt. Das Konzen-trat könnte man dann schmecken, selbst im kräftigsten Rotwein. Aber auf der Heizung funktionierte das. So einfach und doch effektiv, wenn man Zeit hatte. Und was hatte er sonst in dieser Menge? Die niedrige Temperatur war sein Geheimnis. Und die Geduld. Zwei, drei Tage brauchte das Konzentrat auf dem Heizkörper in seiner Küche, um genug Flüssigkeit verdunstet zu haben. Ein feines Konzentrat, das sich hinter den Gerbstoffen eines kräftigen Rotweines gut zu verstecken wusste. Die Grundlage war geschaffen. Sein großer Spaß konnte beginnen. Er lehnte sich im Sessel zurück und schloss die Augen. Karajan und Smetana hatten die Moldau erreicht.
1.
Es war verdammt kalt. Paul Kendzierski fror. Obwohl er beide Hände tief in seinen Jackentaschen vergraben hatte, fühlte er sie kaum noch. Abgestorben kamen sie ihm vor, obwohl er sie bewegte. An seinem Bauch spürte er die Bewegung beim Ausstrecken und Zusammenballen der Finger. Er hatte nicht damit gerechnet, dass es hier so eisig kalt werden würde. Es war der Wind, der das alles unerträglich machte. An diesem Hang, mitten in den Weinbergen. Manchmal pfiff es sogar, wenn eine Böe an ihm vorbeiraste und die rechte Seite seiner Jacke tief eindrückte. Feine Nadelstiche an seinen Füßen signalisierten ihm, dass sich auch dort unten langsam Froststarre einzustellen schien. Festgefroren zwischen kahlen Reben. Vorsichtig bewegte er sich von einem auf den anderen Fuß. Leicht wankend hin und her. Vielleicht war ja so das Schlimmste zu vermeiden. Reinhold Messner! Warum musste er gerade jetzt an den denken? Die Kälte, der Wind. Es fehlten nur die Schneeverwehungen, irgendein Achttausender im Hintergrund, schroffe Felswände, vereiste Bärte unter den Nasenlöchern und große, runde, spiegelnde Brillen. Bei dem Gedanken an Messners Fußzehen wurden die Schmerzen an seinen eigenen heftiger. Das Hin- und Herwanken brachte keine wirkliche Linderung. Es verschlimmerte alles nur noch. Kendzierski blieb ruhig stehen. Still, sich in sein Schicksal fügend. Sollten sie doch abfrieren! Dann musste er zumindest nicht mehr mit zu solchen idiotischen Terminen. „Kendziäke, Sie müsse do mitkomme!“ Ludwig-Otto Erbes‘ Lieblingssatz. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nieder-Olm hatte ihn heute Morgen höchstselbst in seinem Büro abgeholt. Nervös auf den Zehenspitzen tänzelnd. Seine ganz persönliche Art, die Wichtigkeit der eigenen Mission zu unterstreichen. „Wir müsse do zusamme hin. Das ist wischdisch!“ Erbes brauchte dieses Tänzeln, um seine fehlende Körpergröße zu verdrängen. Mitte 50, kugeliger Bauchansatz. Das lichter werdende Haar, das er mutig quer legte, in der Hoffnung, die größer werdende Lücke auf seinem Kopf zu schließen.
Ohne weitere Ausführungen war er losgehastet. Der Chef mit seinem Bezirkspolizisten im Schlepptau. Kendzierski kam sich dann immer wie ein Riese vor. Gut 30 Zentimeter größer als Erbes, wie ein Trottel seinem Chef folgend, der in strammem Schritt vorauszueilen pflegte, gehetzt, auf der Flucht, aber immer pünktlich. Auf die Minute.
Der Blick von Erbes heute Morgen um kurz vor halb zehn hätte ihn stutzig machen müssen. An ihm hinunterwandernd, so als ob irgendetwas mit seiner Kleidung nicht in Ordnung gewesen wäre. Kendzierski hatte die errötende Wärme in seinem Gesicht gespürt. Etwa der Hosenlatz? Wie peinlich. Aber der war es nicht gewesen. Alles war in Ordnung. Der graue glatte Strickpulli mit dem V-Ausschnitt, das blaue Hemd, dessen Kragen zu sehen war, hatte er heute Morgen sogar frisch angezogen, auch da Entwarnung. Seine dunkle Jeans hatte er schon seit ein paar Tagen an, aber die war noch o.k. Die dunkelbraunen Lederschuhe mit den dünnen Sohlen brauchten wieder einmal ein wenig Farbe. Aber das war hier eine Verbandsgemeindeverwaltung und kein Laufsteg einer Pariser Modenschau. Erbes hatte ganz leicht nur den Kopf geschüttelt und war dann losgelaufen. Jetzt wusste er warum. Trotz der Kälte, die sein Gehirn langsam einfrieren ließ.
Seit einer knappen halben Stunde standen sie hier schon auf weiß gefrorenen Grashalmen und Blättern inmitten kahler Rebstöcke. Kaum Schutz vor Wind und Kälte. Es war einer dieser für ihn spontanen Freilufteinsätze. Erbes‘ unkalkulierbare Anwandlungen, Kendzierski müsse dabeisein. Er war als Bezirkspolizist zwar viel unterwegs, draußen in den sieben Landgemeinden, die neben der Stadt Nieder-Olm zu seinem Aufgabengebiet gehörten. Die kleinen Ortschaften inmitten unzähliger Weinberge, weiße Kirchtürme mit spitzen Schieferdächern und starren Hähnen. Jede Gelegenheit nutzte er, um aus seinem dunklen Büro herauszukommen. Bei jedem Wetter, aber dann bitte geplant und in der richtigen Kleidung. Für den heutigen Montag hatte das nicht auf seiner Tagesordnung gestanden. Ein ganzer Stapel Akten hatte sich auf seinem Schreibtisch angesammelt. Fein säuberlich in die Höhe geschichtet. Und für den hatte er sich heute Morgen zurechtgemacht. Jawohl! Bloß nicht zu dick angezogen. Es gab kaum etwas Schlimmeres als dauerschwitzend im eigenen Büro zu sitzen. Daher der dünne Pullover und die leichten Sommerschuhe, obwohl die Temperaturen jetzt hier draußen in Essenheim nach langen Unterhosen, dicken Wollsocken und einer Skimütze schrien. So konnte das unmöglich weitergehen. Es war Mitte Januar, ein richtiger Winter.
Für heute Nachmittag nahm Kendzierski sich die Anschaffung einer Notfall-Winter-Grundausstattung vor. Wenn er diesen Einsatz Marke Ostfront irgendwie heil überstand. Ein Paar dicke Handschuhe, Pudelmütze, Wollschal und Stricksocken. Das alles deponiert im Aktenschrank seines Büros. Ein ganz persönliches Basislager für die spontanen Einsätze mit Erbes im rheinhessischen Himalaya.
Einen Moment noch, Herr Erbes, ich bin gleich so weit. Alleine daran würde dieses Projekt schon scheitern. Nervös auf den Zehenspitzen wippend würde sein Chef vor ihm stehen, während er sich die Schuhe aus- und dicke Wollsocken anzog. Handschuhe, Pudelmütze, fertig für die Arktis-Expedition. Erbes wartete nicht eine Minute, nie und nimmer. Kendziäke, wir müsse los. Die wadde uff uns! Auf, auf! Leesche Sie en Zahn zu! Des iss nedd irgendwer. Isch konn doch de Londrat nedd wadde losse! Erbes würde vorauseilen und er in Wollsocken, die Schuhe in der Hand, hinkend hinterher.
Es waren bestimmt mehr als zehn Grad unter null. Sein linker Fuß hatte sich nun endgültig vom Rest seines Körpers losgesagt. Adieu! Junge, komm bald wieder. Kendzierskis unterkühltes Gehirn versuchte die Kommunikation wieder in Gang zu bringen. Vergeblich. Seine Hände und die Ohren würden als nächstes dran sein, wenn sich hier nicht bald etwas änderte. Langsam, aber sicher sagten sich alle von seinem reichlich überforderten Rumpf los. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff, nur wirklich weit konnten sie ja nicht kommen. Gerne hätte er jetzt wieder angefangen hin und her zu wippen. Vom einen Fuß auf den anderen, ein klein wenig Bewegung nur. Die Angst, mit tauben Füßen das Gleichgewicht zu verlieren, hielt ihn davon ab. Erbes würde es ihm ganz sicher nicht verzeihen, wenn er hier mitten zwischen den Rebzeilen der Länge nach hinschlagen würde. Die weit aufgerissenen Augen der anderen. Was ist denn mit Ihrem Bezirkspolizisten los, Herr Erbes? Hat der heute Morgen schon einen getrunken? Wirre Gedanken, Sauerstoffmangel, die Höhenkrankheit wenige Meter unterhalb des Gipfels. Delirium.
Der kleine klare Tropfen, der an Erbes‘ roter Nasenspitze hing, riss ihn heraus. Sein Chef sah ebenso erfroren aus, wie er sich selbst fühlte. Um die anderen Zuhörer schien es auch nicht viel besser zu stehen. Glasige Augen, starr nach vorne gerichtet. Leuchtend rote Nasen. Die Abordnung der Kreisverwaltung. Der Leiter des Bauamtes und sein Sachbearbeiter sowie der Ortsbürgermeister. Im Halbkreis standen sie um den einzigen, dem diese barbarische Kälte und der Wind nichts auszumachen schien. Munter gestikulierend, redend ohne Unterlass, mit einer näselnden Stimme. Dem war nicht kalt. Warm geredet, warm gehalten von einer Ausstattung, die genauso gut in die 30er Jahre gepasst hätte. Eine große Schirmmütze aus grobem grauen Stoff. Stofflappen, die sich links und rechts herausklappen ließen, um die Ohren zu schützen.
Neid gepaart mit Abscheu. Das war es, was Kendzierski empfand. Wie hässlich sah das aus. Ein Mantel im gleichen groben Stoff. Dick und sicherlich warm, Ton in Ton die Hose dazu. Wie konnte man sich in solche Nostalgie-Klamotten packen, wenn man nicht einmal Mitte 30 war? Das blasse Gesicht mit den knochigen Zügen und der spitz hervorstehenden Nase hätte er auch einem Zwanzigjährigen noch abgenommen. Jedes einzelne Wort schien er durch diese lange Nase gewaltsam herauszudrücken. Kendzierski spürte den sich langsam steigernden Hass ganz tief in sich. Vielleicht ließ sich der ja als Wärmequelle nutzen? Er hatte bis jetzt nicht einmal eine schwache Ahnung davon, was er hier überhaupt zu suchen hatte. Planungen für ein Neubaugebiet. Ortserweiterung. Platz für 150 Häuser, 500 neue Einwohner. Panoramablick ins Selztal. Zwischen Reben leben. Er kam sich vor wie auf einer Verkaufsveranstaltung. Ortstermin mit dem Planungsbüro.
„Lassen Sie uns ein kleines Stück weitergehen. Von dort unten können wir die gesamte Fläche übersehen. Von dort aus zeige ich Ihnen, wie wir uns die Verkehrsführung gedacht haben.“ Geübt rollte er den Plan zusammen, auf dem er in den letzten langen Minuten die Ausmaße des Neubaugebietes umrissen hatte, und schob ihn in die schwarze Röhre zurück, die ihm wie ein Pfeilköcher quer über den Rücken hing. Alleine der Bogen fehlte ihm. Oder die Armbrust. Vielleicht in dem kleinen Alukoffer, der neben ihm stand. Der Wilhelm Tell Rheinhessens. Freiheitskampf im Hügelland.
Langsam setzte sich die Karawane in Bewegung. Der jugendliche Wilhelm Tell vorneweg. Seine frierende Streitmacht im Gänsemarsch hinterher. Der Hass auf Tell und Erbes ließ in Kendzierski den Hauch einer wohltuenden Wärme aufsteigen.
2.
Sonntag, den 1. Januar 1933
Mein neuer Anlauf für ein Tagebuch. Der wievielte es ist, vermag ich nicht zu sagen. So oft habe ich schon genauso hier gesessen und angefangen, doch weit bin ich nie gekommen. Ein paar Wochen vielleicht waren es, dann hat mich die Arbeit eingeholt, im Frühling, wenn alles wächst und ich kaum noch hinterherkomme. Dann bin ich abends immer zu müde gewesen, um noch ein paar Sätze aufs weiße Papier zu bringen. Jetzt ist alles ganz anders, da bin ich mir sicher. Es bewegt mich zu viel und das muß niedergeschrieben werden. Was bringt uns das neue Jahr? Noch mehr Probleme, vielleicht die Aussicht, einen Teil davon in den Griff zu bekommen. Ich bin guter Dinge und voller Hoffnung, daß wir das zusammen schaffen.
Vor der Kirche ist heute Morgen die gesamte SA aufmarschiert, als der Rest des Dorfes drinnen betete. Es sind die größten Halunken aus dem Ort dabei gewesen und noch ein paar aus Elsheim dazu. Die haben sie alle zusammengefahren, nur um zu beeindrucken. Die Fuhrwerke standen am Friedhof fein in Reihen. Sie haben sie unbewacht dort abgestellt. Wie hätten die doch blöde geguckt, wenn die Gäule weg gewesen wären. Der Mut hat mir gefehlt für einen solchen Spaß. Es wäre wahrlich eine kurze Freude nur gewesen. Es waren einfach zu viele Braunhemden unterwegs. Sie haben jetzt einen starken Zulauf. Es scheint, als wollten sie jetzt alle mit dabei sein.
Mittwoch, den 4. Januar
Zwei Wingerte gezackert. Es ist noch zu naß. Dickwurz geholt, zwei Wagen.
Freitag, den 6. Januar
Starker Frost. Draußen ist es ja kaum auszuhalten. Nach zwei Stunden im Wingert mußte ich zurück. Der Wind ist zu kalt. Er faucht aus Norden herbei, ein eisiger Wind ist das.
Samstag, den 7. Januar
Kuhstall frisch geweißt. Den ganzen Tag habe ich drinnen gesessen und Werkzeug ausgebessert. Alles, was uns den Sommer über gebrochen ist. Ein Dutzend neue Zinken für die beiden Heurechen habe ich geschnitzt. Die gleiche Arbeit wie jeden Winter, sie ging mir leicht von der Hand. Was würden wir machen, wenn es die kalten Tage nicht gäbe? Es würde ja doch alles bald zerbrochen und unnütze sein. Die Natur erlegt uns die Ruhe auf, die wir brauchen, um alles wieder in Ordnung zu bringen.
Sonntag, den 8. Januar
Von Klein-Winternheim mit dem Zug nach Mainz. Aussprache mit den Anderen. Die SA geht gegen einige vor, es scheint eine neue Taktik zu sein. We. ist auf dem Bahnsteig angegriffen worden, letzte Woche und übel zugerichtet worden. Es waren hinterhältige Halunken. Ihnen verdankt er die Wunde am Kopf, die auch heute noch naß war. Sie heilt sehr schlecht, spannt und hindert ihn daran, sich frei zu bewegen. Zwei ortsbekannte Schläger waren es, die ihm aufgelauert haben. Sie haben ihn erwartet und waren gut vorbereitet. Das war kein Zufall, sondern geplant. Keine Vorwarnung gab es und ihren Hinterhalt haben sie genutzt. Sie haben sofort zugeschlagen. Das zeigt uns, wie furchtlos sie werden, sie gehen doch immer dreister gegen uns vor. Wir müssen da tätig werden. Wir können hier draußen nicht abhauen und in der Menge verschwinden, wie in der Stadt. Und sind wir doch dort viel mehr und daher stärker. In der Stadt, da haben die noch Angst vor der Retourkutsche. Hier draußen auf den Dörfern sind wir alleine auf uns gestellt. Da hilft kein Schreien und Rufen und Warten auf Verstärkung. Bis die herbeigeholt ist, sind wir schon zwei Tage beerdigt.
Abends Streit mit Margot deswegen. Sie hat Angst um mich.
Mit seiner zitternden Hand knipste er das Licht der Tischlampe aus und lehnte sich zurück. Der alte Schreibtischstuhl knarrte gefährlich unter seinem Gewicht. Im dunklen Zimmer, alle Rollläden heruntergelassen, saß er minutenlang regungslos. In sich hineinhörend, dem Rhythmus seines hämmernden alten Herzens lauschend. Nur ganz langsam beruhigte sich die rasende Erregung dort drinnen. Das Pochen in seiner Brust, das seinen gesamten Oberkörper erschütterte. Immer und immer wieder. Zuerst wurden die Abstände ein wenig größer, dann die Schläge sachter. Endlich hatte sein Vater eine Stimme. Die Stimme eines Toten, geisterhaft. Er hatte sie nie gehört. Bei dem Gedanken daran schossen ihm Tränen in die Augen. Sein Gesicht kannte er von den wenigen Fotos. Verblichen, gelblich vom Alter. Die Züge eines jungen Mannes. Der geschwungene Schnurrbart. An beiden Seiten ganz leicht nur nach oben gedreht. Aber jetzt hatte er seine Stimme gehört. Zum ersten Mal, aber mit jedem Wort deutlicher. Sachte am Anfang, die letzten Sätze schon ganz entschlossen. Empört über das Unrecht. Natürlich wusste er, dass das kaum seine Stimme sein konnte. Warum sollte er sich an ihren Klang erinnern können? So lange war das alles her.
Er hatte ihn doch nie gesehen.
3.
Ganz langsam spürte Kendzierski, dass Leben in seine Finger zurückkehrte. Heißes Blut brannte sich durch gefrorene Adern. Jede noch so kleine Bewegung schmerzte. Hände, gepresst auf ein Nadelkissen. Feine spitze Stiche tief unter die Haut, tausendfach. Trotzdem drückte er seine Hände fest gegen den Heizkörper. Wenn die erst einmal aufgetaut waren, konnte er sich auch mit seinen Füßen beschäftigen. Jetzt war daran nicht zu denken. Wie sollte er die Schnürsenkel ohne fremde Hilfe aufbekommen? Allzu lange konnte das ja wohl nicht dauern, bei den Temperaturen. Wenn eines in dem Rathaus der Verbandsgemeinde aus den frühen 70ern funktionierte, dann war es die Heizungsanlage. Die massigen Heizkörper in Dunkelbraun waren von Anfang Oktober bis Ende März gleichbleibend heiß. Ein Drehregler war zwar vorgesehen, doch ließ er sich auch mit äußerster Kraftanstrengung nicht bewegen. Auf Nachfrage hatte ihm der Hausmeister vorletzten Winter mitgeteilt, dass das in allen Räumen so sei. Sie habbe doch do nedd etwa dro rumgefuhrwerkd? Kendzierski hatte ihn fragend angeschaut. Der Vorwurf in der Stimme war das einzige, das er damals verstanden hatte. Ich? Nein, nein. Losse Se die Griffel weg, Herr Kendschinski! Dess hodd alles soin Sinn. Des heiße Wasser muss dorschlaafe kenne, sunst grien die Letzte gonz hinne nix und die Leidunge gefreern in. Donn kenne mer zumache.
Um seine letzten, gewichtigen Worte zu unterstreichen, hatte der Hausmeister den bisher drohend nach oben gehaltenen Zeigefinger in die Waagerechte bewegt. Wie die Mündung eines Pistolenlaufes zielte die Fingerspitze auf Kendzierskis Brust. In Verbindung mit dem grimmige Entschlossenheit vermittelnden Gesichtsausdruck war Kendzierski sofort eines klar gewesen: Hände weg vom Drehregler an der Heizung in seinem Büro, auch wenn er damals nicht verstand, was genau ihm sein Gegenüber hatte sagen wollen.
Jetzt war er zum ersten Mal so richtig froh, dass sich sein Büro bei geschlossenem Fenster in ungeahnte Temperaturzonen bringen ließ.
Nach den Händen kamen die Füße dran. Kendzierski blickte nach hinten zur Tür. Absolute Ruhe auf dem Flur und Erbes hatte ihn ja heute früh schon heimgesucht. Alles andere war beherrschbar. Ohne sich mit den verknoteten Schnürsenkeln aufzuhalten, streifte er die Schuhe von den Füßen. Wenn erst einmal alles richtig aufgetaut war, ließen sich die Dinger ganz leicht entwirren. Fest presste er, auf seinem Bürostuhl sitzend, die Fußsohlen gegen die Heizung. Ein unbeschreibliches wohliges Gefühl breitete sich wärmend in ihm aus. Eine Mischung irgendwo zwischen Glück und Geborgenheit ließ ihn die Hände hinter dem Kopf verschränken und damit der Erschöpfung freien Lauf. Langsam senkten sich seine Augenlider. Der Rest seines Körpers leistete kaum merklich Gegenwehr. Ganz langsam sank er ein Stück weit in sich zusammen, sein Mund öffnete sich einen Spalt und sein Kinn setzte sacht auf seiner Brust auf. Ein kaum vernehmbares Röcheln verriet die sanfte Ruhe. Es war Montagvormittag, halb zwölf. Kendzierskis dämmernde Gedanken zogen ihn zurück in die eisige Hölle, der er gerade entkommen war.
„Das zusätzliche Verkehrsaufkommen wird beträchtlich sein. Das Dorf wird um ein gutes Viertel größer, zumindest was die Einwohnerzahlen angeht. Da ist es nur natürlich, dass auch die Infrastruktur mitwachsen muss. Wir haben in Zusammenarbeit mit der Gemeinde die wichtigsten Punkte bereits besprochen.“ Tell hatte dem Ortsbürgermeister zugenickt und nur kurz Luft geholt. „Kindergarten, Schule, soziale Angebote. Das muss sich alles im Hinblick auf 500 neue Einwohner entwickeln. Den Autoverkehr des neuen Baugebietes wollen wir über eine direkte Anbindung an die Landstraße ableiten. Ich kann Ihnen das zunächst auf der Karte zeigen, dann sehen wir uns das vom Aussichtspunkt aus an. Schauen Sie hier.“
Der Blick Wilhelm Tells galt ihm. Alle standen sie um ihn und seinen riesigen Plan. Krakenarme hielten ihn gegen den kalten Wind aufgefaltet. Lange bewegliche Arme, vier, fünf, sechs. Alle gehörten zu Tell und alle steckten in den dicken Ärmeln seines wollenen Mantels.
„Sie müssen schon noch ein Stück näher kommen. Wir beißen nicht.“ Auch Erbes starrte ihn an. Sein Chef und der Beamte der Kreisverwaltung, mit großen, weit aufgerissenen Augen. Beide mit bläulich schimmernder Haut, tiefgefroren. Nur ihre dünnen Haare bewegten sich im Wind. Er wollte einen Schritt nach vorne, aber irgendetwas hielt ihn fest. Mit aller Kraft versuchte er dagegen anzukämpfen, mit den Armen rudernd. Seine Oberschenkel gehorchten noch, die Kniegelenke schon nicht mehr und seine Füße standen fest. Starres Gras, mit Raureif überzogen, hielt ihn und seine Füße am Ort. Kein Zerren half. Die weiß gepuderten Halme bewegten sich nicht einen Millimeter.
„Die Hauptverkehrsstraße des Neubaugebietes ziehen wir hier an der Seite entlang. Sie verläuft in zwei großen Bögen, um die Landstraße auf der Höhe am bisherigen Ortsausgang zu erreichen. Es ist die einzige Möglichkeit, um den Höhenunterschied zu bewältigen. Gleichzeitig bietet diese Variante aber auch einen gewissen Zusatznutzen.“ Tell grinste breit. Die Wangen in seinem ansonsten blassen Gesicht leuchteten rot. „Das Neubaugebiet lässt sich bei Bedarf rechts der neuen Verbindungsstraße beträchtlich erweitern. Und dass Sie in ein paar Jahren Bedarf haben werden, das kann ich Ihnen jetzt schon prophezeien. Die Südlage, dieser Blick, am Hang, und quasi unverbaubar, das ist selten zu finden.“
Voller Stolz streckte Tell beide Arme in Richtung Selztal, während seine Krakenarme den Plan zusammenrollten und im Köcher verschwinden ließen.
4.
Sonntag, den 8. Januar
Mit Margot nach Mainz gelaufen. Sie wollte wieder mal den Rhein sehen. Dort haben wir lange am Ehrenmal für Stresemann gestanden, direkt am Rhein. Sie ist so gerne dort, um still dem Wasser zuzusehen. Sie trotzt dort der Kälte, die sie sonst nie lange ertragen will. Meine Margot leidet wortlos, aber ich kann nichts ändern, ich kann doch nicht aus meiner Haut.
Dienstag, den 10. Januar
Kartoffeln sortiert den ganzen langen Tag. Sie halten sich leidlich gut dieses Jahr. Nur wenige mußten wir verfüttern und der Rest reicht uns bis die ersten Frühen gut sind.
Mittwoch, den 11. Januar
Trestern eingefahren: Hieberg, Hinter Wiesen, Zwanzig Morgen. Die richtige Arbeit bei diesem Frost. Viel Bewegung bringt das, hoch und runter die Rebzeilen mit der schweren Schubkarre. Nachmittags war es sonnig und richtig warm, trotz sieben Grad minus. Dem Boden tut der Frost gut und mir die Ruhe im Wingert. Kein Mensch war sonst unterwegs im ganzen Selztal. In Elsheim unten war nicht einmal ein Fuhrwerk zu sehen, den ganzen Tag. Die klare Luft, so sauber und weit, bis zum Donnersberg konnte man von unserem Hieberg aus sehen und noch weiter. Ich habe lange da gestanden und in die Ferne geblickt. Soll ich für Margot mit der Partei brechen? Das geht nicht! Gerade jetzt werden wir gebraucht. Überall. Es wird das Jahr der Entscheidung. Den Nazis müssen wir Einhalt gebieten, es begehrt doch sonst keiner auf.
Montag, den 16. Januar
Der Winter macht endlich eine Pause und läßt milde Luft herein. Ich habe den ganzen Tag zum Zackern genutzt.
Mittwoch, den 18. Januar
Drei Stück Wein sind geholt worden, von Goldschmitt aus Partenheim. Er will auch noch vier Stück Roten haben, aber erst im April. Er hat ihn probiert und war sehr zufrieden. Das sind gute Geschäfte, die in Aussicht stehen.
Donnerstag, den 19. Januar
Mist eingefahren: Stadecker Weg und Moruff. Kartoffeln zurechtgemacht. 25 Zentner verkauft.
Sonntag, den 22. Januar
Die SA macht wieder Rundfahrt durch Rheinhessen. Bestimmt vierzig Mann waren es, die heute auf schweren Lastkraftwagen im Ort Halt machten. Sie sind hernach durchs Dorf gezogen, mit Kampfliedern und ihrem lauten Geschrei. Auch ein paar von hier waren mit dabei: der junge Rupp, der Weber, vom Wagner IV der Mittlere und immer der Schmitt. In der Menge ist der ganz groß und laut, nur wenn es um die Wurst geht, dann macht der sich die Hosen voll. Den armen Viehhändler Mayer haben sie auf der Straße fast erwischt. Die ganze Hauptstraße jagten sie ihn sodann entlang. Alle waren sie hinter ihm her, ein Gebrüll und Gejohle. Durch die engen Gässchen konnte er ihnen entwischen, da kannten sie sich nicht aus. Die SA-Männer von hier haben dann alle zu seinem Häuschen geführt. Nicht viel hat da gefehlt, und sie wären eingedrungen und hätten alles zerschlagen in ihrem Haß. Geschrien haben sie: Wir kriegen dich, wir kriegen dich! Komm raus, du Judensau! Beim nächsten Mal holen wir dich! Horst-Wessel-Lied dann zum Abschluß und weiter.
Die Polizei kam eine Stunde danach. Die halten sich da fein raus und sind ja eh zu wenige. Wenn die Nazis an die Macht kommen, gibt es kein Pardon. Das kann man sich jetzt schon ausrechnen, wenn man sie gesehen hat. Noch sind sie mit gezogener Bremse unterwegs, aber wehe, wenn sie losgelassen werden!
Margot hat am ganzen Körper gezittert. Ganz weiß war sie im Gesicht. Irgendwann stehen die mal vor unserer Tür und brüllen, dann ist es bald um uns geschehen. Sie muß doch verstehen, daß ich nicht aufhören kann.
Montag, den 23. Januar
Gezackert. Es ist jetzt schön trocken.
Vorsichtig schloss er das Tagebuch. Die brüchigen Seiten, die beim Umblättern knackend nachgaben. Bei jeder Seite, die er umblätterte, hatte er Angst, dass sie ihm unter seinen zitternden alten Händen zerbrach. Ganz vorsichtig ging er mit den eng beschriebenen kleinen Blättern um, fast zärtlich sacht. Er würde es sich nie verzeihen können, wenn das alles durch ihn Schaden nehmen würde. So lange hatte er darauf gewartet, auf dieses Zeichen. Eigentlich sein ganzes langes Leben. Zumindest seit er sich erinnern konnte. Ein ganzes Leben als Suche. Fotos, Zeitungsausschnitte, mal einen der wenigen Briefe. Tief unten im alten schweren Sekretär hatte er ein dünnes Bündel gefunden, fest verschnürt mit einer Kordel. Es war seine Handschrift, die geschwungenen Bögen der Anfangsbuchstaben, die sich ihm eingeprägt hatten. Damals war er vielleicht fünfzehn gewesen. Die Mutter noch in den Weinbergen und er schon aus der Schule zu Hause. Jeden Nachmittag ging er an den Sekretär. Betrachtete die Schrift, die er nicht zu entziffern vermochte. Gleichmäßig, wie auf einer unsichtbaren Linie tanzend. Lange brauchte er bis er einzelne Worte lesen konnte. Nach und nach die Sätze, einzelne Briefe erfasste. Immer wieder, den gleichen Text. Seine Worte, schöne Worte, liebe Worte.
Den letzten Brief schob er immer wieder beiseite. Über Wochen. Der war anders. Starres Papier, rundherum brüchig. Dort eingerissen, wo er gefaltet gewesen war. Mit dem Bleistift geschrieben, nicht mit dem Füller, wie die anderen. Unbeholfene Buchstaben einer zitternden Hand, gebrochen seine stolze Schrift.
Eines Tages waren die Briefe plötzlich weg. Die Stelle leer, an der er sie bis dahin immer gefunden hatte. Kein Wort. In den Augen seiner Mutter lag etwas Tröstendes. Reden konnte sie nicht. Es lag ein Foto an der Stelle. Er und sie, zusammen, ein Ausflugsfoto. Die Mutter im langen hellen Kleid, im Wind. Mit der Linken hielt sie ihren Hut. In den rechten Arm hatte er sich eingehängt. Er trug einen dunklen Anzug, eine noch dunklere Krawatte mit dickem Knoten. Glückliches Lächeln für den Fotografen. Hinter ihnen eine Säule, aufgeschichtete Quader. Ein weißer Adler war zu erkennen, eine Tafel, die Schrift zu klein. Dahinter Wasser, der Rhein. Unbeschwertes Glück lange vor der Katastrophe. Er hatte das Foto liegen gelassen und nie wieder nach den Briefen im alten Sekretär seiner Mutter gesucht, solange sie lebte.
5.
Das Brechen der gefrorenen Grashalme war deutlich zu hören. Ganz nahe, ein paar Meter höchstens von ihm entfernt. Vorsichtig tastende Schritte, so hörte sich das an. Der Andere suchte etwas. Die Füße langsam und gedämpft aufsetzend. Schritt für Schritt, spähend in das Dickicht. War das der Atem seines Verfolgers, den er da hörte, oder doch der eigene? Krampfhaft bemühte er sich, die Luft anzuhalten, zu lauschen. Er oder ich? Verdammt, er selbst war es! Ganz eindeutig. Sein Pulsschlag beschleunigte sich. Rasendes Herz, hämmernde Schläge in seiner Brust. Hoffentlich war das nicht zu hören. Er spürte die Schläge so deutlich. Stille, kein Laut mehr. Der Andere lauschte, stand auch irgendwo, nicht weit weg von seinem Versteck in den Hecken, zwischen den starrgefrorenen Blättern. Der Jäger, gespannt, bereit sofort zu schießen. Bei der kleinsten Bewegung. Wie lange konnte er das noch aushalten? Ohne Luft. Er musste so dringend tief einatmen. Noch einen Moment. Schritte! Es waren wieder seine Schritte zu hören. Das musste weiter weg sein. Leise Bewegung im gefrorenen tiefen Gras. Jetzt erst traute er sich wieder durchzuatmen. Ganz leise und langsam, obwohl seine Lungen mehr wollten. Mehr von dieser eisigen Luft, die schmerzte.
Ohrenbetäubender Lärm durchbrach die Stille. Kreischend stieg direkt vor ihm ein Rebhuhn auf. Das Klatschen der Flügel, die an den Körper schlugen, um schwerfällig an Höhe zu gewinnen, Flucht nach oben. Krachend beendete ein Schuss den unnützen Fluchtversuch. Der war doch schon längst in der anderen Richtung ein gutes Stück weit weg gewesen. Warum das jetzt? Das Brechen dürrer Äste verriet ihm, dass der Andere getroffen hatte. Dumpf schlug der zerschossene Körper auf dem Boden auf. Verdammt, irgendwo direkt neben ihm war das! Hastig drehte er den Kopf. Suchend hin und her. Schnelle Schritte. Der leblose Körper lag keine zwei Meter von ihm entfernt. Von dort sah der Andere ihn bestimmt, spätestens wenn er sich bückte, um seine Beute aufzuheben. Noch hatte er vielleicht eine kleine Chance zu entkommen. Jetzt sofort! Er sprang zur Seite aus dem Dickicht. Nur ein paar Meter waren es bis zu den dichten Tannen, der Schonung. Weihnachtsbäume soweit das Auge reichte. Dahinten fingen die Häuser an. Wenn er es erst einmal bis dorthin geschafft hatte, war er in Sicherheit. Er hörte die Schritte des Anderen näher kommen und dann einen krachenden Schuss. „Nein! Nicht schießen!“ Kendzierski brüllte, so laut er konnte, in das eisige Dämmerlicht.
„Paul? Ist alles in Ordnung mit dir?“
Klara Degreif stand in seinem Büro. Seine Lieblingskollegin, die ein paar Zimmer weiter für die Bausachen zuständig war. Klara war ein paar Jahre jünger als er. Wenige Zentimeter kleiner, schlank und dunkelblond. Ihre langen glatten Haare hatte sie wie fast immer hinten mit einem unscheinbaren Gummi zusammengebunden. Die Klinke hielt sie noch in der Hand.
„Sorry, mir ist die Tür vielleicht ein wenig zu heftig zugefallen. Habe ich dich geweckt?“