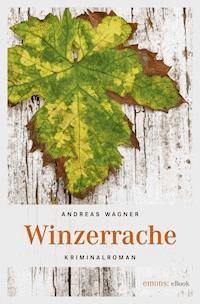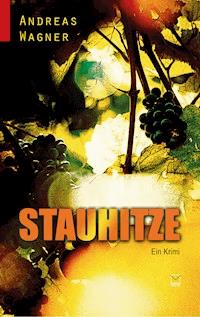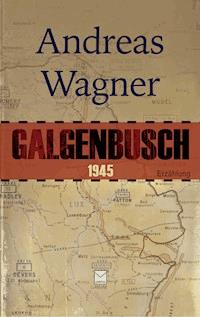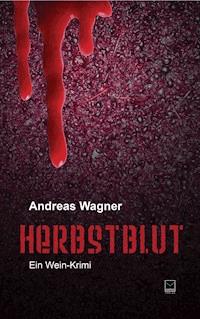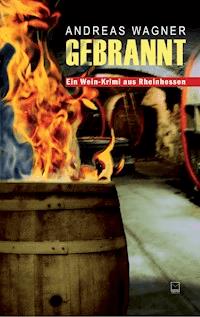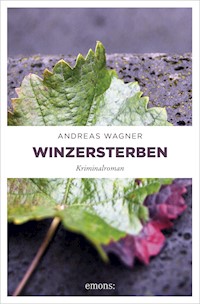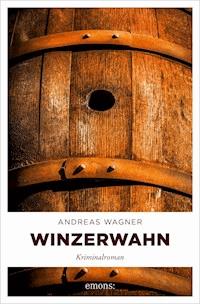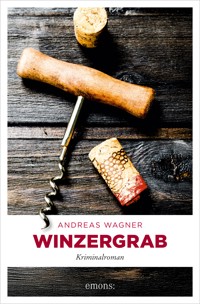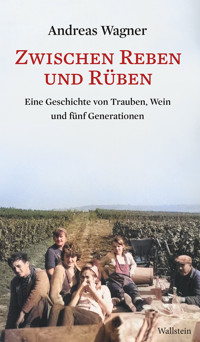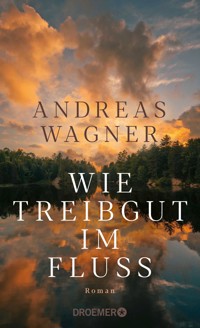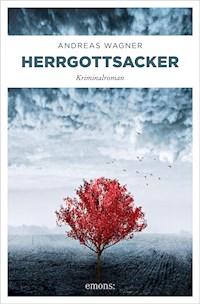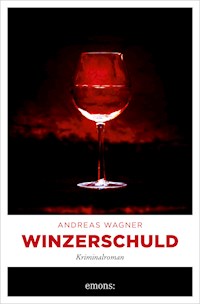Für Nina, Phillip, Hanna und Fabian
Andreas Wagner
Schlachtfest
Die Handlung und alle Personen sind völlig frei erfunden; Ähnlichkeiten wären rein zufällig.
© Leinpfad Verlag Herbst 2012
Alle Rechte, auch diejenigen der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung des Leinpfad Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: kosa-design, Ingelheim E-Book-Konvertierung: Beltz Bad Langensalza GmbH
Leinpfad Verlag, Leinpfad 5, 55218 Ingelheim, Tel. 06132/8369, Fax: 896951 E-Mail:
[email protected]ISBN ebook 978-3-942291-47-7
1.
Die Halme gaben brechend unter dem Gewicht seiner Füße nach. Seine Schritte begleitete ein knackendes Geräusch, das im Klang variierte je nachdem, wie er die Füße aufsetzte. Hob er sie ordentlich in die Höhe und senkte sie dann gerade hinab, war das Splittern der ausgetrockneten Stoppeln ganz deutlich zu hören. Einen Moment hielten sie starr unter seinen Sohlen stand. Auf wankendem Untergrund fühlte er sich dann, das Gleichgewicht suchend für einen Augenblick. Gegen gut achtzig Kilo hatten sie aber keine Chance. Die letzten brachen, wenn er sein gesamtes Gewicht auf den jeweiligen Fuß verlagerte.
Anders klang es, wenn er schlurfend voranschritt. Die Füße kaum angehoben, drückte er sie durch die Halme vorwärts. Ein paar Schritte machte er zwischendurch auf diese Art, auch wenn ihm das Geräusch brechender und splitternder Halme lieber war. Er musste so viel mehr Kraft aufwenden, um die breiten Stahlkappen seiner ledernen Arbeitsschuhe durch die dichten Bündel zu schieben. Es klang eher nach einer harten Wurzelbürste und ihren Borsten, als nach den Resten langer Weizenähren, durch die er unterwegs war.
Jetzt hob er die Füße wieder ordentlich in die Höhe und lauschte dem Brechen und Splittern unter seinen harten Sohlen. Langsam zog er weiter, Schritt für Schritt, den Blick gesenkt auf den trockenen Boden vor sich. Da war wieder eins! Es deutete sich immer mit kleinen Verfärbungen im hellen Boden an. Kaum sichtbar waren sie, aber das Auge fing sie dennoch ein. Ein klein wenig nur war der helle ockerne Boden an diesen Stellen dunkler. Ein Hauch nur, der ihn feucht erscheinen ließ, obwohl es doch seit etlichen Wochen schon nicht mehr wirklich geregnet hatte. Dennoch hoben sich die schmalen Pfade vom Rest ab. Aus verschiedenen Richtungen liefen sie auf das Loch zu und führten das Auge und ihn zum Ziel.
Er ließ sich nach vorne auf die Knie sinken, stellte den kleinen weißen Eimer links neben sich ab und nahm mit dem alten Esslöffel, den er in der Rechten hielt, ein paar Körner aus diesem auf. Mit dem Zeigefinger der Linken machte er den Eingang des Mauselochs frei und ließ dann ein paar rote Kügelchen hineinrollen. Mit dem gekrümmten Zeigefinger schob er ein wenig lose Erde hinterher und verschloss damit die Öffnung. Unter einem gut hörbaren Seufzer schob er sich wieder in die Höhe. Dabei griff er nach dem Bügel des kleinen Eimerchens. Begleitet vom Brechen der Stoppeln unter seinen Füßen setzte er seinen Marsch über den abgeernteten Acker fort.
Die Trockenheit im Frühjahr war schuld an der Mäuseplage. Kein Tropfen Regen war im April und Mai gefallen. Die Mäuse hatten sich dadurch unbegrenzt vermehren können. Durch ein paar ordentliche Schauer im Frühjahr ersoff sonst ein Teil von ihnen. Die Brut in ihren Löchern kam nicht in voller Zahl durch. Ganz natürlich dezimiert durch ein paar Dutzend Liter Regen pro Quadratmeter. Die Trockenheit im Frühjahr hatte also doppelt Schaden angerichtet. Zuerst war das Getreide kaum gewachsen. Ein Teil der Halme war sogar ganz vertrocknet, weil die Wurzeln längst noch nicht in tiefere Erdschichten vorgedrungen waren. Im Mai hatte es hier auf dem Acker sogar nach einem Totalschaden ausgesehen, so licht standen die wenigen Halme dürr in die Höhe. Juni und Juli hätten ein Stück weit für Linderung gesorgt, wenn nicht die vielen Mäuse wieder einen Großteil davon zunichte gemacht hätten. Zu schwere Ähren auf dünnen Halmen, die den Rückstand aus dem trockenen Sommer nicht mehr aufzuholen vermocht hatten. Vieles lag bei der Ernte platt auf dem Boden. Das war fast ganz aufgefressen von den Mäusen. Man konnte jetzt noch erkennen, wo im Juli und August große Flächen eingeknickt darnieder gelegen hatten. An diesen Stellen konnte man das Gewirr der Mäusewege kaum übersehen. Unzählige Löcher, die er alle gewissenhaft mit den kleinen roten Giftkörnern bestückte, die der Plage den Garaus machen sollten. Der Wirkstoff verhinderte die Blutgerinnung. Nach einiger Zeit starben die Tiere an inneren Blutungen oder kleinsten Verletzungen. Das geschah zeitverzögert zum Verzehr der Körner und verhinderte, dass andere Artgenossen misstrauisch wurden. Auf diese Weise fraßen mehr Tiere an der gleichen Stelle, weil der Anblick verendeter Familienmitglieder sie nicht warnen konnte. Wenn es die Natur nicht regelte, dann musste er es eben tun. Er schnaufte vor sich hin. Ansonsten würden ihm die Viecher das frisch gesäte Korn schneller wieder auffressen, als er es in den Boden gebracht hatte.
Er hielt für einen Moment an. Den Eimer mit den Ködern in der linken und den Löffel in der rechten Hand, ließ er seinen Blick schweifen. Die Weite hier oben auf dem Hochplateau tat ihm gut. Es war schön hier zu stehen. In der Ferne war der Rheingraben zu erkennen. Wie ein dunkler Krater hob er sich von der hellen trockenen Erde ab. Es roch schon nach Herbst, obwohl die Temperaturen Anfang Oktober noch fast sommerlich anmuteten. Die kurzen Ärmel seines rot-blau karierten Hemdes täuschten nur notdürftig darüber hinweg, dass sich die Vegetationsphase ihrem diesjährigen Ende zuneigte. Es war mehr Zersetzung und Vergehen, als dass Neues emporwuchs. Das nächste Jahr würde besser werden. Er sog die warme Luft des späten Vormittags ganz tief in sich hinein. Sein massiver Brustkorb schwoll an.
Auf ein schlechtes Jahr folgte doch fast immer ein gutes. Vor allem hier auf einem seiner ertragreichsten Äcker. Der Boden hatte sich erholt in diesem Jahr. Die eigenen Kräfte geschont, um im nächsten Jahr umso reichlicher zu geben.
Er wollte eigentlich in diesem Moment weiterlaufen, mit neuem Schwung über die brechenden Halme hinweg, aber das Brummen eines Motors hielt ihn ab. Er kannte den alten grünen Lada-Geländewagen, der hinter ihm ein Stück weit sogar auf seinen Acker gefahren war. Das machte nur er und daran konnte man gut erkennen, dass er nicht hierher gehörte. Selbst während der Getreideernte im Hochsommer, wenn ein kleiner Funken nur genügte, um einen Großbrand im trockenen Stroh auf den Äckern zu entfachen, raste der mit dem alten Geländewagen über die gemähten Felder. Keiner von hier wäre so bescheuert. Der hatte sich hier ja auch nur hereingedrängt, keiner wollte ihn, aber er machte sich trotzdem breit.
Jesko Steinkamp war mittlerweile aus seinem Geländewagen herausgesprungen und kam auf ihn zu. Schnelle Schritte wie immer, gehetzt und vielbeschäftigt wollte er aussehen, egal wobei. Seine glatt zurückgekämmten dunkelbraunen Haare bewegten sich nur leicht. Reichlich Gel gab ihnen so viel Gewicht, dass sie in der gewünschten Position liegen blieben. Trotz der Wärme trug er seine grüne Wachsjacke über dem himmelblauen Hemd und hellbraune Cordhosen. Mit dem wackligen Jeep im Hintergrund sah er in dieser Verkleidung wie ein verarmter Landadeliger aus. Graf Jesko von und zu, Erbe eines stattlichen Rittergutes. Davon träumte der wahrscheinlich, wenn er sich morgens in seine Verkleidung zwängte. Er schnaufte verächtlich und spuckte einmal neben sich. Eine lachhafte Erscheinung auf ein paar Hektar Pachtland, zwischen Kohlköpfen, Brokkoli und buntem Salat.
„Was soll das mit dem Gift hier auf dem Acker?“
Der andere war jetzt nur noch ein paar Meter von ihm entfernt. Die geschwollenen Adern an dessen Hals konnte er mittlerweile deutlich erkennen. Das war also der Grund für seinen Auftritt.
„Mein Acker, mein Getreide und auch meine Mäuse, die ich vergifte!“
Er ging ihm einen Schritt entgegen und brachte sich breitbeinig mit aufgeblähtem Brustkorb in Position.
„Das ist doch idiotisch. Es gibt so viele Bussarde in diesem Jahr. Über den Herbst holen die noch die meisten Mäuse weg. Besonders jetzt, wo denen die Deckung fehlt auf den geräumten Äckern.“ Er stand nun direkt vor ihm. Stoßweise atmend, wegen der hundert Meter, die er über den Stoppelacker gerannt war. „Jetzt vergiften Sie erst die Mäuse und wahrscheinlich noch einen Teil der Bussarde mit, die die halbtoten Tiere fressen. Dann geht im Laufe des Winters der Rest der Bussarde ein, weil ihnen die Nahrungsreserven fehlen. Und im nächsten Jahr haben wir wieder die gleiche Mäuseplage. Hirnlos ist das!“
„Das ist mein Acker hier, also runter, bevor ich zuschlage.“
Er spürte, wie es in seinem Brustkorb hämmerte. Beide Fäuste, die rechte mit dem Löffel und die linke mit dem Eimerchen, ballte er krampfhaft. „Wegen der paar verlausten Kohlköpfe und dem geschossenen Salat brauchst du hier nicht den Dicken zu machen. Das hier ist mein Acker und von dem verschwindest du jetzt augenblicklich. Und wenn du mit deinem rostigen Jeep noch einmal über eines meiner Grundstücke fährst, dann zeige ich dich an!“
Er machte drohend noch einen Schritt auf den anderen zu. Der Steinkamp wich ein Stück zurück. Mehr mit dem Oberkörper, als ob er jetzt schon einen Schlag erwartet hätte. Seine Augen kniff er dabei zusammen. Er war gut zehn Jahre jünger, Mitte vierzig, dürr, aber mit kugeligem Bauch und ohne Muskeln. Hoch aufgeschossen, aber ein wenig krumm, immer nach vorne gebeugt. Haltung und Statur eines Menschen, der die meiste Zeit seines Lebens auf einem gepolsterten Bürostuhl verbracht hatte, um bei jedem Gang auf die Toilette, den Sitz der zurückgegelten Haare überprüfen zu können. Dieser Gedanke ließ ihn grinsen und auch die Genugtuung, die er wärmend spürte, weil der jetzt nicht mehr weiterwusste. Als Verlierer würde er seinen Acker verlassen. Das, was er hier machte, hatte alles seine Ordnung und er hielt sich genau an die Regeln. Die Giftkörner in die Löcher und alles schön zumachen, damit nicht andere Tiere zu Schaden kamen. Er wusste genau, dass der Steinkamp nur darauf wartete, dass er ihm eins überbraten konnte. So waren sie, diese Typen, die keine Ahnung von der Landwirtschaft hatten, aber doch den Mund mehr als voll nahmen. So lange bis sie sich daran einmal verschluckten. Von so einem brauchte er sich nicht erklären zu lassen, wie das alles zu funktionieren hatte.
„Worauf wartest du noch, runter hier, bevor ich mich vergesse!“
Er versuchte ihm drohend noch einen Schritt näher zu kommen. Der Steinkamp zeigte aber keinerlei Anzeichen, zurückweichen zu wollen. Seine Lippen hielt er einen kleinen Moment noch fester zusammengepresst, bevor es in knappen Worten aus ihm herausdrängte.
„Das kann ganz schnell gehen.“
„Was?“ Er fühlte jetzt das Blut heiß in seinen Kopf schießen. Was wollte der noch? „Was kann ganz schnell gehen?“ Er brüllte ihn an.
„Es ist jetzt Herbst.“ Der Steinkamp sprach leise und ganz langsam. „Die Aussaat hier macht vielleicht schon ein ganz anderer.“ Seine Lippen verformten sich. Er glaubte ein Grinsen auf dem Gesicht seines Gegenübers zu sehen.
„Das hier ist mein Acker, schon lange!“
Er ließ den Eimer fallen und ballte seine linke Faust. Die Rechte mit dem alten Löffel hielt er drohend in die Höhe. „Wag nicht, mir den abzunehmen!" Er wollte noch etwas Drohendes hinterherschicken. Aber es fiel ihm nichts weiter ein. Er spürte in diesem Moment schon, dass er der Verlierer sein würde. Und der Steinkamp grinste wieder. Jetzt noch breiter, so selbstsicher und siegesgewiss. Die Hand mit dem Löffel zitterte vor seinen Augen. Er musste jämmerlich aussehen, wie er da stand. Krampfhaft drohend. Aber womit? Der ließ sich nicht einschüchtern. Der genoss es immer mehr, ihm zuzusehen, bei seinen hilflosen Bemühungen.
„Es war gar nicht so teuer, den Georg Fauster davon zu überzeugen, dass er mir neben seinen übrigen Flächen auch diese hier ab dem kommenden Jahr verpachten wird. Nur ein paar Scheine auf die Hand hat mich das gekostet.“ Steinkamps Lippen blieben offen, sodass er beim Grinsen seine weißen Zähne zeigte.
Das war zu viel. Der Zorn trieb ihn an und aus seinem Mund kam ein tiefes Knurren. Schnell tat er einen halben Schritt nach vorne, ließ den Löffel fallen und holte mit seiner geballten Rechten aus. Das sollte er ihm büßen, dieses miese Schwein! Windelweich würde er ihn schlagen, hier auf seinem Acker, ihm alle Knochen brechen. Ein spitzer Schmerz ließ ihn in der Bewegung aufheulen. Sein Oberkörper krümmte sich nach vorne, die Faust verfehlte ihr Ziel um ein gutes Stück. Der gezielte Tritt Steinkamps auf seine rechte Kniescheibe hatte ihn zusammensacken lassen.
Alles war so schnell gegangen, dass er die Bewegung seines Gegenübers erst sah, als dessen Bein schon wieder auf dem Weg zurück war. Er fiel nach vorne auf die Knie, dann zur Seite weg. Unter Schmerzen wälzte er sich auf den Rücken. Tränen schossen ihm in die Augen. Aus seinem Mund kamen gequälte Laute. Es war ganz sicher irgendetwas kaputt gegangen, dort unten in seinem Knie.
Er spürte die Wucht und den damit einhergehenden Druck auf seinem Brustkorb, als der Steinkamp auf ihn sprang. Seine Augen waren geblendet von der Sonne, die gleißend hoch am Himmel stand. Den Schlag, der ihn knapp oberhalb des linken Auges traf, hatte er nicht sehen können. Und selbst wenn, wäre ein Ausweichen kaum möglich gewesen. Er konnte jetzt das heiße Blut spüren, das ihm über die Schläfe und in das Auge strömte. Ein roter Schleier, der fast wohl tat, weil er ihn vor der schmerzenden Helligkeit schützte. Den zweiten Schlag in sein Gesicht erkannte er am Schatten, der ihm vorauseilte. Ein Reflex ließ seinen Kopf wegzucken. Den Schmerz konnte er trotzdem nicht verhindern. Die Faust traf ihn von links kommend auf der Wange und fuhr über seine Nase. Das knackende Geräusch und das herausschießende Blut verrieten ihm deutlich, dass mit diesem zweiten Hieb größerer Schaden entstanden war. Ein rauer Schrei, gar nicht wirklich laut, kam aus seinem weit aufgerissenen Mund. Der Schmerz schickte blitzende Sternchen vor seine Augen. Alles andere war Dunkelheit um ihn herum. Dumpfe, zarte Dunkelheit, die ihn einhüllte und ihm das Gefühl nahm, noch auf dem Rücken dazuliegen. Er schwebte frei in der Luft, spürte gar nichts mehr. Auch den Schmerz nicht, den seine gebrochene Nase verursachte, und das Knie. Vielleicht bewegte sich sein Körper noch immer, zuckte hin und her, wand sich unter dem Schmerz. Er bekam das aber nicht mehr mit.
Erst der Druck auf seinem Hals holte ihn zurück. Er versuchte zu spucken, um das viele Blut, das er als Ursache vermutete, loszuwerden. Den Hals frei bekommen, um wieder unbeschwert durchatmen zu können. Es gelang ihm nicht. Es waren dessen Hände, die er jetzt deutlich auf sich spüren konnte. Sie nahmen ihm die Luft, immer mehr. Sein eigenes gurgelndes Röcheln konnte er hören. Die Todesangst, die seinem Körper letzte Kräfte verlieh. Die aufgerissenen Augen Steinkamps erkannte er über sich. Sein Grinsen. Seine Entschlossenheit, nicht abzulassen. Ein schwaches Gurgeln kam noch aus ihm. Da war doch noch Leben, obwohl sein Widerstand schon längst gebrochen war. Er fühlte, wie es in diesem Moment heiß zwischen seinen Beinen lief, über die Oberschenkel. Jetzt war bald alles vorüber.
2.
Paul Kendzierski las den Brief schon zum zweiten Mal.
Diesmal schüttelte er den Kopf sachte zu den einzelnen Sätzen. Es war kaum zu glauben, was hier mit den gleichmäßigen, leicht verwischten Buchstaben einer Schreibmaschine schwarz aufs Papier gebracht worden war. Das Schreiben war an den Verbandsbürgermeister Ludwig Otto Erbes gerichtet. Kendzierski hatte es daher zunächst nur kurz überflogen, mit der Absicht, es nach wenigen Blicken und seinem Kürzel in die Ablage zu befördern, in der es noch ein paar Wochen liegen konnte. Bis dahin hatte sich der Grund des Schreibens erledigt. Das Gerüst sollte bis dahin längst abgebaut sein.
Die ersten Sätze schon hatten ihn stutzig gemacht. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, in obiger Angelegenheit mit Ihrem Bezirkspolizisten in Kontakt zu treten, wende ich mich nun direkt an Sie. Ich hoffe inständig, dass ich zumindest von Ihnen eine Antwort auf mein Schreiben erhalten werde. Kend- zierskis Blick huschte an das Ende des Briefes. Die deutlich lesbare Unterschrift in geschwungenen, ausladenden Bögen. Hieronimus Lübgenauer. Durchschlag an Herrn Bez.Pol. P Kendzierski. Daher kam also der leicht verschwommene Eindruck, den die Buchstaben auf dem Papier erweckten. Sauber mit der Schreibmaschine getippt, inklusive mehrerer Durchschläge. Das Original für Erbes, der erste Durchschlag für ihn und der zweite für die eigenen Unterlagen zu Hause. Die ganz alte Schule, Oberstudienrat im Ruhestand oder höherer Dienst innere Verwaltung. Der Name sagte ihm dennoch nichts. Bereits mit Schreiben vom 14. September d. J. habe ich Herrn Bez.Pol. P Kendzierski auf die unhaltbaren Zustände, die mit den Renovierungsarbeiten am Haus Wassergasse No. 37einhergehen, hingewiesen. In gleichem Schreiben habe ich ihn gebeten, in dieser Sache aktiv zu werden und zeitnah für Abhilfe zu sorgen. Das Gerüst, das der Nachbar für die Fassadenisolierung und den nachfolgenden neuen Verputz inklusive Anstrich errichtet hatte, ragte einen Meter und 47 Zentimeter über die Grundstücksgrenze hinaus und stand damit schon seit etlichen Wochen auf dem Bürgersteig, der zum Grund und Boden des Unterzeichners gehörte. Kendzierski hatte beim ersten groben Überfliegen des Schreibens genau an dieser Stelle das Blatt zur Seite legen wollen. Erstens konnte er sich nicht an ein Schreiben eines Hieronimus Lübgenauer erinnern und zweitens lief die Frist für das betreffende Gerüst, dessen Aufbauplan er sogar noch grob vor Augen hatte, Ende der kommenden Woche ab. Noch bevor den Unterzeichner also seine Antwort erreichen würde, hätte sich das Problem schon auf ganz natürliche Weise von alleine erledigt.
Er hatte trotzdem weitergelesen. Wohl nur aus dem Grund, weil er wissen wollte, womit der Rest der Seite gefüllt war. Die Beschwerde über sein angebliches Nicht-aktiv-Werden und das Gerüst hatten nur wenige Zeilen eingenommen. Dreiviertel des Schreibens blieben also noch, wofür auch immer. Kendzierski schüttelte wieder den Kopf. Unsicher, ob er laut lachen oder erschrocken dreinblicken sollte. Das Verhalten der Eigentümer Wassergasse No. 37 in besagtem Fall reihte sich ein in eine Kette nicht mehr zu tolerierender Verfehlungen der letzten Jahre. Angefangen hatte alles damit, dass seine Nachbarn und ihre Mieter nur außerordentlich selten die Straße fegten, wenn, dann lustlos und so, dass sie einen Teil des Kehrichts einfach weiter und damit auf seinen Teil des Bürgersteigs schoben. Eine Zeit lang habe er das hingenommen, um des lieben Friedens Willen, zwischen Nachbarn, Haus an Haus. Man wolle doch gut miteinander auskommen, gerade wenn man so nahe beieinander wohnte. Die Häuser in den alten Ortskernen klebten ja förmlich aneinander. Deswegen habe er eben alles zusammengekehrt, auch die Reste, die sie weiter zu ihm geschoben hatten. Er habe das so gemacht, dass er seinen eigenen Kehrtag vom Samstag auf den Dienstag vorverlegte, um dann zumindest den anfallenden Abfall in die Mülltonne des Nachbarn zu entsorgen, der sie bereits an diesem Tag herausstellte, obwohl doch erst am Mittwoch die Abholung anstand. Das war ja sein gutes Recht, schließlich musste er seine eigene Mülltonne, die er natürlich erst mittwochs, aber dafür schon um kurz nach sieben in der Frühe vors Haus stellte, nicht noch mit dem Kehricht des Nachbarn beschweren.
Dabei war ihm aufgefallen, dass sie in Wassergasse No. 37 anscheinend nicht nur das Kehren nicht sonderlich ernst nahmen. Alle drei Mülltonnen, Papier, Grüner Punkt sowie Restmüll, die er auch in den folgenden Wochen unauffälligen Routinekontrollen unterzog, wiesen eklatante Mängel im Hinblick auf Sortiergenauigkeit und Wiederverwertbarkeit der ihnen zugeführten Gegenstände auf. Zum Teil war er selbst eingeschritten und hatte Papier aus dem Grünen Punkt in die Papiertonne sowie einen eindeutig dem Restmüll zuzuordnenden Sack aus dem Grünen Punkt in das richtige Behältnis platziert. Dabei hatte er auch ein gutes Dutzend Glasflaschen, zumeist hochprozentige Alkoholika, heraussortiert und der örtlichen Glastonne zugeführt. Der im vergangenen Winter kaum und wenn dann nachlässig und freudlos vom Schnee geräumte Bürgersteig sowie das jetzige Baugerüst hätten das Maß endgültig voll gemacht. Es ist an der Zeit einzuschreiten, Stärke zu zeigen. Wir können doch nicht alles durchgehen lassen. Irgendwann tanzen sie uns dann auf der Nase herum. Ich bin mir aber doch ganz sicher, dass ich in Ihnen, verehrter Herr Verbandsbürgermeister, einen Verbündeten gefunden habe, der mir in meinen Bemühungen nicht nur das notwendige Verständnis entgegenbringt, sondern diese auch tatkräftig zu unterstützen bereit ist. Kendzierski konnte es jetzt nicht mehr zurückhalten. Es war ein kurzes Auflachen nur, das von einem entschiedenen Klopfen an seiner Bürotür jäh unterbrochen wurde. Hieronimus Lübgenauer persönlich? Bloß nicht! Viel eher noch Erbes. Die Entschlossenheit im Anklopfen sprach eindeutig für diese Variante. Der Chef. Sicher im dunklen Anzug, der über dem kugeligen Bauch spannte. Eine grelle Krawatte aus dem eigenen fast unerschöpflichen Fundus, fest zugeschnürt, sodass sich der Hemdkragen tief in den viel zu kurzen, aber fleischigen Hals drückte. Nervös wippend. Die mutig quer gelegte Locke, die die kahler werdende Stelle im Mittelbereich von Erbes' Kopf überdecken sollte, schwang im wippenden Takt luftig locker mit. Immer wieder auf die Zehenspitzen, um an Größe zu gewinnen. Für einen kleinen Moment nur. Kendziäke, habbe Sie denn auch den Briefgelese? Da müsse Sie was mache, das kann so nicht weitergehen. Dabei würde er mit dem Zeigefinger, weiter wippend, in der Luft herumfuchteln. Warum habbe Sie denn da nicht gleich reagiert? Wir sind Dienstleister für unsere Bürger. Ihre Anliegen müssen wir ernst nehmen, es zumindest versuchen. Und schlichten, wenn es Probleme gibt, auch mal in einem Nachbarschaftsstreit. Sie müssen raus aus dem Büro und auf die Leute zugehen. Das erwarten die von uns. Bürgernahe Verwaltung!
Es war ein Reflex. Kendzierski schüttelte den Kopf heftig hin und her. Das Klopfen erklang erneut, nur ein wenig zaghafter jetzt. Es konnte also nicht Erbes sein. Der wäre schon längst hereingekommen, auch ohne auf eine Antwort zu warten.
„Ja!“
Er legte den Brief zur Seite. Für sich hatte er noch keine endgültige Entscheidung getroffen, wie er damit weiterverfahren wollte. Abwarten und Aussitzen oder doch ausweichend antworten, in der Hoffnung, dass sich dieser Lübgenauer dadurch beruhigen ließ.
„Klara!“
Seine Kollegin hatte ihren Kopf vorsichtig durch den Spalt hereingeschoben.
„Du bist alleine?“ Sie ließ ihren Blick durch das Zimmer schweifen. „Von außen hatte es sich so angehört, als ob du Besuch hättest. Stimmen.“
Er deutete einen Blick unter den Schreibtisch an. „Kann sich höchstens hier versteckt haben.“ Leise flüsternd fuhr er fort. „Müsste dann aber Erbes sein. Sonst passt da wohl keiner drunter.“
Klara grinste und kam herein. Ihr Büro lag nur ein paar Türen weiter auf dem gleichen Flur. Sie war für die Bausachen in Nieder-Olm und den umliegenden sieben Landgemeinden zuständig und nach seinem Wechsel von Dortmund in die rheinhessische Provinz seine verständnisvolle erste Ansprechpartnerin gewesen. Die Simultanübersetzerin für die Eigenarten der weinhaltigen, überschaubaren Region, in der er seither seinen Dienst als Bezirkspolizist versah. Ein Jahr hatte es gedauert, bis sie sich eingestehen konnten, dass sie doch mehr als nur gute Freunde waren. Ein weiteres Jahr hatten sie ihre Beziehung geheim gehalten. Sie wollten damals nicht zum Traumpaar der Verbandsgemeindeverwaltung ausgerufen werden. Einen Kuss gab es daher nur hinter verschlossenen Türen. So, dass es sonst keiner mitbekam. Aber geahnt hatten es ohnehin schon alle, wahrscheinlich auch gewusst, als sie das Versteckspiel endlich beendeten. Nur Erbes redete weiterhin von Ihrer, äh, Kollegin, Kendziäke, wenn er in seiner Anwesenheit von Klara sprach. Kendzierski gefiel sich in dieser Rolle. Er als Erbes, hektisch wippend, um Größe zu gewinnen. Und immer das vorgeschobene unsicher lange äh. Äh-Ihre-Kollegin, äh-Kendziäke.
„Du denkst an unseren Termin nachher?“
Klaras Blick hatte jetzt etwas geschäftsmäßig Entschiedenes. Eine Frage, die keine Frage war. Mehr eine Klarstellung, ein Hinweis mit Fragezeichen, der aber keine wirkliche Entscheidungsmöglichkeit vorsah. Der Termin nachher: Er versuchte ausweichend zu lächeln und nickte zweimal, um Zeit zu gewinnen. Ganz langsam dämmerte ihm, was der heutige Tag noch an Kuriositäten für ihn bereithielt.
Er hatte es lange geschafft, immer wieder von diesem Thema sanft, aber nachdrücklich und auch teilweise ganz erfolgreich abzulenken. Bis vor einigen Wochen war es sogar einige Zeit ruhig geworden. Er glaubte, dass er dadurch noch einen ordentlichen Aufschub bekommen hatte. Klar würden sie einmal zusammenziehen. Das war der Lauf der Dinge, den er auch akzeptierte. Aber so eilig war es ihm damit auch wieder nicht. Er hatte sich sehr gut im bisherigen Zustand eingerichtet. Sie wohnten ja doch fast zusammen, aber in getrennten Wohnungen. Das hörte sich zwar reichlich bescheuert an, beschrieb den derzeitigen sehr erfolgreichen Zustand dennoch hinreichend treffend. Jeder hatte sein eigenes Reich und trotzdem waren sie oft zusammen. Klara in seiner kleinen Wohnung, auch für mehrere Tage und Nächte, dann wieder er bei ihr und auch beide mal für sich alleine. Die Tür hinter sich zugezogen. Stille, Einsamkeit, wenn auch nur das Gefühl von Einsamkeit. Die geordnete eigene kleine Welt. In der hatte er sich so gut eingerichtet, dass er mächtig Scheu davor hatte, das alles aufzugeben. Sein eigenes Reich. Mit dem Zusammenziehen verband er ein gefühltes zu ihr Ziehen. Idiotisch eigentlich, wo sie doch auch auszog und sie zusammen eine neue Wohnung suchten. Trotzdem hatte er das Gefühl, alles aufzugeben. Aus diesem Grund hatte er sich immer gewunden, wie ein glitschiger Aal, wenn das Thema gemeinsame Wohnung anstand. Gute Begründungen, keine Ausreden, wie er fand. Unmöglich ähnlich gute Wohnungen zu finden, gerade in der Größe, die sie zusammen brauchten. Der Markt abgegrast. Es wäre doch kopflos, nur deswegen einen Vertrag unter ungünstigen Bedingungen abzuschließen und sich wohnungs- und lagenmäßig zu verschlechtern. Zusammen wohnten sie doch eigentlich jetzt auch schon. Viel mehr wäre das auch in einer neuen Wohnung nicht. Als das alles nicht mehr wirkte, hatte er sogar seine negativen Eigenschaften in den Ring geworfen. Die Launen, die Ruhe, die er ab und an brauchte, die streng riechenden Socken, sein Schnarchen. Es schien geholfen zu haben. Klara hatte nicht mehr davon angefangen. Ein stiller Triumph, den er nicht auskostete, aber dennoch seinem diplomatischen Geschick zuschrieb. Clever gelöst die Situation für ein, zwei Jahre, dann konnte man ja noch mal darüber reden. Er liebte sie ja schließlich auch.
Absolute Ruhe, bis letzte Woche. Ihr Lächeln, das er sonst so gerne hatte. Die dunklen, glatten langen Haare um ihr zartes Gesicht, das sie immer ein paar Jahre jünger wirken ließ, als sie wirklich war. Ihr Lächeln hatte einen Anflug von Überlegenheit gezeigt. Er wusste noch nicht warum und eigentlich hatte sich ihm dieser kleine unscheinbare Zug in ihrem Blick auch im Nachhinein erst wirklich vollends erschlossen. Sie wusste aber ganz sicher in diesem Moment schon, wohin sie wollte, mit ihm und dem Gespräch, das sie angefangen hatte. Paul, mein Vermieter macht Probleme. Er braucht die Wohnung für seine Tochter, die im kommenden Winter mit der Ausbildung fertig ist. Er hatte sie verständnisvoll in den Arm genommen und sich sofort mit fester Stimme bereit erklärt, mit dem Vermieter zu reden. Im schlimmsten Fall stünde er bereit für Wohnungssuche, Verpacken und Schleppen von Umzugskartons. Kendzierski war sich sicher, es genau so formuliert zu haben. Klara musste ihn absichtlich falsch verstanden haben! Das war ihm schon in dem Moment klar geworden, als sie ihm verklärt in die Augen sah. Zwei kleine Tränen kullerten über ihre Wangen. Die weggewischte Trauer über den Verlust oder die Freude darüber, dass er einer gemeinsamen Wohnung zugestimmt hatte. Die Tränen verboten ihm sofort heftigst zu widersprechen. Als sie sich am nächsten Morgen vor dem Büro trafen — Klara hatte darauf bestanden, alleine zu Hause in ihrer alten Wohnung zu schlafen — präsentierte sie ihm strahlend den ersten Besichtigungstermin. Ich habe mir dafür extra die letzten beiden Stunden am Freitag freigenommen. Du hast ja bestimmt noch Überstunden von Fassenacht und kannst problemlos weg.
„Um elf hole ich dich ab. Es sind nur drei Wohnungen. Ein Makler. Eine erste Bestandsaufnahme. Die Grundrisse sind gut.“ Sie lächelte ihn an. „Ich freue mich ja so!“
Kendzierski lächelte zurück, ernsthaft bemüht, dass das nicht gequält, sondern reichlich natürlich wirkte. Er hatte das wirklich vergessen. Oder vielleicht auch verdrängt. Oder beides. Egal.
3.
Georg Fauster hob den Eimer leicht an und schob ihn einen halben Meter weiter. Der hölzerne Griff klebte an seiner Hand, so viel Süße hatten die Trauben. Er richtete sich auf und blickte die Zeile hinunter. Genüsslich streckte er sich. Die Knochen eines Siebzigjährigen brauchten ab und an eine etwas entspanntere Haltung als das ständige Sich-nach-vorne-Beugen während der Traubenlese. Der Nebel im Tal war ganz verschwunden. Heute Morgen noch, als sie zusammen rausgefahren waren, hatte er wie eine dichte Suppe dort unten fest gehangen. Nur hier oben im Berg war die Sicht schon frei gewesen. Die Sonne hatte das bisschen Nebel schnell verzehrt, aufgelöst und das Tal geräumt. Jetzt hatte er freie Sicht auf die unteren Weinbergslagen, die in die Ebene ausliefen. Dann folgten noch ein paar Stoppeläcker bis an die Selzwiesen heran. Das Flüsschen durchschnitt das breite Tal. Auf dem anderen Ufer ging es genau so weiter wie diesseits. Erst ein paar Wiesen und dann die Äcker: Rüben, Getreide und Spargel. Nur die Weinberge fehlten. Die Rebstöcke brauchten die Sonne der Südseite, damit sie ordentliche Trauben brachten.
Ein kaum hörbares Stöhnen kam über seine Lippen, als er sich wieder leicht nach vorne beugte, um mit der linken Hand nach der nächsten Traube zu langen, die die Schere in seiner Rechten dann vom Stock schnitt. Für einen kurzen Moment hielt er die Traube in der Hand, drehte sie und legte sie dann in seinen Eimer. Es war mal eine, die gut aussah. Bei den meisten musste er einzelne Beerchen oder ganze Fäulnisnester herauskratzen. Bei den ganz extremen blieb nur ein Drittel der abgeschnittenen Traube für den Eimer übrig. Der Rest lag als Abfall auf dem Boden, wenn er mit ihr fertig war. Herausgekratzt mit der langen Spitze der Schere. Die staubenden faulen Beerchen, die sie nicht haben wollten. Er wusste, warum er viel lieber den Vollernter kommen ließ. Da war das schnell gemacht, das Stück. Aber der Herbert wollte es so. Schon seit ein paar Jahren nahm ihm der Kollege aus dem Nachbardorf die Trauben ab. Er selbst verkaufte alles direkt an eine Großkellerei, die den Vollernter und auch gleich den Fahrer mit dem Traubenwagen an den jeweiligen Weinberg schickten. Sie legten den Erntetermin selbst fest und teilten ihm hinterher die eingefahrene Menge mit. Anfang Dezember bekam er sein Geld dafür. Der Marktpreis, gemittelt über die letzten beiden Monate. Dafür, dass er kaum Arbeit mit der Weinlese hatte, war das ein ordentlicher Preis. Er musste ja nicht einmal mehr seine alte Kelter bemühen. Eine ganz saubere Angelegenheit so, wie es lief, daher hatte er sich auch nie über den Preis beschwert, den sie ihm zahlten.
Aber trotzdem hatte er zugestimmt, als ihm der Herbert vorschlug, die Trauben seines alten Grauen Burgunders zu übernehmen. Er war mit ihm Anfang der Sechziger zur Weinbauschule gegangen, danach hatten sie sich immer mal wieder getroffen. Der Herbert kelterte alles selbst, füllte ab und verkaufte seine Weine direkt. Einen Teil über zwei Händler im Norden, den Rest direkt an Einzelkunden, die er in mehreren Touren pro Jahr selbst mit seinem LKW belieferte. Zweimal schon hatte er ihm bei einer solchen Ausfahrt geholfen und jedes Mal war er froh gewesen, dass seine Arbeit mit den Trauben am Weinberg endete. Das andere war ihm doch zu mühsam vorgekommen. Und die ständige Freundlichkeit war auch nicht sein Ding.
Die Mehrarbeit hier in seinem Weinberg vergütete ihm der Herbert ordentlich. Ein deutlicher Aufschlag für jedes Kilo und noch ein Bonus, wenn hohe Oechslegrade erreicht wurden. Dafür nahm er die zusätzliche Handarbeit gerne in Kauf. Er entfernte im Frühjahr die überzähligen Triebe, ordnete die grüne Laubwand mehrmals, entfernte die Blätter vor den heranreifenden Trauben und schnitt erste faule Trauben heraus. Beim Grauen Burgunder war das notwendig. Das Stielgerüst der Sorte war im Grunde für die wachsenden Beeren zu eng. Wenn sie in die Reifephase übergingen, bestand daher ständig die Gefahr, dass sich die Beeren einer Traube gegenseitig zerquetschten, besonders dann, wenn es reichlich Regen im September gab. Trotz aller Handarbeit konnte man den Trauben dann beim Aufplatzen und Faulen zusehen. Er hätte den Weinberg einfach eine Woche eher geerntet. Das hätte einige Mühe erspart und 500 Liter mehr eingebracht.
Es war ja zum Glück nur für eine kleine Fläche. Und es war in diesem Jahr zum letzten Mal. Der Herbert hatte ihm zwar in den Ohren gelegen, zumindest diesen einen Weinberg nur für ihn noch ein paar Jahre weiterzumachen. Siebzig ist doch kein Alter, Schorsch. Oder willst du jetzt nur noch auf Kreuzfahrtschiffen herumschippern? Hast doch eh fast alles schon gesehen. Er war aber bei seinem Entschluss geblieben. Die meisten hörten noch früher auf. Er hatte keine Kinder, seine Frau war schon gut zwanzig Jahre tot. Deshalb hatte er bis siebzig gemacht. Aber nach diesem Herbst war Schluss, endgültig. Die gepachteten Äcker und Weinberge würde er zurückgeben und seine eigenen Flächen an den verpachten, der ihm das beste Angebot vorlegte. Käufer für einen Großteil der Maschinen hatte er schon in Aussicht. Das meiste war ohnehin alt wie er. Im Winter spätestens war die Scheune leer und er das alles los.
Er griff wieder nach dem Eimer und schob ihn einen halben Meter weiter. Noch ein Dutzend Stöcke, dann war er oben. Die anderen brauchten sicher noch ein gutes Stück länger. Alle viel jünger, aber diese Arbeit waren sie einfach nicht gewöhnt.
Das Geräusch eines Traktors kam näher. Die steile Straße hier hinauf hatte er hörbar zu tun. Georg Fauster streckte sich in die Höhe. Auf den Zehenspitzen konnte er über die Rebzeile hinwegspähen. Den Traktor erkannte er eigentlich schon am Klang. Der Blick über das Reblaub hinweg diente nur der Rückversicherung. Ein alter Fendt 108 S. Der gehörte dem August Meierbach. Er senkte sich wieder in die gebeugte Haltung zurück. Ein kurzes Nicken zum Gruß genügte, wenn er vorbeifuhr. Mit dem August Meierbach hatte er nie viel anfangen können. Der war zehn Jahre jünger als er, aber schon der alte Meierbach und sein Vater waren sich nicht grün gewesen. Irgendein alter Krach, über den er selbst nicht mehr wusste, als dass es ihn einmal gegeben haben musste. Die Abneigung hatte sich auf die beiden Söhne übertragen. Sie grüßten sich, aber mehr nicht.