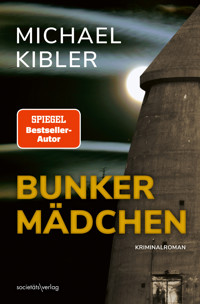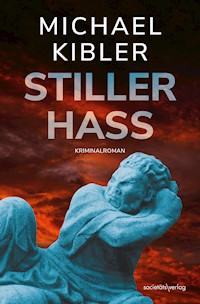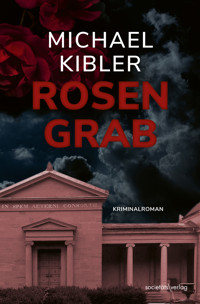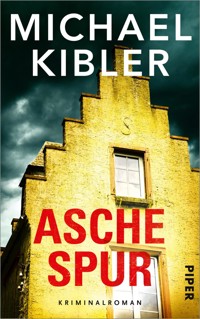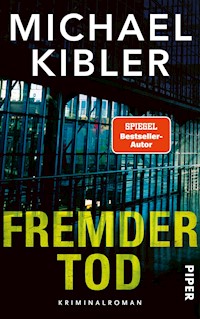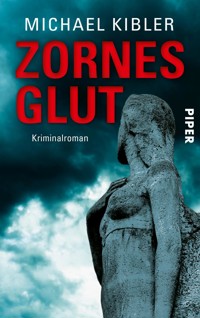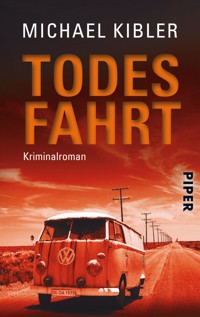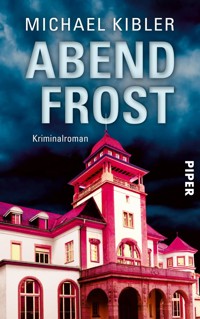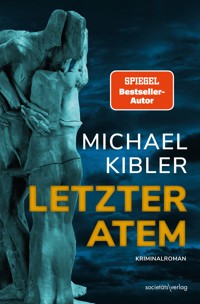
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Societäts-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
»Nein, meine Frau hat sich nicht umgebracht«, sagt der Mann zu Privatdetektiv Steffen Horndeich. Er und seine Partnerin Jana Welzer gehen dem Fall nach. Doch die Rechtsmedizin hat keinen Zweifel: Suizid. Im engeren Umfeld der Toten finden sich nirgends Hinweise auf einen Mord. Aber wenige Tage später wird deren Schwester erschossen. Und so kommen den Ermittlern langsam Zweifel am Selbstmord. Dann: Ein weiterer Mord! Mit derselben Waffe – aber auf Mallorca. Während die Polizei noch über Zuständigkeiten debattiert, nehmen Horndeich und Jana den Fall selbst in die Hand. Denn die Wahrheit ist viel weitreichender, als sie geahnt haben …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Kibler
Letzter Atem
Kriminalroman
Alle Rechte vorbehalten • Societäts-Verlag
© 2024 Frankfurter Societäts-Medien GmbH
Satz: Julia Desch, Societäts-Verlag
Umschlaggestaltung: Julia Desch, Societäts-Verlag
Umschlagabbildung: Statue: Michael Kibler; Hintergrund: NatalyFox/Shutterstock
Printausgabe ISBN 978-3-95542-484-8
E-Book ISBN 978-3-95542-485-5
Besuchen Sie uns im Internet:
www.societaets-verlag.de
Für die Verfechterin der Familienkutsche
Lydia I
Deine Hand ist kalt. Nicht eiskalt. Aber eben schon zu lange zu kalt. Ich weiß das, denn ich habe deine Hand oft gehalten.
Und so tue ich es auch jetzt.
Seit drei Stunden.
Sie wollten mich schon aus dem Zimmer hinauskomplimentieren.
Es ist ein Arzt, der erlaubt, dass ich noch bei dir sitze. Aber auch das kann er nicht mehr lange vor der Belegschaft der Station vertreten. In ein paar Minuten werde ich dich verlassen müssen.
Ich fühle mich – gänzlich leer.
Was auch daran liegt, dass ich in den vergangenen Tagen und Wochen zu viel Kraft verbraucht habe.
Mit dir starb die Hoffnung darauf, dein Leben vielleicht doch noch um Jahre oder sogar Jahrzehnte zu verlängern. Keine Chance.
Seit einer Stunde habe ich nicht einmal mehr Tränen. Davor – ja, da ist diese Kraft buchstäblich aus mir herausgeflossen.
Wenn ich früher deine Hand gehalten habe, dann hieltest du in diesen Momenten auch die meine fest. Es ist wohl der fehlende Druck deiner Finger, stets sanft, aber doch deutlich spürbar, der mir zeigt, dass du nicht mehr da bist.
So viele Bilder fliegen durch meinen Kopf.
Von dir, als du klein warst.
Von deinem Papa.
Von uns dreien.
Es sind schöne Motive, und ich lasse sie zu.
Dann schleicht sich ein anderes Bild hinzu. Es ist, als ob jemand auf ein Foto, das dich, Papa und mich zeigt, noch jemand anderen mit einem feinen Edding skizziert. Diese Striche passen so überhaupt nicht dazu. Und ich möchte, dass sie nicht gezeichnet werden. Aber in diesem Fall bin ich im Foto gefangen und kann es nicht verhindern. Wer auch immer sich hier als Karikaturist austobt – er trifft das Antlitz deines Bruders leider ziemlich gut, sodass ich ihn sofort erkenne.
Aber der hat auf diesem Bild nichts zu suchen.
Gar nichts.
Doch genauer betrachtet: Er ist ja auch schon tot. Du bist tot. Desgleichen dein Papa.
Ich bin die einzige Überlebende.
Doch überlebt zu haben scheint nur mein Körper.
Meine Seele, sie ist mit dir gestorben.
Montag, 3. Juni
»Sie hat sich nicht umgebracht!«
Privatdetektiv Steffen Horndeich hatte den Satz nun zum fünften Mal gehört. Aber zum ersten Mal hatte sein Gegenüber dabei mit der Faust auf den Tisch gehauen. Nicht doll. Die Kaffeetassen waren nicht gehüpft. Aber er hatte seinen Standpunkt nun auch mit einer körperlichen Geste sehr deutlich gemacht.
Horndeich hatte immer noch nicht ganz verstanden, worum es seinem Gegenüber ging.
»Das müssen Sie mir glauben!«, fügte er nun noch an.
Horndeich liebte Serien, die er auf seinem großen Fernsehschirm anschauen konnte. Und, ja, er mochte auch Krimiserien, wenn sie nicht gar zu unbekümmert mit der Realität umgingen. Er hatte aber eine Top-10-Liste der Sätze, die ihn zusammenzucken ließen. ›Das müssen Sie mir glauben!‹ nahm dabei unangefochten Platz eins ein. Dieser Satz war sowas von bescheuert und so etwas von irrelevant. Als ob der Polizist daraufhin sagen würde, »Okay, Sie haben mich überzeugt, ich glaube Ihnen«, aufstünde und ginge.
Horndeich hatte Jahrzehnte bei der Mordkommission in Darmstadt gearbeitet. Er hatte diesen Satz niemals aus dem Mund eines Verdächtigen gehört. Auch Verdächtige schienen ein feines Gespür dafür zu haben, welche Äußerungen sinnvoll waren und welche überflüssig.
Er hatte gerade die Bilderrahmen auf seinem Schreibtisch zurechtgerückt, als der Mann ihm gegenüber geklingelt hatte. Viele Menschen stellten auf ihrem Schreibtisch das Familienbild auf. Papa, Mama, Kinder. Ja, ein solches Bild zierte auch seinen Schreibtisch. Und doch war es ihm wichtig, von jedem Mitglied in seiner Familie ein einzelnes Foto dazu zu stellen: Sandra, seine Frau. Und die drei Kinder Stefanie, Alexander und Antje.
Das Antlitz des Mannes war parallel zum Läuten auf seinem Monitor erschienen: ein junger Mann. Woher hatte der die Adresse? Horndeich und seine Kollegin Jana Welzer waren erst seit zwei Wochen in diesem Domizil beheimatet. Die neuen Visitenkarten und auch die Briefbögen waren zwar bestellt, aber noch nicht gedruckt. Auf ihrer Website hatten sie die neue Adresse erst vor einer Woche eingetragen. Offensichtlich schien es zu funktionieren.
Unter dem Bild auf dem Monitor fanden sich ein paar Buttons, die per Maus angeklickt werden konnten. Einer war grün unterlegt und mit dem Begriff »Sprechen« beschriftet. Horndeich hatte auf den Button geklickt und gesagt: »Ja?«
»Guten Tag. Ich möchte zu Horndeich & Welzer.«
»Kommen Sie bitte in den ersten Stock«, hatte er erwidert und den Mauszeiger sogleich auf den nächsten Button geführt, der mit »Öffnen« beschriftet war. Natürlich konnte man all diese Funktionen auch an dem kleinen Kästchen im Vorraum des Treppenhauses ausführen, aber Tastatur und Maus am Schreibtisch waren definitiv bequemer.
Horndeichs Büro maß gut 20 Quadratmeter. Die Fenster gingen gen Westen und Süden – womit der Raum immer in helles Licht getaucht war. Der kleine Nachteil war: Wenn er in den Vorraum vor dem Treppenhaus gelangen wollte, musste er entweder durch den kleinen Archivraum gehen oder durch das Büro seiner Kollegin Jana Welzer. Da die im Moment nicht da war, ging er durch ihr Büro. Das war mit knapp 30 Quadratmetern noch großzügiger bemessen als sein eigenes.
Ja, es war eine Einschränkung, dass ihre Klienten nicht einfach im Erdgeschoss in einen Empfangsraum treten konnten. Vielmehr mussten sie ein Treppenhaus emporsteigen, um im ersten Stock zu landen. Wie auch dieser junge Mann. Noch bevor er ihn begrüßt hatte, hatte Horndeich den Herrn taxiert. Ende 30, sehr gepflegt, teurer Anzug, vielleicht sogar maßgefertigt. Athletisch, mit ausgeprägtem Brustkorb, der auf Sport oder Bodybuilding schließen ließ. Siebentagebart. Aber ebenfalls sauber getrimmt. Durchgestrecktes Kreuz. Sehr buschige Augenbrauen, ausgeprägter Kehlkopf. »Herr Horndeich?«, hatte der noch Unbekannte gefragt. Die Stimme ein wenig hoch. Aufgrund der äußeren Erscheinung hatte Horndeich auf eine viel tiefere Stimme getippt.
»Ja, Steffen Horndeich«, hatte er gesagt und dem Mann die Hand gereicht.
Der hatte sie ergriffen. Schlabber-Handtuch. Horndeich hatte das Gefühl gehabt, wahrlich ein Handtuch zu drücken. Also – er hatte zugedrückt. Das Handtuch ließ sich zwar drücken, hatte aber den Druck nicht erwidert. Etwas, was Horndeich hasste. Er konnte nicht einmal genau sagen, weshalb.
»Ich brauche Ihre Hilfe«, hatte der Mann gesagt. Und seinen Namen hinzugefügt: »Ich heiße Magnus Weidt.«
Horndeich hatte ihn ins Dachgeschoss geführt, wo Jana und er den Empfangs- und Besprechungsraum eingerichtet hatten, mit zwei kleinen Erkern. Pittoresk. Einfach wunderbar.
Horndeich war mit seiner Kollegin Jana Welzer nun Mieter in der exklusiven Darmstädter Adresse Mathildenhöhweg 2, dem Haus Deiters. Es gehörte zum sogenannten Jugendstil-Ensemble, das 1901 erbaut worden war. Sieben weitere Häuser gehörten dazu. Entstanden waren die Gebäude im Rahmen der Jugendstil-Ausstellung des damaligen Großherzogs Ernst-Ludwig, der der Welt hatte zeigen wollen, dass Kunst und Alltag vereinbar waren – in schönen Häusern mit schönen Möbeln und schönen Alltagsgegenständen, wie etwa dem Besteck. Das Haus Deiters war ein Mini-Schlösschen, erdacht von Josef Maria Olbrich, ein architektonisches Kleinod auf der Mathildenhöhe in Darmstadt.
Horndeich und Jana hatten im Turmzimmer nur einen sechseckigen Tisch aufgestellt, darum sechs Stühle. Auch eine Theke fand sich darin, darauf eine Kaffeemaschine. Die hatte Jana aus ihrem alten Büro mit in die Gemeinschaft gebracht. Jana Welzer war zuvor noch als Nachlasspflegerin aktiv gewesen. Doch sie hatte diesen Teil ihres Berufs aufgegeben, um nun mit Horndeich die gemeinsame Detektei zu betreiben.
Horndeich wies Herrn Weidt mit einer Geste einen Sitzplatz zu. Er setzte sich ihm nicht gegenüber, sondern an einen der Seitenränder.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte er.
Es gab Kollegen, die fuhren, bevor sie diesen Satz aussprachen, erst einmal einen Laptop hoch. Doch der stand dann wie ein kleiner Wall zwischen ihm und dem Klienten. Bei einem Erstgespräch wollte Horndeich von Computern nichts wissen, und eigentlich auch nicht von Notizheften und Ähnlichem. Bei einem Erstgespräch ging es immer nur darum, eben ein erstes Gespräch zu führen.
»Sie hat sich nicht umgebracht!«, hatte der Mann nun mehrfach gesagt. »Und das sollen Sie herausfinden und beweisen.«
»Kaffee?«, wollte Horndeich wissen.
Weidt nickte nur.
Horndeich bereitete den Sud zu, stellte einen Becher vor Weidt ab. Er selbst gab ein wenig Milch in seine Tasse, Weidt führte den Becher hingegen sofort zum Mund.
»Sie hat sich nicht umgebracht, das habe ich verstanden«, sagte Horndeich nun. »Aber ich habe noch nicht begriffen, wer sich nicht umgebracht hat. Können Sie mir das noch einmal langsam und chronologisch berichten?«
Was er bislang verstanden hatte, war, dass die Frau von Weidt sich offensichtlich umgebracht hatte. Und dass Magnus Weidt das nicht akzeptieren konnte oder wollte.
Weidt sah Horndeich nun direkt an. Dann sagte er langsam, bedacht, Wort für Wort, Satz für Satz: »Ich kam nach Hause, vor zwei Wochen. Kam ins Wohnzimmer. Und da lag unser Sohn schreiend auf dem Boden. Er ist erst ein halbes Jahr alt. Und daneben lag meine Frau, Femke, auch auf dem Boden. Ein Pappschächtelchen Dorimorzol daneben. Drei Blister, jeweils zehn Tabletten herausgedrückt. Aber sie hätte sich niemals umgebracht! Warum auch?«
»Haben Sie damals die Polizei gerufen?«
»Ja, selbstverständlich!«
»Und was hat die gesagt?«
»Die kamen angerauscht. Und auch ein Rechtsmediziner war dann tatsächlich vor Ort. Kam aus Frankfurt. Heinrich oder so ähnlich.«
»Dr. Martin Hinrich?«
»Ja, genauso hat er geheißen.«
»Und dann?«
»Na, sie haben meine Frau mitgenommen.«
»Und Ihr Sohn?« Horndeich schluckte, als er diese Frage aussprach. Denn er selbst war Vater von drei Kindern. Und bei allen drei Kindern hatte er die Phase Mein-Kind-ist-ein-halbes-Jahr-alt auch durchgestanden. Mit sehr wenig Schlaf. Mit viel, viel, viel Energie. Und das war noch nicht einmal die Hälfte der Energie, die seine Frau Sandra hatte aufbringen müssen.
»Mein Sohn? Den haben sie bei mir gelassen. Wo sonst?«
Die Frage war völlig irrelevant, aber sie ploppte aus Horndeichs Mund heraus, bevor der Denkprozess abgeschlossen war: »Wie geht es ihm?«
»Er ist okay. Meine Eltern helfen mir. Ron hat immer nur Femkes Brust akzeptiert. Fläschchen war ein absolutes No-Go. Drei Tage lang hatte er es verweigert. Dann hatte Ron wohl kapiert, dass es nur die Alternative gab: Fläschchen oder verhungern. Nachdem er das akzeptiert hatte, kehrte ein bisschen Ruhe ein.«
Was Horndeich inzwischen begriffen hatte, war, dass sich Femke Weidt offensichtlich mit Schlaftabletten umgebracht hatte. Was er noch nicht verstand, war, weshalb Magnus Weidt daran zweifelte. »Was hat die Rechtsmedizin denn zur Todesursache gesagt?«
Weidts Blick schien Horndeich durchdringen zu wollen: »Die haben gesagt, Femke sei an einer Überdosis Schlaftabletten gestorben. Aber das ist einfach nur Schwachsinn. Sie hat sich nicht umgebracht.«
Das hatte Horndeich ja inzwischen mehrfach gehört. Nun stellte er die Gegenfrage: »Wieso sind Sie sich so sicher, dass Ihre Frau sich nicht umgebracht hat?« Natürlich, diese Frage beherbergte keinerlei Diplomatie. Aber Diplomatie war auch nicht das entscheidende Kriterium, wenn es wirklich darum ging, einen vermeintlichen Selbstmord als Mord zu enttarnen. Denn darum ging es Magnus Weidt ja ganz offensichtlich.
»Herr Horndeich, meine Frau war eine Frau, die leben wollte. Die nichts anderes wollte als leben.«
Horndeich versuchte, sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen. Der Säugling auf dem Boden. Seine tote Frau daneben. Die Tabletten. Alles eindeutig. Worin lag der Zweifel begründet?
»Gab es irgendwelche Zweifel am Selbstmord Ihrer Frau?«
»Nicht für die Polizei und nicht für die Rechtsmedizin.«
»Aber für Sie? Warum?« Auch diese letzte Frage war nicht diplomatisch.
»Herr Horndeich, meine Frau war etwas Besonderes. Ich weiß, das sagen, im Idealfall, alle Ehemänner von ihren Ehefrauen. Mir war es vom ersten Moment an klar, dass ich diese Frau liebe. Und ich glaube, das beruhte von Beginn an auf Gegenseitigkeit. Wir wussten beide genau, was wir wollten. Zusammen sein. Das Leben gemeinsam verbringen. Eine Hochzeit. Kinder. Und es hat zwar ein Weilchen gedauert, bis es geklappt hat, aber dann wurde sie schwanger. Und wir haben uns beide so auf das Kind gefreut. Wir haben uns noch mehr gefreut, als es endlich da war. Unser Ron. Das mag für Sie jetzt alles klingen wie die Klischees aus einem Pilcher-Film, aber wir beide waren von Anfang an vernarrt in unseren Jungen. Und dann soll sich meine Frau von einem Moment auf den anderen umbringen? Mit Schlaftabletten? Mein Gott, sie hatte ja nicht einmal Schlaftabletten. Wozu auch, sie hatte ja nicht einmal Schlafprobleme!«
Sie saß auf dem Balkon ihrer Wohnung im Lucasweg 13. Ostseite. Ihre Wohnung verfügte über den Luxus von zwei Balkonen. Dieser kleinere der beiden war von Stein umfasst, ein Originalbalkon des Gründerzeithauses.
Auf einem kleinen runden Tischen stand ein Becher mit Kaffee. Sie selbst saß auf einem Klappstuhl. Sie hatte keine gute Nacht gehabt. ›Keine gute Nacht‹ – dafür gab es eine eindeutige Definition: Sie hatte wieder von Benjamin Lorenz geträumt. Dem Mann, der sie seit über 20 Jahren geliebt hatte. Der Mann, der jahrelang um sie geworben hatte. Der Mann, mit dem sie tatsächlich ein halbes Jahr lang eine Beziehung geführt hatte, ihm treu gewesen war, ja, endlich erkannt hatte, dass sie ihn auch liebte.
Denn Ben war gestorben. Am 10. Januar. Herzversagen. Sie hatten abends zusammen aneinandergekuschelt hier in ihrem Wohnzimmer auf der Couch gesessen, einen Film geschaut. »Und täglich grüßt das Murmeltier«, ein Film, den sie beide so geliebt hatten. Bens letzte Worte waren gewesen: »Mach mal auf Pause, ich muss auf die Toilette.« Er war aufgestanden, zwei Schritte gegangen, zusammengebrochen und nicht mehr aufgewacht.
Herzversagen.
Mit knapp über 40.
Sie hatte noch versucht, ihn zu reanimieren. Es war ihr nicht gelungen. Sie hatte auf eine Obduktion bestanden. Vier gebrochene Rippen, die Reanimation hätte also erfolgreich sein können. Aber außer den vier gebrochenen Rippen keine weiteren Krankheiten oder Einschränkungen. Sein Herz hatte einfach aufgehört zu schlagen.
Jana ertappte sich, wie ihr wieder Tränen die Wange herunterliefen. Trotz Sonne, trotz Sommer, trotz Wärme, trotz all dem, was anders war, als an jenem beschissenen Abend vor knapp einem halben Jahr.
Sie hätte bereits im Büro sein sollen. Vor knapp einem Jahr hatte sie ihr Büro aufgegeben. Es hatte sich im Souterrain des Hauses ihrer Eltern befunden, nicht weit entfernt von Horndeichs Haus, in dem er ebenfalls im Souterrain sein Büro als Privatdetektiv eingerichtet hatte. In diesem Büro hatte Jörn Großeimer, ein Freund von ihr, der sich auf Innenausbau spezialisiert hatte, unter einem alten Parkett einen riesigen Blutfleck entdeckt. Und dieser Blutfleck war eng mit ihrer eigenen Familiengeschichte verbunden gewesen.
Sie hatte das Büro danach aufgegeben und war zunächst für kurze Zeit bei Steffen Horndeich in dessen Detektei im Richard Wagner-Weg eingestiegen. Es war nicht leicht gewesen, für beide neue passende Räume zu finden. Jetzt residierten sie im Haus Deiters – einen schöneren Ort konnte man sich kaum vorstellen.
Nur war heute wieder einer jener Morgen gewesen, an denen sie es kaum aus dem Bett geschafft hatte. Sie wusste nicht, wie lange sie schon auf dem Balkon gesessen hatte. Aber der Kaffee war inzwischen kalt.
Jana hörte, wie ihr Handy klingelte. Sie musste es auf dem Tisch im Wohnzimmer liegen gelassen haben. Sie erhob sich, ging zurück in die Wohnung, nahm das Handy auf. Horndeich. Sie nahm das Gespräch an.
»Hallo Jana«, begrüßte sie Horndeich. »Bei mir sitzt ein Mann, der vielleicht unsere Hilfe braucht. Aber ich möchte, dass auch du seine Geschichte hörst. Das ist alles etwas – seltsam. Und es ist mir wichtig, deine Meinung dazu zu hören. Könntest du ins Büro kommen?«
Das schätzte sie an Horndeich. Kein Spruch: »Wo bleibst du denn?«
Im vergangenen halben Jahr hatte er die Detektei am Leben erhalten. Hatte viel gearbeitet. Hatte eigentlich den Großteil der Arbeit gemacht und sie nie kritisiert oder hinterfragt. Ja, im vergangenen halben Jahr hatten sie keine spektakulären Fälle zu lösen gehabt. Sie hatten ein paar Rahmenverträge mit Firmen. Das war gut, denn das sicherte das Grundeinkommen. Trugen Mitarbeiter USB-Sticks mit Firmeninformationen aus dem Haus? Gab es konspirative Treffen von Managern mit Personen von Konkurrenzunternehmen? Joggte der Rückengeschädigte trotz Krankmeldung sechs Kilometer durch den Wald? Es waren oft solche Dinge, die sie zu erledigen hatten. Auch wenn sie eher nur wenig zum Tagesgeschäft beigetragen hatte – die Routine hatte ihr etwas Halt gegeben.
»Jana?«
Sie war schon wieder mit ihren Gedanken abgedriftet. Im Traum der vergangenen Nacht hatte sie wort- und regungslos neben Ben auf dem Boden gesessen. »Ja, ich bin da.« Blödsinnige Antwort. Dabei wollte sie nur sagen, dass sie jetzt wieder in Horndeichs und ihrer Welt war und nicht mehr in jener Traumwelt, die sie so peinigte.
»Kannst du vorbeikommen?«
Auch hier wieder Horndeichs große Empathie. Keine Ansage: »Wann bist du endlich hier?«
»Ja, bin in fünf Minuten da.«
Dazu war nicht viel nötig. Sie brauchte vier Fußminuten zu ihrem neuen Büro. Und sie musste sich einfach nur eine Hose anziehen, Strümpfe, Schuhe und loslaufen. Und genau das würde sie jetzt auch tun.
»So, und jetzt noch einmal Stück für Stück und langsam«, sagte Janas Kollege Steffen Horndeich.
Magnus Weidt saß am Tisch im Turmzimmer. Horndeich hatte ihm Jana vorgestellt. Und ihm erklärt, er müsse jetzt einfach alles etwas strukturierter von sich geben als zuvor.
»Es war Dienstagabend vor zwei Wochen. Also der 21. Mai. Ich kam zurück aus dem Büro. Hatte länger gedauert, war so gegen 20 Uhr.«
Horndeich hatte ihr nur einen Kurzbericht über den potenziellen neuen Klienten gegeben, als er sie begrüßt hatte. Nun saß sie schräg gegenüber von Magnus Weidt und ihrem Kollegen Steffen Horndeich. An dem sechseckigen Tisch hätten sie die Randpunkte eines Mercedes-Sterns abbilden können. »Länger?«, wollte sie wissen. Horndeich hatte ihr nur gesagt, dass er über Magnus Weidt nichts wisse. »In welchem Beruf arbeiten Sie?«
»Ich? Ich arbeite bei Evonik hier in Darmstadt. Bin in der Unternehmenskommunikation.«
»Okay, beschreiben Sie uns, wie Sie in Ihre Wohnung gegangen sind – und wo Sie wohnen«, forderte ihn Horndeich auf.
»Wir wohnen in der Kastanienallee. Nicht weit vom Bayerischen Biergarten. Ich schloss die Haustür auf, ging zu unserer Wohnung im ersten Stock, schloss dort die Wohnungstür auf. Das Erste, was mir auffiel, war, dass keine Musik lief. Femke hatte immer Musik laufen. Wenn es so was gäbe, würde man sagen: Sie war musiksüchtig. Wir haben in jedem Zimmer einen Lautsprecher, und alle sind untereinander verbunden und spielen dieselbe Musik. Femke liebte Country-Musik. Da gab es für sie tatsächlich einen perfekten Radiosender. ›Kickin’ Country‹ auf 181.fm nennt der sich. Hat sie oft gehört, weil auch unser Sohn dann meist ruhig war. Auch er scheint diese Musik zu lieben.«
Ihr Gegenüber hielt kurz inne.
»Und dann?«, hakte Horndeich nach einigen Sekunden nach.
Weidt suchte zunächst Horndeichs Blick, gleich darauf den ihren. »Als ich keine Musik gehört habe, wusste ich, dass irgendetwas ganz falsch lief. Statt Musik hörte ich unseren Sohn schreien. Und ich ging ins Wohnzimmer.«
Weidt sah Jana nun direkt an: »Ich habe das Herrn Horndeich schon gesagt. Auf dem Boden lag weinend unser Sohn Ron, daneben meine Frau, leblos. Ich versuchte, sie wiederzubeleben. Keine Chance. Aber sie war auch schon kalt. Trotzdem habe ich es versucht.«
Kein gutes Thema. Vier gebrochene Rippen. Auch kein Erfolg. Jana konnte so gut nachvollziehen, was in diesem Mann vorgegangen sein musste …
Polizei gerufen, gewartet, Polizei eingetroffen, Ron versucht zu beruhigen – diesen Teil seiner Erzählung nahm Jana kaum wahr.
»Warum glauben Sie nicht an einen Selbstmord Ihrer Frau?«, stellte Horndeich nochmals die provokative Frage.
Vier gebrochene Rippen.
Jana vernahm nur einzelne Worte. »›Unser Sohn‹, ›abgöttisch geliebt‹, ›niemals‹«. Dann spürte sie eine Berührung an ihrem Schienbein. Horndeich hatte sie angestupst. Danach war sie wieder voll da.
»Und außerdem, ich bin nicht allein mit meiner Meinung: Sprechen Sie mit Femkes Mutter. Auch sie glaubt nicht, dass ihre Tochter sich umgebracht haben soll.«
»Herr Weidt, wir werden das jetzt besprechen. Und wir werden entscheiden, ob wir Ihren Fall annehmen.«
Magnus Weidt nickte nur, verabschiedete sich dann von Horndeich und ihr.
Horndeich geleitete ihn zum Ausgang, kam dann wieder zurück.
Sie fragte Horndeich: »Glaubst du ihm? Also, glaubst du, dass seine Frau sich tatsächlich nicht umgebracht hat?«
Es war ein sehr leises, sehr verhaltenes Lächeln, als er sagte: »Jana, ich weiß es nicht. Aber bringt sich jemand mit Schlafmitteln um, der glücklich ist über den Nachwuchs? Der ein halbes Jahr zuvor ein gesundes Kind geboren hat? Der, zumindest auf den ersten Blick, in einer glücklichen Ehe lebt? Ich denke, da sind Zweifel angebracht.«
Jana nickte nur. Da war sie ganz auf der Seite ihres Kollegen.
»Ich schlage vor, wir machen einen Termin bei Hinrich. Er scheint sie ja damals auf dem Tisch gehabt zu haben. Soll er uns sagen, wie er den Tod der jungen Frau einschätzt. Wenn ich seine Aussage habe, dann kann ich mit Weidt über weitere Maßnahmen oder eben keine Maßnahmen sprechen.« Martin Hinrich war der Rechtsmediziner in Frankfurt, der sich immer auch den Leichen aus Darmstadt annahm, bei Mord, bei Totschlag oder eben auch bei unklarer Todesursache.
»Ja, das klingt für mich nach einem guten Plan.«
Wieder hatte Horndeich die Initiative übernommen. Wieder fand sie das einfach nur gut. Und war sehr dankbar darüber.
»Gut. Dann versuche ich, einen Termin bei Hinrich zu bekommen.«
»Papa, wie kann eine Musik gleichzeitig so traurig und so schön sein?«
Darauf wusste Papa Horndeich auch keine Antwort. Zumindest keine, die sein bald zehnjähriger Sohn auf Anhieb verstanden hätte. Nein, wenn er ehrlich war, hatte er auch keine Antwort darauf, die er selbst verstanden hätte. Auch er liebte Musik, wenngleich er nicht diesen tiefen Zugang zu den Sphären der Klassik gefunden hatte, in denen sich sein Sohn bereits bewegte.
Der war inzwischen ein guter Cellospieler, beherrschte sein Lieblingskonzert, geschrieben für dieses Instrument vom Komponisten Edward Elgar, bereits auswendig. Und spielte es nicht nur fehlerlos, sondern eben mit Gefühl, wie zumindest der stolze Papa es empfand.
Umso mehr überraschte ihn der Hintergrund der eben gestellten Frage. Denn Alexander hatte vor fünf Minuten postuliert, er wolle jetzt Klarinette lernen.
»Klarinette? Wie kommst du ausgerechnet auf Klarinette?«
»Frau Kreutzer hat mit mir heute Klarinette gespielt.«
»Frau Kreutzer? Deine Cellolehrerin?« Hätte Steffen Horndeich es nicht besser gewusst, hätte er fast geglaubt, gerade ein Herzchen in den Augen seines Sohnes gesehen zu haben.
»Sie kann beides. Sie spielt perfekt Cello. Aber sie spielt eben auch Klarinette. Und heute haben wir zusammen gespielt. Ein Stück von Beethoven. Also kein schweres Stück. Ist im WoO verzeichnet, Nummer 27, weiß man noch nicht mal, ob Beethoven wirklich der Komponist war. Aber das ist ganz egal. Das Stück ist so schön. Ich durfte den Cello-Part spielen. Habe ihn einmal allein gespielt, dann hat Frau Kreutzer gesagt, ich bin bereit für das Duo. Und sie hat die Klarinette gespielt. Und das war sooo schön! Papa, das will ich auch können.«
Horndeich schwirrte der Kopf. Er hatte keine Ahnung, was ein WoO sein sollte. Und noch weniger verstand er, weshalb sein Sohn jetzt scheinbar das Cellospiel aufgeben wollte. »Willst du das Cello an den Nagel hängen?«
»Nein, Papa, ich will beides. Und ich kann beides. Da muss ich mehr üben. Das weiß ich. Aber ich will das können.«
»Ich denke, da sollte ich zuerst mal mit Frau Kreutzer sprechen.«
»Kannst du machen, wenn ich danach Klarinette lernen darf.«
Sowohl seine Tochter Stefanie als auch seine Frau Sandra hätten diesen Satz mit einem Augenzwinkern von sich gegeben. Aber was Humor anging, war Alexander völlig aus der Art geschlagen. Was er sagte, meinte er. Das Konzept, etwas zu sagen, von dem man eigentlich das Gegenteil dachte, war ihm absolut fremd.
»Hallo? Papa?«
»Äh, ja?«
»Ich dachte, du wolltest mit Frau Kreutzer sprechen.«
»Ja, aber Frau Kreutzer ist ja wohl leider im Moment nicht da«, versuchte sich Horndeich in einem schwachen Scherz.
Alexander sah ihn völlig verständnislos an: »Handy?«
»Nein, mein Sohn, das werde ich mit Frau Kreutzer persönlich besprechen. Gib mir zwei Tage Zeit, dann reden wir wieder über dieses Thema.«
»Okay.«
Auch das war eher untypisch für einen Zehnjährigen. Ansage vom Papa, ein simples ›Okay‹, und das Leben ging weiter.
Horndeichs Handy klingelte, Sandra war am Apparat. »Ja, Schatz?«
Seine Frau teilte ihm mit, dass sie noch lange arbeiten müsse. Eigentlich hatte Sandra einen Halbtagsjob in der IT-Forensik im Polizeipräsidium Darmstadt in der Klappacher Straße. Die Kollegen hatten vor ein paar Tagen einen Drogendealer festgenommen. Und als sie seine Wohnung auf links gedreht hatten, waren nicht die 200 Gramm Koks das Interessanteste gewesen, sondern das kleine Bataillon an Rechnern. Es sah so aus, als sei die Koks-Dealerei nur ein Nebenerwerb gewesen. Offensichtlich waren diese Computer Teil eines größeren Netzwerks, in dem Bilder und Videos ausgetauscht wurden, die definitiv unter das Strafrecht fielen. Und Sandra war Teil des Teams, das sich der Ernte von Filmen und Fotos dieser Festplatten nun widmen musste.
»Kein Problem«, sagte Horndeich zu ihr. Er hatte sich am Abend mit Jana verabredet, um gemeinsam zu Martin Hinrich nach Frankfurt zu fahren. Sie wollten mit dem Rechtsmediziner über den Todesfall Femke Weidt sprechen. Bis dahin waren es noch drei Stunden. Horndeich saß mit Alexander im Wohnzimmer. Das grenzte an die Terrasse, diese wiederum an den Garten. Und aus jenem drang nun die schrille Stimme seiner Tochter Stefanie durchs geschlossene Fenster. »Nein! Dein Eingang!«
Stefanie, obwohl inzwischen fast 13 Jahre alt und damit quasi pubertär, neigte gemeinhin nicht zu hysterischen Gefühlsausbrüchen. Vor 15 Minuten hatte Horndeich sie mit dem Familienhund Fidel, einem hübschen, flinken und auch ziemlich schlauen Chihuahua, in den Garten verschwinden sehen. Stefanie teilte mit dem Hund eine Leidenschaft: den Ball. Wobei die Aufteilung der Aufgaben unverrückbar festgeschrieben war: Stefanie warf den Ball, Fidel sprintete kaum langsamer als derselbe hinter ihm her, nahm ihn ins Maul, brachte ihn seinem Frauchen, und die warf ihn wieder in eine andere Richtung. So einfach. So unkompliziert. Weshalb Horndeich den Ausbruch nicht so ganz verstand.
»Du machst das jetzt weg, Küken. Dein Hund. Deine Kotze.« Auch diese Stimme war ihm durchaus vertraut, wenn auch nicht in dieser Lautstärke und dieser Tonhöhe. Liv Wörner war knapp 20 Jahre alt und wohnte in der Souterrainwohnung des gemeinsamen Hauses im Richard-Wagner-Weg 56. Und Liv war die Tochter seiner Frau. Wenn auch nicht die seine. Liv entstammte einer Beziehung vor Horndeich. Einer sehr gewaltsamen Beziehung. Weshalb Sandra ihre Tochter damals wenige Wochen nach der Geburt zur Adoption freigegeben hatte. Liv war bei Adoptiveltern groß geworden – und sie hatte emotional definitiv Glück gehabt mit diesen Eltern. Doch vor gut einem Jahr waren diese gestorben und hatten Liv nur Schulden hinterlassen. Und da hatte sie dann auf der Matte von Horndeichs und Sandras Haus gestanden. In den Unterlagen der verstorbenen Adoptiveltern hatte sie den Namen ihrer leiblichen Mutter gefunden. Nun studierte sie, wohnte im Souterrain – und soweit schien alles in Ordnung.
»Fick dich!«, rief seine Tochter. Also, seine leibliche Tochter. Manchmal war das Sortieren innerhalb einer Patchwork-Familie schon etwas herausfordernd. Horndeich war bereits versucht, die Tür zur Terrasse zu öffnen, um seine Tochter zur Räson zu rufen. Doch das konnte er sich sparen, denn Stefanie stapfte längst über die Terrasse ins Wohnzimmer. Noch bevor Horndeich irgendetwas sagen konnte, rief sie, kaum weniger laut als zuvor im Garten: »Kann sie sich abschminken, die blöde Kuh. Und ich bin kein Küken!«
Bevor Horndeich auch nur Luft geholt hatte, um seine Tochter wegen des doch etwas unflätigen Wortgebrauchs zu ermahnen, schoss sie an ihrem Vater vorbei in Richtung Treppenhaus, um nach oben in ihr Zimmer zu verschwinden.
»Fick dich, fick dich«, rief nun auch Antje aus dem hinteren Teil des Wohnzimmers. Antje war die jüngste Tochter von Horndeich, inzwischen vier Jahre alt und ein riesiger Fan von Lego Duplo, mit dem sie sich während der ganzen Zeit völlig unbemerkt im hinteren Teil des Wohnzimmers beschäftigt hatte und Einhörner baute. Allerdings in ihrem Prinzessinnenkleid. Und die nun Horndeichs Hypothese bestätigte, dass man die Worte seiner älteren Tochter wahrscheinlich im Umkreis von 100 Metern gehört hatte.
Antje kam auf ihren Vater zu, eines der Einhörner in der Hand. Was vor sechs Wochen für einen riesigen Schwall Tränen gesorgt hatte. Denn es war schwierig, mit den Lego-Duplo-Steinen ein Einhorn zu bauen. Und so hatte sich Horndeich eines Abends an den Basteltisch gesetzt und an zehn Duplo-Steine bunte Plastikhörner angeklebt. Lang lebe die Erfindung des Sekundenklebers.
Antje hielt das Einhorn hoch und fragte: »Papa, was ist ›Fick dich‹?«
Alexander versuchte helfend einzugreifen und sagte: »Antje, wenn Mama und Papa sich ganz lieb haben, dann …«
»… dann lass es jetzt mal gut sein, Alexander, danke.« Antje blickte in die Runde, erkannte, dass diese zwei Silben definitiv für Aufmerksamkeit sorgten und wiederholte noch dreimal »Fick dich«, während sie wieder zu ihrem Einhorn-Lego-Zoo ging.
»Ich mach es nicht weg«, hörte nun Horndeich Livs Stimme, die offensichtlich ebenfalls über die Terrasse ins Wohnzimmer gekommen war.
»Ich mach das gleich weg«, sagte Horndeich. Er hatte keine Lust, jetzt Gericht darüber zu führen, wer verantwortlich war, Hinterlassenschaften des Hundes zu beseitigen. Horndeich hatte einen Gartenschlauch – das Problem würde sich relativ einfach lösen lassen.
Das Wegwischen konnte auch noch zehn Minuten warten. Er ging nach oben, klopfte an die Zimmertür seiner Tochter. Trat ein. Stefanie lag auf ihrem Bett. Wenn es Teenagern in irgendwelchen Filmen schlecht ging, dann hatten sie immer einen Kopfhörer auf, hörten Weltmusik in Flugzeugdüsenlautstärke und starrten auf ein iPad. Stefanie war da eher der klassische Typ: Sie lag einfach auf dem Bett und hatte das Kissen über den Kopf gezogen.
Horndeich setzte sich auf den Bettrand, legte die Hand auf Stefanies Rücken. Der Kopf kam unter dem Kissen hervor.
»Stefanie, was ist los?«
»Liv – die ist echt eine ›Bitch‹! Die ist nicht Mama. Die hat mir nichts zu sagen. Die ist einfach nur eine Tochter wie ich! Und die soll mich nicht immer Küken nennen!!«
Womit seine Tochter offensichtlich die grundsätzliche Problematik aufgezeigt hatte, die weit jenseits irgendwelcher Hunde-Hinterlassenschaften lag. Horndeich wusste auch, dass Stefanie für ihren Hund ihr letztes Hemd gegeben hätte. Aber er wusste ebenso, dass Stefanie auf fremde Körperausscheidungen jenseits von Darm und Blase extrem empfindlich reagierte. Sie war sich nie zu schade gewesen, mit dem Plastiktütchen den Hundekot einzusammeln. Aber bei Erbrochenem musste sie passen. Das war dann zumeist Sandras Job. Die ja jetzt nicht da war.
Horndeich konnte zutiefst pragmatisch sein. Er drückte seiner Tochter einen Kuss auf die Stirn und sagte: »Ich mach jetzt mal die Kotze weg.«
»Danke, Papa«, sagte Stefanie leise.
»Aber nur unter einer Bedingung«, erwiderte er.
Stefanie hob eine Augenbraue.
»Das mit dem ›Fick dich‹, das würde ich dich bitten zu unterlassen. Grundsätzlich. Und ganz besonders in dieser Lautstärke.«
Stefanie wollte etwas erwidern, aber Horndeich hob die Hand. »Kaum hast du es in die Welt geschrien, hat Antje es bereits aufgenommen. Das finde ich jetzt nicht so witzig. Oder willst du ihr erklären …« Horndeich überlegte kurz, dass Stefanie diesen Job sicher sofort übernehmen würde. »Vergiss es«, sagt er.
Stefanie grinste schräg.
Horndeich grinste schräg.
Wenig später stand er im Garten, den Wasserschlauch in der Hand. Er zielte auf Fidels halb verdaute Hinterlassenschaften, sprühte sie fort vom Waschbeton des Eingangs zur Wohnung von Liv. »Machst du das jetzt weg?«, wollte Liv von ihm wissen. Sie stand in der Eingangstür zu ihrer Wohnung.
»Naja, du machst es offensichtlich nicht«, erwiderte er.
»Steffen, das ist nicht mein Job. Das ist doch nicht mein Hund.«
Horndeich seufzte. »In einer Minute sind die Spuren des Dramas beseitigt. Warum bist denn so kratzbürstig zu Stefanie?«
»Ich? Kratzbürstig?« Liv wollte die Tür zuschlagen. Horndeich stellte seinen Fuß zwischen Rahmen und Tür. Ja, es tat weh, als die Tür auf seinen kleinen Zeh prallte. »Liv, ich muss heute Abend weg, mit Jana. Wir haben einen neuen Fall. Kannst du auf die Kleinen ein Auge werfen?«
»Steffen, darüber müssen wir reden. Wollte ich schon eine ganze Weile lang tun. Ich bin keine Babysitterin. Ich hab mein eigenes Leben. Und heute Abend treffe ich mich mit Leon. Und da liegt mir sehr viel dran.«
Horndeich hatte keine Ahnung, wer Leon war. Er war sich nicht sicher, ob er es nicht wusste, weil Liv nichts davon erzählt hatte, oder ob er nichts davon wusste, weil er sich nicht daran erinnerte, dass Leon irgendjemand ganz Wichtiges war.
Was er hingegen registrierte, war, dass Liv nicht auf die Kinder aufpassen würde. Und dass seine Frau erst zu unbestimmter Zeit zu Hause sein würde.
Horndeich zog seinen Fuß weg. Ließ Liv die Tür schließen.
Stellte das Wasser ab.
Fragte sich, ob er die Kotze vor Livs Tür nicht einfach hätte liegen lassen sollen.
Dann griff er zu seinem Handy und rief Jana an.
Sie würde allein zu Hinrich fahren müssen.
Martin Hinrich arbeitete inzwischen seit mehr als zwei Dekaden am rechtsmedizinischen Institut im Süden Frankfurts. Eines der wenigen rechtsmedizinischen Institute, die in einer wunderschönen Gründerzeitvilla residierten. Doch Horndeich hatte bei dem Rechtsmediziner keinen Termin während des Arbeitstags bekommen, sondern Hinrich hatte ihn abends zu sich nach Hause eingeladen.
Martin Hinrich und seine Lebensgefährtin Emilia Schubert, wie er auch der Rechtsmedizin verhaftet, lebten in einem schmucken Einfamilienhäuschen in Frankfurt Rödelheim, quasi am Ufer der Nidda.
Jana steuerte den Wagen genau dorthin. Eigentlich hätten sie und Horndeich gemeinsam fahren sollen, doch Horndeich hatte irgendein familiäres Problem zu lösen. Weshalb es nun an ihr war, allein zu fahren. Was sie nicht störte. Sie hatte ohnehin das Gefühl, Horndeich einiges schuldig zu sein.
Sie fuhr mit ihrem roten Jaguar XF Kombi über die A5. Bis vor einem Jahr war sie noch als Nachlasspflegerin unterwegs gewesen. Immer wenn Menschen starben und es keine sofort identifizierbaren Verwandten oder Erben gab, war es ihr Job gewesen, das Leben der Verstorbenen abzuwickeln, also in deren Namen Konten aufzulösen, Wohnungen und Versicherungen zu kündigen und Wertgegenstände zu sichern. Da hatte sie es oft mit Kisten voller Leitzordner zu tun gehabt – und in einem Kombi ließen diese sich bedeutend effizienter hin- und her kutschieren. Flott kutschieren – denn Jana war eine ausgesprochene Freundin der linken Spur. Daran hatte sich auch mit dem Jobwechsel nichts geändert.
Wenig später stellte Jana den Wagen unmittelbar vor Hinrichs Haus ab. Auf ihr Klingeln öffnete Emilia Schubert. »Jana! Wie schön, dich wiederzusehen!«
Jana erwiderte die unerwartete Umarmung von Emilia. Vor einem Jahr, als sie in ihrem damaligen Büro das Blut unter dem Parkett gefunden hatte, hatte ihr Emilia Schubert mit einigen DNA-Analysen geholfen. Sie leitete ein entsprechendes Labor in Frankfurt.
Sie hatten sich im Zusammenhang mit diesem Fall ein paarmal gesehen und waren schließlich bei einem Abendessen auch zum Du übergegangen. Doch danach? Nein, der Kontakt war eingeschlafen.
»Komm rein, Martin ist noch nicht da. Er hat angerufen, dass er sich ein bisschen verspätet.«
Jana betrat das Haus, legte ab und folgte der Rechtsmedizinerin ins Wohnzimmer.
»Darf ich dir etwas anbieten? Ich weiß, du musst fahren. Aber vielleicht mixe ich uns einen leckeren alkoholfreien Cocktail.«
Das Wohnzimmer ging fließend in eine Küche über, getrennt durch eine Bar mit einer Theke und einem Barschrank an der Seitenwand. Im Regal standen einige Flaschen, in der Bar selbst fand sich nicht nur das Eisfach, sondern auch eine Spüle und alle Utensilien, die man für den Mix eines Cocktails benötigte.
»Wie geht es dir?«, wollte Emilia wissen.
Jana hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel gesagt. Gemeinhin antwortete man auf eine solche Frage mit: »Gut.« Aber dieses Wort schien sich so tief in ihren Rachen versteckt zu haben, dass es nicht möglich war, es über die Lippen zu hieven.
»Wie geht es Ben?«
»Also ihm – mir – uns.« Jana, die sonst so große Stücke darauf hielt, sich klar, knapp und präzise auszudrücken, musste ob ihrer Antwort selbst schmunzeln. Okay, in der Kategorie ›knapp‹ hätte sie vielleicht noch einen halben Punkt ergattert …
»Oh, das klingt kompliziert«, erwiderte Emilia, während sie aus verschiedenen Flaschen Flüssigkeiten in einen Cocktailmixer gab.
Jana hatte keine Lust, um den heißen Brei herumzureden. »Ja, wir waren ein Paar. Und, nein, wir sind es nicht mehr. Ben ist vor einem halben Jahr verstorben.«
Emilia setzte die Flasche ab, sah Jana an. Dann trat sie um die Bar herum, kam auf Jana zu – und nahm sie in den Arm. »Das tut mir sehr, sehr leid«, flüsterte sie. Und ließ sie sofort darauf wieder los. Perfektes Timing. Denn sonst hätte Jana angefangen zu heulen. Und das wollte sie nun wirklich nicht, an diesem Ort, in dieser Situation.
Emilia füllte weiter den Cocktailmixer und sagte nichts. Jana setzte sich auf einen der vier Barhocker und sprach ebenfalls nicht. Nach ihrem letzten Fall hatte Ben sie zu einer Kreuzfahrt eingeladen. Sie hatten die Karibik durchkreuzt, Kuba gesehen, Jamaika, die Jungferninseln, Trinidad und Tobago – es war einfach nur schön gewesen. Und es war der Moment gewesen, in dem Jana gespürt hatte, dass sie mit Ben den Rest ihres Lebens verbringen wollte. Er, der vor der Reise noch seinen Lebensmittelpunkt in Berlin gehabt hatte, war schließlich zu ihr in den Lucasweg gezogen.
Emilia stellte ein Glas vor Jana ab, der Inhalt mangofarben-exotisch, sogar mit Papierschirmchen.
»Prost«, sagte Emilia und hielt Jana das eigene Glas entgegen. Sie stießen miteinander an.
»Woran ist er –«, fragte Emilia, als das Schloss der Eingangstür zu hören war. Martin Hinrich kam nach Hause.
»Später …«, flüsterte Emilia, ging um die Bar herum in Richtung Flur. Jana hörte nur, wie sie ihren Gefährten mit einem Kuss begrüßte.
Hinrich betrat den Raum. »Aber hallo! Ihr habt schon angefangen zu feiern? Ohne mich?«
»Aber selbstverständlich«, sagte Emilia. »Denkst du, wir warten mit dem Cocktail, bis du vielleicht dazustößt?«
So durfte nur Emilia mit ihm reden, das wusste Jana. Nicht aus eigener Erfahrung, aber Horndeich hatte ihr schon die eine oder andere Geschichte über den manchmal durchaus etwas arrogant wirkenden Rechtsmediziner erzählt. Auch sie selbst hatte an den Abenden, die sie gemeinsam verbracht hatten, festgestellt, dass er im Mittelpunkt eines Gesprächs primär eine Person wünschte: sich selbst.
»Ich habe uns etwas zu essen vorbereitet. Es braucht aber noch 15 Minuten, bis das kulinarische Kunstwerk vollendet ist. Vielleicht nutzt ihr beiden die Zeit, um über diesen Fall zu sprechen«, schlug Emilia vor und deutete mit einem Arm in Richtung der Sitzecke des Wohnzimmers.
Martin Hinrich hatte eine Vorliebe für opulente britische Möbel. So nahmen auch die beiden schweren Ledersofas breiten Platz ein. Diese hätten sich auch in einem britischen Herrenclub durchaus wohlfühlen können. Hinrich bedeutete Jana, auf dem einen Platz zu nehmen.
»Einen Whisky für dich?«, stellte er die Frage in den Raum, doch schon am Tonfall erkannte Jana, dass es eher eine rhetorische Frage gewesen war. Es war ihm klar, dass Jana noch fahren musste.
Er hakte auch nicht weiter nach, goss sich selbst einen bernsteinfarbenen Trank ein. Jana erkannte auf dem Etikett »Traigh Bhan« und »19 years«, aber das sagte ihr gar nichts. Hinrich setzte sich auf das andere Sofa. Nein, er ließ sich nieder. Dann sagte er: »Horndeich hat mir nur gesagt, es ginge um den Fall mit jener jungen Frau, Femke Weidt, die sich umgebracht hat.«
Jana nickte. »Ja. Ihr Ehemann hat sich bei uns gemeldet. Und er hat erhebliche Zweifel daran, dass es Selbstmord war.«
Hinrich nickte nur. »Ja, Leah Gabriely hat mir davon erzählt. Tragisch. Diese Frau Weidt lässt einen Säugling zurück. Und einen trauernden Ehemann. Nicht leicht.«
Leah Gabriely leitete die Abteilung K10 der Darmstädter Polizei, jene Büros, die sich um Gewalt-, Brand-, Waffen- und Sexualdelikte kümmerten sowie die Vermisstenstelle betreuten. Und da Magnus Weidt die Polizei gerufen hatte, war Leah Gabriely sogar persönlich vor Ort gewesen. »Besteht aus Ihrer Sicht die Möglichkeit, dass diese Frau sich tatsächlich nicht umgebracht hat? Gibt es nur den Hauch eines Zweifels?«
»Na, na, na«, zog Hinrich die Augenbrauen zusammen. »Wir hatten uns doch schon einmal auf das Du geeinigt, oder? Und das mache ich keineswegs leichtfertig! Deshalb bestehe ich dann auch auf einer gewissen Konsequenz in der Durchhaltung.«
Jana musste die Worte zweimal durch ihr Gehirn laufen lassen, bevor sie den Sinn tatsächlich verstand. »Okay, hattest du irgendwann auch nur den Hauch eines Zweifels?«
»Nein«, sagte Hinrich, und der Tonfall war entschieden.
»Keinen Zweifel?«
»Nicht den Hauch eines Zweifels. Eine Sekunde bitte«, bat er und erhob sich. Keine Minute später kam er mit einem Hefter in der Hand zurück. »Ich habe hier meinen Abschlussbericht. Da habe ich alles reingeschrieben. Da steht auch drin, weshalb ich keinerlei Zweifel an einem Selbstmord habe.«
»Kannst du mir den Bericht zukommen lassen?«
Hinrich rollte die Augen. »Nein. Das kann ich natürlich nicht. Die Staatsanwaltschaft hat ihn bekommen – und das war’s.«
Jana nickte. War einen Versuch wert gewesen, auch wenn sie von vornherein angenommen hatte, dass der Versuch ins Leere laufen würde.
»Aber ich kann dir über einen fiktiven Fall erzählen, der zufällig fast eins zu eins dem entspricht, den ich an Femke Weidt erlebt habe.«
Jana machte eine einladende Handbewegung.
»Also: Die fiktive Dame, die wir jetzt mal Femke Weidt nennen wollen, war kerngesund – also im Rahmen ihrer Möglichkeiten.«
Jana runzelte die Stirn: »Wie meinst du das denn?«
»Nun, alle Organe von ihr waren in einem guten Zustand. Leber, Bauchspeicheldrüse, Nieren, Darm, das Herz – alles picobello. Ihrem Körper war auch abzulesen, dass sie ein Kind geboren hatte. Aber auch die Rückbildung nach der Geburt war völlig problemlos vonstattengegangen.«
»Aber?«, sprach Jana das Wort aus, das wie ein Wölkchen im Raum schwebte.
»Nun, ihre Lunge war nicht okay. Also einer der beiden Lungenflügel war nicht okay. Er war krank. Schwerkrank.«
Hinrich machte eine Pause, führte das Nosing-Glas unter die Nase, schnupperte ein wenig, nahm dann einen kleinen Schluck des Whiskys.
»Ein Lungenflügel? Wie kann das funktionieren?«
Hinrich hielt ihr die Handfläche entgegen, wie einem Hund, dem man ein Stop-Signal senden wollte. Parallel dazu arbeiteten seine Gesichtsmuskeln im Kieferbereich auf Hochtouren, er spülte die Flüssigkeit in seinem Mund hin und her, bevor er nach rund einer halben Minute schluckte. »Ah«, sagte er genüsslich. Und konnte sich dann doch nicht verkneifen zu sagen: »Da hat sich doch jeder Euro von diesen 250 Genossen gelohnt.«
250 Euro für einen Whisky?
»… den ich dir geschenkt habe!«, hörte Jana Emilias Stimme aus dem Küchenbereich.
»… wofür ich dir nachher noch einmal einen Kuss schenken werde«, sagte Hinrich und wandte seine Aufmerksamkeit wieder Jana zu. »Wo waren wir?«
»… nur ein Lungenflügel«, hörte Jana abermals Emilias Stimme, die dadurch nur deutlich machte, dass sie dem Gespräch durchaus ihre Aufmerksamkeit widmete. Parallel dazu hörte Jana das Zischen von Fett in einer Pfanne.
»Ja, nur ein kranker Lungenflügel. Voller Bronchiektasen. Peribronchiale Streifenzeichnung und zystische Hohlräume in den Atemwegen. Die Lunge zugekleistert mit Drei-Schichten-Sputum. Gruselig.«
Jana war genauso schlau wie vorher.
Wieder kam Hilfe aus der Küche: »Martin! Deutsch, bitte. Kein Fachchinesisch!«
»Ah, ja«, räusperte sich Hinrich. Nahm einen Schluck Whisky. Mit gleichem 30-Sekunden-Prozedere des Schmeckens und Schluckens. Dann fuhr er fort: »Femke Weidt litt im fortgeschrittenen Stadium unter Mukoviszidose. Das ist eine Krankheit, bei der der Schleim nicht flüssig ist, sondern sich extrem verdickt. Das führt nicht nur, aber auch, und zumeist ganz besonders zu Problemen in der Lunge: Da man nicht richtig abhusten kann, bleibt der zähflüssige Schleim in der Lunge und führt dann oft zu Entzündungen.«
»Und diese Krankheit kann man auch nur in einem Lungenflügel bekommen?«, spann Jana die Erklärungen Hinrichs weiter – die sie nun, da er sie auch für Schüler der unteren Klassen verständlich ausgedrückt hatte, verstanden hatte.
»Nein, natürlich nicht. Mukoviszidose betrifft immer die gesamte Lunge. Es handelt sich um eine Erbkrankheit, die sich übrigens autosomal-rezessiv vererbt.«
Jana griff die Steilvorlage nicht auf und fragte auch nicht zurück.
Martin Hinrich wartete auch nur zehn Sekunden, bevor er fortfuhr: »Femke Weidts Lunge war so sehr geschädigt, dass einer ihrer Lungenflügel durch einen Spender-Lungenflügel ersetzt worden ist. Und der erfreute sich bester Gesundheit.«
»Femke hatte ein Spenderorgan in sich?«
»Ja. Offensichtlich schon eine ganze Weile. Die Nähte an Atemwegen und Adern waren hervorragend verheilt, und dies schon seit längerer Zeit.«
»Das heißt, Femke Weidt hat vor ein paar Jahren ein Spenderorgan bekommen? Und jetzt bringt sie sich um?«
»Ganz offensichtlich.«
»Aber das ergibt doch überhaupt keinen Sinn«, rief Jana aus, etwas lauter, als sie es beabsichtigt hatte.
»Das ist nicht die Fragestellung, die ich beantworten muss«, sagte Martin Hinrich. Und fuhr fort: »Ja, Femke Weidt war gesund. Ja, sie hat vor ein paar Jahren einen Lungenflügel gespendet bekommen. Ja, ihr Körper hat dieses Organ sehr gut angenommen. Und, ja, sie starb an einer Überdosis Dorimorzol. Oder zumindest an dessen Wirkstoff Pentosynthol.«
»Woher wollen Sie das wissen?«
Nun ertönte aus dem Küchenbereich »Na, na, na!«, parallel begleitet von einem zutiefst beleidigten Blick Martin Hinrichs.
»Ich meine, weshalb sind Sie sich – bist du dir sicher, dass das die Todesursache war?«
»Nun, Jana, fangen wir mal mit dem Wirkstoff an. Pentosynthol ist eines der jüngeren Entwicklungen von Schlafmitteln. Es ist besonders magenfreundlich. Das hat den großen Vorteil, dass Patienten dieses Medikament gut vertragen. Auch bei etwas höherer Dosierung. Man muss sich nicht übergeben. Das allerdings hat den Nachteil, dass es sich als Suizid-Medikament herumgesprochen hat. Die Zahl derer, die sich mit diesem Wirkstoff das Leben genommen haben, ist in den vergangenen zehn Jahren extrem angestiegen. Heute gibt es schließlich so etwas wie Suizid-Foren im Internet. Gruselig.« Hinrich sprach weiter: »Femke Weidt hatte das Medikament gut vertragen. Sie hat sich nicht einmal erbrochen.«
»Und das langt als Beweis?«
»Nein. Natürlich nicht. Ich formuliere es mal etwas überspitzt: Hätte Femke Weidt ein dickes Loch im Kopf gehabt, hätte sie eine Schusswunde oder eine Stichwunde gehabt, hätte die These der Todesursache durch Pentosynthol ziemlich gelitten. Aber da war rein gar nichts. Die Analyse aller Körperflüssigkeiten hat keine Auffälligkeiten zutage gefördert. Es gab überhaupt keine Anzeichen von auch nur dem Hauch von Gewaltanwendung gegen ihren Körper. Oder, um es ganz knapp auf den Punkt zu bringen: Alles war bestens, abgesehen von der Vergiftung durch Pentosynthol.«
Jana schwieg.
Offensichtlich fühlte Hinrich sich dadurch aufgefordert, dem Ganzen nochmals Nachdruck zu verleihen: »Jana, Femke Weidt ist durch eine Überdosis Pentosynthol gestorben. Daran gibt es keinen Zweifel. Und es gibt nicht einen einzigen winzigsten Hinweis darauf, dass sie es nicht selbst genommen hat. Keine Hämatome am Körper, keine Verletzungen am Kopf, keine im Mund, keine im Rachenraum – einfach gar nichts.«
Lydia II
Gibt es das grenzenlose Glück? Mit der großen Liebe an der Seite?
Mein Gott – wenn Erinnerungen mit solchen Worten beginnen, kann der Text nur fürchterlich enden …
Ja, für mich gab es das. Für drei Jahre in meinem Leben. Heute weiß ich, man muss für alles im Leben bezahlen. Damals war mir das nicht bewusst. Aber ich habe es gelernt. Auf die harte Tour. Ich habe für diese drei Jahre bezahlt. Und der Wechselkurs war hundsmiserabel.
Würde ich, wenn ich es könnte, diese drei Jahre ungeschehen machen, um danach nicht so einen irrsinnigen Schuldenberg begleichen zu müssen? Ich weiß es nicht. Das Gute daran ist, dass sich die Frage nicht stellt, weil ich die Vergangenheit nicht ändern kann. Keinen Tag. Keine Stunde, keine Minute. Keine Sekunde. Keine von den Entscheidungen, die ich getroffen habe, kann ich ungeschehen machen. Nichts von dem, was mir widerfahren ist, kann ich ungeschehen machen.
Meine Liebe, ich habe deinen Vater kennengelernt, zwei Jahre vor deiner Geburt. Es war wohl das schönste Jahr in meinem Leben. Ich fühlte mich so leicht, so frei, das Leben lag mir zu Füßen, die Welt stand mir offen, und ich war viel zu jung und zu naiv, um auch nur den Hauch eines Gedankens daran zu verschwenden, dass mein Leben vielleicht nicht weiter in diesen Bahnen verlaufen könnte.
Mein Papa, er hat mir diese Reise geschenkt. Zu meinem 19. Geburtstag. Und zur bestandenen Ausbildung. Krankenschwester habe ich gelernt – und, ja, ich war gut in meinem Job. Das Hospital, das mich ausgebildet hatte, wollte mich auch übernehmen. Ich hatte sogar schon zugesagt.
In Rotterdam sind wir auf das Fluss-Kreuzfahrtschiff gestiegen, es sollte uns bis Basel bringen. Ich war sicher eine Exotin: Auf dem Schiff gab es kaum jemanden, der nicht mindestens 35 Jahre älter war als ich. Auch mein Vater war über seinen Schatten gesprungen. Er liebte eigentlich mehr die Berge als die Flüsse. In Köln ist dann dein – damals noch zukünftiger – Vater zugestiegen. Der die Reise mit seiner Mutter und auch nur ihr zuliebe angetreten hatte.
Seit diesem Moment hatten wir jeden Tag zusammen verbracht. Und Papa hat es mir nicht einmal krummgenommen, dass er mich von Köln bis Basel kaum zu Gesicht bekommen hat. Er, der Witwer, hat sich mit der Mutter deines Vaters, ebenfalls Witwe, gut verstanden, was die Sache erheblich einfacher gemacht hat.
Dein Vater hatte gerade sein Maschinenbau-Studium beendet. Dein Großvater hatte ihm ein stolzes Sümmchen Geld vererbt. Und so gingen wir nach dieser Kreuzfahrt auf Weltreise. Mein Schatz, ich habe jeden Kontinent dieser Welt mit eigenen Augen gesehen. In diesem Jahr haben dein Vater und ich das gesamte Erbe auf den Kopf gehauen. Und ich habe so viel erlebt, dass ich daraus ein Buch hätte machen können. Aber ich habe nichts aufgeschrieben. Wir haben noch nicht einmal fotografiert – es war die Zeit, bevor ein Handy primär ein Fotoapparat gewesen war. Wir haben einfach nur – gelebt.
Als wir nach diesem Jahr zurückkehrten nach Deutschland, da fing dein Vater an zu arbeiten, in einem international ausgerichteten Maschinenbauunternehmen, nicht so weit entfernt in Heilbronn, wie einige viele aus unserem kleinen Städtchen. Und er hielt um meine Hand an. Wir hatten eine schöne Wohnung. Und wir heirateten. Mein Vater und seine Mutter – sie waren ebenfalls ein Paar geworden. Es hätte eine Doppelhochzeit werden können, aber mein Vater wollte nicht mehr heiraten. Und wenn es in meinem Leben irgendeine Konstante gibt, dann diese: Die Paukenschläge des Schicksals kommen nicht als Schlag – sondern immer gleich als Trommelwirbel: Am Tag unserer Hochzeit habe ich den Schwangerschaftstest gemacht. Und als ich zu deinem Vater »Ja, ich will« sagte, wusste ich, dass es dich geben würde.
Dich, meine Tochter, habe ich geboren fast gänzlich ohne Schmerzen. Ungewöhnlich für eine Erstgebärende. In Filmen, da schreien die Frauen den ganzen Fernseher nieder, wenn sie ein Kind gebären.
Ja, natürlich litt auch ich, als ich dich geboren habe. Aber ich habe nicht geschrien. Ich habe nicht schreien müssen. Es tat weh, aber es war auszuhalten. Und du hast es mir leicht gemacht. Die ganze Geburt hat von der ersten Geburtswehe bis zum ersten Schrei keine sechs Stunden gedauert.
Wir haben damals nach ganz klassischem Rollenbild gelebt. Dein Papa hat gearbeitet, war immer wieder auf Montage in Deutschland und auch in Europa unterwegs. Aber wenn er zu Hause war, dann haben wir das Leben in vollen Zügen genossen. Wir haben mit Freunden gefeiert, wir sind gereist, wenn natürlich nun mit dir in einem viel kleineren Radius. Dein Vater – er wollte alle Welterbe der UNESCO zumindest in Deutschland mit eigenen Augen sehen. Mit dir im Kinderwagen besuchten wir einige.
Dein Vater und ich – wir haben uns wirklich geliebt. Ich weiß nicht, was die Zukunft gebracht hätte. Es waren ja nur jene drei Jahre, die wir unser Leben teilen durften.
Hätte es für uns irgendwann auch ein verflixtes siebtes Jahr gegeben? Aus heutiger Perspektive hätte ich mir das gewünscht. Denn das hätte zumindest noch weitere vier Jahre gemeinsam mit deinem Vater bedeutet.
Aber das war uns nicht vergönnt. Wenn der Trommelwirbel des Schicksals loslegt, kann man nicht glücklich leben.
Da ist man froh, wenn man überlebt.
Immer und immer und immer wieder.
Obwohl?
Irgendwann ist man nicht einmal mehr darüber froh. Der Moment, in dem der Tod zunehmend Gast wird in den eigenen Gedanken.
Dienstag, 4. Juni
Die Eltern von Femke Weidt wohnten in Weiterstadt, im Kastanienweg. Fast alle Wege in diesem Viertel trugen die Namen von Bäumen.
Das Einfamilienhäuschen lag ein wenig entfernt von der Straße. Mehrere dieser Gebäude waren aneinandergebaut worden. Und das Haus der Familie Weidt war ein Eckhaus. Was nicht bedeutete, dass es direkt an der Straße lag, dass man dort auch einen Parkplatz fand. Die Kennzeichnungen auf der Straße, wo man parken dürfe und wo nicht – chaotisch war noch eine freundliche Bezeichnung für die Straßenpinselei vermeintlicher Parkzonen. Je wirrer, desto einträglicher für die Stadt … »Da darfst du nicht parken«, sagte Jana.
Horndeich, der inzwischen dreimal um den Block gefahren war, sagte nur: »Das ist ein 35 Euro-Parkplatz. Nicht mehr. Und nicht weniger.« Er rangierte den Wagen an den Straßenrand, stellte den Motor ab und verließ das Auto.
»Sicher?«, fragte Jana.
Horndeich antwortete nicht einmal darauf.
Zum Glück gab es Navis, die zeigten auch einem Fußgänger, wo er eine Adresse fand. In diesem Fall war das besonders hilfreich.
Jana hatte Horndeich bereits im Wagen vom gestrigen Treffen mit Martin Hinrich und Emilia Schubert berichtet. Kein Zweifel am Selbstmord aus der Perspektive des Rechtsmediziners. Horndeich war gespannt, was Femkes Eltern sagen würden.
Die Zugänge zu den Häusern lagen ein bisschen verschachtelt. Als Horndeich die Türklingel drückte, erklang zweistimmiges Hundekläffen. Dann, noch ein wenig lauter als die Tiere, offensichtlich die Stimme des Frauchens: »Nala! Lilli!« Die Berufung auf die Namen der Angerufenen bewirkte nicht den vermeintlich erstrebten Effekt: Die Hunde kläfften nur noch lauter.
»Einen Moment«, rief die Dame des Hauses jenseits der Tür.
Horndeich kannte die Situation. Auch bei Fidel hatte es einige Monate Trainings bedurft, bis der kleine Hund kapiert hatte, dass er niemanden beschützen musste und das dies auch nicht seine Aufgabe war. Sprich: Er hatte die Klappe zu halten.
Nach ungefähr einer halben Minute öffnete die Dame die Tür.
»Steffen Horndeich mein Name, das ist meine Kollegin Jana Welzer«, stellte Horndeich sich und seine Kollegin vor.
Gesine Siefken war eine sehr kleine Frau. Also, eine sehr, sehr kleine Frau. Horndeichs erste Assoziation war die von Alberich im Münster-Tatort, also jene Rolle der Schauspielerin Christine Urspruch. Okay, Christine Urspruch maß 1,32 Meter. Aber die 1,55 Meter hätte Gesine Siefken kaum gerissen. Horndeich wusste nicht, wohin sie die Hunde gesperrt hatte, aber sie verweilten offensichtlich hinter irgendeiner Tür, hinter der sie nicht mehr bellten.
»Kommen Sie doch rein«, bat die Frau sie ins Innere des Hauses. Der Flur war eng, bog nach rechts ab, wurde noch ein bisschen enger, weil die Garderobe mit Mänteln, Jacken und Schals ein wenig den Durchgang blockierte.
Gesine Siefken deutete auf einen Tisch zwischen Küche und Wohnbereich. »Nehmen Sie doch Platz«, sagte sie mit freundlicher Stimme.
Jana setzte sich, Horndeich ebenso.
»Kaffee? Tee?«, wollte die Dame des Hauses wissen.
Jana schüttelte den Kopf, Horndeich verneinte verbal.
Weshalb sich die Dame nun auch zu ihnen setzte.
»Frau Siefken, Ihr Schwiegersohn kam gestern zu uns.« Bereits am Telefon hatte Horndeich erklärt, wer sie waren und warum sie Gesine Siefken sprechen wollten. »Wie gesagt, er ist nicht überzeugt davon, dass Ihre Tochter sich selbst umgebracht hat.«
Frau Siefken schüttelte ganz leicht den Kopf. »Das hätte sie auch nie getan.«
»Wir haben gestern mit dem Rechtsmediziner gesprochen, der Ihre Tochter untersucht hat. Er hat gesagt, die Todesursache sei eindeutig. Ihre Tochter sei durch eine Überdosis Pentosynthol gestorben.«
Horndeich sah, wie Tränen in Gesine Siefkens Augen stiegen. Sie sah Jana an und sagte: »Meine Tochter hat sich nicht umgebracht. Niemals. Ich weiß, Sie hören das wahrscheinlich oft. Aber ich weiß eben auch, dass meine Tochter sich nicht umgebracht hat. Sie hat ihre Krankheit bekämpft. Sie hat ein Kind bekommen. Sie hatte einen Mann, den sie liebte und der sie liebte. Nein, da gab es so überhaupt keinen Grund.«
Horndeich sah zu Jana. Doch die war mit ihren Gedanken gerade woanders. So übernahm er die weitere Gesprächsführung: »Erzählen Sie uns von Ihrer Tochter.«
Gesine Siefken deutete auf eine Fotografie, die an der Wand hing. Sie zeigte Gesine Siefken, offensichtlich ihren Mann und zwei Mädchen, die auf diesem Foto einander glichen wie ein Ei dem anderen. »Mein Mann und ich, wir hatten schon gedacht, dass wir keine Kinder mehr bekommen würden. Waren auch einmal in so einer Fruchtbarkeitsklinik. Konntest du vergessen. Das kann kein normaler Mensch bezahlen. Mein Mann arbeitet seit 30 Jahren bei Opel in Rüsselsheim. Ich hab damals noch bei Aldi an der Kasse gesessen – wir waren nicht so die Hauptkunden in dieser Klinik. Aber dann, dann wurde ich tatsächlich schwanger. Und dann sagte die Frauenärztin, ich bekäme Zwillinge. Zwei Mädchen. Femke und Deike.«
Horndeich unterbrach Frau Siefken: »Sie haben zwei Kinder? Zwillinge?«
»Ja. Beide 2001 geboren. Unser großes Glück.«
»Der Rechtsmediziner hat festgestellt, dass Femke einen Lungenflügel gespendet bekommen hat. Und dass der andere Lungenflügel aufgrund von Mukoviszidose in einem extrem schlechten Zustand war.«
Gesine Siefken hielt nur kurz inne. »Sicher, dass Sie keinen Kaffee oder einen Tee wollen? Ich brauche jetzt einen.« Sie erhob sich.
»Ich nehme dann gern einen Tee. Einen schwarzen oder einen grünen«, meinte Jana.
»Kein Problem«, entgegnete Frau Siefken. Sie ging auf eine Kaffeemaschine zu. Daneben stand ein Wasserkocher. Sie bereitete Jana einen Tee zu, sich selbst den Bohnensud. Während sie in der Küche stand, sagte sie, Horndeich nicht zugewandt: »Sie hatten beide diese Scheiß-Krankheit. Mukoviszidose. Als sie drei Jahre alt waren, haben wir einen Schweißtest machen lassen. Das Ergebnis: Natriumchlorid von 120 Millimol pro Liter. Der DNA-Test danach brachte die Bestätigung: Meine beiden Engel litten an dieser fürchterlichen Krankheit. Husten ohne Ende, nicht abhusten können, das ganze Drama. Wir sind über die Jahre den gesamten Marathon gerannt, mehrmals. Und auch durch diverse Labyrinthe. Wachstumshormone, Vitaminkuren, Cortison, Antibiotika, dann sogar Gentamicin. Parallel dazu stete jährlich wechselnde Ernährungshinweise. Wissen Sie, hunderttausend Handlungsempfehlungen. Und sie wissen nie, ob sie das Richtige getan haben. Mein Mann, Ubbo, er war der, der uns immer weiter durch alle Optionen und Therapien navigiert hat. Ich war die, die sich jeden Tag das Leiden ansehen musste.«
»Ihr Mann? Wo ist er?«
»Er arbeitet. Er schraubt in Rüsselsheim die neuen Opel Astras zusammen. Wird heute Abend um sieben Uhr wieder da sein. Wenn Sie mit ihm sprechen möchten.«