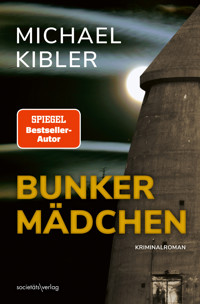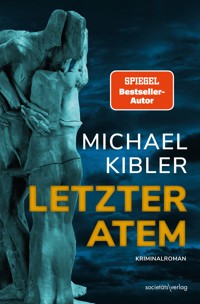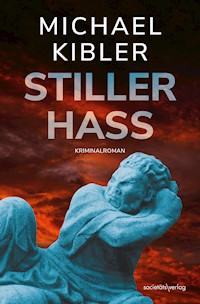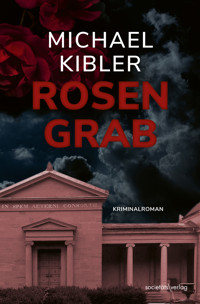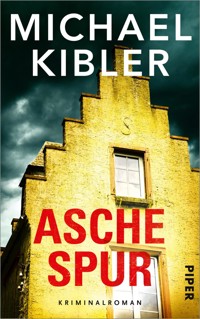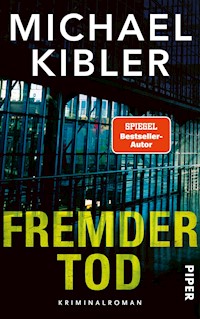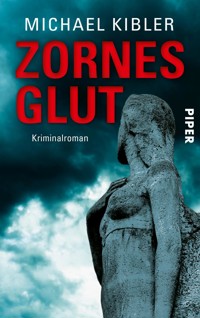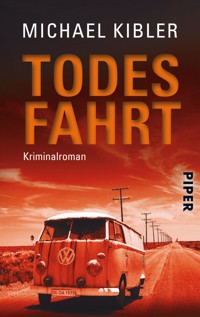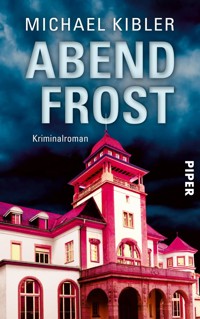Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Societäts-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein freier Tag am Badesee für Horndeich – aber so hatte er sich den nicht vorgestellt: Direkt vor ihm taucht eine Wasserleiche auf. Horndeich und seine Kollegin Margot Hesgart ermitteln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Kibler
Opfergrube
Kriminalroman
Band 7
Alle Rechte vorbehalten • Societäts-Verlag
© 2024 Frankfurter Societäts-Medien GmbH
Satz: Julia Desch, Societäts-Verlag
Umschlaggestaltung: Julia Desch, Societäts-Verlag
Umschlagabbildung: Statue: Creative-Commons/Aidexxx/Darmstadt Friedensplatz Leibgardistendenkmal; Hintergrund: NatalyFox/Shutterstock.com
Printausgabe ISBN 978-3-95542-508-1
E-Book ISBN 978-3-95542-509-8
Besuchen Sie uns im Internet:
www.societaets-verlag.de
I don’t know who you think you are
but before the night is through
I wanna do
bad things with you.
Jace Everett, Bad things
PROLOG
Und, meinst du, das ist die gerechte Strafe?«
Ich sitze hier in diesem dunklen Loch. Seit Tagen. Diese innere Stimme, die von den dreckigen Wänden hallt, wird jetzt auch noch philosophisch. Kaum zu ertragen.
»Quatsch. Vergiss es. Ich soll sterben, Mann. Das ist nicht gerecht. Nicht mal der amerikanische Präsident ist heute noch für Todesstrafe.«
Die Stimme säuselt wieder: »Klar. Aber ich meine – so mal rein moralisch.«
Seit ein paar Tagen ist sie da. Kommt von woher auch immer. Aber ich, ich liege in der Grube. Vielleicht fünf mal eins fünfzig groß, keine zwei Meter hoch. Meine Hände sind mit Plastikband gefesselt. Wenn ich mal muss, kann ich kaum meine Lage verändern. Und die Stimme, die es ja gar nicht gibt, die nur in mir drin meckert, geifert, brüllt, lamentiert – die spricht von Moral. Schlechter Witz.
Ich bin schon zu lange hier. Das hält kein Mensch aus, ohne durchzudrehen.
»Das war nicht richtig, damals!«, schreit die Stimme. Und ich würde ihr so gern eine reinhauen. Aber wie schlägt man sich selbst mit gefesselten Händen?
Mann, Mann, Mann, so langsam geht die mir echt auf den Keks. Klar, das war ein wenig too much, damals. Und? Kein Grund, jetzt hier zu liegen, oder? Wie konnte ich mich bloß selbst in so eine Situation bringen? Ich habe doch kaum was gemacht, damals. Aber das sieht man hier offensichtlich anders.
Ich höre, wie die Decke über meiner Grube einen Spaltbreit geöffnet wird. Einerseits ein gutes Geräusch, denn etwas wird gleich passieren. »Etwas ist anders. Alles, was anders ist, ist gut.« Aus dem Film Und täglich grüßt das Murmeltier. Genauso fühle ich mich auch. Nur Dunkelheit, keine Uhr. Keine Ahnung, ob es fünf Tage sind, die ich hier bin, oder fünfzehn. Aber jeder Tag ist wie der vorige. Jede Minute gleicht ihrer Vorgängerin exakt. Durch den Spalt fällt schummriges Licht, vielleicht von einer Glühbirne. Eine Flasche Wasser wird in die Grube hinuntergelassen, an einem Plastikband. Dann wieder völlige Dunkelheit.
Wieder die innere Stimme: »Das war nicht richtig, damals.«
Klar, geschenkt, war nicht richtig.
Mein Name ist Emil Sacher.
Und ich habe Mist gebaut. Mindestens einmal in meinem Leben so richtig fetten Mist.
Und dafür werde ich wohl mit dem Leben zahlen. Die Frage ist nur, ob ich vorher noch komplett durchdrehe.
Gerecht?
Nein.
Abwendbar?
Ebenfalls nein.
Scheiße.
MITTWOCH, 20. JUNI
Das Wasser war wunderbar weich. Horndeich liebte es. Seit der Hauptkommissar in Darmstadt wohnte, mochte er diese Zeit des Sommers, in der er im Badesee mitten in der Stadt schwimmen konnte. Dreimal pro Woche, so war zumindest der Plan, schwamm er eineinhalb Kilometer. Natürlich standen am Seeufer keine Schilder mit Meterangaben, aber es gab ja Google-Earth. Mithilfe des virtuellen Globus, der auf dem PC Satellitenbilder von jedem Punkt der Erde anzeigte, hatte er mehrere Strecken in dem Badesee ausgemessen, sodass er immer eine gute Orientierung über die zurückgelegte Distanz hatte. Von der Rutsche bis zum Sprungturm waren es hundertsiebzig Meter. Zog man in einem großzügigen Bogen an der im Wasser angeketteten Badeinsel vorbei, waren es sogar knapp zweihundert Meter.
Horndeich hatte an diesem Mittwoch frei, und auch die Mörder der Stadt schienen sich brav ans Sommerloch zu halten – oder waren in Urlaub.
Wegen seines alten Benz hatte sich der Vormittag zunächst anders gestaltet, als Horndeich es geplant hatte. Der Wagen war zwar angesprungen, ging dann aber wieder aus und wollte sich nicht mehr starten lassen, obwohl der Anlasser kraftvoll leierte. Hendrik, alter Freund und Autobastler, hatte den Wagen unter die Lupe genommen und nach ein paar Minuten nur ein einziges Wort gesagt: »Benzinpumpe.« Horndeich hatte gleich gewusst, was das bedeutete: viel Geld und eine lange Wartezeit. Denn sein Benz Kombi war Baujahr 1965, mit Flossen, dunkelrot, perfekt restauriert – anscheinend bis auf die Benzinpumpe. Hendrik hatte den Benz samt Horndeich zum Schrauber seines Vertrauens in die Heidelberger Straße geschleppt. Dann hatte Horndeich sich einen Leihwagen besorgt, Golf Kombi. Der würde es für ein paar Tage tun müssen.
Erst eine Stunde danach war er mit seiner kleinen Familie am Badesee angekommen. Horndeichs Frau Sandra lag im Schatten der Bäume auf der Woogsinsel, jener Oase am Rande des Sees, knapp halb so groß wie ein Fußballfeld. Auch seine Tochter Stefanie war mit von der Partie. Da die aber gerade erst ihren ersten Geburtstag gefeiert hatte, schwamm sie noch nicht. Doch die Vorteile von wasserdichten Windeln hatte auch Horndeich schon zu schätzen gelernt. Wobei er bis vor wenigen Wochen noch gar nicht gewusst hatte, dass es tatsächlich Windeln gab, die auch das Eindringen von Wasser verhinderten.
Der Badesee hatte den großen Vorteil, dass Horndeich die Bahnen nicht mit verkappten Kampfschwimmern oder schwimmenden Kaffeekränzchen teilen musste. Das Einzige, was das Schwimmen beeinträchtigte, waren ab und an irgendwelche Wassergräser, die seine Beine streiften. Und die Dinger wuchsen schneller, als man sie abschneiden konnte.
Viele Darmstädter verschmähten den See, weil das Wasser wegen der vielen Schwebstoffe nicht glasklar war. Dabei sorgte der Darmbach für einen steten Frischwasserzulauf. Und auch die regelmäßigen Wasserproben zeugten durchgehend von guter Wasserqualität.
Im Nichtschwimmerbereich planschten sicher hundert Leute. Horndeich war froh, dass er der Masse entschwommen war.
Er versuchte, das Tempo etwas zu erhöhen, und erreichte die Badeinsel, die rechts von ihm mit Ketten an dem für sie bestimmten Ort gehalten wurde. Die Stadt hatte sie erst in diesem Jahr zu Wasser gelassen. Auf den knapp vierzig Quadratmetern sonnten sich zahlreiche Badegäste. Ein Pärchen am Rand knutschte ziemlich ungeniert.
Horndeich hob den Kopf aus dem Wasser, sog die Luft ein, tauchte unter, die Arme verdrängten das Wasser, er glitt nach vorn, die Beine stießen sich im Wasser ab, der nächste Atemzug stand an.
Da erkannte Horndeich, dass in einiger Entfernung vor ihm etwas im Wasser trieb. Ein Fisch?
Er lenkte die Schwimmbewegungen ein wenig nach rechts, zog die Arme durch, tauchte wieder auf.
Ein verdammt großer Fisch. Dann hörte er bereits das Schreien von der Badeinsel, die inzwischen hinter ihm lag. Mindestens dreistimmig. Zwei Frauen, ein Mann.
Horndeich schaute auf den Körper vor sich im Wasser. Er paddelte jetzt auf der Stelle. Das war kein Fisch. Ganz sicher nicht. Das, was da vor ihm im Wasser lag, war ein menschlicher Körper. Und definitiv ein toter menschlicher Körper.
Oh nein, dachte er. Dann wendete er. Kurz überlegte er, auf die Badeinsel zuzusteuern. Doch dann drehte er bei. Hundertzwanzig Meter entfernt am Ufer warteten seine Frau und seine Tochter. Und sein Handy.
Jetzt kraulte er. So schnell er konnte.
Eine Dreiviertelstunde später war die Woogsinsel komplett geräumt. Die Spurensicherung suchte bereits das Ufer ab, Taucher der Bereitschaftspolizei untersuchten den Grund des Sees. Die Kollegen von der Schutz- und Bereitschaftspolizei nahmen die Personalien der Badegäste auf, die jetzt auf der hinter der Woogsinsel liegenden Wiese standen und darauf warteten, nacheinander das Gelände verlassen zu dürfen.
Mit einem Boot hatten die Jungs der Bereitschaftspolizei zuerst die Badegäste, die nicht bereits selbst ans Ufer geschwommen waren, von der kleinen Badeinsel zur Woogsinsel gefahren. Danach hatten sie die Leiche an Land gebracht und auf der Woogsinsel abgelegt. Über der Leiche war inzwischen ein Zelt aufgebaut, nicht zuletzt, um Neugierigen das Gaffen unmöglich zu machen.
Bevor die Bereitschaftspolizei eingetroffen war – von ihrem Stützpunkt in Mainz-Kastel aus hatten die auch knapp eine halbe Stunde gebraucht –, war die Leiche ungeschützt im Wasser getrieben. Kurz hatte Horndeich erwogen, den Ekel zu unterdrücken und sie eigenhändig an Land zu ziehen. Doch er wollte auf keinen Fall eventuelle Spuren vernichten oder verunreinigen. Also hatte er mit all den anderen auf die Einsatzbusse und Gerätschaftswagen der Mainzer Kollegen gewartet.
Es hatte eine Viertelstunde gedauert, bis die Kollegen der Schutzpolizei das ganze Gelände um den See, inklusive der Fußwege, abgesperrt hatten. Vorher hatte Horndeich ungläubig beobachtet, wie sich auf dem Fußweg Menschentrauben bildeten, die den im Wasser treibenden Körper mit ihren Handys ablichteten. Er hatte auch die eine oder andere Spiegelreflexkamera mit Monster-Tele gesichtet. Einer der Meisterfotografen war sogar auf einen Baum geklettert, um freie Sicht zu haben.
»Was haben wir hier?«, fragte Margot Hesgart. Steffen Horndeichs zehn Jahre ältere Vorgesetzte und Partnerin war inzwischen auch eingetroffen. Sie trug bereits einen weißen Schutzanzug sowie blaue Plastiküberschuhe. Wieder einmal fiel Horndeich auf, dass sie in den vergangenen Wochen sicher zehn Kilo abgenommen hatte. Da Margot nie dick gewesen war, erreichte sie allmählich die Grenze jenseits eines gesunden Body-Mass-Index.
Horndeich trug die gleiche Verkleidung, die seine Shorts und das kurzärmelige Hemd verdeckte. Sandra war mit Stefanie und den anderen Badegästen bereits gegangen. Seine Frau hatte einmal ebenfalls zur Mordkommission Darmstadt gezählt, bevor sie zum Landeskriminalamt nach Wiesbaden gewechselt war. Aber momentan war sie ohnehin in Elternzeit.
»Leiche. Männlich. Nackt. Gefesselt«, erklärte Horndeich seiner Kollegin. Gemeinsam mit Margot betrat er das Zelt. Margot schaute auf den nackten Körper des Mannes. Die Leiche war aufgedunsen, und die Farbe des Körpers war alles andere als appetitlich. Der Körper lag auf der Seite. Ihn auf den Rücken zu legen wäre nicht möglich gewesen. Der Grund war offensichtlich: Beide Hände und beide Füße waren aneinandergefesselt, hinter dem Rücken.
Horndeich sah wieder auf den Mann auf dem Boden. Gruselig, der Gedanke, so ertrinken zu müssen.
Margot ging in die Hocke, betrachtete das Gesicht. »Könnte er es sein?«, fragte sie.
Horndeich wusste, wovon sie sprach. Vor drei Wochen war ein Hochschullehrer aus Darmstadt spurlos verschwunden. In dieser Haltung konnte Horndeich schlecht die Größe schätzen, doch die Eckdaten stimmten: vierzig Jahre alt, dunkles, kurzes Haar, athletischer Körperbau, trainiert, keine Blinddarmnarbe, auch sonst keine Narben oder unveränderliche Kennzeichen – der Mann vor ihnen war ein guter Kandidat.
Ein weiterer Mann betrat das Zelt: Dr. Martin Hinrich, der Gerichtsmediziner aus Frankfurt. Auch er trug die Spurenvermeidungsuniform.
»Na, was haben wir denn da?«, fragte er, offenbar bester Laune.
»Männliche Wasserleiche. Nackt. Gefesselt«, sagte Margot.
Horndeich wusste, wie das mit den Wasserleichen war. Natürlich war ein menschlicher Körper schwerer als Wasser, im Leben wie im Tod. Deshalb sank er zunächst ab, auf den Grund des Gewässers. Nach geraumer Zeit bildeten die Bakterien im Körper Gase, wenn sie den Körper zersetzten. Und dann stieg der Körper wieder auf. Quod erat demonstrandum.
Horndeich erinnerte sich, dass das bei fünf Grad kaltem Wasser nach rund zwei Wochen der Fall war. Doch der Sommer hatte Darmstadt seit vierzehn Tagen fest im Griff; das Wasser im Woog hatte inzwischen an der Oberfläche fast fünfundzwanzig Grad. Und da der See an den tiefsten Stellen nur vier Meter tief war, waren die unteren Wasserschichten wohl auch nicht mehr eiskalt. Was den Verwesungsprozess und damit den Auftrieb beschleunigt haben durfte.
»Und? Auf den ersten Blick eine Idee zur Todesursache?«, fragte Margot.
Steilvorlage für den Gerichtsmediziner: »Bewegungsmangel.«
»Mein Gott, Hinrich, können Sie nicht einmal ein wenig Respekt vor den Toten zeigen?«, blaffte Margot lauter als sonst.
Was Hinrich dazu veranlasste, aus der Hocke heraus zu ihr aufzuschauen. »Bin ich Hellseher, werte Kollegin? Nein. Ich muss den toten Herrn erst mal mit nach Frankfurt nehmen. Auf den Tisch legen. Entfesseln. Und dann untersuchen. Und das möglichst flott, denn wenn der hier noch ein paar Stunden in der Hitze fault, kann ich ihn gleich ins Jeffersonian schicken.«
Margot hob eine Augenbraue, und Horndeich konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Wohin?«, fragte sie.
Horndeich antwortete: »Bones. Die Knochenjägerin. Fernsehserie. Sie ist forensische Anthropologin. Ihr Institut heißt Jeffersonian. Die schaut immer nur auf die Knochen, wenn das Fleisch schon nicht mehr dran ist.« Seit geraumer Zeit waren er und seine Frau Sandra zu Serien-Junkies geworden. Kleine Filmhäppchen, passend für die knappe Pause zwischen Tochter füttern und Tochter wickeln.
»Schon gut«, antwortete Margot.
»Ich sehe keinen typischen Schaumpilz. Aber wenn er einige Tage unter Wasser lag, dann ist das kein Wunder. Schaumpilz vor dem Mund hätte eindeutig auf Ertrinken schließen lassen.«
Hinrich ging in die Hocke. Dann nahm er die nötigen Utensilien aus dem Koffer und untersuchte die Leiche von Kopf bis Fuß. Margot und Horndeich standen schweigend daneben.
»Ich kann noch nicht sagen, ob das die Todesursache war, aber er hat einen Schlag auf den Kopf bekommen.« Hinrich wandte sich dem Team zu, wobei er mit der Hand das Kopfhaar des Toten etwas zur Seite hielt.
»Wann können Sie uns Genaueres sagen?«
»Frau Hesgart, Sie kennen mich doch inzwischen gut genug, um sich diese Frage selbst beantworten zu können. Ich pfeife auf den Feierabend, meine Freundin wird mir einen langen Vortrag über die Work-Life-Balance halten. Und dennoch werde ich mir die Leiche gleich zur Brust nehmen. Und schwuppdiwupp haben Sie morgen schon die ersten Ergebnisse.«
Hinrich drehte den Toten über den Bauch auf die linke Seite. Alle drei Augenpaare richteten sich auf die rechte Gesäßhälfte. Dort war ein Tattoo zu erkennen, etwa von der Größe eines Zwei-Euro-Stückes. Es zeigte ein japanisches oder chinesisches Schriftzeichen.
Margot sah zu Horndeich: »Die Frau von Emil Sacher hat nichts von einer Tätowierung gesagt.« Sie nahm ihre kleine Digitalkamera und lichtete das Tattoo ab.
»Ja. Keine Narben, keine Tattoos, keine Piercings, da war sie sich sicher gewesen.«
»Also doch nicht Emil Sacher? Wer denn dann?«
Die drei traten aus dem Zelt. In diesem Moment fuhr ein Leichenwagen von der Einfahrt unweit des Eingangs in Richtung Liegewiese heran. Als ob die Situation nicht eh schon grotesk genug gewirkt hätte, schien der Wagen der Bestatter deutlich älter zu sein als das Opfer. Ein Mercedes Kombi – die Flossenvariante 220B, der gleiche Wagen, den auch Horndeich fuhr. Nur war seiner rot und nicht schwarz. Und seiner hatte keine Milchglasscheiben am Heck.
Die Bestatter zogen sich ebenfalls Schutzkleidung an, dann rollten sie eine Trage über das Brückchen von der Liegewiese auf die Woogsinsel.
»Fahrt ihr jetzt in retro?«, konnte sich Horndeich nicht zu fragen verkneifen.
Einer der Bestatter grinste verhalten. »Normalerweise nicht. Aber alle anderen Wagen sind unterwegs.« Er schaute in den Himmel, wo sich erste Wolken zeigten. »Liegt wohl an der schwülen Hitze. Zum Glück hat der Chef das gute Stück restaurieren lassen«, meinte er. Dann verschwand er mit dem Kollegen im Zelt.
Horndeichs Blick wanderte über die Karosse. Perfekt restauriert, so sah es auf den ersten Blick aus. Dann schaute auch er nach oben. Würde heute wohl tatsächlich noch ein Gewitter geben.
Wenig später rollte die Trage mit gefüllter Bergungshülle wieder in Richtung des Leichenwagens.
»Kommen Sie mit nach Frankfurt?«, fragte Hinrich Horndeich.
Der zuckte mit den Schultern. Der Tag konnte kaum mehr schlimmer werden. »Aber ich darf mich vorher noch umziehen, ja?«
Margot war dankbar, dass Horndeich den Job übernommen hatte, Hinrich in Richtung Sektionstisch zu begleiten. Am Abend oder aber spätestens morgen würde Hinrich Näheres zum Tod des Mannes sagen können. Sie beschloss, schon etwas Vorarbeit zu leisten. Vielleicht konnte sie den Mann identifizieren. Sie würde es jedenfalls versuchen.
Sie fuhr auf den Parkplatz am Präsidium, stellte ihren Mini Clubman ab und war drei Minuten später im Büro, das sie sich mit Horndeich teilte.
Sie sah aus dem Fenster. Von Westen her zog eine dicke schwarze Wolkenfront heran. Welch grandiose Metapher, dachte Margot und wandte sich ab. Denn ihr Noch-Ehemann Rainer saß gerade in einem Flugzeug, das ihn aus den USA und damit aus ebendiesem Westen nach Deutschland brachte. Das wusste sie nicht von ihm, sondern von ihrem Vater. Es war Rainers erster Besuch auf dieser Seite des Atlantiks seit über einem Jahr. Und er kam nicht allein. Hoffentlich wurde er in seinem Flieger gut durchgeschüttelt.
Obwohl die Temperatur im Büro der jenseits der Fenster in nichts nachstand, war Margot nach einem Kaffee zumute. Sie ging zum Kaffeeautomaten, stellte ihre Tasse unter die Düse und drückte auf die Kaffee-Taste. Die Maschine heizte auf, und wenig später konnte sie den Zucker in das Getränk geben. Einen Löffel. Gegen die Bitterkeit, wie sie immer zu sagen pflegte. Nur dass es vor einem knappen Jahr nur ein halber Löffel Zucker gewesen war. Die Bitterkeit in ihrem Leben war gestiegen. Sie hätte in letzter Zeit wahrscheinlich drei Löffel pro Tasse gerechtfertigt. Im Moment war das das geringste Problem. Es hatte Zeiten gegeben, da hatte sie ein paar Kilo mehr auf den Hüften gehabt, doch auf dem Berg von negativen Gedanken waren im vergangenen Jahr zahlreiche dieser Kilos dahingeschmolzen.
Sie fuhr ihren Rechner hoch und loggte sich ins System ein.
Männlich, zwischen dreißig und fünfzig – da wurden ja sicher nicht so viele vermisst. Auch wenn Hinrich den Todeszeitpunkt noch nicht genannt hatte, ging Margot davon aus, dass der Mann noch nicht länger als eine Woche tot war. Wahrscheinlich eher kürzer. Denn für eine Wasserleiche hatte er noch ganz manierlich ausgesehen.
Margot blätterte durch die Vermisstenmeldungen der vergangenen Woche. In Darmstadt war seit Emil Sacher, der nun bereits zwanzig Tage lang verschwunden war, niemand vermisst worden. Sie weitete die Suche auf den Landkreis, dann auf Südhessen aus. In Bensheim wurde eine Prostituierte vermisst, aber da war nicht klar, ob sie nicht einfach ihren Wohnort aufgegeben hatte. Es gab weiter keine verwertbaren Hinweise.
Margot weitete die Suche auf ganz Hessen aus. Auch kein Treffer. Dann nahm sie sich die ganze Republik vor. Aber ein Mann dieses Alters, zwischen 175 und 185 Zentimetern groß, schlank, mit blauen Augen, wurde nirgends vermisst. Seltsam. Sie weitete die Suche auf den Zeitraum der letzten vier Wochen aus. Ebenfalls Fehlanzeige.
Der Himmel war nun pechschwarz. Margot hatte das kaum registriert und unbewusst die Schreibtischlampe angeschaltet.
Blitz und Donner kamen im selben Moment. Der Donner klang, als ob die Bundeswehr neben dem Gebäude Artillerieübungen veranstaltete. Margot zuckte zusammen. Opfer wurde die Maus, die Margot dabei vom Tisch geschleudert hatte.
Mit dem Donner setzte auch der Platzregen ein.
Margot hob die Maus vom Boden auf. Sie trat ans Fenster und beobachtete den Weltuntergang. Die passende Kulisse zum Untergang ihrer Ehe. Rainer arbeitete seit fast eineinhalb Jahren in den USA, an der Uni in Evansville. Dort hatte er einen Forschungsauftrag bekommen – und aus den zunächst wenigen Wochen waren Monate geworden. Margot hatte von Anfang an nicht den Eindruck gehabt, dass Rainer überhaupt zurückkommen wollte. Vor einem Dreivierteljahr, im Oktober, da hatte sie schließlich all seine Sachen aus ihrem Haus in ein Lager schaffen lassen. Da lagerten sie immer noch.
Und jetzt flog er hierher. Mit Rhonda. Die war seine Assistentin, viel jünger. Und inzwischen von der Assistentin zu honey befördert worden. Rainer war Weihnachten noch nicht mit ihr zusammen gewesen – hatte er zumindest versichert. Margot hatte das sogar geglaubt. Denn Rhondas wichtigste Eigenschaft war wohl die, dass sie immer und automatisch in Rainers Nähe war und er sich nicht besonders um sie bemühen musste. So sah das wenigstens Margot. Dass Rhonda nun mit Rainer im Flieger saß – auch das wusste Margot nur von ihrem Vater, bei dem er sich zuvor gemeldet hatte. Feigling.
Ihr Vater, Sebastian Rossberg, und seine Lebensgefährtin Chloe waren seit vier Wochen in Darmstadt. Auch ihr Dad hatte mehr als ein Jahr in den USA verbracht, nachdem er dort seine Jugendliebe wiedergetroffen hatte. Nun wollte er der Frau seines Lebens seine Heimat zeigen, die die Amerikanerin noch nie gesehen hatte. Daher hatte Margot die beiden auch kaum zu Gesicht bekommen.
Der nächste Donner war leiser, das Gewitter zog weiter, aber das Geräusch riss Margot aus ihren Gedanken. Sie setzte sich wieder an den Schreibtisch. Die Maus funktionierte noch. Wenigstens das. Obwohl Emil Sachers Frau ausgesagt hatte, ihr Mann habe kein Tattoo, rief sie nun noch mal die Akte »Sacher« auf. Sacher war Hochschullehrer, Diplomingenieur. Und er war mitten im Semester verschwunden. Das war drei Wochen her, und so lange war der Mann im Woog definitiv nicht tot.
Sie betrachtete die drei Fotos, die seine Ehefrau der Polizei überlassen hatte. Ein gut aussehender Einundvierzigjähriger ohne Bart. Hatte er Ähnlichkeit mit der Woogsleiche? Margot übertrug die Bilder, die sie mit ihrer kleinen Taschenkamera gemacht hatte, auf den Rechner. Betrachtete sie. Die Haarfarbe stimmte überein: tiefes Schwarz. Sowohl der Tote als auch Emil Sacher hatten leichte Geheimratsecken. Auch die Augenpartie war ähnlich. Margot ging davon aus, dass der Mann Emil Sacher war. Vielleicht war er erst nach seinem Verschwinden tätowiert worden?
Margot und Horndeich hatten Emil Sachers Kollegen an der Uni befragt, hatten mit seinem Sohn gesprochen und mehrmals mit seiner Frau. Er hatte nichts mitgenommen. Er war am Mittwoch vor drei Wochen nach der Vorlesung vom Institut in der Petersenstraße in Richtung Parkdeck gegangen, auf dem sein Wagen stand. Der hatte nach seinem Verschwinden immer noch dort gestanden. Die Handy-Ortung hatte ergeben, dass das Handy, wenige Minuten nachdem er das Parkdeck betreten haben musste, abgeschaltet worden war. Weder seine EC- noch seine Kreditkarte waren in den Tagen danach benutzt worden – und er selbst blieb wie vom Erdboden verschwunden.
Sie hatten die Gesprächsdaten des Handys überprüft, aber auch da war nichts Auffälliges zu finden gewesen. Er war am Tag vor seinem Verschwinden von einer Nummer angerufen worden, die die Kollegen nicht hatten zuordnen können. Es war eine anonyme Prepaidkarte gewesen. Das war das einzig Auffällige, was sie überhaupt hatten finden können. Wenn man das auffällig nennen konnte. Margot blätterte weiter durch die Unterlagen und sah, dass Emil Sachers Frau Angelika ihnen auch die Adresse des Zahnarztes ihres Mannes hinterlassen hatte.
Sie griff zum Telefon. Dann wählte sie die Nummer des Doktors.
Horndeich hatte es seiner Chefin nicht ausreden können. »Ja, heute Abend noch«, hatte sie auf sein ungläubiges Nachfragen wiederholt. Also war er vom Zentrum der Rechtsmedizin in Frankfurt nochmals zum Präsidium gefahren, um von dort aus mit Margot weiter in den Diltheyweg zu fahren. Dort wohnte die Familie Sacher in einem kleinen Reihenhäuschen gegenüber dem Alten Friedhof. Die Familie bestand jetzt nur noch aus Emil Sachers Frau Angelika und dem siebzehnjährigen Filius, Bruno Sacher. Denn die Identifikation des Toten als Emil Sacher war dank Margots Kontakt mit dem Zahnarzt inzwischen eindeutig. Der hatte den Zahnstatus an Hinrichs E-Mail-Adresse gemailt. Bingo. Vier Tage vor seinem Verschwinden hatte ihm der Zahnarzt drei Backenzähne für Kronen vorbereitet und abgeschliffen. Zusammen mit einem Implantat und drei charakteristischen Gold-Inlays bestand damit kein Zweifel mehr daran, dass der Tote Emil Sacher war.
»Also, noch mal in Kurzform, was hat Hinrich herausgefunden?«, erbat Margot einen Bericht.
Horndeich zog sein kleines Notizbuch aus der Innentasche. Eine kurze Zeit lang hatte er versucht, sein Handy als Notizbewahrer zu nutzen. Aber die Daddelei auf der virtuellen Tastatur hatte mehr Vertipper als brauchbare Informationen hervorgebracht. War nett, wenn man das später alles problemlos auf den Rechner beamen konnte – doch Buchstabenmüll blieb eben einfach Buchstabenmüll.
Er öffnete das Notizbuch. »Also, Emil Sacher ist ungefähr zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag umgebracht worden. Genauer kann Hinrich das nicht eingrenzen, ohne zu raten. Da Sacher aber kaum freitags oder samstags während des Badebetriebs in den Woog gekippt wurde, ist Freitagnachmittag bis Freitagnacht als Todeszeitpunkt am wahrscheinlichsten.«
»Klingt einleuchtend«, sagte Margot und lenkte den Mini auf die Linksabbiegerspur der Klappacher Straße.
»Er hat einen Schlag auf den Kopf gekriegt, ziemlich heftig, wahrscheinlich war er danach bewusstlos. Der Schädel hat einen feinen Riss bekommen. War ein stumpfer Gegenstand. Der hat aber keine Partikel hinterlassen, zumindest keine, die auf den ersten Blick auffallen. Hinrich schaut sich das alles noch mal durchs Mikroskop an. Gestorben ist Sacher aber tatsächlich durch Ertrinken.«
Margot fuhr die Nieder-Ramstädter hinunter – deutlich schneller als mit den erlaubten fünfzig Stundenkilometern. »Der Mörder schlägt ihm auf den Kopf, zieht ihn aus, fesselt ihn, fährt ihn an den Woog, schleift ihn irgendwo ins Wasser, versenkt ihn? Da muss schon richtig viel Hass dahinterstehen.«
»Ja, sieht nicht so aus, als ob es im Affekt aus Leidenschaft passiert ist«, meinte Horndeich. »Aber eine Frage bleibt dennoch offen: Wo war Sacher die sechzehn Tage zwischen seinem Verschwinden und seiner Ermordung?«
»Und wieso hat uns seine Frau nichts von dem Tattoo gesagt?«
»Richtig. Auch dazu hat Hinrich sich geäußert: Er sagte, dass die Tätowierung nicht frisch gewesen ist, also völlig ausgeheilt – daher mindestens sechs Wochen alt oder eben älter.«
Margot bog in den Herdweg ab, zog dann nach links in den Diltheyweg, als ob sie eine Rallye gewinnen wollte.
»Hui, flott, flott«, versuchte Horndeich seinem Unmut humoristisch Luft zu machen.
»Was zu meckern?«, fragte Margot.
Horndeich arbeitete nun wirklich lange genug mit seiner Kollegin zusammen, um zu wissen, wann er die Diskussion am besten vertagte. »Nein, nein, alles bestens.«
Sie stellten den Wagen vor dem Haus der Sachers ab. Es war ein schmuckes Häuschen. Die beiden Polizisten stiegen aus.
Margot klingelte.
Keine zehn Sekunden später wurde die Tür geöffnet.
Angelika Sacher stand vor ihnen, extrem bleich im Gesicht. Die Frau erkannte Margot auf den ersten Blick wieder. »Er ist es, nicht wahr?«, sagte sie noch vor einer Begrüßung.
Horndeich wunderte sich zwar, wie die Frau so schnell von der Leiche im Woog erfahren hatte, aber es bestand kein Zweifel daran, dass sie von genau dieser Leiche sprach. Frau Sacher wirkte noch zerbrechlicher, als er sie in Erinnerung gehabt hatte. Angelika Sacher war kaum einen Meter sechzig groß. Sie trug ein leichtes Sommerkleid in erdfarbenen Tönen. Das schulterlange Haar hatte sie zu einem einfachen Pferdeschwanz gebunden. Ihr Gesicht war kaum geschminkt.
»Hesgart, Kripo Darmstadt, und mein Kollege Horndeich«, sagte Margot.
»Ich weiß doch, ich erinnere mich.«
»Frau Sacher, dürfen wir hereinkommen?«, fragte Margot.
Die Angesprochene trat zur Seite. Von einem schmalen Flur ging es nach links in den Wohn- und Essbereich.
»Bitte«, sagte Angelika Sacher und deutete auf eine großzügige Sitzgarnitur. Das Wohnzimmer war schlicht, aber stilvoll eingerichtet. Ein Bücher- und ein CD-Regal, ein Fernseher, eine Musikanlage und Lautsprecherboxen – alles war in Weiß gehalten.
Margot setzte sich, Horndeich tat es ihr nach. Dann hörte er Schritte – jemand kam die Treppe herunter. Sekunden später betrat Bruno Sacher den Raum. Er trug eine etwas antiquiert anmutende Popperfrisur, ein türkisfarbenes Hemd, Röhrenjeans und Cowboystiefel, offenbar aus Schlangenleder. Im besten Fall würde der junge Mann seinen individuellen Stil irgendwann noch finden. Im schlimmsten hatte er genau das schon getan.
Er sah seine Mutter an. »Die Polizei?«
»Hauptkommissar Horndeich, Kripo Darmstadt, meine Kollegin Hauptkommissarin Hesgart«, stellte diesmal Horndeich vor.
»Warum sind die da?«, fragte der Sohn die Mutter. Und jede Farbe war aus seinem Gesicht gewichen.
Noch jemand, der schon von der Leiche gehört hat, dachte Horndeich.
Margot und Horndeich sahen sich an. Und Horndeich erkannte, dass er heute dran war, die Todesnachricht zu überbringen. Seine Kollegin wirkte etwas derangiert.
»Frau Sacher …« Horndeich zögerte. Wie sollte er den jungen Mann ansprechen? »… Herr Sacher«, er wahrte besser die Form, wenn Bruno Sacher auf ihn auch kaum wie ein »Herr« wirkte. »… wir haben heute Emil Sacher tot aufgefunden.«
Angelika Sacher, die immer noch stand, ließ sich auf einen der Sessel sinken. Ihr Sohn setzte sich neben sie auf die Lehne. »Ich habe es gewusst. Er ist es, die Leiche aus dem Woog, nicht wahr?«
Horndeich nickte. »Ja. Wir konnten den Toten im Woog eindeutig als Emil Sacher identifizieren.«
Bruno Sachers Gesicht hatte wieder etwas an Farbe gewonnen. Er legte den Arm um seine Mutter.
Horndeich konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Geste ein wenig theatralisch wirkte. Weder die Gattin noch der Sohn des Verstorbenen brachen in Tränen aus.
»Können Sie uns schon Näheres sagen? Wer hat ihn umgebracht? Wann? Wie? Ist er ertrunken, weil er gefesselt war?« Frau Sachers Stimme war ganz ruhig, während sie die Fragen abfeuerte wie Pfeile.
»Woher wissen Sie von den Fesseln?«, fragte Margot und sprach damit aus, was Horndeich dachte. Obwohl der bereits einen Verdacht hatte.
Bruno Sacher stand auf und kam wenige Sekunden später mit einem kleinen Laptop zurück. Er stellte das Gerät vor Horndeich und Margot auf den flachen Sofatisch. Der junge Mann setzte sich wieder, und sein rechtes Bein wippte im schnellen Takt eines Stakkato-Punk-Liedes, das nur er selbst hören konnte.
Der Bildschirm zeigte die Internetpräsenz einer bundesweit erscheinenden Tageszeitung, deren vier weiße Buchstaben auf rotem Grund wohl jedem Deutschen bekannt waren. Die Seite zeigte die Nachrichten der Region Frankfurt. Und Horndeich wusste sofort, wo der Fotograf gestanden haben musste, als er mit einem Tele die Leiche im Wasser treibend abgelichtet hatte. Der Fotograf war sicher der Kerl auf dem Baum gewesen. Ein bisschen Retusche hier, ein wenig Unschärfe dort – sie hatten das Bild des Toten »aufmacherfreundlich« hergerichtet, eklig genug, um die Kunden anzuziehen, gerade dezent genug, um sie nicht abzustoßen. Der Fokus lag auf der Fesselung.
Den Redakteuren war diesmal offenbar auf die Schnelle keine brillante Überschrift eingefallen. »Wer macht so was?«, titelte die Überschrift. »Mafia-Mord in Darmstadt?« war die Unterzeile.
Horndeich nickte nur. Die Details hatte er der Familie eigentlich ersparen wollen. Keine Chance.
»Ja, das ist Ihr Mann«, sagte Horndeich und sah Angelika Sacher an.
»Ich habe es gewusst«, hauchte sie nur.
Immer noch keine Tränen. Weder beim Sohn noch bei der Ehefrau. Beide schwiegen.
»Haben Sie keine Vorstellung, wer Ihrem Mann, Ihrem Vater das angetan haben könnte?«, schaltete sich Margot wieder ein.
Beide schüttelten den Kopf, sahen sich an, schüttelten wieder den Kopf.
»Hat er leiden müssen?«
»Ja«, sagte Margot im selben Moment, in dem Horndeich »Nein« sagte.
Horndeich übernahm. »Nein. Ich komme gerade von der Gerichtsmedizin. Er war bereits tot, als er …« Horndeich wusste nicht, wie er fortfahren sollte.
»… im Woog versenkt wurde«, beendete Bruno Sacher den Satz.
Horndeich nickte nur. Er sah nicht ein, weshalb er der Familie noch mehr Leid zufügen sollte. Zumal die beiden nicht aus dem Kreis der Verdächtigen ausgeschlossen waren. Zumindest noch nicht. Nur Margot, er und Hinrich wussten, dass Emil Sacher ertrunken war. Das waren genug Menschen.
»Wann ist er gestorben?«, fragte Angelika Sacher.
»Wahrscheinlich vergangenen Freitag«, antwortete Horndeich.
»Wir müssen Sie das fragen, und deshalb frage ich Sie gleich«, meinte Margot: »Wo waren Sie am vergangenen Freitagabend?«
Mutter und Sohn sahen sich abermals kurz an, dann sagte Bruno Sacher: »Freitag? Da haben wir doch die Herr der Ringe-Nacht gemacht. Das war doch Freitag?«
Ein kurzes Lächeln huschte über das Gesicht der Frau. »Ja. Freitag. So um sieben haben wir angefangen, und das ging dann so bis halb zwei, denke ich.«
»Auf DVD. Teil 1 bis 3«, fügte der junge Mann hinzu.
Angelika Sacher nickte.
Bruno Sacher wippte nach wie vor mit dem rechten Bein. Das Lied im Kopf war offenbar noch nicht zu Ende.
»Wann können wir meinen Mann beerdigen?«, fragte Frau Sacher.
»Das entscheidet die Gerichtsmedizin«, entgegnete Margot. »In ein paar Tagen.«
Schweigen senkte sich über den Raum.
»Sie haben wirklich keine Ahnung, wer Ihrem Mann, Ihrem Vater das angetan hat?«, fragte Margot nochmals.
Wieder schüttelten beide den Kopf.
»Gut. Wenn wir noch weitere Fragen haben, werden wir uns bei Ihnen melden.«
Margot stand auf, Horndeich tat es ihr nach.
Angelika Sacher erhob sich ebenfalls, sah die Kommissare an. »Danke, dass Sie noch heute Abend persönlich vorbeigekommen sind.«
Bruno Sacher sagte nichts. Er sah Margot und Horndeich kurz an, nickte, dann verschwand er, und Horndeich hörte wieder Schritte auf der Treppe, diesmal auf dem Weg nach oben.
Angelika Sacher begleitete die Polizisten zur Haustür.
»Frau Sacher – eine Frage hätte ich noch.« Margot griff in die Tasche, holte die kleine Digitalkamera heraus, schaltete sie an und hielt gleich darauf den Monitor in Angelika Sachers Richtung. »Ihr Mann war tätowiert. Auf der rechten Gesäßhälfte.«
Angelika sah Margot direkt an. »Das wusste ich nicht.«
»Das verstehe ich nicht«, meinte Margot.
Die Gesichtsfarbe der Frau veränderte sich nicht, als sie sagte: »Wir haben seit Jahren getrennte Schlafzimmer. Die Basis unserer Ehe ist weniger die Sexualität als die geistige Harmonie. Also – sie war es. Diese Tätowierung ist höchstens vier Jahre alt. Sonst wüsste ich davon.«
Margot nickte nur. »Danke«, sagte sie, dann verabschiedete sie sich. Horndeich tat es ihr nach.
»Keine Träne«, sagte Margot. »Sie ist eiskalt.«
»Jeder trauert anders«, erwiderte Horndeich. Aber irgendetwas an dieser Szenerie hatte ganz und gar nicht gestimmt.
DONNERSTAG, 21. JUNI
Das ist alles so verdammt keimfrei. Es passt nicht. Es passt einfach nicht.« Margot war wütend. Sie hatte die erste Stunde im Präsidium damit verbracht, die Akte über den seinerzeit als vermisst gemeldeten Emil Sacher zu lesen. Sie war die Aussagen der Ehefrau durchgegangen, die Aussagen der Uni-Angestellten, die Aussagen, die die Kollegen aus München von Sachers Kompagnon Sven Taggt aufgenommen hatten. Mit dem hatte Sacher eine gemeinsame Motorrad-Tuning-Firma betrieben. »Emil Sacher muss ein Gott gewesen sein. Keiner hat auch nur ein einziges negatives Wort über ihn gesagt.«
Horndeich stellte ihr eine Tasse Kaffee hin. Den Löffel Zucker hatte er bereits hineingetan. »Als diese Menschen befragt wurden, da war Emil Sacher ja auch nur vermisst. Ich meine – stell dir mal vor, er kommt aus seinem Spontanurlaub aus Italien wieder und erfährt, dass sein Geschäftspartner über seine krummen Geschäfte geplaudert hat, der Arbeitskollege über die Geliebte und die Frau über seine Vorliebe für Sadomaso. Ich kann die Leute verstehen.«
Margot rollte mit dem Bürostuhl ein wenig zurück. »Du hast ja recht. Nur für uns bedeutet das, dass wir bei Punkt null anfangen müssen.«
»Jepp. So ist das halt.«
»Und außerdem hasse ich Heiligenscheine.«
»Wir sollten nachher noch mal in die Uni gehen und Sachers Kollegen auf den Zahn fühlen.«
Margot nickte. Am Fachbereich Fahrzeugtechnik war der Institutsleiter seit Monaten erkrankt – und Sacher hatte die Leitung kommissarisch übernommen. Das, obwohl sein Kollege Gerhard Weller bereits fünf Jahre länger am Institut arbeitete. Aber angeblich waren sie dennoch dickste Kumpel, wollte man der Aussage Wellers von vor gut zwei Wochen Glauben schenken.
Es klopfte zaghaft an der Tür.
»Herein«, sagte Horndeich, und sein Blick fiel auf die Gestalt, die im Türrahmen stand. Margot wollte auch dorthin schauen, aber sie konnte den Blick nicht gleich von Horndeich abwenden. Cartoon-Figuren bekamen in solchen Situationen immer Stielaugen. Dann sah sie zum Türrahmen. Okay. Alles klar. Die Frau war wohl Mitte zwanzig und bildhübsch. Margot erkannte auf den ersten Blick, dass sie kaum geschminkt und ihre Ausstrahlung daher authentisch war. Da es bereits jetzt, um zehn Uhr, fast dreißig Grad im Schatten hatte, war die Dame entsprechend luftig gekleidet. Das rote Kleid saß perfekt, die Sandaletten ebenfalls – und der dezente Schmuck fügte sich zusätzlich perfekt ins Bild. Seit Kurzem hörte Margot gern die Lieder der deutschen Sängerin Ina Müller – auch wenn die tollen Texte nicht von ihr, sondern von dem begnadeten Frank Ramond stammten. Der hatte für Ina unter anderem den Refrain gedichtet: Ich hab lieber Orangenhaut als gar kein Profil. Bis eben hatte Margot diese Zeile so gemocht, dabei an Rainers Rhonda gedacht und Ina und Frank vorbehaltlos zugestimmt. Und nun wusste sie, dass jedes Profil gegen diese Schönheit verblassen würde.
»Bin ich hier richtig bei Frau Hesgart und Herrn Horndeich?« Die Venus sah beide an. Und hatte auch noch so eine verdammt engelhafte Stimme. Ekelhaft. »Die Dame von der Pforte hat mich zu Ihnen geschickt.«
»Ja«, entgegnete Margot. »Was können wir für Sie tun?«
»Ich komme wegen Emil Sacher. Dem Toten. Dem aus dem See.«
Horndeich sah wieder zu Margot. Okay, so viel Professionalität war dann doch noch übrig. Dann schaute er wieder auf den strahlenden Morgenstern: »Woher wissen Sie, dass er tot ist? Das haben wir noch nicht an die Presse gegeben.«
»Setzen Sie sich doch«, sagte Margot.
Horndeich schob der jungen Frau einen Stuhl vom Rand des Büros heran. Dann setzte er sich wieder hinter seinen Schreibtisch.
Die Dame ließ sich auf dem Stuhl nieder, und ihr Blick wanderte zwischen Margot und Horndeich hin und her, bis er schließlich auf Margots Gesicht verweilte. Wenigstens das. »Er ist tot, nicht wahr?«
»Darf ich Sie nach Ihrem Namen fragen – und danach, in welchem Verhältnis Sie zu Herrn Sacher stehen?«
»Ich heiße Marlene Ritter. Ich studiere in Frankfurt an der Fachhochschule Maschinenbau. Dort habe ich Emil – also Herrn Dr. Sacher – kennengelernt. Er ist ein Freund von mir.«
»Wie kommen Sie darauf, dass er der Tote aus dem See sein könnte?«, wollte Margot von der jungen Frau wissen.
»Die Bilder im Netz.«
»Nun, auf dem Bild auf der Webseite dieser Boulevardzeitung konnte man nicht viel erkennen.«
»Nein, da nicht. Aber es gibt ja noch andere Bilder im Netz.« Marlene Ritter zog ihr Handy aus der kleinen Handtasche und fuhr mit den Fingern ein paarmal über den Bildschirm. Dann zeigte sie es Margot.
Drei Fotos, alle aufgenommen, als der Tote noch im Wasser trieb. Einmal das Gesicht des Toten. Dann die Fesselung, als das Boot der Bereitschaftspolizei den Körper in Richtung Ufer bugsierte, ganz deutlich und gestochen scharf. Und dann ein Bild des Tattoos, als sich die Leiche auf dem Weg zum Ufer gedreht hatte. Die Zurückhaltung von Informationen war im Zeitalter des Internets ein klein wenig schwieriger geworden, dachte Margot.
»Wie lange kannten Sie Emil Sacher?« Mit der Wahl der Tempusform des Verbs gab Margot nun zu, dass der Tote Emil Sacher war.
Das registrierte auch Marlene Ritter. Ihr Blick wanderte nochmals kurz zu Horndeich, dann sah sie wieder Margot an. »Knapp drei Jahre.«
Margot sagte nichts. Sollte die junge Frau erzählen.
Die fuhr auch sogleich fort. »Ich war im ersten Semester, als Emil einen Vortrag über Fahrdynamik von Zweirädern gehalten hat. War an die fortgeschrittenen Semester gerichtet, aber da ich mich schon immer für Motorräder interessiert habe, ging ich hin. Saß zufällig ganz vorn. Und Emil hat mich dort gesehen. Nach der Vorlesung bin ich zu ihm hin – und wir sind zusammen essen gegangen.«
»Nur das?«
Marlene Ritter ging gar nicht auf Margots Gegenfrage ein: »Wissen Sie, wer das getan hat?«
»Nein, daran arbeiten wir.«
»Und ich bin sicher, Sie haben kaum eine Spur.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Weil alle Ihnen erzählt haben, wie perfekt Emil war. Wie zuckersüß sein Leben war, sodass sich niemand erklären kann, wer ihm Böses wollte.«
»Aber Sie wissen das?«
»Ja. Ich kenne ihn. Ich kannte ihn. Vielleicht besser als irgendjemand anderes.«
»Also hatten Sie ein Verhältnis?«
»Ja. Aber ein besonderes.«
Horndeich schaltete sich ein: »Sie haben ihn über zwei Jahre lang gebeten, sich scheiden zu lassen, er hat immer gesagt, er würde seine Frau verlassen, aber er hat es nie getan – und da sind bei Ihnen irgendwann die Sicherungen durchgebrannt.«
Marlene Ritter sah Horndeich an. Sie musterte ihn kalt, und Margot konnte in ihrem Blick vor allem eines erkennen: Verachtung.
»Herr Horndeich, Sie können versichert sein, dass ich viel wollte, aber ganz sicher nicht mit seiner Frau tauschen. Die Ebene, auf der Emil und ich miteinander umgegangen sind, war eine andere.«
»Welche?«, wollte Margot wissen.
»Eine rein sexuelle.«
Warum war Margot nicht überrascht? Das erklärte auch, dass die Dame das Tattoo erkannt hatte.
»Wir haben – nun, sagen wir, gewisse Neigungen geteilt. Und ausgelebt. Das war es, was uns verbunden hat, und nur das. Ansonsten hat jeder von uns sein eigenes Leben gelebt.«
»Wie oft haben Sie sich getroffen? Und wo?«
»Das war unterschiedlich. Emil war viel unterwegs, hielt guten Kontakt zu anderen Universitäten, war immer wieder in München, wo er ja noch die Firma hatte. Er hat mich oft mitgenommen – oder mir einfach das Ticket bezahlt, und wir haben uns dann in der Stadt getroffen, in der er gerade war.«
»Und wie oft war das der Fall?«
»Einmal im Monat, zweimal, je nachdem.«
»Sie meinten eben, Sie wüssten, wer Emil Sachers Feinde waren.«
»So würde ich es nicht formulieren. Aber er hat mir viel erzählt.«
»… während Sie Ihre Neigungen ausgelebt haben?«
Wieder sandte Frau Ritter Horndeich einen vernichtenden Blick. »Nein. Wir haben auch miteinander geredet. Und dadurch, dass ich außerhalb unserer Treffen nicht in sein Leben involviert war, hat er mir viel erzählt.«
»Was zum Beispiel?«
»Zum Beispiel sagte er, dass seine Frau ein Alkoholproblem hat. Dass er sich kaum traut, sie zu irgendeinem offiziellen Anlass mitzunehmen – wobei das in seinen Kreisen oft wichtig sein kann. Aus beruflichen Gründen. Um weiterzukommen.«
»Frau Sacher ist Alkoholikerin?«
»Wenn mir Emil keinen Mist erzählt hat – und er hat keinen Grund dazu gehabt, ja, dann ist sie das wohl.«
»Was hat er Ihnen über seine Kollegen und Mitarbeiter erzählt?« Einerlei, ob diese Zeugin Margot sympathisch war oder nicht – auf jeden Fall erweiterte sie ihre Perspektive auf den toten Emil Sacher.
»Meinen Sie Weller, der ihn am liebsten aus der Uni gefegt hätte, weil Sacher die kommissarische Leitung bekommen hat? Oder meinen Sie Sven Taggt, seinen Teilhaber an der Firma in München, der davon überzeugt ist, dass ihm mindestens zwei Drittel von den Gewinnen zustehen würden?«
Marlene Ritter sah Horndeichs Lächeln nicht, da sie nach wie vor nur mit Margot direkt sprach. Aber Margot konnte dieses Lächeln verstehen. Die Dame in Rot war keine zehn Minuten im Raum – und schon hatten sie drei Ansatzpunkte, mit denen sie weiterarbeiten konnten.
»Und der Sohn war auch nicht gerade begeistert, als Emil ihm den Geldhahn zugedreht hat. Nachdem der junge Mann bereits dreimal unangenehm bei Ihren Kollegen aufgefallen ist.«
Punkt Nummer vier. Auch wenn diese schöne junge Frau mit ihrer Arroganz nicht gerade gut bei Margot ankam – wenn es nach ihr ging, durfte Marlene Ritter den Raum gern noch ein wenig länger mit ihrer Attraktivität erhellen. Wenn sie dabei nur weiter aus dem Nähkästchen plauderte.
»Frau Ritter – können Sie uns etwas über diese Tätowierung sagen?«
Die Angesprochene nickte. Und zum ersten Mal bekam ihr unterkühltes Auftreten leichte Risse. Sie schlug den Blick nieder, und Margot hatte den Eindruck, dass sie kurz mit den Tränen kämpfte.
»Ja, das kann ich. Wir haben sie uns beide am selben Tag stechen lassen.«
»Gemeinsam?« Nun war Margot doch ein wenig irritiert. »Sie haben die gleiche?«
»Ja. An der gleichen Stelle.«
Margot war froh, dass sie mit Rainer seinerzeit nur Ringe getauscht hatte. Die konnte man abstreifen. Zumindest äußerlich.
»Darf ich fragen, wie es dazu kam?«
Frau Ritter sah Margot wieder mit offenem Blick an, mit einer Spur Trotz darin. »Gleich an dem Abend, an dem wir das erste Mal zusammen essen gewesen sind, haben wir gespürt, dass da eine unglaubliche Spannung zwischen uns war. Also sind wir in ein Hotel gegangen. Und haben gleich kapiert, dass wir perfekt zueinanderpassten und einander guttun konnten.«
»Wie meinen Sie das?« Margot war bewusst, dass sie sich jetzt auf schlüpfriges Terrain begab.
»Er mochte die dominante Rolle, ich die devote. Klischees, ich weiß, aber es ist nicht einfach, seine Wünsche auszuleben, wenn man keinen Partner hat, der einen respektiert. Devot heißt ja nicht, dass kein Respekt im Spiel ist.«
Margots Kenntnisse auf diesem Gebiet waren eher theoretischer Natur. Sie hatte die Praxis auch nie vermisst. Wenn man Emil Sachers Leichnam in diesem Licht betrachtete, konnte man die gefesselten Gliedmaßen durchaus auch so deuten, dass hier jemand mit seiner devoten Rolle nicht zufrieden gewesen war und Rache geübt hatte.
Marlene Ritter sprach weiter. »Wir waren meist in Hotels. Vor einem Jahr in Paris saßen wir abends in einer Bar. Waren nicht mehr nüchtern. Aber so – zufrieden. Dann kamen wir an einem Tattoo-Studio vorbei. Es war meine Idee. Ich habe eine Schwäche für japanische Kalligraphie. Und es gibt ein japanisches Zeichen für ›Eros‹ – also das Begehren. Genau das war es, was uns verbunden hat. Also haben wir uns beide dieses Tattoo stechen lassen. Es war – es war wie die Besiegelung eines Paktes.«
Margot nickte zwar, hatte aber eine etwas andere Vorstellung von den Beweggründen. Sie glaubte, dass Horndeich mit seiner »Ich-wollte-dich-deiner-Frau-ausspannen«-Theorie näher an der Wahrheit lag.
Marlene Ritter war noch etwa eine halbe Stunde geblieben und hatte geredet wie ein Wasserfall, bis sie schließlich in Tränen ausgebrochen war und sich nicht mehr beruhigen konnte. Margot hatte einen Arzt gerufen. Der hatte gemeint, Marlene Ritter stehe kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Horndeich hatte eher den Eindruck gehabt, dass sie die Grenze bereits überschritten hatte. Der Arzt hatte ihr vor Ort einen Gnadenhammer gesetzt. Und sie dann ins Krankenhaus fahren lassen.
Daraufhin hatten Margot und er die große Mühle angeworfen: In München sollten Kollegen den Firmenpartner von Sacher befragen, insbesondere nach seinen Begehrlichkeiten bezüglich des Firmengewinns und vor allem nach einem Alibi. Es wäre durchaus auch für einen Münchner möglich gewesen, Sacher dort umzubringen und dann mit der Leiche nach Darmstadt zu fahren. Horndeich hatte sofort die Akte von Sacher junior im System gecheckt. Marlene Ritter hatte recht gehabt: dreimal Diebstahl in den vergangenen Jahren. Nie etwas Großes – dennoch. Er hatte neben ein paar Verwarnungen auch schon diverse Arbeitsstunden abgeleistet. Der Darmstädter Zoo Vivarium war ihm für etwa achtzig Stunden Gehege ausmisten zu Dank verpflichtet.
Wieder klopfte es an der Tür.
Horndeich sah in Richtung Türrahmen. Diesmal keine ansprechende Weiblichkeit, die ihm – das musste er ja nun wirklich zugeben – auf den ersten Blick die Sprache verschlagen hatte. Marlene Ritter war nun wirklich das gewesen, was er unter dem Begriff »attraktive Frau« verstand. Genau bis zu dem Moment, in dem sie den Mund aufgemacht hatte. Sozusagen.
Im Türrahmen stand Kollege Paul Baader, der Kopf des Teams der Spurensicherung. »Hab den vorläufigen Bericht für euch.«
Margot hatte sich gerade wieder einen Kaffee gemacht. Als sie aufstand, war Horndeich einmal mehr aufgefallen, dass sie in den vergangenen Wochen ziemlich abgenommen hatte. Aber er konnte sie kaum darauf ansprechen. Sie wehrte immer sofort ab. Kaffee als Ersatz für Nahrung – selbst mit der inzwischen vierfachen Ration an Zucker war das kaum nahrhaft zu nennen.
»Lass hören«, meinte Horndeichs Kollegin.
Baader setzte sich auf den Stuhl, auf dem zuvor Marlene Ritter gesessen hatte.
»Also: Wir wissen, wo der Bewusstlose in den Woog gelassen wurde.«
»Gut. Wo war das?«, wollte Margot wissen.
Baader legte den DIN-A3-Fotoausdruck des Badesees aus der Vogelperspektive auf den Tisch. Dann zeigte er auf eine Stelle im Südwesten, auf den Fußweg, der parallel zur Heinrich-Fuhr-Straße verlief.
»Hier. Ist keine Überraschung – das ist ziemlich nah bei der Stelle, wo die Leiche aufgetaucht ist. Da ist ein Zaun zum Fußweg hin, der ist nicht beschädigt. Aber vom Zaun bis zum Wasser, da haben wir noch deutliche Schleifspuren gefunden. Hautabrieb – sicher vom Opfer. Ansonsten Fehlanzeige: keine Fasern außer einem Fussel, der offenbar von den Fesselungen stammt – ich habe bereits mit Hinrich gesprochen.«
Horndeich kannte die Stelle gut. Ein paar Jahre zuvor hatte er sich mit einem Verdächtigen eine Verfolgungsjagd geliefert. Der Typ war mit einem Vespa-Dreirad quer durch die Stadt geheizt und genau an derselben Stelle in den Woog gerauscht, wobei er den Zaun durchbrochen hatte. Kurz danach war der Zaun erneuert worden. »Und der Zaun weist keine Spuren auf?«
»Nein. Nichts.«
»Aber jemand muss Sacher ja über den Zaun gehievt haben. Vielleicht sollten wir Arnold Schwarzenegger verhören. Der könnte ihn vielleicht einfach über den Zaun gehoben haben.«
»Klar. Möglich. Aber die Büsche zwischen Zaun und Weg sprechen eine andere Sprache. Da gibt es ganz deutliche Spuren, dass jemand mit einem Wagen neben den Zaun gefahren ist. Ich denke, der Täter hat einen Pritschenwagen gehabt. Vielleicht einen Kipper, mit dem er die Ladefläche zur Seite kippen konnte. Er ist mit dem Teil einfach nah genug an den Zaun herangefahren, hat die seitliche Bordwand aufgeklappt und das Opfer über den Zaun geschoben. Oder die edle Variante: Er kippt die komplette Lade zur Seite, und Sacher purzelt jenseits des Zauns in die Büsche. Dann hat der Täter den Wagen weggefahren, irgendwo in der Nähe abgestellt. Er kam zu Fuß zurück, um den Körper ins Wasser zu zerren. Ich nehme fast an, er hatte einen Plastikanzug an, um Spuren zu vermeiden. Diese Theorie passt zumindest zum Spurenbild. Das Opfer hat wohl zuerst wirklich längs zum Zaun gelegen, bevor es zum Wasser gezerrt wurde.«
»Kann man von den Spuren auf das Auto schließen?«
»Vergiss es. Die beiden Gewitter am Samstag und Sonntag haben die Spurensuche nicht eben einfach gemacht. Wir sind froh, dass wir überhaupt entdeckt haben, dass da ein Wagen gewesen sein muss.«
»Ein Pritschenwagen. Oder sogar ein Kipplaster? Wo bekommt man den so was her? Oder ist unser Mörder ein Bauunternehmer?«
»Da werdet ihr wohl die Verleihfirmen abtelefonieren müssen.«
»Habt ihr noch was rausgefunden?«
»Nein, nicht wirklich. Wir haben einen Pflanzenexperten vom LKA angefordert – der schaut sich die Beschädigungen an den Büschen zwischen Zaun und Ufer und auch die zwischen dem Zaun und dem Fußweg an. Aber ich bin ziemlich sicher, dass auch der sagen wird, dass die Nacht von Freitag auf Samstag als Zeitpunkt ziemlich wahrscheinlich ist.«
»Haben die Taucher noch was gefunden?«
»Nein, rein gar nichts. Also, sie haben die Stelle identifiziert, an der die Leiche eine Weile gelegen hat. Aber ansonsten – nichts. Keine Kleidungsstücke, keine Gegenstände. Abgesehen von den zwei Fahrradtorsos, dem Metallregal und dem Computermonitor. Das waren nur die großen Gegenstände. Ist eine regelrechte Müllhalde dort unten. Aber nichts, was irgendwie mit Emil Sacher in Verbindung steht. Das Zeug liegt dort schon deutlich länger.«
»Dann sehen wir jetzt schon ein bisschen klarer«, sagte Margot.
Sie sah auf die Uhr. »In einer knappen Stunde kommt Angelika Sacher. Ich denke, sie ist uns ein paar Antworten schuldig.«
Die Uni in Darmstadt war über viele Standorte in der ganzen Stadt verteilt. Horndeich hatte sich extra einen Plan der Institute an der Lichtwiese im Südosten der Stadt ausgedruckt.Wenig hilfreich war, dass fast alle die Adresse »Petersenstraße« hatten. Das war die große Zufahrtsstraße, die gleichzeitig am Stichende eine große Schleife von fast einem halben Kilometer Länge aufwies. Dann kamen noch die Stichstraßen hinzu, die von der Straße abgingen und auch alle den gleichen Straßennamen hatten. Ein Albtraum für Paketboten und Kriminalhauptkommissare.
Mit viel Geduld fand er den Eingang des Fachbereichs Fahrzeugtechnik. Und wünschte sich sogleich ein Navi für das Labyrinth im Inneren. Nach dem unnützen Hinauf- und Hinabsteigen von gefühlten zwölf Stockwerken fand er schließlich das Büro von Dr. Gerhard Weller.
Margot war im Büro geblieben und fütterte die Computer mit Berichten, bevor Angelika Sacher ins Präsidium kommen würde. Bis vor wenigen Minuten war Horndeich noch dankbar gewesen, dass er einen Außeneinsatz hatte.
Horndeich klopfte an die Tür.
»Herein«, tönte eine Bassstimme von der anderen Seite.
Horndeich trat ein.
»Dr. Weller?«
Der Mann nickte. »Jepp. Sie sind Kommissar Horndeich?«
»Ja«, sagte er und reichte dem Mann die Hand. Sie verschwand beinahe in der fleischigen Pranke seines Gegenübers. Der hatte einen kräftigen Händedruck. Weller wog sicher hundertdreißig Kilo. Er war groß, trug das spärliche graue Haar zu einem dünnen Zopf gebunden.
»Willkommen im Reich der Fahrzeugtechnik.«
Horndeich wusste nicht so recht, was er darauf antworten sollte.
Weller zeigte auf eine CAD-Konstruktion auf dem Vierzig-Zoll-Monitor. »Unsere neueste Entwicklung«, sagte er. Horndeich hatte keinen blassen Schimmer, was die kryptische Zeichnung darstellte. Er nickte anerkennend. Damit war Weller offenbar schon zufrieden.
»Ihre Kollegen haben mich schon befragt, vor zwei Wochen. Ich hab auch heute keine Ahnung, wohin sich der Kollege Sacher verdrückt hat.«
»Herr Weller, wir ermitteln nicht mehr in einem Vermisstenfall. Emil Sacher ist tot. Er wurde umgebracht. Deshalb müssen wir uns jetzt mit jedem aus seinem Umfeld nochmals unterhalten.«
Weller war sichtlich geschockt. Und sprachlos. Also redete Horndeich einfach weiter. »Sie haben meinem Kollegen gegenüber ausgesagt, Sie hätten sich mit dem Opfer gut verstanden. Und Sie könnten sich sein Verschwinden nicht erklären. Gilt das heute auch noch? Oder fällt Ihnen vielleicht doch noch etwas ein, was uns weiterhelfen könnte?«
»Wann wurde er denn umgebracht?«, fragte Weller.
»Nun, das bringt mich gleich zur nächsten Frage: Wo waren Sie Freitagabend und in der Nacht von Freitag auf Samstag?«
Weller musste nicht einmal überlegen. »Da war ich in Kassel. Habe einen Freund besucht. Bin Freitag dorthin – und Sonntag war ich wieder hier.«
»Können Sie uns den Namen Ihres Freundes geben?« Täuschte sich Horndeich, oder zögerte Weller tatsächlich, bevor er zu einem Zettel griff und eine Adresse aufschrieb?
Horndeich nahm den Zettel entgegen – dann griff er zum Handy. »Margot – kannst du bitte das Alibi von Gerhard Weller überprüfen? Er sagt, er war bei diesem Mann in Kassel.« Horndeich gab den Namen und die Telefonnummer durch.
Er nahm zwar keine Schweißtropfen auf der Stirn des korpulenten Mannes wahr – dennoch hatte er den Eindruck, dass er Angst hatte. »Herr Weller, wie war Ihr Verhältnis zu Emil Sacher wirklich?«
Weller zögerte. Dann seufzte er. »Nicht so gut, wie ich vor zwei Wochen gesagt habe. Aber da musste ich ja auch damit rechnen, dass ich ihm noch mal gegenüberstehen würde.«
Womit sich Horndeichs Theorie bestätigt hatte.
Nun, da ein Wiedersehen nicht mehr zu befürchten war, zog Weller vom Leder: »Sacher war ein egozentrisches, überhebliches Arschloch. Er ging über Leichen, um seine Ziele zu erreichen. Ich weiß nicht, wie und wo er geschmiert hat, aber er hat alles erreicht. Dass man ihm die stellvertretende Leitung übertragen hat, zum Beispiel – und, sehen wir es realistisch, wer einmal Prof. Dr. Dr. Jetzlows Position erben wird, ist eh klar. Okay, jetzt natürlich nicht mehr.«
»Also steigen Ihre Chancen?«
»Keine Ahnung. Sicher werde ich mich wieder bewerben – und die Karten werden noch mal neu gemischt. Aber, Herr Horndeich – oder wie spreche ich Sie korrekt an?«
»Passt schon.«
»… also, Herr Horndeich – ich habe seit Jahren hier einen guten Job. Ich verdiene mein Geld mit Dingen, die mir wirklich Spaß machen. Ich habe eine zehnjährige Tochter, für die ich viel Unterhalt zahle, die ich dafür aber oft sehe. Auch wenn Sacher ein Arschloch war – wofür hätte ich ihn umbringen sollen? Für dreihundert oder vierhundert Euro mehr im Monat? Ich werde doch nicht so bescheuert sein, alles aufs Spiel zu setzen, nur weil ein affektierter Affe neben mir Karriere machen will? Da hätte ich an dieser Uni noch ein paar mehr um die Ecke zu bringen.«
»Haben Sie eine Ahnung, wer Sacher möglicherweise ans Leder wollte?«
»Herr Horndeich, ich hatte nur auf beruflicher Ebene mit Sacher zu tun. Ich habe ihn hier im Institut erlebt. Er hat immer ein Auge auf junge Studentinnen geworfen – wenn es in unserem Fachbereich auch nicht allzu viele davon gibt. Ich habe ihn bei offiziellen Anlässen gesehen. Er war bei den Mächtigen beliebt, er sprach ihre Sprache. Keine Ahnung, ob es da unterschwellige Machtkämpfe gegeben hat. Es tut mir leid, ich glaube, ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen.«
»Und bei den Studentinnen?«
»Ich wüsste nicht, dass eine auf seine Avancen eingegangen wäre.«
»Und zum Tag seines Verschwindens – da haben Sie auch nichts Neues zu sagen?«
»Nein. Er ist vor mir gegangen, gegen siebzehn Uhr. Ich hatte hier noch ein paar Berechnungen laufen – die Ergebnisse wollte ich abwarten. Ich hab mich dann so gegen zwanzig Uhr auf den Weg gemacht. Von seinem Verschwinden habe ich nichts mitbekommen.«
Horndeich sah in sein Notizbuch. Er hatte keine weiteren Fragen. »Danke, Herr Dr. Weller«, sagte er und verabschiedete sich. Als er zu seinem Wagen ging, hatte er das Gefühl, dass das Alibi von Weller einer Überprüfung nicht standhalten würde.
Horndeich fuhr zurück zum Präsidium. Doch bevor er zu Margot gehen würde, wollte er noch etwas abklären. Bereits seit dem Vortag hatte er sich so seine Gedanken gemacht. Mal sehen, ob sein Bauchgefühl ihm recht gab.
Angelika Sacher traf pünktlich um fünf Uhr nachmittags im Präsidium ein. Margot holte sie an der Pforte ab. »Es tut mir leid, dass wir Sie nochmals hierherbitten mussten, aber die Untersuchungen laufen auf Hochtouren – und da tauchen auch immer wieder neue Fragen auf.«
Angelika Sacher sagte nichts, sondern folgte Margot in die oberen Stockwerke in Richtung der Vernehmungsräume.
»Kaffee?«, fragte Margot.
Angelika Sacher schüttelte den Kopf. »Nein. Danke.«
Beide Frauen betraten den Gesprächsraum und setzten sich an einen Tisch einander gegenüber. »Frau Sacher, lassen Sie mich gleich zur Sache kommen«, begann Margot.
Die Ehefrau des Verstorbenen nickte nur.
»Zeugen haben ausgesagt, dass Ihre Ehe nicht so glücklich war, wie Sie sie uns zunächst geschildert haben.«
Angelika Sacher sah Margot an, sagte aber nichts.
»Ihr Sohn ist vorbestraft? Wegen Eigentumsdelikten?«
Frau Sacher nickte. »Ja. Aber was hat das mit dem Tod meines Mannes zu tun?«
»Stimmt es, dass das Verhältnis zwischen Ihrem Mann und Ihrem Sohn – angespannt war?«
Angelika Sacher schaute Margot direkt an. »Ja, ihr Verhältnis war nicht gut. Aber was bitte soll das mit der Ermordung von Emil zu tun haben? Mein Sohn hat meinen Mann nicht umgebracht. Ich auch nicht. Außerdem haben wir zum Todeszeitpunkt gemeinsam DVDs geschaut. Was also wollen Sie von mir? Ich habe doch schon alles gesagt.«
»Aber nicht, dass Sie ein Alkoholproblem haben.«
Angelika Sacher sah Margot an, und ihre Gesichtszüge formulierten die Frage, die sie nicht laut stellte: Woher wissen Sie das? Dann sagte sie: »Ja. Das stimmt.«
»Was stimmt? Dass Ihre Ehe nicht gut war? Oder dass Sie Alkoholikerin waren? Oder sind?«
»Ich war keine wirkliche Alkoholikerin, zum Glück nicht, denn dann wäre es mir viel schwerer gefallen, mein Pensum zu reduzieren. Seit einem Jahr trinke ich kaum mehr. Vielleicht mal ein Glas Sekt zum Anstoßen. Ich brauche den Alkohol nicht mehr. Zufrieden?«
»Darum geht es nicht, Frau Sacher. Wir versuchen, den Mörder Ihres Mannes zu finden. Und dafür müssen wir sein Umfeld, sein Leben kennen.«
»Mein Mann war ein Scheusal.« Angelika Sacher flüsterte den Satz. Machte eine Pause. Und fuhr dann noch leiser fort: »Aber ich habe ihn nicht umgebracht.«
»Was meinen Sie mit Scheusal?« Margot hatte ihre eigene Definition davon, aber die tat hier nichts zur Sache. Ihre Definition war in der vergangenen Nacht samt Gspusi über den großen Teich geflogen.
»Mein Mann hatte einen Hang zur Gewalt. Nicht nur, aber auch im Bett. Das habe ich mir leider erst zu spät eingestanden. Ich habe zu spät begriffen, dass sich ein erwachsener Mensch, wenn er seinen Charakter erst einmal entwickelt hat, nicht mehr grundsätzlich ändert. Ich habe gedacht, wenn wir erst verlobt sind, dann ist er sich meiner Liebe sicher. Dann wird er nicht mehr – zuschlagen. Dann dachte ich, es braucht den Ring am Finger, damit sich etwas ändert. Tat es nicht. Die letzte Hoffnung: Ein Kind würde etwas bewirken. Und dann wurde mir klar, dass er sich nicht ändern würde.«
»Haben Sie eine Ahnung, wer einen Grund gehabt hätte, Ihren Mann zu töten?«
»Ja und nein. Sein Kompagnon in München – die beiden hatten immer wieder Streit. Mein Mann war keiner, der einen Konflikt leise beilegte. Bei ihm endete eine Auseinandersetzung erst, wenn er seinen Willen durchgesetzt hatte. Die Reibereien mit Sven Taggt, so heißt der Kollege in München, zogen sich schon seit Jahren hin. Sonst fällt mir dazu nichts ein.«
»Gab es vielleicht noch andere Menschen, zu denen er Kontakt hatte? Außerhalb von der Uni oder von München?«
Margot sah auf ihre Armbanduhr. Es war fast halb sechs. Wo blieb Horndeich? Er hatte doch nur den Uni-Typen befragen wollen.
In diesem Moment klopfte es an die Tür des Vernehmungsraums. Noch bevor Margot »Herein« sagen konnte, ging die Tür bereits auf. Horndeich.
»Sorry, könntest du gerade mal kurz?«
»Entschuldigung, bin gleich wieder da«, sagte Margot und erhob sich. Im Flur meinte sie zu Horndeich: »Erstens: Warum bist du erst jetzt da? Und zweitens: Warum unterbrichst du die Vernehmung?«
»Erstens: weil ich noch etwas überprüft habe. Und zweitens: weil du mir gleich dankbar dafür sein wirst.«
Horndeich führte Margot in ihr Büro. »Setz dich.«
Margot tat, wie ihr geheißen. Horndeich klickte mit der Maus, und auf Margots Monitor kam Bewegung in ein Video. Es zeigte einen Überfall auf eine Tankstelle.
»Und?«, fragte Margot.
Horndeich wartete noch ein paar Sekunden. Dann drückte er den Pause-Button. »Hier«, sagte er und zeigte auf einen der Männer. »Den kennen wir, oder?«
»Wer soll das sein?«
»Hallo? Wohin schaust du eigentlich bei Männern, wenn sie dir gegenübersitzen?«
Margot sagte nichts, und Horndeich zeigte auf die Schuhe des Räubers. »Freitagabend. Tankstelle in Lorsch. 22.45 Uhr. Die machen einen Überfall. Und der Typ da – das ist Bruno Sacher.«
Horndeich klopfte jetzt auf die Stelle, wo man die hellen Stiefel eines der Täter sehen konnte.
»Das soll ein Beweis sein?«
Horndeich grinste. »Das ist nur ein starkes Indiz. Schau, jetzt kommt die lustige Szene.« Einer der drei jungen Männer ging durch den Raum und sprühte Farbe auf die Überwachungskameras. Dabei überging er aber die, von der aus der Film gedreht worden war.
»Zu blöd. Eine Kamera haben sie übersehen. Und jetzt kommt der interessante Teil.«
Die Räuber überfielen den Tankwart hinter dem Tresen, ließen sich das Geld geben. Und bereits im Hinausgehen zog einer der Räuber die Maske vom Gesicht. Jetzt erkannte es auch Margot: Der Mann mit den hellen Stiefeln war Bruno Sacher. Er überfiel mit ein paar Kumpanen eine Tankstelle in Lorsch, während er angeblich mit seiner Mama Herr der Ringe geschaut hatte.