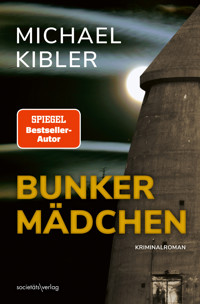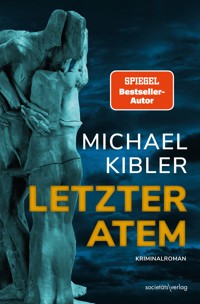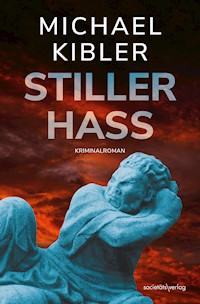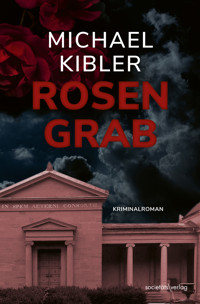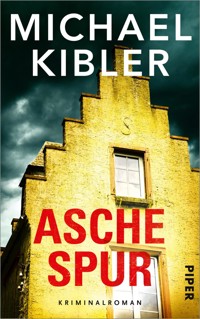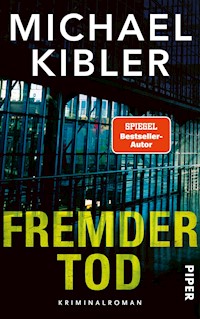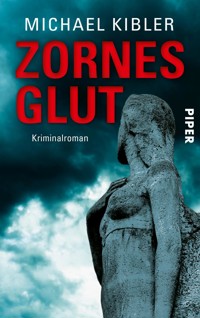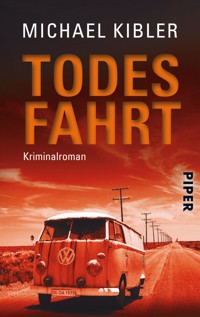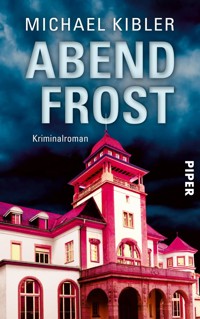5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Spannungsvoll
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wie alles begann: Horndeich ermittelt in seinem ersten Fall in Darmstadt. Für alle LeserInnen von Nele Neuhaus und Wolfgang Burger. »Schon während Margot sich neben den Toten kniete, überfiel sie ein Gefühl, dass dieser Mann noch etwas verbarg und drehte den Kopf in ihre Richtung. Dann wusste sie, was es war. Sie hatte den Augenblick immer gefürchtet, und doch gewusst, dass er eines Tages kommen würde: Sie kannte den Toten.« In Darmstadt gibt es ein Treffen der so genannten »Madonnenkinder«: Kinder, die in den Jahren 1947 bis 1957 aus dem zerbombten Darmstadt zur Erholung nach Davos in die Schweiz geschickt wurden. Das Geld dafür stammte aus »Mietzahlungen« der Stadt Basel für das berühmte Madonnenbild von Hans Holbein, dem Jüngeren. Es könnte ein fröhliches Treffen werden, doch damals ist etwas geschehen, über das man lange nicht geredet hat – und bald schon kommt es zum ersten Mord. Der erste Roman von Michael Kibler ist klug und voll hintergründiger Spannung. Er spielt mitten im Herzen von Darmstadt: Das Heinerfest bildet die Kulisse des Geschehens – Holbeins Madonna lächelt milde dazu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Krimi gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Madonnenkinder« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© dieser Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 2021
© Erstveröffentlichung:
Frankfurter Societäts-Druckerei 2008
Korrektur: Ines Kaplan
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: Hans Holbein d. J.
Madonna des Bürgermeisters Jacob Meyer zum Hasen, 1525/26 und 1528
(Öl auf Nadelholz, 146,5 x 102 cm, Detail)
Sammlung Würth, Inv. 14910
Fotograf: Volker Naumann, Schönaich
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Nachwort
Für Basia und Misiu
Donnerstag
Sie hätte sich nie darauf einlassen sollen. Hauptkommissarin Margot Hesgart schalt sich eine Idiotin. Eine Idiotin, deren Fuß schmerzte, ebenso wie die Schürfwunde am Unterarm. Wieder hatte sie sich zu etwas breitschlagen lassen, was sie eigentlich nicht wollte. Bergsteigen. Idiotische Beschäftigung für eine Frau, die über dreihundertfünfzig Kilometer von den Alpen entfernt lebte und über hundertfünfzig vom nächsten Gebirge, das den Namen auch nur halbwegs verdiente.
Vor drei Wochen hatte sie von Cora, ihrer besten Freundin, einen Gutschein geschenkt bekommen. Probetraining beim Südhessischen Bergsteigerklub in Bensheim. Die trainierten in einer eigenen Halle an der Kletterwand. Und nahmen im Sommer mehrmals besagte dreihundertfünfzig Kilometer in Kauf, um den Alpen per Kletterseil und Karabinerhaken zu trotzen.
Nicht dass Margot den Bergen nicht verbunden gewesen wäre. Sie war begeisterte Bergsteigerin gewesen. War. Bis vor zehn Jahren. Damals hatte es Spaß gemacht, sich mit Gämsen zu messen. Nun, nachdem sie heute einmal abgerutscht war und an die Konsequenzen bei jedem Kuppeln schmerzhaft erinnert wurde, wusste sie, dass dieses Kapitel in ihrem Leben endgültig abgeschlossen war. Sie hatte sich den Donnerstag Nachmittag extra für dieses dumme Training freigenommen. Aber die beiden anderen Trainingsstunden würde sie jemandem schenken, der Freude daran hätte. Vielleicht Ben, ihrem Sohn. Oder Horndeich, ihrem Kollegen.
Sie lenkte ihren BMW 116i von der A5, fuhr die Rheinstraße nach Darmstadt hinein. Vor dem Zentrum der Stadt verschwand der Verkehr in einem Tunnel und wurde unter der Innenstadt hindurchgeführt. Als Margot wieder das Tageslicht erblickte, waren die Wolken endgültig strahlendem Sonnenschein gewichen. Sie wollte über den Cityring fahren, der den Verkehr um das Stadtzentrum herumleitete, doch die Absperrung lenkte sie nach rechts.
Auch das noch, dachte sie. Heinerfest. Jedes Jahr der gleiche Zirkus. Die Darmstädter feierten ihr jährliches Stadtfest mitten auf den Durchgangsstraßen, und der Verkehr kam zum Erliegen. Jetzt leiteten sie die Autos schon nachmittags um, obwohl zu der Zeit noch kaum Heiner – wie die Darmstädter sich selbst meinten nennen zu müssen – über das Fest flanierten. Die Uhr auf dem Armaturenbrett zeigte 17:00 Uhr. Um diese Zeit konnte man dem Personenstrom durchaus noch mit den vorhandenen Ampeln Herr werden.
Margot fluchte, bog nach rechts in die Pädagogstraße und schlich entlang der ausgewiesenen Umleitung. Die führte natürlich am Ende auch übers Festareal, wenn auch nur am Rande. Zur Rechten sah sie die größte transportable Wasserrutschbahn Deutschlands. Oder Europas? Ihr war es gleichgültig, sie konnte ohnehin nicht nachvollziehen, wie jemand dafür Geld ausgab, sich in voller Montur nass spritzen zu lassen. Sie mochte das Fest, aber die ganzen Fahrgeschäfte und Karussells waren ihr ein Gräuel. O.k., für das Riesenrad legte sie noch ein gutes Wort ein. Nachts darin über den Lichtern der Stadt zu schweben … Genau, jetzt noch einen kleinen Anfall von Romantik, dachte sie. Verdirb dir nicht selbst die Laune, Schätzchen.
Fünf Minuten später bog sie in den Richard-Wagner-Weg ein, in dem ihr Haus stand. Gleich würde sie sich den Fuß genauer ansehen. Hoffentlich war die Schwellung zurückgegangen. Fünfzehn Minuten Leid unter Eiswürfeln durften nicht vergeblich gewesen sein. Und sie würde ihren Arm verbinden.
Sie stellte den Wagen vor dem Haus mit der Nummer sechsundfünfzig ab. Einer der unschlagbaren Vorteile des Domizils im Komponistenviertel war das Angebot an freien Parkplätzen. Sie schloss den BMW ab, öffnete das Gartentörchen zum Haus – und blieb abrupt stehen. Erst sah sie ihn. Dann seine Koffer. Wer zur Hölle – »Rainer?« Der Tonfall verriet, dass ihre Freude über den Gast ungefähr so überschwänglich war wie jene beim Anblick eines Gerichtsvollziehers.
»Hallo, Margot, entschuldige, wenn ich hier so aus dem Nichts auftauche. Aber – ich …«
Margot stemmte die Hände in die Hüften. »Wie kommst du dazu …? Wieso mit den Koffern …?« Ohne Bart hatte sie ihn nicht gleich erkannt. Ansonsten waren die vergangenen sieben Jahre jedoch gnädig mit ihm umgegangen. Doch wie um alles in der Welt konnte er es wagen, einfach mit Sack und Pack bei ihr aufzukreuzen? »Hat dich gerade deine Frau vor die Tür gesetzt?«
Sein Lächeln verursachte ihr ein leises Kribbeln, das sie jetzt weder zulassen wollte noch zulassen würde. »Nein, nein, nein, keine Panik. Es handelt sich nur um vier Tage. Dein Vater, er hat gesagt, dass ich vielleicht bei dir übernachten könne. Ich habe kein Zimmer in der Stadt mehr bekommen. Abgesehen von den Suiten im Maritim ist alles dicht. Ich bezahle dir auch gern …«
Es hatte etwas Rührendes, wie er so vor ihrem Haus stand, gleich einem zu gut gekleideten Clochard. Sieben Jahre, Margot, mach dich nicht lächerlich. Du bist Kommissarin. Hauptkommissarin. Du wirst mit ganz anderen Kerlen fertig. »Hast du nicht geklingelt?«
»Doch, aber es hat niemand geöffnet.«
»O. k., dann komm erst mal rein«, kapitulierte sie.
Wenige Minuten später standen sie in der Küche, jeder einen Cappuccino in der Hand. Rainer hatte kurz zusammengefasst, wie es dazu kam, dass er überraschend vor ihrem Haus aufgetaucht war. Als Kunsthistoriker nahm er an einer mehrtägigen Veranstaltung in Darmstadt teil. Die Pension, in der er sich ursprünglich hatte einquartieren wollen, war völlig überbelegt, weil das Personal und der Computer eine Privatfehde austrugen. »Wenn es dir nicht recht ist, finde ich sicher auch in irgendeinem Vorort was, aber dein Vater sagte …«
»Was hast du eigentlich mit meinem Vater zu tun?«
»Er hat die Veranstaltung organisiert, an der ich teilnehme. Dieses Madonnentreffen.«
Margot dachte, sie habe sich verhört. »Was hast du denn auf dem Madonnentreffen verloren?« Irgendwo auf dem steinigen Weg seiner Erklärungen musste sie die falsche Abzweigung genommen haben. Nicht genug, dass er mit dem halben Inhalt seines Kleiderschranks vor ihrer Tür aufgetaucht war, er mischte auch bei Vaters Veranstaltung mit …
»Was ist denn ein Madonnentreffen?« Ihr Sohn Ben trat in die Küche.
»Du bist da? Rainer hat geklingelt …«
Ben wandte sich dem Gast zu, streckte ihm die Hand entgegen. »Ich bin Ben. Margots Sohn.«
»Rainer. Ein alter Freund von Margot.«
»Ich habe ein bisschen unterm Kopfhörer entspannt, sorry. Haben Sie lange draußen warten müssen?«
»Nein. Nur zehn Minuten. Was hört man denn so unterm Kopfhörer?«
»Kennen Sie sicher nicht. Moloko.«
Rainer zog die Augenbraue nach oben. »Die I Am Not a Doctor oder die Things to Make and Do«?
Ben lächelte erstaunt. »Letztere. Gefällt mir am besten.«
»Mir auch«, meinte Rainer. Margots Blick wanderte zwischen den beiden hin und her, als ob sie ein Tennisspiel verfolgte. Satz und Sieg für Rainer. Das war die längste Unterhaltung, die Ben in den vergangenen zehn Jahren von sich aus mit einem ihrer Bekannten geführt hatte. »Und du bleibst nur zu diesem Madonnentreffen?«
Rainer nickte.
»Haben Sie schon ein Hotel? Wir haben unten ein Gästezimmer – also wenn meine Mutter nichts dagegen hat …«
Rainer hatte nicht nur den Satz gewonnen, sondern das ganze verdammte Match. Sie erkannte ihren Sohn nicht wieder. Und hatte über dem Erstaunen den Zeitpunkt für eine taktvolle Absage verpasst. Sie deutete mit dem Kinn in Richtung ihres Sohnes. »Der Herr zeigt dir das Zimmer, und ich mache mich noch frisch. Um sechs wird das Heinerfest offiziell eröffnet, und da muss ich hin.«
»Lust mitzukommen?«, lud Ben den neuen Kurzzeitmitbewohner ein, als Margot gerade die Küche verließ. Es klang, als ob sie sich seit Langem kennen würden. Margot schüttelte unmerklich den Kopf.
»Was ist das eigentlich, das Heinerfest?«, fragte Rainer.
»Ich schlag Ihnen etwas vor: Ich erklär Ihnen auf dem Weg in die Stadt, was das Heinerfest ist, und Sie sagen mir, was es mit diesem Madonnentreffen auf sich hat.«
*
»Eigentlich ist es ganz einfach«, erklärte Ben dem unverhofften Gast, den er genauso offensichtlich wie seltsamerweise ins Herz geschlossen hatte. Zu dritt schlenderten sie in Richtung Innenstadt. »Einmal im Jahr, immer am ersten Wochenende im Juli, feiern die Darmstädter ihr ›Heinerfest‹, in diesem Jahr zum vierundfünfzigsten Mal. Die Innenstadt und die große Einfallstraße von Osten werden gesperrt, und Buden und Karussells nehmen das Terrain in Beschlag. Ein riesiges Volksfest. Dazu gibts viel Livemusik und eine Menge Veranstaltungen. Nachher wird das Fest eröffnet, und mein Opa ist einer von denen, die das ganze Jahr zuvor geplant und organisiert haben. Deshalb gehen wir auch immer zur Eröffnung.«
Während des letzten Satzes legte er den Arm um Margot. Was war in ihren Jungen gefahren?
»Und was ist ein Madonnentreffen? Klub der Nonnen oder so?«
»Du oder ich«, fragte Rainers Blick, und Margot zuckte nur mit den Schultern. »O. k., die kurze Variante«, begann Rainer. »Nach dem Krieg wurden Kinder aus dem zerbombten Darmstadt zur Erholung in die Schweiz geschickt. Ähnlich wie heute Kinder aus den durch Tschernobyl verseuchten Gebieten zur Erholung ins Ausland fahren. Das Geld dafür stammte aus ›Mietzahlungen‹ der Stadt Basel für das berühmte Madonnenbild von Hans Holbein dem Jüngeren, einem berühmten Maler, der lange Zeit in Basel lebte. Das Gemälde gehörte damals der großherzoglichen Familie, die es an das Kunstmuseum Basel auslieh. Prinzessin Margret von Hessen und bei Rhein verwendete das Geld ausdrücklich zu diesem wohltätigen Zweck – daher auch der Name ›Madonnenkinder‹ für die, die in den Genuss einer solchen Erholungsreise kamen. Und dein Opa hat ein Wiedersehen für diese Madonnenkinder organisiert, die zwischen 1947 und 1957 nach Davos gefahren sind. Es fängt morgen an und dauert bis Sonntagabend.«
»Ja, ich erinnere mich, ich glaube, er hat mir mal von einer solchen Reise erzählt«, dachte Ben laut nach.
»Und was hast du auf diesem Treffen zu suchen?« Margots Ton war schärfer, als sie es beabsichtigt hatte. Doch der Plauderton zwischen Rainer und ihrem Sohn irritierte sie. Jedes Mal wenn sie in den vergangenen Jahren auch nur eine flüchtige Verabredung mit einem Mann hatte, strafte Ben diesen im günstigsten Fall mit Missachtung. Die Familienpackung zynischer Seitenhiebe hatte schon einige potenzielle Beziehungen im Keim erstickt. Was war los mit ihrem Sohn? Nach Saulus nun Paulus?
Rainer ignorierte den Tonfall und erklärte, dass er gerade an einem Buch über Holbein arbeite.
»Dem Jüngeren?«, fragte Ben. Sie verstand die Welt nicht mehr.
»Ja, über Holbein den Jüngeren. Da das Buch sich an Jugendliche richtet, möchte ich auch ein Kapitel über den Bezug der Kunst zum ›wirklichen Leben‹ schreiben, und da erschien mir das Madonnentreffen als gutes Beispiel.«
Inzwischen schlenderten sie die Alexanderstraße parallel zur Festmeile entlang, um sich nicht durch den Trubel schlängeln zu müssen, und erreichten wenig später das Fest. Noch drängten keine Massen entlang der Stände. Unmittelbar neben Margot rief eine Losverkäuferin unermüdlich »Tombola, Tombola« ins Mikro und betonte stets die zweite Silbe. »Der Preis ist heiß«, verkündete sie weiter, »Werbespiele, Werbespiele, Werbespiele.« »Also was nun, Werbespiel oder Tombola?«, fragte sich Margot. Andere offenbar auch, denn vor dem Stand war nicht viel los.
Sie erreichten das Schloss, das eigentliche Zentrum der Stadt, in dem auch die Eröffnung stattfand. Rund um die Mauern des Schlossgrabens breitete sich das Volksfest aus.
Im Glockenbauhof, dem größten der drei Schlosshöfe, herrschte drangvolle Enge. Margot fühlte sich wie der berühmte Hering in der Dose. Dagegen erschien die Freiheit an einer Kletterwand geradezu verlockend.
Ihr Vater entdeckte sie, kam auf sie zu, begrüßte Margot mit einem Kuss, umarmte seinen Enkel und reichte Rainer die Hand. »Hat es geklappt?«, fragte er seine Tochter. »Ich hoffe, es war dir recht, doch wir haben einfach kein Zimmer mehr für Rainer bekommen!«
Wir. Margot hatte eine passende Entgegnung auf der Zunge, die ihr jedoch schon wieder unpassend erschien, bevor sie sie aussprach. Zumal ihr Vater unterbrochen wurde. Ein älterer Herr tippte ihm auf die Schulter, hesselte: »Ei, He’ Rossbäsch’, dass Sie aach hië sind, dess freid misch abbä«, schüttelte ihm die Hand, als ob es sich um den Ast eines Pflaumenbaums handelte.
Margot kannte das Prozedere. Da ihr Vater einen Sitz in der Stadtverordnetenversammlung inne hatte, kannten ihn die wichtigen Darmstädter und die, die sich dafür hielten. Nur schade, dass einige seinen Namen ›Rossberg‹ offenbar nicht richtig aussprechen konnten. Sosehr Margot ihre Stadt liebte – mit dem Dialekt würde sie nie warm werden.
»Danke, Herr Rossberg, für die Vermittlung, Margot war so freundlich, mir ihr Gästezimmer zur Verfügung zu stellen.«
Ben war so freundlich, korrigierte Margot stumm.
»Na, das freut mich zu hören. Bei euch alles ruhig?«
Margot nickte. Zum Heinerfest hatte die Mordkommission glücklicherweise noch nie einen neuen Fall bekommen. Die Menschen brachten sich zu anderen Zeiten um. Sie hoffte, die Regel, die sich seit Jahrzehnten bestätigte, würde auch in diesem Jahr nicht gebrochen.
Wieder wurde ihr Vater angesprochen. Ernst Dengler begrüßte ihn herzlich, nickte den anderen zu. Margot kannte den alten Freund ihres Vaters. Auch er saß in der Stadtverordnetenversammlung, zählte, wie ihr Vater, zum Darmstädter Urgestein.
Die Musik auf der Bühne wurde unterbrochen, Festpräsident Metzger und Oberbürgermeister Benz gaben salbungsvolle Worte von sich, Margot beobachtete ihren Sohn, der dies bemerkte, ihr eines seiner güldensten Lächeln schenkte und abermals den Arm um sie legte.
Nach dem Festakt verabschiedete sich Ben, er wolle noch ein paar Freunde treffen. Rainer und Margot begleiteten ihren Vater noch ins Hamelzelt, dem größten Bierzelt des Festes, benannt nach seinem Besitzer, der Darmstädter Institution Willi Hamel. Das Zelt stand auf dem Karolinenplatz, dem großen Platz zwischen dem alten Theater, das heute das hessische Staatsarchiv beherbergte, und dem Schloss. Der traditionelle Bieranstich ging im allgemeinen Trubel unter, und Margot fand es entschieden zu eng. Ihr Vater strahlte übers ganze Gesicht. Das war sein Moment. Ein Jahr Planung, Organisation und damit verbundener Ärger lagen hinter ihm. Jetzt ließ er sich feiern.
»Ein toller Mann, dein Vater«, sagte Rainer.
Margot schmunzelte. »Ihr wart einander schon immer die beiden treuesten Fans …«
In dem Moment, in dem sich ihr Magen lautstark dafür einsetzte, dem von seiner Besitzerin offenbar angedachten Hungerstreik entgegenzutreten, fragte Rainer, ob sie nicht etwas essen gehen wollten.
»Hast du nichts anderes vor?« Margot war sich nicht sicher, ob ihr ein Nein oder ein Doch lieber gewesen wäre.
»Nein, das Treffen fängt ja erst morgen an.«
Sie hatten beide keine Lust, sich dem Trubel des Festes länger auszusetzen. »Gegenüber vom Haus deines Vaters, da ist doch so ein netter Mexikaner – ›Pueblo‹ oder so«, schlug Rainer als Alternative vor.
Margots Magen stimmte zu, Salat und Krebsfleisch hatte er schon lange nicht mehr kredenzt bekommen. Und das Pueblo lag nur fünf Minuten zu Fuß entfernt. Gleich neben dem Kneipeneingang, nur abgetrennt durch einen Windfang, stand ein kleiner Tisch für zwei Personen, Margots Lieblingstisch. Oft saß hier ein Typ, etwas älter als sie, immer mit Buch oder Laptop bewaffnet und immer dann, wenn sie einmal in aller Ruhe hier essen wollte. Doch heute war der Tisch unbesetzt. Der Mann war wohl auch ein Fan des Heinerfestes.
Rainer und Margot nahmen Platz, sie begrüßte Sina, die Bedienung. Dann bestellten beide etwas zu essen und plauderten danach in lockerem Tonfall, als ob sie sich nicht vor sieben Jahren, sondern vergangene Woche zum letzten Mal gesehen hätten. Margot erzählte von ihrer Arbeit, er von der seinen. Private Themen standen nicht auf der Tagesordnung. Kein Passierschein.
Nach gutem Mahl und einer gemeinsam geleerten Flasche Wein spazierten sie durch die milde Sommernacht nach Hause, setzten sich dann noch in den Garten.
»Noch ein Glas Wein?« Kein vernünftiger Vorschlag, Frau Hesgart, schalt sie sich selbst. Doch Vernunft war definitiv nicht ihre herausragende Eigenschaft am heutigen Tage. Die Unvernunft hatte schon begonnen, als sie Hand an die Kletterwand gelegt hatte.
Sie genoss die frische Luft, stieß mit Rainer an, der den Sicherheitsabstand von einem halben Meter unaufgefordert einhielt. Aber Rainer war Geschichte. Er hatte in ihrem Leben für genügend Turbulenzen gesorgt. Nicht heute Abend. Nicht morgen. Und ganz gewiss nicht in den Stunden dazwischen.
»Was macht Ben jetzt eigentlich?«, riss Rainer sie aus ihren Gedanken.
»Er studiert. Zweites Semester BWL. Hat ausnahmsweise mal auf seine Mutter gehört. Obwohl er mir immer in den Ohren gelegen hat, er wolle Kunst studieren. Wäre dann eher dein Metier gewesen.«
Sie prostete ihm zu, er hob das Glas, und wieder fiel ihr Blick auf seine rechte Hand. Sie versuchte zu erahnen, ob Rainer den Streifen am Finger per Sonnenstudio in Expresstempo getilgt hatte: »Kein Ring mehr?«
Rainer grinste verlegen. »Nein, seit drei Jahren nicht mehr – und du? Immer noch keinen?«
Irgendwer hatte die Tagesordnung manipuliert. Hatte nicht vorhin unter der Rubrik »Auf keinen Fall« noch gestanden »Alles was auch nur im Entferntesten nach Privatleben riecht«? Und war sie es nicht selbst gewesen, die jetzt durch ihre Frage dieser Manipulation – zu Recht – bezichtigt werden konnte?
Rainers Hand strich sanft über die ihre. Ameisen krabbelten unter der Haut. Zeit, die Tagesordnung gänzlich abzuschließen, wenn ihr schon die Einhaltung der einzelnen Punkte entglitt.
Sie entzog die Hand. »Nein, kein Ring. Seit Horsts Tod nicht mehr.« Und ich werde diesen bereits seit sechzehn Jahren anhaltenden Zustand auch nicht beenden, dachte sie. »Ich gehe jetzt schlafen. Du hast unten ein eigenes Bad.«
»Ben hat es mir gezeigt.«
Sie wandte sich zum Gehen.
»Margot?«
Ein letzter Blick? Denk an Orpheus … »Ja?«
»Danke.«
Margots Schlafzimmer lag im ersten Stockwerk des Hauses, von Bens Zimmer durch ihr Arbeitszimmer getrennt. Rainer schlief in der Einliegerwohnung im Souterrain. Sie hatte Ben damals angeboten, die Wohnung zu beziehen, doch er hatte es vorgezogen, das hellste Zimmer des Hauses für sich zu wählen. Heute Nacht war sie ihm dafür dankbar.
Wie konnte Rainer sich erdreisten, so plötzlich wieder in ihrem Leben aufzutauchen? Sie fand keine Antwort mehr auf diese Frage, denn Müdigkeit und Wein entzogen den Augenlidern jegliche Kraft. Margot versank in unruhigen Schlaf.
Freitag
War es Instinkt, oder waren elektromagnetische Felder daran schuld? Margot erwachte immer, wenige Sekunden bevor der Radiowecker sie mit den neuesten Nachrichten quälen konnte. Und oft auch schon kurz bevor Telefon oder Handy anschlug.
Trotz ihres Flirts mit Bacchus’ Bestem und nur wenigen Ruhestunden riss irgendetwas Margot aus dem Schlaf. Bevor noch alle Sinne »Aufgewacht, Mylady« meldeten, klingelte das Handy wie ein altes Schellacktelefon. Margot hielt überhaupt nichts von irgendwelchem Klingeltonschnickschnack, ebenso wenig wie von ins Handy integrierten Kalendern, Kameras und bald noch Handwärmern und Taschenlampen. Als Horndeich, der große Junge, ihrem mobilen Quälgeist beibrachte, sich zumindest akustisch wie ein normales Telefon zu benehmen und das blöde Technogepiepse für Arme aufzugeben, hätte sie ihn umarmen können.
Sie schaute aufs Display. Für einen Anruf um 2:45 Uhr hingegen hätte sie ihn am liebsten erwürgt!
Sie raunte ein müdes »Ja?« in den Äther.
»Kundschaft, Margot«, sagte er nur.
Kundschaft für die Mordkommission. Irgendwie stand dieses Heinerfest unter keinem guten Stern. Kletterwand, Rainer und jetzt auch noch eine Leiche … Der Nachricht über den gewaltsamen Tod eines Menschen konnte sie meist mit professioneller Distanz begegnen. Anders sah es aus, wenn sie den Tatort untersuchte. Aber sie hatte ja noch eine Gnadenfrist. »Wo?«
»Direkt hinterm Eingang zum Herrngarten. Der zwischen altem Theater und Museum. Alles schon in Flutlicht getaucht wie bei den Achtundneunzigern – du kannst es nicht verfehlen.«
»O. k., gib mir zehn Minuten.« Während der letzten Silben schloss sie bereits den Reißverschluss ihrer Jeans.
Neun Minuten später erreichte sie den hell illuminierten Herrngarten, und Steffen Horndeich trat durch einen Vorhang aus feinem Bindfadenregen auf sie zu. Das Flutlicht ließ den Tatort in grausam klarem Licht erscheinen, nicht einmal der Regen milderte diesen Eindruck. Das Opfer lag auf der Seite, zwischen zwei Büschen, wirkte achtlos weggeworfen wie ein benutztes Taschentuch. Trotz des Regens erkannte sie noch Blutspuren auf dem Weg und die Blutseen, die Kopf und Oberkörper umflossen. Gleich emsigen Ameisen wuselten zwei Beamte der Spurensicherung, Paul Baader und Hans Häffner, in ihren weißen Anzügen um die Leiche herum. Ein anderer Kollege schoss die wirklich letzten Bilder von dem Toten. Aus den Augenwinkeln erkannte Margot, dass dieser groß, schlank und nicht mehr ganz jung war.
»Und?«, fragte sie.
»Keine Ausweise, kein Portemonnaie. Schürfwunden an der linken Hand – wahrscheinlich eine geklaute Uhr. Ich tippe auf einen Junkie, der es wirklich nötig hatte, an ein paar Kröten zu kommen …«
Tagsüber, bei Sonnenschein, war die grüne Lunge der Stadt Tummelplatz für Liebespaare, Spontanpicknicker, Jung und Alt. Der Teich in der Mitte bot Enten und anderem Wasserfedervieh ein Zuhause. Aber der Teil des Parks zwischen Süd- und Südwesteingang war Marktplatz der Pillen und Pülverchen für Sternenjäger ohne Rakete. Mal wurde die Szene geduldet, um sie zumindest unter Kontrolle zu halten. Dann wieder protestierten einige Bürger etwas lautstarker, woraufhin sie durch Razzien wieder aufgelöst wurde. Bis die Klagen aus anderen Ecken der Stadt kamen, dass sich nun dort überall neue Szenen bildeten.
»Schon was zur Todesursache?« Margot hatte ihren Kollegen noch nicht einmal begrüßt, aber das kannte der schon. Sie knetete eine Ausbuchtung an ihrer Jacke, sicheres Zeichen für ihre Anspannung. Sie hatte in ihrem Leben schon einige Leichen gesehen, auch wenn Darmstadt sich glücklicherweise nicht mit Tötungsmetropolen wie Frankfurt oder einigen Städten im Osten des Landes messen konnte. Doch stellte sie fest, dass sie trotz zunehmender Erfahrung nicht abgebrühter wurde, sondern die feine Schicht Abwehr, die ihre Seele vor der Wirkung dieser Bilder beschützen sollte, immer dünner wurde.
Steffen Horndeich – den jeder Horndeich nannte, auch Margot, obwohl sie sich schon über drei Jahre lang kannten und duzten – sagte: »Hinrich sitzt auch schon im Wagen, er müsste gleich da sein.«
Martin Hinrich war der zuständige Arzt der Pathologie, und er hatte, wie Horndeich, in dieser Nacht Bereitschaftsdienst. Da sich Darmstadt mangels Klientel den Luxus einer Gerichtsmedizin nicht leisten musste, rauschten bei Mordfällen immer die Gerichtsmediziner aus Frankfurt an.
»Wer hat ihn gefunden?«
»Karl Strässer, ein Rentner, hat seinen Hund hier Gassi geführt. Der ist losgeschossen und hat Herrchen zu der Leiche geführt, kurz vor halb drei. Hundi hat was an der Blase, deshalb muss er alle zwei Stunden mit ihm raus. Auch nachts.«
»Wo ist er?«
Horndeich führte seine Kollegin zu dem Mann. Der Hund wedelte mit dem Schwanz, Margot streichelte ihm über das nasse Fell. »Herr Strässer?«
»Ja, dä binn isch«, antwortete der Mann in breitem Hessisch. Margot fragte ihn, wie er die Leiche entdeckt hatte, und erfuhr nur die epische Variante von Horndeichs Zusammenfassung, verknüpft mit der kriminalistischen Schlussfolgerung, dass der Täter sicher einer von den Ausländern sein müsse, die den Herrngarten ja schon fast besetzt hätten.
»Tippen Sie auf Österreicher oder Belgier?«, erkundigte sich Margot und ließ den verdutzten Rentner einfach stehen.
Die Lichter zweier Scheinwerfer blendeten sie kurz, als Hinrichs Alfa den Weg entlangfuhr. Der Arzt stieg aus, begrüßte Margot und Horndeich. Sie hatten schon früher zusammengearbeitet. Dann ließ Hinrich sich zu dem Toten führen.
Er kniete sich neben die Leiche, untersuchte sie mit geübtem Blick und flinken Händen.
»Und?«, fragte Horndeich.
»Tot«, sagte er.
»Ach nee.«
Hinrich erhob sich. »Also, soweit ich das jetzt schon sagen kann: Er hat wahrscheinlich von hinten einen über den Kopf gezogen bekommen. Vielleicht damit.« Er deutete auf den Stumpf einer zerbrochenen Bierflasche, die etwas abseits des Toten auf dem Boden lag.
»Das haben weder Kopf noch Flasche gut überstanden. Und hier ist eine Schnittwunde. Hat die Halsschlagader getroffen. Vielleicht auch mit der Bierflasche? Das kann ich aber erst in Frankfurt rausbekommen. Das Ganze ist noch nicht lang her, ich tippe so auf zwei Uhr – plus minus zehn Minuten. Alles Weitere morgen. Jetzt nehm ich ihn erst mal mit.«
Margot dankte dem Kollegen, trat dann näher zum Tatort. »Kann ich ihn mir ansehen?«, fragte sie eine Beamtin von der Spurensicherung.
»Ja, wir sind hier durch. Wegen des Regens gibts keine verwertbaren Fußabdrücke. Ach ja, er ist nicht zwischen den Büschen umgebracht worden, sondern hier auf dem Weg. Der Täter hat ihn wohl zur Seite gerollt, damit nicht jeder gleich über ihn stolpert. Sehr aufmerksam. Schauen Sie ihn sich ruhig an.«
Schon während sie sich neben den Toten kniete, überfiel sie ein Gefühl, dass dieser Mann noch etwas verbarg, und drehte den Kopf in ihre Richtung. Dann wusste sie, was es war.
Margot hatte den Augenblick immer gefürchtet und doch gewusst, dass er eines Tages kommen würde. Sie kannte den Toten.
»Ernst Dengler«, sagte sie tonlos und schaute in die toten Augen eines Freundes ihres Vaters. Vor wenigen Stunden hatte sie den Mann noch lebend gesehen, als er ihren Papa begrüßte. Er war wohl schon Wegbegleiter ihres Vaters gewesen, als sie selbst noch nicht einmal in Gedanken existierte. Sie hatte ihn kaum gekannt, er war nur ein paarmal in der Wohnung ihrer Eltern zu Gast gewesen, als sie dort noch gelebt hatte. Doch sie hatte immer gespürt, dass er und ihr Vater tief verbunden waren.
Dengler wurde in einen Zinksarg gelegt, dieser verschwand in einem Leichenwagen.
»Zoschke, fahren Sie mit«, wies Margot einen Beamten an, der Hinrich begleiten und der Obduktion beiwohnen würde. »Wenn Hinrich durch ist, bringen Sie uns die Ergebnisse. Wenn’s länger dauert, bitte um acht einen Zwischenbericht.« Die hochgezogene Lippe von Heribert Zoschke, der sich verständlicherweise ebenfalls gern mit Nachnamen anreden ließ, zeigte, wie sehr er über den Job erfreut war. Er nickte und ging zu Hinrichs Wagen.
Margot ließ sich auf eine Bank fallen, streckte die Beine von sich, ignorierte den Regen. Horndeich setzte sich neben sie.
»Wer bringt einen fast Siebzigjährigen um? Von hinten. So feige und hinterhältig.«
»Nach allem, was wir hier haben, scheint es wirklich ein Raubüberfall zu sein«, dozierte Horndeich.
Margot schloss die Augen, seufzte. »Wie bringe ich das bloß meinem Vater bei?«
*
Das Bettlaken hätte einem Modell der tektonischen Verwerfungen des San-Andreas-Grabens alle Ehre gemacht. Nach drei Stunden unruhigem Schlaf schälte Margot ihren Körper unter der Decke hervor, duschte und fühlte sich danach ein wenig besser. Das bleiche Gesicht Denglers hatte sie auch in ihren Träumen verfolgt. Diese Art Horrorkino war ihr bislang erspart geblieben. Sicheres Zeichen dafür, dass die Seelenschutzschicht bedenklich dünn geworden war. Dünner, als sie bislang gedacht hatte.
Als sie aus dem Badezimmer trat, signalisierte ihre Nase Kaffeeduft, den sie zunächst für die Geruchsvariante einer Fata Morgana hielt. Doch auch nach drei Atemzügen hatte sich das Aroma nicht verflüchtigt, sondern verstärkt. Außerdem wurde er inzwischen durch das Röcheln der Kaffeemaschine untermalt, das anzeigte, dass diese die letzten Wassertropfen verarbeitete.
Sie schlüpfte in ihre Kleidung und stieg die Stufen hinab. Der Wecker zeigte halb acht.
»Guten Morgen«, sagte Rainer, als er Kaffee in ihre Tasse goss. »Immer noch schwarz mit einem halben Löffel Zucker gegen die Bitterkeit?«
Sie nickte nur stumm, denn am Tisch saß eine echte Fata Morgana. »Wie kommt es denn, dass du schon auf bist?«
Die Fata Morgana mit Bens Antlitz antwortete: »Weil es Frühstück gibt. Sag mal, ›ein halbes Stück Zucker gegen die Bitterkeit‹ – wie gut kanntet ihr euch eigentlich?«
Margot ignorierte die Frage sowie das Grinsen und ließ ihren Blick über den liebevoll gedeckten Tisch wandern, auf dem nicht einmal ein Strauß Blumen fehlte. »Wow«, brachte sie bloß heraus.
»Na, ich dachte, wenn du mich hier schon wohnen lässt, kann ich mich auch ein wenig nützlich machen.« Rainer goss auch Ben eine Tasse Kaffee ein, dann sich selbst.
»Was ist mit dir los, freust du dich nicht?«, fragte Ben.
»Kundschaft«, meinte Margot. In knappen Worten umriss sie, was in der Nacht geschehen war.
Rainer ließ Messer und Brötchen sinken. »Ernst Dengler?«
»Ja.«
»Er wollte auch auf das Madonnentreffen kommen.«
»Das wird er jetzt wohl nicht mehr«, konstatierte Margot. Sie leerte die Tasse in einem Zug, griff dann nach der Hand ihres Sohnes. »Sorry, ich muss los. Ich hatte gehofft, dass ich ein ruhiges Heinerfestwochenende mit dir verbringen könnte, aber daraus wird wohl nichts werden.«
»Schon o. k., kannst ja nichts dafür. Ich werde Rainer mal die Stadt zeigen.«
»Ja, macht euch einen schönen Tag. Danke für das tolle Frühstück.«
»Gern geschehen. Wir sehen uns.«
Das wird sich kaum vermeiden lassen, dachte Margot, bevor die Haustür ins Schloss fiel.
*
Horndeich saß bereits am Schreibtisch ihres gemeinsamen Büros. Der Raum war mit modernen Möbeln eingerichtet. Margot hatte auch ein bisschen Grün ins Leben gebracht: drei Töpfe mit Zyperngras, einen mit einer Grünlilie. Doch Kollege Horndeich war die Person mit dem grünen Daumen. Zumindest der, der regelmäßig die Gießkanne schwenkte.
Auf einem Sideboard neben dem Waschbecken und unter dem großen Stadtplan thronte die Kaffeemaschine, die hier ihr Gnadenbrot bekam. Sie hatte keine Inventarnummer, was wohl daran lag, dass sie lange vor der Erfindung der Inventarisierung gekauft worden war. Und sie produzierte den schlechtesten Kaffee der Welt. Immer wieder dachte Margot daran, das marode Teil zu ersetzen. Doch leider kam ihr der Gedanke immer nur dann, wenn sie gerade wieder einen Kaffee aufsetzte oder – was seltener vorkam – einen trank.
Horndeich kaute auf einer Mohrrübe und war in ein Schriftstück vertieft. Sie konnte das Büro betreten, wann immer sie wollte, Horndeich war schon da. Der Mann war ein wandelndes »Ich-bin-schon-da«-Phänomen. Er war frisch rasiert, und sie mochte sein Rasierwasser. Wenn es auch nicht annähernd das auslöste, was Rainers Duftwässerchen … Sie verbot sich, den Gedanken weiterzuspinnen. Polizeihunden trainiert man mühevoll ab, sich durch den Geruch von Kaninchen oder läufigen Artgenossinnen aus der Ruhe bringen zu lassen. Also sollte dir das doch wohl auch gelingen, Margot. Die innere Stimme. Besserwisserin.
»Morgen!«, grüßte sie.
Horndeich verringerte die Lebenserwartung seiner Möhre um weitere zwei Zentimeter, bevor er den Gruß kauend erwiderte.
»Hast du schon was rausgefunden?«
»Klar.« Wieder ein Zentimeter.
»Und schon was Neues von den Frankfurtern?«
»Ja, Zoschke hat vor ein paar Minuten angerufen. Die Bierflasche sei die Tatwaffe. Aber Hinrich sei noch immer fleißig am werkeln. Bis zum finalen Tusch können noch ein paar Stunden vergehen. Aber«, fuhr er, ohne abzusetzen, fort, »ich habe heute Nacht ohnehin nicht mehr schlafen können. Da hab ich ein bisschen recherchiert.«
»Über das Opfer?«
»Ja.«
»Ich weiß nur, dass Ernst Dengler der gleiche Jahrgang wie mein Vater ist, also 1937. Dann …«, sie musste überlegen. »Er ist auch in der Stadtverordnetenversammlung.«
»Jepp, aber das ist noch nicht alles. Er war ebenfalls Mitglied im Heinerfestausschuss, Parteivorstand der Darmstädter CDU, IHK-Präsident und Schirmherr diverser Wohltätigkeitsveranstaltungen. Ziemlich aktiv auf dem Stadtparkett. Verheiratet mit Marianne Dengler, geborene Fuchs. Sie haben einen Sohn, Fritz, der ist 41, und Ernst hat noch einen Zwillingsbruder. Der heißt Max.«
Manchmal konnte sie Horndeichs Fleiß nur bewundern. »Sonst noch was?«
Horndeich blätterte zwischen ein paar Ausdrucken, dann zog er eines der Blätter hervor. »Er hatte eine Firma. Die Pointus GmbH.«
Bei dem Namen klingelte etwas. Pointus. Software. »Die Pointus?«
Das Unternehmen residierte am alten Messplatz in einem Glaspalast, vor zehn Jahren neu hochgezogen, dreistöckig, und in seiner Sachlichkeit ein reizvoller Kontrast zu Hundertwassers Waldspirale. Margot hatte immer gedacht, der Bau hätte sich bei seinen architektonischen Brüdern im Frankfurter Bankenviertel viel wohler gefühlt.
»Ja. Genau die. Sind wohl inzwischen nach SAP die Zweitgrößten, was Unternehmenssoftware angeht. Jahresumsatz 3dreihundertfünfzig Millionen, rund zweitausend Mitarbeiter. Für Darmstadt ein echter Goldesel. Und das Vermögen des alten Herrn lässt sich nur schätzen, aber er ist mehrfacher Millionär. Dengler ist Vorstandsvorsitzender, seit Gründung der Firma vor fünfunddreißig Jahren. Das Unternehmen ist nach wie vor in Familienbesitz.«
»Waren die schon immer so erfolgreich?«
»Ja. Dengler war einer der Ersten, die begriffen haben, welches Potenzial in Bits und Bytes liegt. Hat sich auch sehr früh Know-how über Vernetzung eingekauft. Vor zehn Jahren schon hatte jeder Büroarbeitsplatz einen Internetzugang, ging damals durch die Presse. Dengler meinte, das Internet werde bald so selbstverständlich genutzt werden wie das Telefon.«