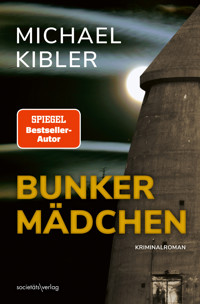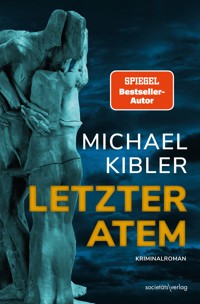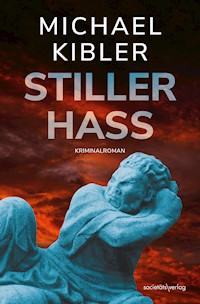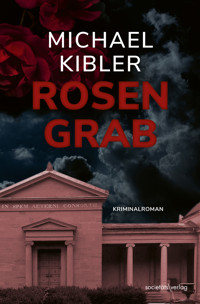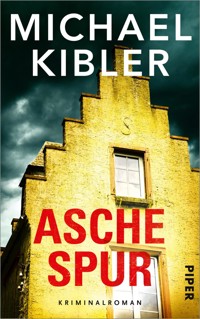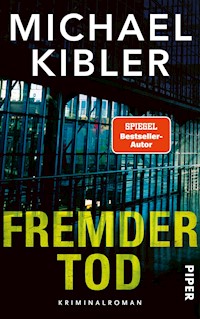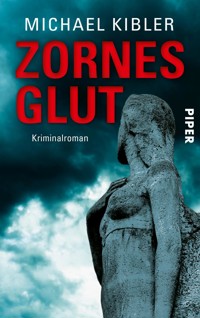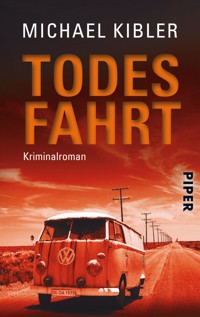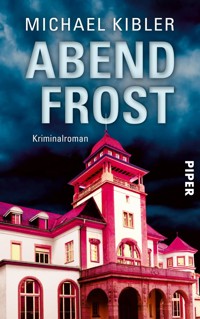9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Während eines Kongresses der Gerichtsmediziner in Darmstadt wird bei Renovierungsarbeiten im Kongresszentrum ein Schädel gefunden. Steffen Horndeich und Leah Gabriely von der Mordkommission finden heraus, dass der Besitzer des Schädels vor sehr langer Zeit verstorben sein muss. Ganz anders sieht es bei den Skelettresten aus, die wenig später in einem Waldgebiet auftauchen: Das Mordopfer kann noch nicht so lange tot sein. Schon die Feststellung der Identität wird zu einem komplexen Puzzlespiel. Und dann mehren sich die Hinweise, dass ausgerechnet der Schädel bei der Lösung des Falls eine wichtige Rolle spielen könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-97867-5
© Piper Verlag GmbH, München 2017
Covergestaltung: semper smile, München
Coverabbildung: Ullsteinbild/imageBROKER, J.W.Alker und shutterstock/leedsn
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
WIDMUNG
PROLOG
DONNERSTAG, 1. JUNI
FREITAG, 2. JUNI
SONNTAG, 4. JUNI
MONTAG, 5. JUNI
DIENSTAG, 6. JUNI
MITTWOCH, 7. JUNI
DONNERSTAG, 8. JUNI
FREITAG, 9. JUNI
SAMSTAG, 10. JUNI
MONTAG, 12. JUNI
DIENTAG, 13. JUNI
MITTWOCH, 14. JUNI
DONNERSTAG, 15. JUNI
FREITAG, 16. JUNI
SAMSTAG, 17. JUNI
SONNTAG, 18. JUNI
EPILOG
NACHWORT UND DANK
QUELLENNACHWEISE
Für Lore Lay
PROLOG
Der Moment.
Der einzige Moment, in dem man eine Chance hat.
In der einen Hand hält er die brennende Zigarette, in der anderen das Messer. »Bist du still, sonst mach ich dich tot! Kohle!«
Die Botschaft: unmissverständlich.
Sie überlegt, während die Synapsen im Gehirn bereits die Überlebensstrategie festgelegt haben.
Der junge Mann vor ihr ist kein Profi. Das, was er hier abzieht, hat er noch nicht oft gemacht. Und schon gar nicht erfolgreich, das zeigt die Unsicherheit in seinem Gesicht. Aber sie sieht auch das Messer. Und vor allem die Zigarette in der anderen Hand.
Sie sollte den Blick von der Kippe abwenden. Sie sollte sich auf das verdammte Messer konzentrieren. Es gelingt ihr nicht.
Der Typ geht einen Schritt in ihre Richtung. Der falsche Schritt.
Nicht umsonst hat sie im vergangenen Jahr immer und immer wieder trainiert, wie sie in einer solch hypothetischen Situation reagieren würde.
Streiche »hypothetisch«.
Sie tritt auf ihn zu. Die Bewegungen laufen völlig automatisch ab. Im Nachhinein kann sie sich kaum erinnern.
Der Mann krümmt sich am Boden. Die Zigarette ist weggerollt, liegt auf dem Asphalt der Straße. Die Spitze glimmt immer noch. Offensichtlich hat die Kippe keinen Schaden genommen. Sie kann den Blick nicht von ihr abwenden.
Auch an ihr ist alles heil. Alles ganz. Er hat ihr nichts tun können.
»Soll ich die Polizei rufen?« Plötzlich die Stimme neben ihr. Worte aus dem Nichts. Sie wendet sich um. Ein Mann.
Sie schüttelt nur den Kopf. »Mach ich schon«, sagt sie. Dann greift sie zum Handy. Sie muss nur die Kollegen rufen. Schließlich arbeitet Leah Gabriely selbst seit vielen Jahren bei der Polizei.
DONNERSTAG, 1. JUNI
Als die zehn Kilo des nagelneuen Abdeckblechs zum zweiten Mal an diesem Tag auf Gerhard Wollreits rechtem Fuß landeten, dachte er voller Wehmut an seinen verstorbenen Kollegen Hans Dellinger. Er und Dellinger waren ein eingespieltes Team gewesen. Aber der Neue, der kriegte so gar nichts auf die Reihe. »Mein Gott, pass doch auf!«, fluchte Wollreit. Zum Glück schützten die Stahlkappen in den Sicherheitsschuhen seine Zehen.
Mit dem Neuen, der so einen unaussprechlichen bosnischen Nachnamen mit gefühlt zehn Zischlauten hatte, würde er wohl nie warm werden. »Willst du, dass wir das Blech noch mal kaufen müssen, weil du Dösel es kaputt gemacht hast?«
Der Neue, den er in Gedanken einfach immer nur »Tsch-Tsch« nannte, schüttelte den Kopf. Wenigstens redete der nicht viel. Sie lehnten das Blech vorsichtig gegen eine Scheibe, hinter der sie Autos aus der Tiefgarage anglotzten.
Bevor Wollreit den Akkuschrauber ansetzte, um die erste der zehn Inbusschrauben des alten Abdeckblechs zu lösen, wanderte sein Blick in die Höhe. Er und sein Kollege standen auf dem Kiesbett am Fuße der Calla im Kongresszentrum Darmstadt. Wollreit imponierte die sich über die Stockwerke hinweg bis zum Dach öffnende, riesige Blüte aus Stahl und Glas. Sie spendete dem Gebäude auf jeder Etage Tageslicht und leitete den Regen in ein Becken tief unter die Erde. Durch sie blieb das Klima im Haus auf natürliche Art im Sommer angenehm kühl. Wie genau das funktionierte, das hatte Wollreit nie verstanden. Es interessierte ihn auch nicht besonders. Er wusste nur: Er war dafür verantwortlich, dass es der Calla gut ging, dass es dem ganzen Darmstadtium gut ging. Dafür lebte er seit über neun Jahren. Was Tsch-Tsch nie kapieren würde. Während Wollreit die ersten Schrauben löste, fiel sein Blick auf das hässliche Loch in der alten Abdeckplatte. Zehn dieser Platten umschlossen den Fuß der Calla, und in eine war der Amboss mit der Spitze voraus gefallen. Wollreit grinste in sich hinein. Ausgerechnet auf der Hochzeitsmesse war eines der Ausstellerpärchen, beide Juweliere, in Streit geraten. Sie hatte ihn auf der Treppe, die in den ersten Stock führte, geschubst. Keine gute Idee. Er hatte das Gleichgewicht verloren, und die Kiste mit dem Amboss war über das Geländer gefallen. Zehn Kilo hatte das Metallteil auf die Waage gebracht, das nur für Dekorationszwecke des Standes gedient hatte. »Wir schmieden sie zusammen«, lautete die Devise des Juwelierladens aus dem Odenwald. Nun, dieser Vorfall hatte sicher die Belastbarkeit der Ehe des Paares und auch jene der Zahlungsbereitschaft der Haftpflichtversicherung auf eine harte Probe gestellt. Aber das war nicht Wollreits Problem. Er musste jetzt die Abdeckplatte ersetzen, damit die Calla wieder in altem Glanz ohne Loch im Plattenfundament erstrahlte.
Die Schrauben ließen sich erstaunlich leicht lösen. Neun hatte er bereits in ein kleines blaues Plastikkästchen gelegt.
»Halt mal«, sagte er zu seinem Kollegen und deutete mit dem Kinn auf das linke Ende der Blechplatte. Gleich würde er die letzte Schraube lösen. Und er wollte nicht riskieren, dass die Platte mit lautem Geschepper ins Kiesbett rutschte.
Tsch-Tsch stützte das Blech.
Sekunden später hielt Wollreit die letzte Schraube in der Hand.
Wieder nickte er – und der Kollege verstand. Gemeinsam trugen sie das Blech zur Seite. Dann fiel Wollreits Blick auf die gut zwei Quadratmeter große Fläche unter der Abdeckplatte. Eigentlich sollte er hier gar nichts sehen, außer nacktem Beton. Doch da stand etwas, das nicht dorthin gehörte. Eine Pappkiste. Gut dreißig Zentimeter an jeder Seitenlinie, schätzte Wollreit mit fachmännischem Blick. Das waren genau die Maße der Hülle einer Langspielplatte. Und damit kannte er sich aus: Cirka viertausend Schallplatten zierten seine eigene Sammlung.
Ich träumte von weißen Pferden.
Das Bild ließ Martin Hinrich nicht mehr los. Seit sie am vergangenen Abend im Restaurant Bockshaut ein wenig zu viel getrunken hatten, kreiste der Gedanke in seinem Kopf. Was daran lag, dass er dieses alte Lied wieder gehört hatte. »Weiße Pferde« von Georg Danzer. Der war auch schon tot, seit ziemlich genau zehn Jahren. Bronchialkarzinom. Lungenkrebs. Und da war Danzer nur vier Jahre älter gewesen als er, Hinrich, jetzt. An Lungenkrebs starben mehr Menschen als an Brustkrebs, Prostatakrebs und Dickdarmkrebs zusammen. Scheißthema. Denn Angelina war ebenfalls daran gestorben. Vor zwanzig Jahren. Kettenraucher wie der gute Georg. Angelina, die Frau, an die er seine Unschuld verloren hatte. Und sie die seine an ihn.
Gemeinsam mit den Kollegen aus der gerichtsmedizinischen Branche hatten sie am Vorabend deftige hessische Küche und leckeres Darmstädter Bier genossen. Vierzehn von 176 Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt. Insbesondere Dr. Vasques aus Sevilla war ganz entzückt gewesen vom Handkäs mit Musik.
Hinrich bemühte sich, dem Vortrag von Frau Dr. Emilia Schubert seine ungeteilte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Das war nicht ganz einfach. Denn Emilia sah Angelina einfach unglaublich ähnlich – Angelina, wie sie ausgesehen haben musste, kurz bevor sie starb. Gerade referierte Dr. Schubert, passend zum Vorabend, über eine Studie, bei der Probanden ein vermeintliches Ausnüchterungsmittel mit dem Namen »Alc-it-down« verabreicht worden war. Vor und nach dem Trinken sollte dieses Präparat – wie es zahlreiche Internetseiten einen glauben machen wollten – die Alkoholresorption im Körper drastisch beschleunigen und – o Wunder – gleichzeitig den Alkoholdunst im Atem tilgen.
Bullshit.
Das sagten Hinrich nicht nur sein gesunder Menschenverstand und seine medizinische Ausbildung, sondern das belegte gleichfalls die Studie der schönen Emilia. Leider hatte sie das bereits ganz am Anfang ihres Vortrags verkündet, sodass die Spannung gen Ende ein wenig abflaute.
Diese stieg jedoch kurzzeitig an, als aus den Lautsprechern im Raum eine Durchsage schallte: »An alle Mitarbeiter, bitte Müller für neunundzwanzig! Müller für neunundzwanzig!«
Wie dämlich war das denn? Hinrich kannte diese Art der Ansage aus dem Supermarkt. »Frau Schmidt, bitte Kasse drei« – der Klassiker.
Ein vernehmliches Raunen zog sich durch die Menge, ebbte ab, dann lauschte das Auditorium wieder den Worten der Kollegin.
Hinrichs Gedanken schweiften abermals ab.
Woran, meine Liebe, glauben wir noch?
1984 hatte Danzer dieses Lied veröffentlicht. In dem Jahr, in dem Angelina mit ihm Schluss gemacht hatte. Das Jahr, in dem er an gar nichts mehr geglaubt hatte. Übrigens auch nicht im darauffolgenden Jahr und auch nicht in jenem danach.
Algo se muere en el alma
cuando un amigo se va.
Etwas stirbt in der Seele,
wenn ein Freund geht.
Wieso ging ihm dieses verdammte Lied nicht aus dem Kopf?
Gestern an der Bar, bevor sie in Richtung Restaurant gezogen waren, da hatte er versucht, Emilia Schubert einen Drink auszugeben. Er war so was von kläglich gescheitert. Eine doppelte Niederlage, denn sie trug nicht mal einen Ehering.
Trotzdem: Es hatte ihn kaum berührt. Aber es berührte ihn, dass es ihn kaum berührt hatte. Frauen, Frauen, Frauen, Mädchen, Frauen – seine Liste an Begegnungen mit dem anderen Geschlecht erschien ihm länger als eine Rolle Polizeiabsperrband.
Dr. Emilia Schubert präsentierte nun die Details der statistischen Auswertung des Alkoholtests der beiden Vergleichsgruppen. Auf gefühlt 537 Folien warf sie irgendwelche mathematischen Kurven an die Wand, unverständlich und uninteressant.
Weiße Pferdewaren in der vergangenen Nacht dann auch durch seinen Traum galoppiert. Vom Strand mitten durch die Stadt und von da aus durch den Hof des uralten ehemaligen Bauernhofs im Nordosten Frankfurts, den er sich im vergangenen Jahr gekauft hatte. Was für ein gruseliger Traum! Erst galoppierten die weißen Pferde durch die Küche, trampelten jegliches Porzellan – das er im wirklichen Leben überhaupt nicht besaß – in Scherben, pflügten dann durchs Wohnzimmer, um schließlich sein Schlafzimmer niederzumachen. Er lag im Bett, rollte sich zur Seite, fiel auf den Boden und sah dann aus der Froschperspektive die Herde galoppieren. Vielleicht sollte er es in Zukunft mit dem Alkohol ein bisschen behutsamer angehen lassen.
Dennoch, so fragte er sich, wozu arbeitete er in dem Bereich, in dem er es tat? Für wen machte er das Ganze? Leichen aufschneiden, die Landkarte von Hämatomen einer Vergewaltigung dokumentieren? Die Mondlandschaft der Brandnarben von Zigaretten oder eine Kindesmisshandlung in ein Kostüm von Fachbegriffen hüllen? Immer und immer, jeden Tag? Und wozu?
Martin Hinrich schloss die Augen.
»Die Auswertung bezüglich des Einflussfaktors ›Alc-it-down‹ zeigte keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen für die Parameter Cmax, tmax, AUC und Elimination«, sagte Emilia. Dann fügte sie noch hinzu: »Ein jedes Glas zu viel ist verflucht und sein Inhalt ein Teufel!«
Applaus brandete auf. Offensichtlich war die schöne Emilia am Ende ihres Vortrags angekommen.
Und nun? Fragestunde. Und in einer halben Stunde der nächste Vortrag.
Hinrich hatte seinen schon gehalten. Zwei Tage zuvor. Eigentlich sehnte er nur noch das Ende der Konferenz herbei. Den heutigen Abend, an dem er noch einen zweiten Versuch starten würde, Emilia persönlich kennenzulernen. Polizeiabsperrband hin oder her. Sie hatten für das gemeinsame Abendessen zum Abschluss des Kongresses nebenan im Welcome-Hotel den großen Raum gemietet. Via Tunnel konnte man sogar im Regen trockenen Hauptes vom Kongresszentrum dorthin gelangen.
Plötzlich stutzte Hinrich. Was hatte Emilia Schubert da gerade gesagt? »Ein jedes Glas zu viel ist verflucht und sein Inhalt ein Teufel!« War das Zufall?
Konnte das ein Zufall sein? Oder hatte seine Leipziger Kollegin ganz bewusst ein Zitat von William Shakespeare eingestreut? Othello. Zweiter Akt.
Vielleicht besaß sie ja ein Buch mit dem Titel Zitatenschatz für Gerichtsmediziner.
Er hatte vor sechs Jahren angefangen, sich für den britischen Dichter zu interessieren. Ein Kollege hatte ihn in das Kleinkunsttheater im Moller-Haus in Darmstadt mitgenommen. Ein Kleinkünstler hatte Shakespeare aufgeführt – oder besser gelesen – und sich dabei die humorvollen Stellen herausgepickt. Hinrich war erstaunt gewesen über den zotigen Humor, den der verehrteste Dichter der Welt in seine Stücke gepackt hatte. Romeo und Julia war der Einstieg gewesen. Er kannte nur die Balkonszene. Und dieser Vortragende – richtig, Manfred Werner war sein Name gewesen, erinnerte sich Hinrich – hatte aus dem Stück die Szene gewählt, in der die Amme und Julias Mutter die Titelheldin vor der Hochzeitsnacht aufklärten. Derb. Und urkomisch. Hinrich schmunzelte bei der Erinnerung.
In diesem Moment öffnete sich die Tür des Vortragsraums. Eine Dame in der Livree des Darmstadtiums trat ein, ging schnurstracks auf Emilia zu, flüsterte ihr etwas ins Ohr und sagte dann laut: »Meine Damen und Herren, ich möchte Sie bitten, diesen Saal zu verlassen. Bitte folgen Sie mir in Richtung Notausgang. Keine Angst, dies ist nur eine Übung, aber wir sind verpflichtet, sie jetzt und hier durchzuführen. Ich bitte Sie um Ihr Verständnis.«
Was war das denn jetzt für eine Nummer?, fragte sich Hinrich.
Mit einem Mal war er hellwach. Die weißen Pferde waren von einem Moment auf den anderen in einem großen Stall in den Randzonen seines Gehirns untergebracht worden.
Hinrich sah das Gesicht von Emilia. Jegliche Farbe war daraus gewichen. Was auch immer Miss Kongresszentrum ihr gesagt hatte, es war ganz offensichtlich ein anderer Text als jener, den sie laut ins Mikro getönt hatte.
Sie hatten den Konferenzraum des Darmstadtiums verlassen, standen alle dicht gedrängt auf dem Bürgersteig. Die Räumung war problemlos vonstattengegangen, nur war es ein bisschen eng, denn die Breite des Gehsteigs reichte kaum, um die fast zweihundert Menschen ihres Kongresses aufzunehmen.
Doch momentan war das kein Problem, denn es fuhr kein einziges Auto auf der angrenzenden Straße. Hinrich sah sich um. An der Abzweigung zur Magdalenenstraße war Polizeiabsperrband quer über die Straße gezogen, dahinter standen zwei Streifenwagen, deren Blaulichter zuckten. Er richtete seinen Blick in die andere Richtung: Ein solches Band versperrte auch die Zufahrt auf den Cityring. Die Straße war leer. Auch zwischen Schloss und dem TU-Gebäude flatterte es rot-weiß. In dem Bereich vom Kongresszentrum bis zum Schloss herrschte dadurch eine unheimliche, autolose Bewegungslosigkeit. Das gab es nur in der Nacht. Bei Tageslicht wirkte es surreal.
»Was ist denn hier los?«, fragte eine weibliche Stimme neben Hinrich.
Noch bevor er den Kopf drehte, wusste er, zu wem die Stimme gehörte. Dr. Emilia Schubert. Sie stand direkt neben ihm. »Keine Ahnung. Aber eine Übung ist das nicht. Und das wissen Sie offensichtlich am besten.«
»Die Dame hat nur gesagt, dass wir den Raum evakuieren müssen, und das zügig, ohne Panik zu verbreiten«, flüsterte Emilia Schubert Hinrich zu.
»Hat sie Ihnen verraten, was los ist?«
»Nein, hat sie nicht.«
Das Zucken von nahenden Blaulichtern war eine deutlichere Antwort. Gleich vier Streifenwagen fuhren auf den Platz vor dem Haupteingang des Darmstadtiums auf.
»Verdammt, was passiert denn hier?«, murmelte Hinrich mehr zu sich selbst.
Er sah, wie eine weitere Traube von Menschen das Darmstadtium durch den Haupteingang verließ. Zwei Kongresse zeitgleich im Haus – eine denkbar unpassende Zeit für eine Übung.
Beamte der Schutzpolizei stiegen aus ihren Wagen. Hinrichs Blick schweifte über die Besetzung. Leider keiner dabei, den er persönlich kannte. Schlechte Chancen, mehr zu erfahren.
Aus dem Kongresszentrum traten noch weitere Gestalten, durch ihre Uniformen als Mitarbeiter des Hauses zu erkennen. Drei von ihnen gingen zu dem kleinen Grüppchen von Beamten, die vor dem Polizeiwagen standen.
Ein Polizeibeamter, den Hinrich zuvor nicht bemerkt hatte, kam auf ihre Gruppe zu. Die meisten seiner Kollegen mussten zu dem Mann aufschauen – Bernd Süllmeier war der größte Beamte der Darmstädter Schutzpolizei. Sie waren sich schon bei einigen Mordfällen über den Weg gelaufen. Süllmeier erkannte Hinrich und hielt direkt auf ihn zu.
»Herr Dr. Hinrich, guten Tag«, begrüßte er den Rechtsmediziner mit Handschlag. Dann wandte er sich der ganzen Gruppe zu: »Sehr geehrte Damen und Herren, würden Sie mir bitte folgen? Ich möchte Sie bitten, auf dem Karolinenplatz auf der anderen Seite des Absperrbands zu warten.«
Hinrich hatte angenommen, dass eine Gruppe von Menschen – in der immerhin annähernd hundert Prozent über einen Doktortitel verfügten – sich in solch einer Situation in ihrem Verhalten deutlich von einer Grundschulklasse unterscheiden würde, musste jedoch feststellen, dass er sich in dieser Einschätzung offenbar getäuscht hatte. Alle bombardierten den Schutzpolizisten mit Fragen. Gleichzeitig, wohlgemerkt.
»Was ist denn los?«, »Wann können wir wieder rein?«, »Wie lange müssen wir hier draußen stehen?« Und natürlich das ein wenig überhebliche, aber immer gern genommene »Ich bestehe darauf, augenblicklich mit Ihrem Vorgesetzten zu sprechen!«. Süllmeier schien Übung mit dergleichen Situationen zu haben, er hob beide Hände in der Geste des Papstes, was tatsächlich für Ruhe sorgte. »Ich kann Ihnen noch nicht sagen, was genau los ist. Sobald ich es weiß, werde ich es Ihnen mitteilen. Bitte folgen Sie mir nun zu Ihrer eigenen Sicherheit hinter das Absperrband.«
Hinrich und der Rest der Herde von Rechtsmedizinerkolleginnen und -kollegen trotteten Süllmeier hinterher. Wenig später standen sie direkt vor dem Alten Theater, das seit zwei Jahrzehnten das hessische Staatsarchiv beherbergte. Wenn Hinrich sich der Berichte richtig erinnerte, wäre darin der sicherste Platz, wenn ihnen hier etwas um die Ohren flog. Darmstadt hatte innerhalb des ehemaligen Theaterbaus ein eigenes Stahlgebäude errichtet. Aber niemand bat sie ins Staatsarchiv. Sie standen einfach auf dem Platz.
»Ein bisschen Angst macht mir das schon«, sagte die inzwischen vertraute weibliche Stimme neben ihm. »Aber Furcht gibt Sicherheit.« War es Zufall? Oder suchte sie jetzt seine Nähe? Und war das nicht schon wieder ein Shakespeare-Zitat gewesen? Furcht gibt Sicherheit? Hinrich erinnerte sich an das englische Original, das er für noch treffender hielt, und machte die Probe aufs Exempel. Er sah Emilia Schubert an und sagte: »Best safety lies in fear.«
Sie lächelte ihn an: »Hamlet.«
»Erster Akt, dritte Szene.« Eine Frau, die Shakespeare mochte. Nein, die ihn sogar zitierte. Hinrich war sich gar nicht bewusst gewesen, dass es einen Schlüssel zu seinem Herzen gab. Doch diese Frau hielt ihn gerade in der Hand. Oder trug ihn vielmehr auf der Zunge. Während Hinrich noch darüber nachdachte, fuhren zwei weitere Wagen auf den Platz vor das Kongresszentrum. Eines der Fahrzeuge erkannte er sofort. Es war ein weißer Mercedes Sprinter. Er trug keine Polizeimarkierungen an den Seiten, aber dennoch eine Blaulichtbatterie über der Fahrerkabine. War Hinrich bis zu diesem Zeitpunkt völlig entspannt gewesen, so produzierten seine Nebennieren nun reichlich Adrenalin. Der Wagen gehörte der Tatortgruppe Sprengstoff des Landeskriminalamts. Das waren die Jungs, die sich darum kümmerten, wenn irgendwelche einsamen Koffer auf Bahnhöfen herumstanden. Die prüften, ob sich im Koffer Sprengstoff befand. Vielleicht sollten seine Berufskollegen jetzt einfach das Alte Theater stürmen und sich dort in Sicherheit bringen?
Hinrich kannte den Wagen so gut, weil sein Cousin Ludger inzwischen beim Landeskriminalamt in Wiesbaden arbeitete. Er war einer jener Zauberer, die mit Sprengstoff umgehen konnten, ohne dass dieser in die Luft flog.
Aus dem Begleitfahrzeug stieg tatsächlich Ludger aus, zusammen mit einem Kollegen.
Hinrich erkannte seine Chance und wandte sich Emilia zu: »Ich werde das jetzt klären«, sagte er und bückte sich unter dem Absperrband hindurch. Er überquerte den Karolinenplatz, trat auf den Cityring. Bernd Süllmeier stellte sich ihm in den Weg. »Herr Dr. Hinrich, Sie können hier im Moment nichts für uns tun. Zum Glück nicht«, versuchte er sich in einem kleinen Scherz.
»Das weiß ich, Kollege Süllmeier«, erwiderte er und hoffte, dass die Beförderung zum Kollegen Süllmeier beiseitetreten ließ.
»Bitte, Herr Dr. Hinrich, ich darf Sie hier nicht durchlassen.«
»Polizeioberkommissar Ludger Fritsch von der Tatortgruppe Sprengstoff erwartet mich, wir haben gerade miteinander telefoniert.« Er deutete in Richtung seines Cousins. Der schaute in diesem Moment gleichfalls in Hinrichs Richtung und hob grüßend die Hand. Hinrich winkte etwas übertrieben zurück. »Sehen Sie?«
»Ich begleite Sie«, sagte Süllmeier, einen letzten Rest seiner Autorität wahrend.
Als Hinrich neben seinem Cousin stand, schlug er ihm jovial auf die Schulter. »Hallo, altes Haus.«
Ludger Fritsch wandte sich um, richtete den Blick zwanzig Zentimeter nach unten – mit seinen ein Meter fünfundneunzig schaute er wie auch Bernd Süllmeier über die meisten Menschen hinweg. »Martin – was machst du denn hier?«, wollte er wissen.
Martin Hinrich war froh, dass Süllmeier bereits wieder auf dem Weg zurück zu seinen Kollegen war und Ludgers Frage nicht hatte hören können. »Wir haben gerade telefoniert« wäre dann als Lüge aufgeflogen. Und wer weiß, vielleicht hätte ihn Süllmeier gleich wieder zurück hinters Absperrband bugsiert. »Ich bin hier bei einem Kongress. Was ist denn eigentlich los hier?«
Ludger Fritsch sah seinen Cousin an und rang ganz offensichtlich mit sich, ob er ihm die Fakten nennen sollte oder ihn besser ganz schnell vom Acker schickte.
»Denk nicht mal darüber nach«, sagte Hinrich. »Ich kann es immer noch Tante Alla erzählen.«
Ludger Fritsch grinste schräg.
Beide wussten, wovon die Rede war. Tante Alla war Ludgers Mutter. Hinrich hatte mehrere Sommer auf dem Bauernhof der Tante und des Cousins verbracht. Und auch wenn Ludger damals viel jünger gewesen war, so ungefähr sechs, während Hinrich bereits fast zwanzig Lenze zählte, hatte Hinrich nie den Eindruck gehabt, dass sein Cousin weniger verwegen gewesen wäre als er selbst. Es war eindeutig Ludgers Idee gewesen, dem Wachhund Harry Pfeffer in die Hundehütte zu streuen. Der Hund verfiel in Raserei. In eine solche, dass er den Briefträger, den er sonst immer gewähren ließ, ins Bein gebissen hatte. Der arme Kerl war ins Krankenhaus gekommen. Und Ludgers Vater hatte Himmel und Hölle in Bewegung setzen müssen, damit der Hund nicht erschossen wurde.
Ludger Fritsch legte eine seiner Pranken um Hinrichs Schulter. »Alles gut, Cousin, alles gut.«
Er stellte Hinrich seinem Kollegen vor: »Martin, das ist Rudolf Sikorski.«
Hinrich reichte dem Mann die Hand. Er war ungefähr in seinem Alter und hatte ebenfalls fast eine Glatze.
»Also, was ist hier los?«, stellte Hinrich die Frage zum zweiten Mal.
»Ein paar der Haustechniker haben eine Pappschachtel entdeckt.«
»Eine Pappschachtel?«, echote Martin Hinrich irritiert. »Wie kommt ihr darauf, dass da Sprengstoff drin ist?«
»Na ja, sie stand nicht einfach rum, sondern sie war unter einem Abdeckblech versteckt. Und vor drei Monaten hat es hier ja eine Bombendrohung gegeben. Da haben wir zwar nichts gefunden, gehen jetzt aber lieber auf Nummer sicher.«
»Und geht ihr da rein und schneidet die Kiste auf?«
Ein schräges Grinsen überzog Ludgers Gesicht. »Nein, wir schicken Teodor rein.«
»Noch einer von euch Sprengstoff-Jungs?« Hinrich erinnerte sich kurz an seine Zeit bei der Bundeswehr. Da hatte er immer die Aufgaben aufgedrückt bekommen, die kein anderer haben wollte. Klos putzen und derlei Appetitliches mehr. Offensichtlich gab es in jeder Gruppe von Menschen einen Theodor.
»Nein. Teodor ist unser kleiner Helfer aus Stahl und Mikrochips.« Ludger Fritsch trat an die Seite des Sprinters und öffnete die Schiebetür. Hinrich staunte nicht schlecht: Aus dem Innern des Transporters heraus schien ihm ein kleiner Panzer entgegenzublicken. Die Front, bestückt mit zwei Scheinwerfern an den Rändern und einer Kameralinse im Zentrum, bildete ein Gesicht. Rechts und links der blauen Karosserie erkannte Hinrich die Metallketten des Antriebs.
Keine zwei Minuten später stand der Panzer neben dem Sprinter. Ludger Fritsch trug ein Bedienpult vor dem Bauch, gespickt mit zahlreichen Tasten, zwei Joysticks und einem Monitor.
Hinrich betrachtete das metallische Raupentier. Ein großer Greifarm war in der Mitte installiert, mit zwei Greiffingern am Ende. An jedem der Gelenke befanden sich weitere Scheinwerfer und Kameras. »Wieso nennt ihr ihn ausgerechnet Theodor?«, dachte Hinrich laut nach.
»Er wird unter diesem Namen verkauft. Ist eine Abkürzung für eine unverständliche Bezeichnung aus viel zu vielen Begriffen. Aber ganz wichtig: Teodor ohne ›h‹. Darauf legt er Wert!«
Hinrich schüttelte den Kopf. »Und du steuerst ihn mit dieser Fernbedienung zu der Kiste, lässt ihn sie rausheben und fährst sie dann hierher, damit ihr sie untersuchen könnt?«
»Dann könnten wir ja auch gleich selbst reingehen«, grunzte Ludgers Kollege. »Vorn an dem Greifarm, da können wir verschiedene Werkzeuge anbringen. Teodor kriegt jetzt erst mal den Röntgenblick installiert.«
Mit routinierten Griffen lösten Ludger und sein Kollege das Greifwerkzeug vom Arm.
Hinrich sah wieder in Emilias Richtung. Er winkte ihr kurz zu. Heute Abend, beim Abschlussessen des Kongresses, würde er dafür sorgen, dass sie neben ihm saß. Und er war sich sicher, dass ihr das heute recht sein würde. Denn dann konnte er aus erster Hand erzählen, wie sein Cousin Ludger Fritsch den Sprengstoff im Paket erkannt und beseitigt hatte. Hoffentlich, ohne das Darmstadtium gleich mit in die Luft zu sprengen …
Die beiden Sprengstoffexperten hatten inzwischen die Röntgeneinrichtung installiert: An einer vertikalen Gabel hing an der einen Seite etwas, das aussah wie ein Flachbild-monitor, an der anderen ein Gerät, das ihn ein bisschen an die Wasser-Pumpgun seines Neffen erinnerte, wenn diese hier auch in dezentem Schwarz gefärbt war und nicht wie ein Exponat einer Pop-Art-Ausstellung. Die Mündung zeigte in Richtung der Monitorfläche.
»Und wie funktioniert das jetzt?«
»Ganz einfach. Wir fahren mit dem Roboter zum Paket und stülpen die Einrichtung darüber. Wie Röntgen beim Arzt. Röntgenkanone vor dir, Martin Hinrich in der Mitte und dahinter der Schirm, der das Bild sichtbar macht. Ersetze Martin Hinrich durch Pappkiste, dann passt es.«
Hinrich nickte.
Ludger Fritsch steuerte den kleinen Roboter in Richtung des Haupteingangs. Sein Kollege begleitete den Minipanzer in Friedensmission. Auf Hinrich wirkte das Gespann – der Held und sein kleiner Roboter – wie der Wissenschaftler Freeman Lowell und sein treuer Gefährte Huey aus dem Film Lautlos im Weltraum. Ebenso schnell erinnerte sich Hinrich daran, dass in diesem 1970er-Film beide dem Untergang geweiht gewesen waren. Keine gute Parallele.
Sikorski öffnete seinem elektromechanischen Kollegen die Eingangstür zum Darmstadtium und die zweite Tür dahinter, die ins Foyer führte. Dann kam er zurück.
Hinrich sah seinem Cousin über die Schulter. Auf dem Monitor konnte man das Foyer aus Teodors Perspektive erkennen.
Eine Mitarbeiterin des Darmstadtiums trat neben Ludger: »Wenn Sie ein bisschen nach links drehen, sehen Sie die Treppe, die nach unten führt.« Sie hielt ihm einen laminierten DIN-A2-Ausdruck des Grundrisses entgegen. Mit dem Finger zeigte sie auf den Zugang.
Ludger nickte. Langsam dirigierte er den Roboter in Richtung der Stufen. Hinrich fragte sich, ob der kleine Röntgenfrosch nicht doch besser den Aufzug genommen hätte, aber der Roboter hatte mit dem Gefälle keine Probleme. Zwei Minuten später konnte Hinrich die Pappkiste aus der Perspektive des Roboters erkennen. Als Ludger den Monitor auf eine andere Kamera umschaltete, sah er, wie das Röntgenequipment den Karton nun von vorn und hinten umschloss.
»So, jetzt schauen wir mal, was da drin ist«, sagte Ludger.
Er betätigte einige Schalter auf seinem Bauchladen. Der Monitor zeigte nun vier verschiedene Perspektiven. Ludger deutete auf die rechts oben. »Hier werden wir gleich sehen, was sich im Innern der Kiste verbirgt.«
Hinrich starrte gebannt auf das Bildschirmfenster in der rechten oberen Ecke. Eine Sekunde später sah er, was sich in der Pappschachtel befand.
Das war definitiv kein Sprengstoff.
Das war ein Schädel.
»Okay, das ist nicht mehr unser Metier«, sagte Ludger Fritsch. Wenige Minuten später verstaute er seinen Roboter bereits wieder im Kastenwagen.
Die Absperrung war aber immer noch nicht aufgehoben worden. Als Martin Hinrich Süllmeier danach fragte, antwortete dieser nur knapp: »Wir müssen jetzt die Spurensicherung rufen. Der Schädel, also der ehemalige Besitzer des Schädels, ist eventuell Opfer eines Mordes geworden.«
O nein, dachte Hinrich. Wenn die den Schädel als Teil eines potenziellen Mordopfers betrachteten, dann würde er heute Abend ganz gewiss nicht neben Emilia an der Tafel sitzen, sondern dazu verdonnert werden, genau diesen Schädel zu untersuchen.
Er seufzte tief.
Horndeich streckte seine Füße aus und lehnte sich im Gartenstuhl zurück. Die Sonne schien ihm auf die Nase. Er schloss die Augen. Ein perfekter Tag.
»Magst du noch einen Kaffee«, fragte seine Frau Sandra. Horndeich nickte nur. Er vernahm das Geräusch, wie der Bohnensud in seine Tasse plätscherte. Abermals gluckerte es, auch Sandra gönnte sich noch ein Tässchen. Er öffnete die Augen und sah, wie seine ehemalige Kollegin Margot Hesgart einen halben Löffel Zucker in ihre Kaffeetasse gab. »Gegen die Bitterkeit«, wie sie immer zu sagen pflegte. Auch wenn es derzeit wenig Bitterkeit in ihrem Leben gab.
Sechs Erwachsene und zwei Kinder saßen um den großen Gartentisch, den Margot und ihr Lebensgefährte Nick auf der Terrasse aufgestellt hatten. Eine Großfamilie. Wenn auch Horndeich, Sandra und ihre beiden Kinder Stefanie und Alexander natürlich nicht direkt zur Familie zählten.
Neben Margot und Nick saßen noch Margots Vater Sebastian Rossberg und dessen Freundin Chloe.
Vor einem Jahr war Margot mit Nick aus Amerika zurückgekehrt, nachdem sie dort eine Zeit lang gelebt hatten. Und nun hatten sie Anfang des Jahres dieses Anwesen gemietet. Mitten im Odenwald, in Lichtenberg, am Rande von nirgendwo, wie es Horndeich vorkam. Zweimal hatten sie sich inzwischen zu acht getroffen. Margots Vater und dessen Freundin wohnten jedoch nicht in Margots neuem Domizil, sondern im Souterrain des Hauses von Horndeich und Sandra in Darmstadt. Wie auch Horndeich hatte Sebastian Rossberg gesagt: »So weit draußen wohnen – das wäre gar nichts für mich.«
Mehr als zehn Jahre hatten Horndeich und Margot gemeinsam Mordfälle gelöst, und insgeheim hatte er gehofft, dass sie noch einmal zur Darmstädter Mordkommission zurückkehren würde. Auch wenn er und Margots Nachfolgerin Leah Gabriely im vergangenen Jahr ebenfalls zu einem richtig guten Team zusammengewachsen waren.
Als ob Margot Horndeichs Gedanken erraten hätte, sagte sie: »Ich hab es nicht bereut, werter Kollege! Gerade gestern kam wieder ein größerer Auftrag rein. Ich glaube, wir haben hier was richtig gemacht«, sagte sie und griff nach Nicks Hand.
Am Vorabend hatte Margot darüber berichtet, dass sie und Nick sich selbstständig gemacht hatten. Vor zwei Monaten war die gemeinsame Firma offiziell an den Start gegangen. »Hesgart & Peckhard« nannten sie sich, einfach nach ihrer beider Nachnamen. Sie berieten Institutionen und Firmen in Sicherheitsfragen. In unsicheren Zeiten wie diesen sollte sich das rechnen, dachte Horndeich. Er wollte gerade nachhaken, um was für eine Art Auftrag es sich handelte, als sein Handy klingelte.
Er hatte sich heute spontan freigenommen, wollte auch am morgigen Freitag noch Überstunden abfeiern. Derzeit hatten offensichtlich zahlreiche Darmstädter Kriminelle ebenfalls Urlaub genommen, denn seit Langem war es mal wieder etwas friedlicher. Er und Leah hatten die Zeit genutzt, überfällige Berichte zu schreiben und Dinge abzuschließen, die liegen geblieben waren. Nun waren ihre Schreibtische zwar nicht leer, denn es gab immer irgendetwas zu tun, aber zumindest war es ein guter Zeitpunkt, einmal zwei Tage freizumachen. Leah hatte versprochen, ihn nur im Notfall anzurufen – und genau ein solcher schien gerade eingetreten zu sein, denn sein Handy zeigte Leahs Nummer.
»Leah, was gibt’s?«
»Entschuldige, dass ich dich an deinem freien Tag störe. Ich bin gerade im Kongresszentrum. Und hier gab es einen Leichenfund. Genau genommen haben die hier einen Schädel gefunden. Wäre gut, wenn du vorbeikommen könntest.«
»Ich bin schon unterwegs«, sagte Horndeich und beendete das Gespräch, ohne zuvor eine sinnlose Diskussion darüber vom Zaun zu brechen, ob es denn auch ohne ihn ging. Er und Leah waren ein Team. Punkt.
»Doch nichts mit den freien Tagen?«, erfasste Sandra die Situation.
Horndeich rollte nur mit den Augen und erhob sich bereits. Er bedankte sich bei Margot und Nick für die Einladung, verabschiedete sich und ging zu seinem Wagen. Sie waren am Vorabend mit zwei Autos gekommen, fünf Passagiere fasste Horndeichs Mazda Xedos 9, den er nun auch schon ein paar Jahre in Ehren hielt. Dennoch hatten sie sich noch einen Zweitwagen zugelegt, da Sandra nicht nur die Kinder kutschierte, sondern inzwischen auch immer wieder Sebastian Rossberg und Chloe. Horndeich mochte den kleinen automobilen Neuzugang – er hatte ihn schließlich selbst ausgesucht: ein knallroter Lada Kalina NFR. 136 PS – ein Schnäppchen, das der Inhaber der Werkstatt, die auch seinen Mazda Xedos 9 pflegte, aus erster Hand abgegeben hatte. Der russische Wagen war eine Rarität auf deutschen Straßen, und dafür hatte Horndeich schon immer etwas übriggehabt. Zudem war er erst neun Monate alt gewesen, als der ursprüngliche Fahrer einen Schlaganfall erlitten hatte und den Wagen schweren Herzens abgeben musste.
»Und Sie können auch diesen Russen reparieren«, hatte er den Inhaber der Werkstatt, Bodo Burgschaum, gefragt.
Der hatte mit gespieltem Beleidigtsein gegrunzt: »Ist der Papst katholisch?«
Horndeich hatte gegrinst und den Wagen gekauft.
Obwohl das Kongresszentrum nur gute zwanzig Kilometer von Lichtenberg entfernt lag, brauchte Horndeich über eine halbe Stunde, bis er den Wagen vor dem Darmstadtium abstellen konnte. Zahlreiche Streifenwagen standen auf dem Vorplatz, Blaulichter zuckten. Bernd Süllmeier kam auf Horndeich zu: »Gut, dass Sie da sind, Kollege Horndeich. Ich bringe Sie rein.«
Horndeich folgte dem groß gewachsenen Mann quer durchs Foyer und am Ende desselben ein Stockwerk in die Tiefe. Weiter kam er nicht, denn die Spurensicherung hatte mit Polizeiabsperrband weiteres Vordringen verwehrt. An der Absperrung stand Horndeichs Kollegin Leah Gabriely. Horndeich war irritiert. Irgendetwas war anders. »Na, was haben wir denn hier?«, fragte er.
Neben Leah stand Martin Hinrich, der ziemlich genervt aussah. »Einen Schädel haben wir hier, einen gottverdammten Schädel, der hier nicht hergehört. Und der ausgerechnet heute gefunden wurde!«
Leah sah Horndeich an, hob kurz die Schultern. Auch sie wusste nicht, welche Laus dem Gerichtsmediziner über die Leber gelaufen war. Sie gab einen kurzen Abriss über die bisherigen Geschehnisse. Die Kiste mit dem Schädel war zur Seite geräumt worden, und die Kollegen der Spurensicherung widmeten sich dem Fuß der Calla. Zwei weitere Kollegen, ebenfalls mit weißen Spurenvermeidungsanzügen bekleidet, untersuchten Kiste und Schädel.
»Haben die Kollegen schon irgendwas rausfinden können?«, hakte Horndeich nach und deutete in Richtung von Silvia Rauch, die das Team der Puzzleteilfinder leitete.
Die hörte die Frage und kam auf Horndeich und Leah zu. »Was wir haben, sind einige Fingerabdrücke. An der Kiste und am Schädel. Das sollte uns schon mal ein gutes Stück weiterbringen.«
»Gibt es noch weitere Knochen?«
»Hier unter der Abdeckung, da ist nichts mehr. Die Techniker haben alle Bleche entfernt.«
»Vielleicht sollten wir im ganzen Haus hinter den Abdeckungen schauen. Der Rest des Skeletts könnte über das ganze Gebäude verteilt sein«, warf Leah ein.
Horndeich sah sie an. Jetzt erkannte er, was anders war. Auf den ersten Blick wirkte sie wie die Leah, mit der er seit einem Jahr zusammenarbeitete. Die Art, wie sie sich kleidete – knielange Röcke, Blusen, darüber steif geschnittene Westen, eine Garderobenauswahl, die auch seiner Mutter gut zu Gesicht gestanden hätte –, die Haare, die sie stets zu einem Dutt gesteckt trug, daran hatte sich nichts geändert. Doch heute wirkte Leah abwesend und gleichzeitig nervös. Eine kleine senkrechte Furche über der Nasenwurzel verriet die Anspannung. Offensichtlich hatte sie in der Nacht nicht viel Schlaf bekommen. Als sie vor einem Jahr aus Wiesbaden zur Mordkommission nach Darmstadt gewechselt hatte, da war diese Vertiefung steter Begleiter gewesen. Erst jetzt, wo sie wieder in Leahs Gesicht zu sehen war, fiel Horndeich auf, dass er sie monatelang nicht mehr so gesehen hatte. Das Leben in der beschaulichen Residenzstadt Darmstadt hatte Leah Gabriely offensichtlich gutgetan – zumindest bis heute.
»Alle Abdeckungen untersuchen? Das ist echt eine saublöde Idee!«, blökte Hinrich.
Horndeich wunderte sich. Was war denn mit dem los?
»Dann müssten die ja beide Kongresse abbrechen!«, legte der Rechtsmediziner noch nach.
Horndeich verstand nicht, was in ihn gefahren war. Sonst war Hinrich immer der Erste, der sich dafür einsetzte, dass er und die Kollegen der Kripo in Ruhe ermitteln konnten und durch nichts und niemanden behindert wurden.
»Vielleicht hat Hinrich recht. Wenn wir einen Verdacht haben, dass der Besitzer des Schädels getötet wurde, dann können wir immer noch das ganze Haus auf den Kopf stellen.«
Horndeich nickte. Sollte ihm recht sein.
Hinrich ging die Treppe nach oben.
»Weißt du, was mit dem los ist?«, wandte sich Horndeich an Leah.
»Keine Ahnung. Er ist schon die ganze Zeit so komisch. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde: Aber ich vermisse seinen schwarzen Humor und seine zynischen Bemerkungen.«
Als die beiden das Darmstadtium verließen, nickte ein Kollege der Schutzpolizei, den Horndeich nicht kannte, Leah zu. Sie erwiderte den Gruß.
»Na, Sie sind ja schon wieder im Dienst?«, wunderte sich der Kollege. Und Horndeich fragte sich, was er damit meinte.
Leah nickte noch einmal, und Horndeich hatte das Gefühl, dass sie nur noch schnell verschwinden wollte. Irgendetwas war passiert, von dem er bislang keine Ahnung hatte.
Alles war schiefgelaufen. Alles.
Sie hatten ihm den Schädel mitgegeben. Nicht in der originalen Pappkiste, die untersuchten sie ja noch weiter. Sondern in einem gepolsterten, kleinen Blechcontainer.
Was hatten die von der Spurensicherung ein Bohei darum gemacht, noch den letzten Fingerabdruckschnipsel auf dem Caput zu erkunden. Der ganze Nachmittag war dabei draufgegangen.
Das Fazit: Er, Martin Hinrich, würde nicht teilnehmen am großen Schlussbankett des Kongresses. Und er würde nicht neben Emilia sitzen. Und, verflixt, er musste sich eingestehen: Das machte ihm verdammt noch mal doch etwas aus. Er ging straff auf die sechzig zu, aber im Moment fühlte er sich wie der Teenager, der sich seinerzeit so Hals über Kopf in Angelina verliebt hatte. Und er da – Hinrich warf einen missbilligenden Blick auf den Beifahrersitz, auf dem er die Blechkiste angeschnallt hatte – war schuld daran. Wenn es denn ein Er war. Er würde die kommenden Stunden damit verbringen, unter anderem diese Frage zu klären.
War ja alles nicht so schlimm. Dr. Emilia Schubert war ja zu erreichen, via E-Mail, via Telefon – und dazu sicher auch per Facebook. Martin Hinrich beschloss, seinen Account in diesem sozialen Netzwerk, der so tot war wie der Besitzer des Schädels an seiner Seite, eventuell wiederzubeleben. Im Gegensatz zu Mister Schädel bestand beim Facebook-Account zumindest eine Chance auf erfolgreiche Reanimation.
Die Frankfurter Rechtsmedizin war in einem wunderschönen Jugendstilgebäude in der Frankfurter Kennedyallee untergebracht. Immer, wenn Martin Hinrich daran zweifelte, ob er doch eine andere Stelle antreten sollte, machte er einen kleinen Spaziergang und betrachtete seine Arbeitsstätte von außen. Besser ging es nicht. Er hatte in den vergangenen Tagen zahlreiche Vorträge gehört von Kollegen aus aller Herren Länder. Und alle PowerPoint-Präsentationen zeigten meist auf Folie drei, vier oder fünf das Gebäude, in dem die Vortragenden arbeiteten. Nun, da hatte er eindeutig das große Los gezogen. Sein Institut residierte in einer Villa und nicht im Keller irgendeines Nachkriegsgebäudes.
Hinrich stellte seinen Wagen, einen 5er-BMW-Kombi, achtzehn Jahre alt, V8-Motor und genügend PS, sodass er sich die Zahl nicht einmal merken musste, auf dem Parkplatz des Instituts ab.
Als er die Blechkiste ins Institut trug, lugte die Sekretärin aus dem Büro neben dem Eingang hervor. »Ach, Herr Dr. Hinrich, ich dachte, Sie wären noch den Rest des Tages auf dem Kongress?!«, sagte sie. Und bewirkte damit nicht, dass Hinrich sich besser fühlte. Er brummte etwas Unverständliches und bog direkt in Richtung der Sektionsräume ab, die im Souterrain lagen.
Als er im Sektionsraum eins angekommen war, stellte er die Kiste auf einem der Seitentische ab. Er entledigte sich seiner Jacke und zog ganz automatisch die Kittelschürze über, auch wenn nicht zu befürchten stand, dass die genauere Inspektion des Schädels irgendwelche Spritzer verursachen würde.
Seine Assistentinnen und Assistenten waren bereits alle nach Hause gegangen.
Hinrich öffnete die Blechkiste, nachdem er sich die Latexhandschuhe übergezogen hatte. Er griff nach dem knöchernen Haupt und legte es auf einem der Sektionstische ab. Nicht, dass es hier viel zu sezieren gab. Über Gehirn, Lunge, Leber und Magen des Verstorbenen würde er wohl kaum etwas herausfinden können. Und der erste Augenschein hatte klargemacht: Wem immer der Schädel gehört hatte, Kopfverletzungen hatte derjenige keine erlitten, denn es fanden sich keinerlei Hinweise auf stumpfe Gewalteinwirkung, die zum Tod hätte führen können.
Hinrich seufzte. Er zog sich einen der Rollhocker heran und sah dem Schädel in die hohlen Augen.
»Wer bist du?«, sprach er.
Natürlich bekam er keine Antwort.
Die wichtigste Frage, die es zuallererst zu klären galt, war jene, ob der Schädel zu einer Person gehörte, die länger als fünfzig Jahre tot war. Dann machte die Suche nur noch wenig Sinn, denn der Tote war unbekannt, der Mörder wahrscheinlich über siebzig oder schon tot. Nein, eigentlich war das die zweitwichtigste Frage. Die drängendste war jene, ob es sich überhaupt um einen menschlichen Schädel handelte. Daran hatte Hinrich allerdings keinerlei Zweifel. Rein theoretisch bestand natürlich die Möglichkeit, dass das Haupt eines Menschenaffen vor ihm lag, doch auch wenn ihm kein Unterkiefer zur Verfügung stand, war dennoch klar, dass die Zähne augenfällig auf einen Menschen schließen ließen. Und das Hinterhauptsloch, also die Schnittstelle zwischen Rückenmark und Gehirn, lag mittig im Schädel und nicht näher am Rücken wie bei den Hominiden.
Ebenso eindeutig war für Hinrich, dass der Besitzer des Schädels ein Mann gewesen sein musste. Die Glabella zwischen den Augenbrauenbogen oberhalb der Nasenwurzel etwa war deutlich ausgeprägt. Und auch der Bereich um das Kiefergelenk und das Innen- und Mittelohr herum war sehr markant. Mister Nobodys Gene trugen definitiv ein Y-Chromosom.
Also zurück zu Frage eins: Wann hatte der Besitzer des Schädels das Zeitliche gesegnet?
Auf den ersten Blick wirkte die knöcherne Oberfläche perfekt. Der Schädel hätte in jedem Museum in einer Glasvitrine stehen können. Die Oberfläche schien regelrecht poliert zu sein. Bei Knochen, die älter waren als fünfzig Jahre, zeigten sich oft Usuren, also Rissbildungen in den äußeren Schichten. Hier waren keine zu sehen. Auch blätterte nichts von der äußeren Schädelschicht ab. Nein, so lange konnte der Kerl noch nicht tot sein.
»Der Schädel hatte einmal eine Zunge und konnte singen«, murmelte Hinrich. Shakespeare. Hamlet. Die Szene, in der Hamlet den Schädel in der Hand hält und einen seiner Monologe beginnt. Aber das half ihnen jetzt auch nicht weiter. Weder Hamlet noch Hinrich.
Der Rechtsmediziner blickte auf seine Armbanduhr. Das Zifferblatt zeigte Viertel vor acht. Hinrich griff zu seinem Diktiergerät und vertraute ihm all die Geheimnisse an, die er in den vergangenen Minuten bei der ersten Begutachtung des Schädels herausgefunden hatte.
Er drückte die Pausetaste. Alle seine Kollegen befanden sich bereits seit fünfundvierzig Minuten an der Tafel des Schlussbanketts. Ließen es sich schmecken. Und er saß hier. Vielleicht könnte er die restlichen Erkenntnisse in den folgenden dreißig Minuten gewinnen, dann hätte er noch Zeit, um nach Darmstadt zurückzufahren. Emilia zu treffen.
Die Türglocke erklang. Wer um alles in der Welt begehrte jetzt noch Einlass in die Gewölbe der Toten? Wahrscheinlich hatte einer der Assistenzärzte etwas vergessen. Andererseits hatten die alle Schlüssel. Vielleicht hatte aber einer von ihnen genau diesen Schlüssel zurückgelassen … Hinrichs Kollegin aus dem Sekretariat, die gewöhnlich die Besucher hereinließ, war inzwischen im wohlverdienten Feierabend. Also stieg Hinrich selbst die Treppen zum Erdgeschoss nach oben. Im Sekretariat betätigte er die Gegensprechanlage. Noch bevor er etwas sagte, erkannte er, wer vor der Tür stand: Die Kamera zeigte, wenn auch etwas verzerrt, das Abbild von Dr. Vasques aus Sevilla. Jener Kollege, der sich am Abend zuvor so für die kulinarischen hessischen Spezialitäten hatte begeistern können. Was um aller Welt wollte der hier?
Hinrich drückte auf die Taste für den Türsummer. Vasques trat ein und stand wenige Sekunden später leibhaftig vor Hinrich: »Dr. Vasques – was führt Sie hierher?«
»Der S’ädel«, sagte der Kollege mit stark spanischem Akzent. Aber immerhin war er einer der ausländischen Gäste, die der deutschen Sprache mächtig waren.
»Der Schädel?«, echote Hinrich.
»Ist er ›istoris‹?«, wollte Vasques wissen.
»Ich weiß es nicht«, antwortete Hinrich ehrlich. »Sie sind nicht beim Bankett?«
Vasques winkte ab. »Eine Bankett – Ihre S’ädel ist viel interessanter!«, beteuerte er. »Ich habe mich auch bes’äftigt mit alte Knochen«, sagte er. »Können Sie mir die S’ädel zeigen?«
»Gern, folgen Sie mir«, sagte Hinrich. Und mit einem Mal war alle Traurigkeit verflogen. Natürlich hätte er Emilia gerne getroffen. Aber dass ein spanischer Kollege ihn aufsuchte, um mit ihm nun quasi zu forschen, das entschädigte für das entgangene Tête-à-Tête, wobei er ja noch nicht mal sicher sein konnte, dass es zu einem solchen gekommen wäre.
Hinrich und Vasques hatten den Sektionssaal knapp erreicht, als erneut die Türglocke anschlug.
»Bitte entschuldigen Sie mich«, sagte Hinrich und stieg die Treppen wieder hinauf. Was war denn heute Abend los?
Das nächste Antlitz, das auf dem Monitor der Türüberwachung erschien, kam Hinrich ebenfalls bekannt vor. Er hatte den Namen des Kollegen nicht mehr auf dem Schirm, aber wenn er sich recht erinnerte, handelte es sich um den Berufsgenossen aus der Charité in Berlin. Wieder gab er die Tür frei. Sekunden später stand der Kollege vor ihm. »Dr. Hinrich! Ich habe gar nicht damit gerechnet, Sie hier anzutreffen. Aber ich konnte nicht umhin, es zu versuchen. Was wissen Sie über den Schädel?«
Hinrich hatte sich fürchterlich geärgert, dass er aus dem Kongress herausgerissen worden war, um seiner Dienstpflicht nachzukommen. Was er völlig unterschätzt hatte: Der Buschfunk hatte es an alle Kollegen weitergetragen, dass er sich um den dubiosen Schädel kümmern musste. Ein Lächeln umspielte seinen Mund. »Dr. …«, zögerte er kurz und gab damit seinem Gegenüber das Stichwort, seinen Namen zu nennen.
»Kleinbasler, Dr. Kleinbasler vom Rechtsmedizinischen Institut in München.«
Na gut, irren war menschlich, dachte Hinrich. »Herr Kollege Kleinbasler, kommen Sie doch einfach mit. Unser spanischer Kamerad ist auch schon da.«
Er führte Kleinbasler in das Souterrain, wo Vasques immer noch wartete. Zu dritt betraten sie den Sektionsraum, der völlig aufgeräumt und steril wirkte, abgesehen vom glotzenden Schädel auf Sektionstisch eins.
»Ein Mann oder eine Frau?«, fragte Vasques.
»Ein Mann.«
Wieder klingelte es an der Tür. Hinrich nickte seinen beiden Kollegen zu. »Wenn Sie kurz warten, ich bin gleich wieder bei Ihnen«, sagte er.
Diesmal zeigte die Videokamera zwei Porträts: Zum einen dieser Typ aus … Hinrich meinte sich zu erinnern, es wäre Rostock gewesen, aber nach dem Berlin-München-Desaster war er sich unsicher. Und neben ihm: Dr. Emilia Schubert. Hinrichs Herz machte einen Satz, höher, als er jemals auf dem Jahrmarkt den Lukas gehauen hatte – worin er nicht schlecht gewesen war.
»Hallo Martin«, begrüßte ihn der Unbekannte. Hinrich erinnerte sich wieder. Einer dieser Typen, die jeden duzen, der nicht bei drei auf den Bäumen war.
Emilia nickte nur. Dann sagte sie: »Du wolltest mir berichten, was heute Nachmittag passiert ist. Und wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg halt zum Propheten …«
»Kommt mit«, übernahm Hinrich einfach das Du. Auch wenn es eigentlich nur der Dame galt.
Zwei Minuten später saßen sie um den Sektionstisch herum. Hinrich hatte aus dem Sitzungsraum des Erdgeschosses mit dem Aufzug ein paar Stühle nach unten gebracht. Für gewöhnlich waren die in einem Sektionssaal ja weniger vonnöten.
»Wie alt ist er?«, wollte Emilia wissen.
Hinrich erklärte, dass die Außenhaut des Schädels in einem außergewöhnlich guten Zustand war. Das konnte bedeuten, dass der Schädel vor wenigen Jahren noch im Kopf eines Lebenden platziert war oder dass ihn jemand sehr sorgfältig aufgehübscht hatte.
»Schauen Sie die Zähne!«, sagte Vasques und nahm damit das voraus, was ohnehin Hinrichs nächster Schritt gewesen wäre.
Schon als er den Schädel das erste Mal begutachtet hatte, war ihm aufgefallen, dass keinerlei Füllungen oder Inlays in die Zähne eingearbeitet waren. Das konnte drei Gründe haben: Entweder war sein Besitzer nachlässig und kam aus einem ländlichen Bereich, wo es keine Zahnärzte gab, oder aber der Schädel war so alt, dass die Zahnmedizin zu Lebzeiten seines Besitzers noch nicht so weit fortgeschritten war. Die dritte Möglichkeit war, dass jemand die Goldinlays herausgebrochen hatte.
»Werte Kolleginnen und Kollegen«, sagte Hinrich, und sein Blick traf sich mit jenem von Emilia, »ich würde Sie gerne zu einem guten Tropfen einladen, auf jenen Unbekannten, der hier in unserer illustren Runde weilt.«
Hinrich ging zu dem kleinen Seitenschrank, der unauffällig in der Ecke des Raums platziert war. Er öffnete die unterste Tür und entnahm ihr eine Flasche seines Lieblingswhiskys. Ein achtzehnjähriger Aberlour mit reiner Sherryfass-Reifung. Zum Glück hatte er in diesem Schränkchen auch zehn Whiskygläser verstaut. Er nahm fünf, stellte sie neben den Schädel auf den Sektionstisch und befüllte sie mit dem edlen Tropfen. Hinrich verteilte die Gläser. Er hob das seine und sagte: »Auf unseren Fremden, dem wir vielleicht noch das eine oder andere Geheimnis entlocken können.«
Sie alle hoben ihr Glas, man prostete einander zu, und sie tranken den Whisky. Nun, die drei männlichen Gäste stürzten die bernsteinfarbene Flüssigkeit hinunter. Nur Hinrich und Emilia ließen das edle Destillat im Mund kreisen, bevor sie es nach fast einer Minute hinunterschluckten. Emilia blinzelte Hinrich zu. »Also, die S’ähne«, sagte Vasques, stand auf und griff sich den Schädel. »Sind keine Füllungen in die S’ähne«, sagte er.
So viel hatte Hinrich auch schon herausbekommen. »Aber hier hat er Karies.« Er deutete auf einen oberen Backenzahn, in Fachkreisen als 26 bezeichnet, den ersten molaren Backenzahn oben links.
Hinrich hatte sich immer nur am Rande mit Zahnheilkunde beschäftigt. Nicht die Toten hatten sein Interesse dafür geschärft, sondern die Lebenden. Meist Frauen, die nach Gewaltakten in Beziehungen Zähne eingebüßt hatten. Hinrich hatte insgesamt zwei Fortbildungen besucht, die ihm ein wenig Fachwissen in diesem Bereich verliehen hatten.
Der Kollege aus München war neben Vasques getreten und deutete auf den rechten Oberkiefer. »Hier fehlt ihm der 44er«, sagte er und fügte gleich hinzu: »Auch der 45er hat ein fettes Loch.« Die beiden prämolaren Backenzähne unten rechts.
Emilia meldete sich zu Wort, direkt an Hinrich: »Dieses Gebiss lässt eigentlich nur einen Schluss zu: Sein Besitzer ist sicher mehr als hundert Jahre tot, wahrscheinlich sogar mehr als zweihundert. Kein Mensch der vergangenen hundert Jahre hätte so viel Karies im Mund gehabt ohne eine einzige Füllung. Und ohne eine Beseitigung der Karies.«
Hinrich nickte. Das wäre auch seine Schlussfolgerung gewesen.
»Haben Sie noch eine S’luck von diese leckere Whisky?« Vasques. Offenbar ein Kenner.
Hinrich schenkte die nächste Runde ein, und wieder prosteten sie sich zu.