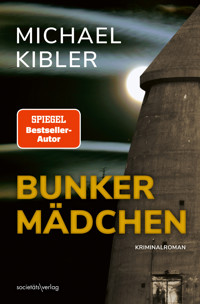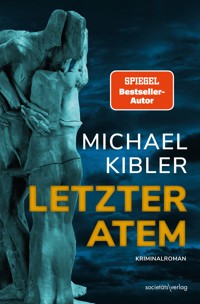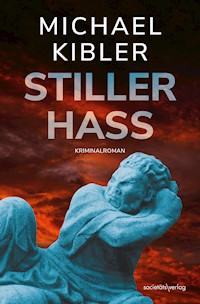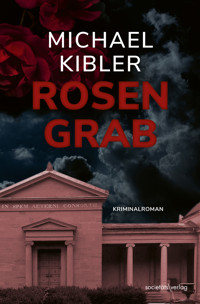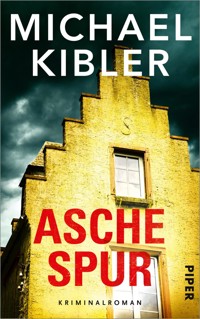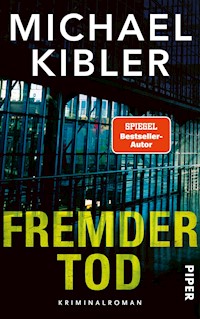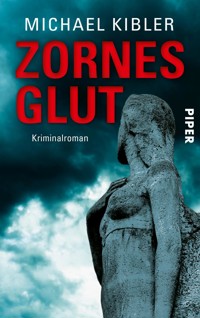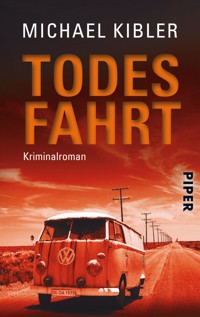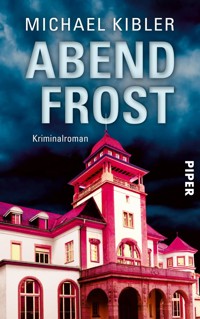9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Hauptkommissar Steffen Horndeich steht vor einem Rätsel. Erst wird in Darmstadt ein ermordeter Professor gefunden, dann die Leiche eines arbeitslosen Physiotherapeuten in Wiesbaden. Zwei Männer, die sich nicht kannten und sich offenbar nie begegnet sind. Und doch gibt es eine grausame Parallele: Beide Opfer wurden mit derselben Tatwaffe hingerichtet. Gemeinsam mit seiner Kollegin aus Wiesbaden sucht Horndeich fieberhaft nach einer Verbindung zwischen den Männern. Da geschieht noch ein Mord …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für die Kleine Rebellin
ISBN 978-3-492-97557-5
Dezember 2016
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2016
Umschlaggestaltung: semper smile München
Umschlagabbildung: Joachim S. Müller (Turm); bunnavit/pangsuk/Shutterstock (dunkler wolkiger Himmel)
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
TOBIAS I
Ich ziehe mit dem Springer auf G5.
Wanja zieht mit der Dame. Ich muss mit dem Springer wieder zurück.
»Er ist wirklich klug, Ihr Sohn«, sagt Wanja zu meiner Mutter. »Mit neun Jahren war ich nicht so klug.«
Seit einer Viertelstunde ist Wanja bei uns in der Wohnung. Wie meistens hat er das Schachspiel mitgebracht. Es ist ein großes Spiel mit schönen Figuren. Ich mag sie noch immer. Die einen sind aus ganz dunklem Holz, die anderen aus hellem. Und sie glänzen so, wie Mama immer sagt, dass ich meine Schuhe putzen soll. Aber so, wie die Figuren glänzen, so hab ich das noch nie hingekriegt. Ich glaube, Wanja putzt die Figuren auch jeden Tag.
Ich weiß nicht, wie er es hingekriegt hat, aber nur ganz wenige Züge danach steht sein Turm mitten auf dem Spielfeld. So gut wie Wanja werde ich wohl nie Schach spielen können.
Mama geht an mir vorbei und streicht mir mit ihrer Hand durchs Haar. Ich glaube, sie hat gar nicht gehört, was Wanja gesagt hat. Ich kenne das. Ihre Schritte werden immer schneller, in zehn Minuten muss sie gehen. Spätschicht.
Ich überlege. Ich kann Wanjas Dame bedrohen, doch dann erkenne ich: Wenn ich den Springer in Richtung Mitte ziehe, ist gleichzeitig auch sein Turm in Gefahr. Ich muss lächeln. Und ziehe.
»Es kann sein, dass es heute etwas später wird. Mein Chef sagt, dass wir nach meinem Dienst noch etwas besprechen müssen.«
Wanja nickt. »Das ist kein Problem. Ich bin ja da.« Dann zaubert er seinen Läufer aus einer Ecke hervor, die ich völlig übersehen habe. Und fort ist mein Springer.
Ich überlege krampfhaft. Nicht gut gelaufen. Und dieser Läufer bedroht jetzt meine Dame und ist auch noch gedeckt. Mist!
Wanja sagt, ich wäre schon viel besser geworden in den letzten Wochen. Kann ja kaum sein. Ich habe noch kein einziges Spiel gegen Wanja gewonnen. Aber vielleicht hat er ja doch recht. Ich glaube, am Anfang haben die Partien nur fünf Minuten gedauert. Jetzt kann es schon mal eine Viertelstunde sein. Vorgestern waren es sogar neunzehn Minuten, hat Wanja mir gesagt.
Er ist streng. »Berührte Figur zieht«, da gibt es nichts zu deuteln. Und dann noch: »Losgelassene Figur steht«.
Während ich jetzt Himmel und Hölle in Bewegung setze, damit Wanja meine Dame nicht schlagen kann, kommt Mama wieder zu mir. Sie legt mir beide Hände auf die Schultern, gibt mir einen Kuss aufs Haar und sagt: »Tschüss, mein Schatz, sei brav und mach deine Hausaufgaben.«
»Tschüss, Mama«, sage ich. Und ärgere mich: Meine Dame ist futsch.
MONTAG, 6. JUNI
Anton freute sich. Sein Papa hatte das Versprechen gehalten. Heute würden sie gemeinsam einen langen Spaziergang machen. Es war der erste Urlaubstag seines Papas, und er war bester Laune. Genauso wie Horia. Papa hatte ihn von der Leine gelassen, auch wenn Anton wusste, dass er das eigentlich nicht durfte. Horia reichte ihm bis zur Hüfte. Papa und Mama hatten ihn aus Rumänien. Anton hatte sie gefragt, zu welcher Rasse Horia gehörte. Aber eigentlich hätte er das nicht fragen müssen. Er wusste, dass das irgendeine Mischung war. Die Nasenspitze verriet, dass auch ein bisschen Schäferhund mit drin war. Und da Horia aus Rumänien kam, hatte Papa ihm einen rumänischen Vornamen gegeben.
Horia hatte jetzt seine fünf Minuten, wie Mama das immer nannte. Er schoss den Waldweg entlang, bis er nicht mehr zu sehen war. Und fünfzehn Sekunden später stand er wieder hechelnd vor Anton, holte sich eine kleine Streicheleinheit ab und raste sofort weiter durch den Wald.
Gemeinsam waren sie am Böllenfalltor-Stadion entlanggelaufen, in dem der Fußballverein der Stadt, der SV 98, seine Heimspiele austrug. Dabei interessierte sich nur Papa für Fußball, Mama überhaupt nicht – und er so ein bisschen. Aber mehr, weil Papa das mochte.
Er war acht gewesen, als Papa ihn gefragt hatte, ob er nicht auch mal ein Fußballstar werden wolle. »Auf gar keinen Fall«, hatte er voller Empörung gesagt. Papa hatte gefragt: »Wieso denn nicht?« Und er hatte daraufhin geantwortet, dass er nicht wollte, dass man seine ganzen Arme mit Bildchen anmalt. Papa hatte angefangen zu lachen und sich kaum mehr eingekriegt.
Jetzt legte er seinen Arm um Antons Schulter, also vielmehr um seinen Nacken. Der Junge fragte sich manchmal, ob er überhaupt wachsen würde. Alle Mädchen in der Klasse waren schon einen Kopf größer. Und bei den meisten seiner Kumpels konnte er schon die Nasenlöcher von unten betrachten. Er mochte diese Spaziergänge mit Papa. Vielleicht auch deshalb, weil der ihn nicht ständig irgendetwas fragte oder irgendwas von ihm wollte. Mit Papa konnte er einfach durch den Wald streifen und auch eigenen Gedanken nachhängen. Mama hingegen wollte ständig irgendwelche Dinge von ihm wissen. Wie es in der Schule gewesen war. Ob der blaue Fleck am Schienbein schon weg wäre, den er selbst überhaupt nicht mehr beachtet hatte. Ob es ihm nicht zu warm sei, zu kalt sei oder doch zu warm. Sebastian, sein bester Freund, sagte immer, dass weder sein Papa noch seine Mama sich für ihn interessierten. Manchmal dachte Anton, dass das vielleicht gar nicht so verkehrt wäre. Also, wenn Mama sich nicht ganz so sehr für ihn interessieren würde. Gut, seit Horia da war, war es ein bisschen besser geworden. Abgesehen davon, dass Mama immer betonte, dass Horia ja sein Hund war. Und er für ihn sorgen müsse. Anton konnte sich gar nicht mehr daran erinnern, dass es ihm einmal so wichtig gewesen war, einen Hund zu haben.
Wo war Horia überhaupt?
Papa rief nach ihm. Aber Horia tauchte nicht auf. Er selbst rief jetzt den Namen seines Hundes.
»Aber ihr lasst ihn nicht ohne Leine laufen!«, hatte seine Mama noch gesagt. Wie sie es immer tat. Papa und er hatten sich nur kurz angesehen, und Papa hatte ihm zugeblinzelt. Wir beide wissen genau, was der Hund manchmal braucht, hatte dieser Blick gesagt. Anton selbst hätte es auch nicht lustig gefunden, wenn er nur an der Leine nach draußen dürfte.
»Hast du gesehen, in welche Richtung er zuletzt gerannt ist?«, wollte Papa von ihm wissen.
Anton zeigte nach links in den Wald. Sie liefen gerade die Backofenschneise entlang. Er kannte die ganzen Wege zwischen Darmstadt, Ober-Ramstadt und Roßdorf. Mit Sebastian fuhr er immer auf seinem Fahrrad durch den Wald. Papa hätte ihn besser mal gefragt, ob er ein Radprofi werden wollte. Wenn sie Rennen fuhren, war es Sebastian bisher nie gelungen, ihn einzuholen.
Papa bog nach links in den Wald ab und rief wieder Horias Namen. Anton folgte ihm. Auch er rief nach Horia. Aber der gab keinen Laut von sich.
Als er weiter in den Wald hineinging, sah er zwei Dinge: den Lenker eines Fahrrads und Horias wedelnden Schwanz.
»Bleib, wo du bist!«, rief sein Vater. Und Anton konnte sich nicht erinnern, dass der Ton in seiner Stimme jemals so scharf gewesen war.
»Steffen?«
Steffen Horndeich drehte sich um. Er kannte die Stimme, wusste aber im Moment nicht, wo er sie einordnen sollte. Soeben hatte er seinen Wagen, einen auberginefarbenen Mazda Xedos 9, auf dem Parkplatz vor dem Polizeipräsidium Hessen-Süd abgestellt. Er war spät dran heute.
Er erkannte die Frau mit dem langen dunklen Haar. Chiara Daunberg. Aber was hatte sie hier bei der Polizei zu suchen? Horndeich trat auf sie zu. »Chiara?«
»Steffen! Gut, dass ich dich treffe. Das habe ich ja gar nicht zu hoffen gewagt. Ich hätte dich gleich auf dem Handy angerufen.«
Seit dem vergangenen Jahr war Chiara die Vorsitzende des Elternbeirats im Kindergarten, er selbst war Stellvertreter. Sie waren einstimmig gewählt worden. Auch Horndeichs Frau Sandra hätte sicher Spaß daran gehabt, sich im Elternbeirat zu engagieren, doch vor elf Monaten war ihr gemeinsamer Sohn Alexander auf die Welt gekommen. Und damit blieb nur noch wenig Zeit zwischen Stillen und Windeln wechseln.
»Was kann ich für dich tun?«, wollte Horndeich wissen.
»Ludwig ist verschwunden.«
Horndeich kannte Chiaras Mann Ludwig. Er hatte ihn zwei- oder dreimal auf Elternabenden oder beim Sommerfest gesehen. Der jüngste Sohn der beiden, Gerald, war genauso alt wie Horndeichs Tochter Stefanie. Beide würden in wenigen Monaten ihren fünften Geburtstag feiern. Die beiden Kinder verstanden sich sehr gut, wenn sie sich nicht gerade im Sandkasten Kuchenförmchen an den Kopf schmissen oder ausgiebig diskutierten, ob Kackaschleim ein schlimmeres Schimpfwort war als Pupspipi. Horndeich hätte nie gedacht, dass seine Tochter, die irgendwann eine junge Dame sein würde, eines dieser Worte auch nur einmal in ihrem Leben aussprechen würde. Hatte er eigentlich selbst damals …?
»Was meinst du mit ›Er ist verschwunden‹?«, hakte Horndeich nach. Ganz automatisch sah er auf seine Armbanduhr. Auch in Zeiten der Smartphones trug er einen Chronografen. Seine Frau Sandra hatte ihm vor einem halben Jahr eine Omega Speedmaster geschenkt, jenes Modell, das auch die Astronauten beim ersten Mondbesuch getragen hatten. Sie war höllisch schwer, definitiv ein Beleg für die Erdanziehung, aber er mochte dieses Monstrum. Und die Zeiger des Monsters zeigten im Moment zwanzig nach elf.
»Er ist heute Morgen ganz früh mit seinem Rad losgefahren. Du weißt ja, wenn er einen freien Tag hat, dann fährt er gern die Strecke quer durch den Odenwald. Er startet um sieben Uhr und ist spätestens um neun Uhr wieder da.«
»Na ja, dann ist er ja noch nicht so lange überfällig.«
»Steffen, wenn ich nach irgendetwas die Uhr stellen kann, dann nach meinem Mann. Wenn er sagt, er ist um neun da, dann weiß ich, dass er um neun da ist. Du kennst ihn doch!«
Da lag zwar keine Panik in Chiaras Stimme, doch sie schnarrte ganz leicht. Wie ein Lautsprecher mit einem Riss in der Membran.
»Hast du versucht, ihn anzurufen?«, leitete Horndeich die nächste Phase bei der Bekämpfung eines vermeintlichen Vermisstenfalles ein.
»Steffen, ich bin doch nicht blöd. Ludwig fährt immer ohne Handy. Er hat alles zu Hause gelassen. Darüber ärgere ich mich schon lange, aber er ist da unbelehrbar. Inzwischen habe ich alle Krankenhäuser angerufen, aber die wissen nichts von einem verletzten Fahrradfahrer. Irgendetwas stimmt da nicht. Vielleicht ist er gestürzt und liegt irgendwo mit gebrochenen Knochen im Wald?«
»Komm mit in mein Büro, dann reden wir weiter.«
Fünf Minuten später saßen sie in Horndeichs Dienstraum. Darin standen zwei Schreibtische. Der eine völlig verwaist, der andere bedeckt mit ein paar Schnellheftern und Papieren. Vor einem knappen Jahr war Horndeichs Kollegin Margot Hesgart nach Amerika ausgewandert, um mit dem amerikanischen Polizisten Nick Peckhard zusammenzuleben. Über zehn Jahre lang hatten sie und Horndeich gemeinsam Fälle gelöst, und Margot fehlte ihm sehr. Als Chefin und als Kollegin. Er hatte die Leitung kommissarisch übernommen. Die Dienststelle suchte derzeit nach einer Nachfolgerin für Margot – händeringend. Doch bis heute leider vergeblich. Gerlinde Schlüter hatte sich für den Job qualifiziert, war aber an der Praxis gescheitert und nach dreimonatiger Probezeit wieder verabschiedet worden. In ihrem Zeugnis stand »in beiderseitigem Einvernehmen«. Doch alle, außer vielleicht Gerlinde Schlüter selbst, denn das würde ihr Ego nicht zulassen, wussten, dass das im besten Falle geschmeichelt, realistisch betrachtet allerdings einfach nur gelogen gewesen war.
Horndeich bot Chiara den Platz am leeren Schreibtisch an. Er holte für sie beide einen Kaffee, dann setzte auch er sich.
»So, jetzt noch mal von Anfang an. Wann ist Ludwig losgefahren, wann hätte er zurück sein sollen? Und wie kommst du darauf, dass ihm etwas passiert ist?«
»Ludwig ist um sieben Uhr losgefahren. Er hat sich von mir verabschiedet, ich lag noch im Bett. Er wollte die mittlere Runde fahren, das sind rund dreißig Kilometer. Das heißt, er hätte allerspätestens um kurz vor neun wieder zu Hause sein müssen. Er fährt die Strecke durch den Wald, an der Grube Prinz von Hessen vorbei. Dann immer weiter Richtung Nieder-Beerbach, die Hutzelstraße entlang. Irgendwann bei Ober-Beerbach dreht er um, sodass er ziemlich genau eine Stunde und fünfundvierzig Minuten für die Strecke benötigt.«
Horndeich hatte bereits Google Maps aufgerufen und die Strecke, die Chiara angegeben hatte, eingegeben.
»Chiara, du hast gesagt, du hast alle Krankenhäuser angerufen?«
»Ja. Er ist nicht da, und auch auf keine der unbekannten Personen passt seine Beschreibung.«
»In welchem Umkreis hast du telefoniert?«
»Dreißig Kilometer, sogar inklusive Frankfurt.«
Horndeich und sie hatten im Elternbeirat des Kindergartens stets gut zusammengearbeitet. Etwa bei diesem Fall mit der Schaukel. Bei der war vor über einem halben Jahr eine der Streben durchgebrochen, und niemand in der Stadt hatte reagiert. Also hatten Chiara und er einen Brief als Elternbeirat an die Stadt formuliert, freundlich, aber bestimmt. Und zwei Wochen später war die Schaukel in neuem Glanz erstrahlt. Kleinkram. Aber wichtig für die Kinder. Und im vergangenen Jahr hatten sie gemeinsam das Sommerfest organisiert: Wer brachte welchen Salat mit, wann würden die kleinen Ballerinas ihren Auftritt haben und wann Gerald mit seinen Kumpels, die sich schon als Gang fühlten, mit ihrer Rap-Show auf die Musik von 50 Cent? Sie hatten im Vorfeld Geld gesammelt, weil es den Offiziellen im Kindergarten untersagt war, das zu tun. Unterm Strich konnte Horndeich sagen, dass Chiara sich vor ihm als eine Person gezeigt hatte, die sehr klar war in ihren Ansichten, die gut organisieren und kleine Unstimmigkeiten elegant schlichten konnte. Und die alles andere als hysterisch war. Wenn diese Chiara sagte, ihr Mann sei verschwunden, dann war Horndeich durchaus geneigt, ihr zu glauben. Und dennoch musste er ein paar unbequeme Fragen stellen. »Chiara, jetzt frage ich dich als Polizist, und ich muss das fragen: Gibt es Schwierigkeiten in eurer Ehe?«
Chiara schüttelte den Kopf. »Nein. Wirklich nichts Besonderes. Unsere Älteste, Nicola, ist ja schon aus dem Haus, das weißt du sicher. Ich bin mit Ludwig nicht immer einer Meinung, wie großzügig wir sie noch unterstützen sollten. Er sagt, sie solle sich einen Job suchen, aber ich bin der Meinung, dass wir genug Geld haben, um sie auch noch zwei Jahre unterstützen zu können. Leonora wohnt noch bei uns, sie macht in zwei Jahren ihr Abitur, da gab es wenig Reibungspunkte. Leonora lebt auch schon zum Großteil ihr eigenes Leben. Du weißt ja, ich bin nicht so die Glucke. Und Ludwig ist auch nicht der Papa, der gleich zur Schrotflinte greift, wenn da mal ein Junge auftaucht. Und auch was Gerald angeht, gibt es wenig Streit. Mit dem dritten Kind hat man weniger Stress. Da hat man dann ja alles schon mal durchgespielt.«
Horndeichs Erfahrung in Bezug auf Kindererziehung reichte noch nicht so weit wie jene von Chiara. Stefanie wurde im August fünf, und Alexander war ein Säugling. Aber in seinem Job hatte Horndeich schon oft erfahren, wie Eifersucht oder auch einfach nur ständige Nörgeleien Ehen an ihr Ende gebracht hatten. Sei es mit einem Messer oder auch nur dadurch, dass einer der Beteiligten plötzlich verschwand. »Chiara, hat Ludwig eine Affäre? Hast du eine, von der er nichts wusste? Oder von der du glaubst, dass er nichts davon weiß?«
Chiara trank einen Schluck Kaffee und setzte dann die Tasse wieder behutsam ab. »Ich weiß, Steffen, das sagen dir wohl alle Ehefrauen – aber nein. Weder er noch ich. Ich habe in meinem Leben einmal eine Affäre gehabt, aber das ist sechzehn Jahre her. Und von dieser Affäre weiß mein Mann seit knapp fünfzehn Jahren. Wir haben uns danach zusammengerauft, sind einen wirklich guten Weg gegangen. Einen Weg, auf dem wir Dinge in unserer Ehe verändert haben. Ludwig hatte keine Affären. Und er hat auch heute keine. Zumindest nicht, soweit ich weiß. Und wenn er eine hätte, wenn er mich wirklich verlassen wollte, dann würde er das mit drei Koffern, all seinen Instrumenten und unserem Dodge Charger machen. Und nicht in verschwitzten Biker-Klamotten auf dem Weg nach Ober-Beerbach.«
Das wiederum schien Horndeich einleuchtend. »Gib mir ein paar Minuten«, sagte er. Dann telefonierte er mit den Kollegen von der Einsatzzentrale. Aber auch da war nirgendwo ein Ludwig Daunberg oder auch nur eine hilflose oder verletzte Person eingesammelt worden.
»Kann es nicht sein, dass er im Wald eine Panne hatte? Dass er im Moment sein Rad quer durch irgendein Gehölz schleppt?«
»Ja, natürlich kann das sein. Er hat immer wieder mal Pannen. Aber er hat auch immer von irgendwo aus angerufen, dass er diese Panne hat und dass er später zu Hause sein wird. Das letzte Mal von einem Aussiedlerhof aus. Jetzt ist es …«, sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr, »bald Viertel vor zwölf. Und ich habe immer noch nichts von ihm gehört. Das passt nicht zu ihm.«
»Okay, Chiara. Kannst du uns irgendetwas über das Rad sagen, mit dem dein Mann unterwegs ist?«
»Klar. Es ist ein Focus. Und er hat es registrieren lassen. Hat mir lang und breit davon erzählt, von diesem FEIN-Schlüssel, den man ins Rad eingravieren lassen kann. Irgendwie sind in diesem Schlüssel die Stadt und sogar die Adresse codiert.«
»Und du hast diesen Schlüssel? Denn wenn das Rad tatsächlich in den kommenden Tagen auftauchen sollte, dann könnten wir es darüber identifizieren.«
Chiara nickte. Sie griff in ihre Handtasche, und schon nach wenigen Sekunden hatte sie das Portemonnaie herausgezogen. Darin befand sich ein Zettel. »Hier hast du alle Daten zu dem Fahrrad«, sagte sie und reichte Horndeich das Papier.
Er sah darauf. Eine genaue Typenbezeichnung des Rades, die Fahrgestellnummer und sogar die FEIN-Codierung. »Nun, damit sollten wir das Rad identifizieren können, wenn es irgendwo auftaucht.«
Horndeich rief ein zweites Mal bei der Einsatzzentrale an. Diesmal fragte er aber nicht nach einer verletzten Person, sondern nach einem gefundenen Fahrrad. »Ja, Horndeich«, sagte Bernd Süllmeier, der Kollege am anderen Ende der Leitung. »Wir haben heute tatsächlich ein Fahrrad gefunden, auf das die Beschreibung passt. Ich sehe gerade mal nach, was die Kollegen im elektronischen Diensttagebuch eingetragen haben.«
Eine kurze Pause entstand, Horndeich vermied es, den Blick in Richtung Chiara zu lenken. Er wollte sie nicht unnötig beunruhigen.
»Können Sie mir diesen Code noch einmal vorlesen?«
Horndeich tat es. Sein Blick wanderte nun automatisch in Chiaras Richtung, und er sah, wie Tränen ihre Wangen hinabliefen.
»Ja, das ist das Rad, ohne Zweifel. Lag im Darmbach in der Nähe der Lichtwiese. Ein Vater und sein Sohn haben es beim Spazierengehen entdeckt. Die Kollegen Peters und Robins waren vor Ort.«
»Sonst noch irgendetwas Auffälliges?«, wollte Horndeich wissen.
»Nicht dass ich wüsste«, antwortete Süllmeier. »Also im Diensttagebuch steht nichts weiter.«
»Gut, dann werde ich mal mit den Kollegen sprechen.« Horndeich legte auf.
Der Hörer hatte noch nicht die Gabel berührt, da fragte Chiara bereits: »Und?«
Horndeich wandte sich ihr zu: »Das Rad wurde bereits heute Morgen gefunden. Aber keine Spur von Ludwig.«
»Dann ist ihm was passiert.« Es war keine Frage, nur eine Feststellung.
Horndeich sparte sich alle hohlen Phrasen, denn er wusste ebenso gut wie Chiara, dass sie recht hatte.
Keine Minute später klingelte das Telefon auf Horndeichs Schreibtisch.
*
»Fünfzehn Minuten, dann stehen Sie hier auf der Matte«, grunzte Rünzig.
Leah Gabriely tippte mit dem Finger auf den virtuellen Button mit der Aufschrift Beenden. Die Hauptkommissarin befand sich gerade auf dem Weg zu ihrem Auto, als Ranzig, wie sie ihren Chef insgeheim nannte, sie angerufen hatte. Ihr VW Golf stand zehn Gehminuten von dem kleinen Restaurant entfernt, in dem sie meistens zu Mittag aß. Sie hatte dort einen Stammplatz in einem kleinen Erker. Leah mochte diesen Platz. Die Sonne schien ihr durchs Fenster in den Nacken, und sie selbst hatte den perfekten Überblick über den gesamten Gastraum. Das Schnitzel war heute etwas zäh gewesen, aber das Ambiente und die Freundlichkeit der Bedienung ließen Leah darüber hinwegsehen.
Rünzig hatte ihr mitgeteilt, dass in der Wellritzstraße eine Leiche aufgefunden worden sei. Wahrscheinlich Kopfschuss. Die Wellritzstraße lag im Westend und gehörte nicht unbedingt zur ersten Wohnlage Wiesbadens und daher auch nicht zu den teuersten. Leah hatte sich die Adresse gemerkt, ohne sie aufzuschreiben, wie sie das immer tat.
»Dein Gehirn ist ein einziger Stapel von unzähligen Notizblöcken. Es müssen mehr sein, als in einem Schreibwarenladen Platz haben«, hatte Bruno zu ihr gesagt. Wie oft habe ich in den letzten Tagen wohl an ihn gedacht?, fragte sie sich. Die Antwort darauf fiel ihr leicht: Immer dann, wenn es ihr nicht so gut ging. Und das auch nicht nur in den letzten Tagen, sondern es waren Wochen, wenn nicht sogar Monate.
Sie erreichte ihren roten VW Golf. Der hatte auch schon fünfzehn Jahre auf dem Buckel, aber er tat genau das, was er sollte: Er brachte sie zuverlässig von Punkt A zu Punkt B. Auch wenn sie kaum mehr Kontakt zu Bruno hatte, so sah sie doch regelmäßig alle sechs Monate bei Fabiano vorbei. Der betrieb eine kleine, unabhängige Autowerkstatt, in der auch Bruno seinen uralten Jeep Gladiator in Schuss hielt.
Leah steckte den Schlüssel ins Schloss der Fahrertür, und während sie sich in den Wagen setzte, prüfte sie mit der rechten Hand, ob der Dutt, zu dem sie ihr langes Haar gewickelt und gesteckt hatte, noch in Form war. Die Fahrt dauerte exakt elf Minuten. Und vierzehn Minuten nachdem sie das Gespräch mit Rünzig mit einem Wisch beendet hatte, erreichte sie die offen stehende Wohnungstür im vierten Stock. Dass hier jemand gestorben war, hatte sie bereits unten im Hausflur, nachdem sie das Haus betreten hatte, feststellen können: Es stank nach verfaultem Fleisch.
Im Treppenhaus vor der Wohnungstür hatten die Kollegen der Spurensicherung weiße Einweg-Overalls in einem Korb abgelegt. Leah empfand es als überaus praktisch, dass die Schuhüberzieher inzwischen bereits in das Einweg-Kleidungsstück integriert waren. Sie schlüpfte in einen der Spurenvermeidungsanzüge, nickte dabei einem Kollegen der Spurensicherung zu, der neben ihr in die Wohnung trat. Sie war sich nicht ganz sicher, ob es sich um den Kollegen Meyer gehandelt hatte, denn er hatte auch den Mundschutz bereits übergezogen. Dann betrat sie die Wohnung. Sie hörte Rünzig: »Ist die Gabriely inzwischen eingetroffen?«
Meyer antwortete ihm: »Ja, eben im Moment.«
Leah hatte sich nicht bemüßigt gefühlt, Rünzig zu antworten. Irgendwie war das alles sehr unglücklich gelaufen in den vergangenen zwei Jahren. Die einzige Abteilung, in der sie sich wirklich wohlgefühlt hatte, war die Abteilung SB des Bundeskriminalamts gewesen. Sie hatte sich mit ihrem Chef, Lorenz Rasper, sehr gut verstanden. Auch mit Daniel, dem Computercrack, war sie gut zurechtgekommen. Die Kollegin aus Mainz, Ricarda Zöller, war bei ihrem letzten Fall zu ihnen gestoßen, als die Abteilung einen Serienkiller quer durch die Bundesrepublik verfolgt hatte. Und natürlich war auch Bruno in der Abteilung gewesen. Irgendwie »ihr« Bruno, aber eben irgendwie auch nicht mehr. Kurz nachdem sie diesen Fall gelöst hatten, war die Abteilung aufgelöst worden. Für kurze Zeit war sie nach München gegangen zur Operativen Fallanalyse, die hatten jemand gesucht, der wie sie mit ihren Argusaugen die einzige Maus auf dem Fußballfeld sofort sehen würde. Der Vorgänger von Rünzig hatte sie dann nach Wiesbaden zur Mordkommission geholt. Und wenige Monate nachdem sie dort angefangen hatte, war der Chef gegangen und durch Rünzig ersetzt worden. Wenn sich Rünzig und Leah in einem Punkt einig waren, dann war dies die gegenseitige tiefe Abneigung. Leah konnte den Choleriker nicht ausstehen. Rünzig schätzte an ihr, dass sie die mit Abstand schnellste Auffassungsgabe von allen hatte. Sie berechnete die Multiplikation mit zwei dreistelligen Zahlen schneller, als Rünzig die Aufgabe überhaupt aussprechen konnte. Aber er ertrug es kaum, dass sie ihn in keiner Weise hofierte.
Auch Leahs Kollege Meyer hatte sie schon als eine lebende 3-D-Kamera bezeichnet, wenn es darum ging, Details eines Tatorts zu erfassen und auch abzuspeichern. Deshalb blieb Leah nach ihrem ersten Schritt stehen. Der Gestank war fürchterlich, aber er war nicht der Grund dafür, dass sie nicht weiterging. Es gelang ihr, den Odem völlig auszublenden, quasi mit einer mentalen Wäscheklammer über den Nasenflügeln. Dafür ließ sie den Flur der Wohnung auf sich wirken.
An der Garderobe hingen zwei Jacken: Eine war ein schon etwas abgewetztes Cordjackett, die andere eine dünne Sommerjacke. Unter dem schmiedeeisernen Gestell stand ein kleines Garderobenschränkchen. Billigster Pressspan, wie eine abgeplatzte Stelle des Eichenfurniers belegte. Sie zog sich ein paar Latexhandschuhe über und öffnete die oberste Schublade. Darin war nichts außer einem Paar Wollhandschuhe und einer Pudelmütze, beide in Schwarz. In der Schublade darunter lag ein gefalteter Schal, in der letzten Schublade Schuhputzzeug.
Der Boden des Flurs war mit grauem Linoleum verlegt, von dem Leah sofort den Eindruck hatte, dass, könnte es sprechen, es vom Bau des Hauses in den Fünfzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts hätte erzählen können. Der kleine und ebenfalls abgewetzte Läufer kaschierte den billigen Boden nur unzureichend. Leah sah an die Decke. Eine runde Lampenfassung ließ anhand von drei Metallklammern vermuten, dass hier einmal eine dekorative Abdeckung das Licht der Glühbirne gedämpft hatte.
Vom Flur gingen vier Türen ab. Jene unmittelbar gegenüber der Wohnungstür führte in ein Schlafzimmer, wie Leah erkannte, als sie sich ein wenig zur Seite beugte. Am Ende des Flurs führte eine weitere Tür nach links, wahrscheinlich ins Wohnzimmer. Die beiden Türen rechts im Flur mussten demnach zu einer Küche und zu einem Badezimmer führen.
»Gabriely!«, gellte Rünzigs Stimme durch die Wohnung. Sie würde nie begreifen, warum ihr Chef sich immer so gebärdete, als ob die ganze Welt um ihn herum kollektiv an einem Hörschaden litt. Sie reagierte nicht, sondern ging ins Schlafzimmer.
Der Raum war klein, keine zehn Quadratmeter groß. Das Bett war einen Meter vierzig breit. Nur ein Kopfkissen und eine Bettdecke zeigten, dass hier jemand alleine schlief. Der schäbige Kleiderschrank schien aus derselben Serie zu stammen wie das Garderobenschränkchen: Eichenfurnier über Pressspan. Leah öffnete die beiden Schranktüren. Dabei schwankte der Schrank. Für einen winzigen Moment glaubte Leah, er würde seinem Besitzer augenblicklich in den Tod folgen. In den Regalfächern linker Hand fand sie sauber zusammengelegte T-Shirts, Unterhosen, Unterhemden und Strümpfe. An der Kleiderstange hingen zehn Hemden und fünf Hosen ebenso wie zwei weitere Jacketts. Winterkleidung sah sie nirgends. Auf einem Seitentisch stand ein alter Röhrenfernseher, darauf eine Zimmerantenne sowie ein schwarzes Plastikkästchen mit einer leuchtend roten LED-Anzeige. Offensichtlich ein Empfänger für digitales Antennen-Programm.
Rünzig erschien im Türrahmen: »Warum sagen Sie mir nicht Bescheid, dass Sie eingetroffen sind?«
Anfangs hatte Leah den Fehler begangen, auf solcherlei Fragen zu antworten, etwa mit: »Ich habe schon angefangen, mir ein Bild vom Tatort zu verschaffen.« Ganz egal, was sie geantwortet hatte, es war stets nur der Auftakt zu einer Tirade. Ganz so, als ob ihre Worte einfach nur der Schuss aus einer Startpistole wären. Also antwortete Leah erst gar nicht, und Rünzig trollte sich wieder, konnte es dabei aber nicht lassen, so laut vor sich hin zu murmeln, sodass auch sie es verstehen konnte: »… hat doch echt einen Dachschaden …«
Den knappen Satz, den sie in Gedanken formte, sprach sie nicht aus: »Du mich auch.« Bis vor wenigen Monaten hätte sie so etwas nicht einmal gedacht.
Sie hörte, wie Rünzig telefonierte. Bei der Lautstärke Seiner Stimme hätte er für dieses Gespräch das Handy eigentlich gar nicht benötigt: »Herr Hinrich, dann bewegen Sie Ihren Hintern hierher. Sofort!« Er machte eine kleine Kunstpause, dann brüllte er weiter: »Da halt ich’s doch mit Praktiker: ›Geht nicht gibt’s nicht!‹« Wieder entstand eine Pause. »Wenn Sie den Knaben hier nicht bald abholen, dann hat er sich selbst aufgelöst.« Noch eine Pause. Dann wieder Rünzig: »In anderthalb Stunden, in Ordnung.«
Sie vernahm Meyers Stimme, der fragte: »Wieso kommt Hinrich von der Gerichtsmedizin nicht sofort hierher?«
»Er hat eine Leiche in Darmstadt, sagt er«, blaffte Rünzig, nicht mehr mit der Lautstärke eines Ferrarimotors, aber immerhin noch mit der eines Porsches. Nun betrat auch Leah den Raum, in dem der Urheber des Gestanks saß. Kein schöner Anblick. Dem Herrn war anzusehen, dass er nicht erst seit dem Frühstück tot war, zumindest nicht nach dem heutigen. Der Oberkörper war nach vorn über den Esstisch gekippt, auf dem kein Geschirr stand. Die grauen Haare verdeckten gnädig jene Stellen, die Leah vom Gesicht hätte sehen können.
Meyer sah in ihre Richtung. Sie musste die Frage gar nicht laut stellen, Meyer schien ihre Gedanken zu erraten, was auch nicht wirklich schwer war. »So wie’s aussieht, ein Schuss in den Hinterkopf. Aber wir wollen noch auf Hinrich warten, bevor wir die Leiche bewegen. Da ist auf jeden Fall ein mächtiges Loch im Schädel.«
Leah nickte. Am anderen Ende des Raumes war ein Bücherregal aufgestellt. Eindeutig ein naher Verwandter von Kleiderschrank und Garderobenschränkchen. Drei Regale standen nebeneinander, die Spalten zwischen den Außenwänden zeigten, dass entweder der Boden schief war oder die Regale. Sie ging darauf zu, um die beachtliche Anzahl an Büchern näher zu betrachten. Auf jedem dritten Buchrücken konnte sie den Begriff Physiotherapie lesen. Sicher fünfzig Zentimeter Regalbreite an Fachliteratur zu diesem Thema. Rund ein Drittel widmete sich speziellen Fragestellungen bei der Physiotherapie von Kindern. In den beiden oberen Regalreihen standen eine Menge Bücher von John Le Carré und weiteren Autoren von Spionageromanen, und darunter befanden sich weitere Fachbücher, aber diesmal drehten sie sich alle um das Thema Modelleisenbahn. Leah überflog auch hier die Buchrücken: Die Themen Landschaftsgestaltung und Dampflokomotiven nahmen einen Großteil der Literatur ein. Das Buch Amerikanische Dampfrösser erregte dann ihre ganz besondere Aufmerksamkeit: »Kopfschuss!«, sagte sie und deutete mit dem blau behandschuhten Zeigefinger der rechten Hand auf das ö zwischen dem r und dem s. Meyer trat sofort zu ihr, auch Rünzig näherte sich auf drei Schritte.
»Ich glaube, hier steckt das Projektil.«
*
Das Navi lotste Horndeich über Landstraßen durch die Walachei. Statt ihn auf die B426 zu schicken, behauptete das Navi steif und fest, er müsse bereits hier, in Nieder-Ramstadt, nach Süden abbiegen, Richtung Waschenbach. Horndeich gehorchte. Er wusste, dass Diskussionen mit der Quäkstimme nutzlos waren und meist doch dazu führten, dass er unterm Strich länger unterwegs war.
Er ließ Waschenbach gerade hinter sich, als das Navi ihn nötigte, rechts in den Wald abzubiegen. Er tat es und sah bereits kurz darauf die zuckenden Blaulichter zwischen den Bäumen. Horndeich fuhr mit dem Wagen bis zur Polizeiabsperrung und stellte einfach den Motor ab.
Er stieg aus dem Wagen. Bernd Süllmeier, der Kollege, mit dem er zuvor kurz telefoniert hatte, wahrscheinlich der größte Kollege in ganz Darmstadt, hob kurz das Absperrband an, sodass er hindurchkonnte. Die Kollegen der Spurensicherung waren wieder einmal schneller gewesen als er. Mit ihren weißen Schutzanzügen wuselten sie bereits durchs Unterholz und wirkten dabei wie überdimensionierte Ameisen: Jeder folgte seinem Weg. Was auf den ersten Blick wie Chaos wirkte, war in Wirklichkeit gut strukturiert.
»Können Sie mir zeigen, wo er liegt?«, wollte Horndeich von seinem Kollegen von der Schutzpolizei wissen.
»Ich zeig’s Ihnen«, sagte Süllmeier und ging den Waldweg entlang. Der Weg stieg an und beschrieb einen Halbkreis. Damit umschloss er quasi den oberen Rand eines Trichters. Jetzt sah es Horndeich selbst: Der tote Mann lag ziemlich genau in der Mitte des Trichters am tiefsten Punkt.
Silvia Rauch von der Spurensicherung trat auf Horndeich zu. Sie reichte ihm einen Anzug. Inzwischen hatten sie bereits so viele Fälle gemeinsam bearbeitet, dass Silvia Rauch seine Konfektionsgröße im Kopf hatte. Wobei die Anzüge auch nicht unbedingt auf individuelle Körpermaße zugeschnitten waren. »Kleide dich ein, dann nehme ich dich mit runter«, sagte sie.
Kaum eine halbe Minute später beugte sich Horndeich über den Toten. Der Mann lag auf dem Rücken. Er war sportlich durchtrainiert, an den Füßen trug er knallrote Radlerschuhe mit Klickvorrichtung, über die Hände hatte er schwarze Fahrradhandschuhe gezogen. Das weiße Radlershirt hatte auf Höhe des Herzens drei Löcher. In diesem Bereich war es bräunlich rot verfärbt. Der grüne Fahrradhelm lag einige Meter weiter entfernt. Er hatte ihn offensichtlich vom Kopf genommen, bevor er getötet worden war. Die Hose war blau mit roten Längsstreifen an den Seiten. Horndeich hatte keine Zweifel, dass es sich um Ludwig Daunberg handelte. Er hatte ihn zwar nicht oft gesehen, aber so viele Radfahrer über fünfzig wurden im Raum Darmstadt derzeit nicht vermisst. Horndeich machte mit dem Handy ein paar Bilder des Leichnams und seiner Umgebung.
»Ah, Sie sind ja auch schon hier!«
Horndeich sah neben sich. Er hatte den Mann für einen Kollegen der Spurensicherung gehalten, doch es handelte sich um Martin Hinrich, den Gerichtsmediziner der Frankfurter Rechtsmedizin.
»Woran ist er gestorben?«, wollte Horndeich wissen.
»Na ja, so ein schweres Rätsel ist das jetzt nicht«, erwiderte der Rechtsmediziner. Obwohl sie sich an der frischen Luft befanden, konnte Horndeich Hinrichs Rasierwasser riechen.
Er mochte es nicht. Ein bisschen zu herb. Aber das lag vielleicht auch daran, dass Hinrich in seinem Beruf meist eher mit süßlichen Düften konfrontiert war. Trotzdem, weniger ist mehr, dachte Horndeich.
Hinrich griff mit den plastikbehandschuhten Händen unter Schulter und Hüfte des Toten und drehte ihn zur Seite. »Habe ich vorhin auch schon gemacht. Schauen Sie sich den Rücken an.«
Horndeich sah, dass dort das gesamte Shirt braunrot gefärbt war.
»Der Gute ist erschossen worden. Und das war tödlich, wenn er nicht Bruchteile von Sekunden zuvor einen Herzinfarkt erlitten hat. Ich schau mir das Ganze natürlich gleich in Frankfurt noch mal an, dann bekommt ihr die Details. Aber an der grundsätzlichen Diagnose wird sich kaum etwas ändern.«
Horndeich nickte. »Irgendetwas Auffälliges an der Leiche?« Er erwartete jetzt wieder einen patzigen Kommentar seitens des Rechtsmediziners, aber der blieb aus.
»Nein. Drei Schüsse ins Herz, und das war’s.«
Horndeich erhob sich aus der Hocke. »Danke, Kollege. Wann machen Sie die Obduktion?«
Hinrich seufzte vernehmlich. »Gerade haben mich die Wiesbadener angerufen. Die haben zur Stunde auch eine Leiche aufgetan. Ich muss dahin, denn da ist nicht ganz so klar, was passiert ist. Außerdem lag der schon eine Weile in der Wohnung und sieht wohl nicht mehr so ganz manierlich aus. Ich fahr jetzt rüber in die Landeshauptstadt, schau mir den Knaben an, dann geht’s stante pede ins Institut. Also so in anderthalb Stunden fange ich mit ihm hier an«, Hinrich deutete auf die Leiche am Boden, »und anschließend widme ich mich dem Toten aus Wiesbaden. Ich denke, danach habe ich mir dann den Feierabend redlich verdient.«
»Gut, dann bin ich in anderthalb Stunden bei Ihnen im Institut«, sagte Horndeich.
»Immer gern«, erwiderte Hinrich, stand auf und stapfte den Hang hinauf in Richtung Waldweg.
Horndeich warf noch einen letzten Blick auf den Toten, dann tat er es Hinrich nach.
»Wer hat die Leiche gefunden?«, wollte er von Süllmeier wissen.
»Ach, das ist nicht so glücklich gelaufen. Da drüben sitzt Regina Poth. Sie ist Grundschullehrerin und hat mit ihren Kleinen einen Ausflug gemacht. Am besten Sie sprechen selbst mit ihr.«
»Frau Poth?« Horndeich setzte sich neben die junge Frau. Sie schien deutlich jünger als dreißig Jahre zu sein.
Frau Poth nickte nur.
»Ich bin Hauptkommissar Steffen Horndeich. Wir untersuchen den Mord an dem unbekannten Toten dort unten.«
Regina Poth nickte wieder.
»Können Sie mir sagen, was passiert ist? Wer hat die Leiche entdeckt?«
»Ich bin ja noch kein Jahr an dieser Schule. Und jetzt passiert mir so was.«
Horndeich nickte nur. Für Regina Poth war es eine Situation, die ihr Leben verändern würde. Für Horndeich war sie eine von vielen, die unverhofft eine Leiche entdeckt hatten.
»Ich hab die Leiche zuerst gesehen. Wegen Elvira.«
»Wer ist Elvira?«
»Elvira ist mein persönlicher Liebling, auch wenn ich das gar nicht sagen darf, so als Lehrerin.«
»Das heißt?«
Regina Poth rutschte auf dem Baumstamm, auf dem sie saß, ein wenig herum. »Wir haben heute einen Ausflug gemacht. Wir wollten um den Steinbruch herumlaufen. Und dabei wollten wir den Kindern erklären, was so ein Steinbruch eigentlich ist. Sie sollten ein Gefühl dafür bekommen, wie groß dieses Gelände ist. Und dass von hier die Steine kommen, die zum Beispiel auf einem Kiesweg liegen. Deswegen sind wir einmal außenrum gelaufen.«
»Ihre Schule ist in Nieder-Beerbach?« Horndeich kannte sich nicht wirklich aus mit der Struktur des Schulsystems im Umkreis von Darmstadt.
»Ja, die Schule liegt nur anderthalb Kilometer von hier entfernt. Und es ist uns allen wichtig, dass die Kinder ein Gefühl kriegen für die Region, in der sie wohnen.«
Jetzt war es an Horndeich zu nicken. Stefanie war noch nicht in der Schule, aber auch im Kindergarten gab es pädagogische Konzepte. Gerade mit Chiara hatte er sich oftmals darüber unterhalten. Er sah das ganz pragmatisch. Er mochte die Qualität eines pädagogischen Konzepts nicht wirklich beurteilen. Aber er war immer froh, wenn es überhaupt ein Konzept gab.
»Und wie haben Sie die Leiche entdeckt? Sie sind doch sicher oben auf dem Weg gelaufen. Und von dort aus haben Sie die Leiche doch gar nicht sehen können.«
Regina Poth lächelte. »Nein. Von dort oben konnte ich natürlich nichts sehen. Die Kinder zum Glück auch nicht. Also am Anfang. Bis sie wieder angefangen haben, Elvira zu ärgern. Sie wird im Moment von ihren Kameraden nur Brillenschlange genannt. Vor vier Wochen hat sie eine Brille bekommen. Und zuerst fand sie das ganz toll, weil sie endlich das, was auf der Tafel stand, richtig gut lesen konnte. Was sie nicht einkalkuliert hat, war der Spott der Klassenkameraden. Sie ist die Erste in der Klasse, die eine Brille hat.«
Horndeich war irritiert. »Aber auch mit Brille kann sie die Leiche von hier oben nicht gesehen …«
Regina Poth unterbrach ihn. »Es war wieder eine der üblichen Rangeleien. Die Klasse sollte in einer Reihe gehen, immer zwei und zwei, die sich an den Händen halten. Es war, glaube ich, Klaus, der wieder ›Brillenschlange, Brillenschlange‹ gerufen hat. Und Elvira, sie hat keine guten Augen, aber sie ist ziemlich stark. Sie ist ja auch schon ein bisschen größer für ihr Alter. Auf jeden Fall hat sie dann angefangen, um sich zu schlagen. Und die Jungs sind natürlich sofort darauf eingegangen. Lange Rede, kurzer Sinn: Sie haben sie geschubst, und sie ist den Abhang hinuntergekullert. Auf dem Weg nach unten hat sie auch ihre Brille verloren. Also sie hatte ziemlich Glück gehabt, dass sie an keinem der Bäume hängen geblieben ist. Irgendwann ist sie einfach liegen geblieben. Na ja, und während meine Kollegin die Kinder zusammengestaucht hat, bin ich runter, um Elvira wieder aufzusammeln. Ein Zufall, dass ich bereits auf dem Weg nach unten ihre Brille gefunden und gleich eingesteckt habe. Und als ich dann bei ihr ankam, da habe ich den Körper gesehen. Er lag etwa fünf Meter von Elvira entfernt. Ohne die Brille konnte sie ihr Umfeld zum Glück nicht erkennen. Sie ist kurzsichtig, hat eine starke Hornhautverkrümmung und jetzt schon vier Dioptrien. Natürlich sind alle Kinder sofort an den Rand des Weges gerannt, um hinunterzusehen. Und drei Sekunden später haben sie im Chor gebrüllt: ›Da liegt einer, da liegt einer!‹ Mit der freien Hand habe ich nach dem Puls des Mannes gefühlt, aber er hatte ja die Augen geöffnet, ohne zu blinzeln. Ich hab schon kapiert, dass da jede Hilfe zu spät kommt. Also habe ich mir Elvira geschnappt und bin mit ihr nach oben. Erst dann hab ich ihr die Brille zurückgegeben.
Auch vom Rand des Weges aus konnte man nicht viel mehr sehen als die Füße des Mannes. Ich habe zu Vera gesagt, dass der Kerl da unten tot ist. Das haben natürlich auch zwei Kinder mitbekommen. Wir hatten ganz schön zu tun, die Kleinen wieder geordnet zu bekommen und den Rückzug anzutreten. Schon nach fünfzig Metern hatten die Kinder diesen Teil des Weges hier nicht mehr im Blick. Zuerst hab ich eine Kollegin angerufen, die mich ablösen konnte, dann habe ich Sie angerufen und hier auf Sie gewartet.«
»Wie geht es der Kleinen?«, wollte Horndeich wissen. So ein kleines Mädchen, das einen Hang hinunterpurzelte und dann unweit einer Leiche landete – Horndeich konnte sich vorstellen, dass sie das nicht so schnell wegstecken würde. Aber Frau Poth grinste in Horndeichs Richtung: »Elvira? Sie ist jetzt der Star. Alle haben sie gefragt, wie das war, so zu stürzen und dann fünf Meter neben einem toten Mann zu landen. Und Elvira musste es sicher fünfzig Mal erzählen, am Anfang sind ihr noch die Tränen runtergelaufen. Doch dann hat sie gemerkt, wie das Interesse an ihr wuchs, und so hat sie die Geschichte von Mal zu Mal mehr ausgeschmückt. Sie gilt jetzt als diejenige, die fast eine Leiche gefunden hat. Und Klaus hat sich sogar zu der Bemerkung hinreißen lassen, dass Mädchen vielleicht doch ganz cool sein können.«
Nun musste auch Horndeich schmunzeln. Manche Dinge regelten Kinder untereinander auf viel einfachere Weise, als Erwachsene sich das manchmal vorstellen konnten.
»Horndeich, komm doch bitte mal rüber.«
Silvia Rauch deutete auf den Boden neben dem Waldweg. »Entschuldigen Sie mich bitte, Frau Poth«, sagte der Kommissar und ging hinüber zu seiner Kollegin von der Spurensicherung. Die hatte schon ein gelbes Plastikschildchen mit einer Nummer darauf auf den Boden gestellt.
»Wir haben Patronenhülsen gefunden. Drei Stück. Sieht aus wie 9 mm.«
Horndeich ging in die Hocke und begutachtete die Messinghülsen. »Wir haben natürlich erst den ganzen Bereich um die Leiche abgesucht, aber da haben wir nichts gefunden. Ganz offensichtlich hat der Täter den Mann hier erschossen und dann den Abhang runtergestoßen.«
»Habt ihr irgendwelche Projektile gefunden?«
»Nein, aber wir sind ja noch nicht fertig.«
*
Leahs Kollegen von der Spurensicherung entfernten das Projektil. Wahrscheinlich stammte es aus einer 9-mm-Pistole. Leah sah sich weiter im Raum um. An der einen Wand stand noch ein weiterer Tisch, der in seinem früheren Leben wohl mal als Esstisch gedient haben musste. An den Stellen, an denen man das Resopal der Tischplatte sehen konnte, zeichneten sich Teile einer kreisrunden Hitzeverfärbung ab. Hier hatte mal ein Topf gestanden.
Jetzt war der Tisch befördert worden: Auf seiner Platte befanden sich zwei Laptop-Computer, von denen jeweils ein Netzwerkkabel in einen Router führte, der auch im Bücherregal untergebracht war. Neben dem Router stand ein drahtloses Festnetztelefon in seiner Ladeschale. Leah wandte sich an Meyer: »Nehmt die beiden Rechner bitte mit.«
Ihr Kollege bedachte sie mit einem Blick, der besagte: Gut, dass du mir Bescheid sagst, von selbst wär ich da jetzt nicht drauf gekommen.
Rünzig telefonierte, lautstark wie immer, dann verkündete er: »Der Tote ist wahrscheinlich der Wohnungsinhaber Helmut Glockner. Arbeitslos, Hartz-IV-Empfänger.«
Leah blickte wieder in Richtung der Leiche. Von hinten durch den Kopf geschossen – das sah für sie nicht nach einem schiefgelaufenen Raubüberfall aus. Erstens gab es hier nichts zu holen außer den beiden Laptops, aber die standen ja noch auf dem Tisch, und zweitens wirkte das alles auf Leah wie eine Exekution. Sie sah in Richtung ihres Chefs: »Wann kommt Hinrich von der Gerichtsmedizin?«
»Er hat gemeint, so in einer Stunde.«
»Gebt mir Bescheid«, sagte Leah in die Runde. »Ich fange schon mal an, mich bei den Nachbarn im Haus umzuhören.«
In der Wohnung nebenan öffnete niemand die Tür, doch bereits in der Wohnung, die direkt unter der von Helmut Glockner lag, hatte sie Glück. Eine ältere Dame öffnete die Tür einen schmalen Spalt. Zwei Ketten sorgten dafür, dass sie auch nicht weiter geöffnet werden konnte.
»Sie wünschen?«
Leah konnte erkennen, dass die Dame über dem hellblauen Baumwollkleid eine Küchenschürze trug. Auf ihr war Snoopy abgebildet, mit Kochmütze auf dem Kopf und einer Pfanne in der Hand. Sie warf einen schnellen Blick auf das Klingelschild und nahm gleichzeitig den Polizeiausweis aus der Jackentasche: »Sie sind Frau Mattis?«
Die Dame nickte. Dabei sackte der Kopf stark nach unten, als ob in ihrem Kinn ein Gewicht angebracht wäre. »Ja, die bin ich. Und wer möchte das wissen?«
Leah hielt den Polizeiausweis direkt vor das Gesicht der alten Dame. Die fingerte an einer Lesebrille mit knallrotem Gestell, die an einem ebenso roten Brillenband befestigt war. »Ah, die Polizei. Er ist tot, nicht wahr?«
Leah hätte jetzt fragen können, wen Frau Mattis meinte. Aber das kam ihr dann doch etwas umständlich vor. Deshalb sagte sie nur: »Ja.«
»Und Sie möchten mir jetzt ein paar Fragen dazu stellen?«
»Ja.«
»Dann gehe ich mal davon aus, dass er keines natürlichen Todes gestorben ist.« Sie hielt kurz inne. »Na, junge Frau, ich lasse Sie mal rein.«
Sie zog die Tür ins Schloss, Leah hörte, wie die Ketten aus den Haltern klackten, dann wurde ihr geöffnet, und sie konnte hinein.
Die Wohnung war genauso geschnitten wie die darüber, in der sie den Toten gefunden hatten. In dem Raum, in dem sich bei Glockner ein Schlafzimmer befand, konnte Leah durch den Türspalt ebenfalls ein Bett erkennen.
»Wenn Sie vielleicht mit in die Küche kommen wollen, ich koche gerade.«
»Haben Sie unsere Kollegen gerufen? Wegen des Geruchs?«
»Nein, das war unser Hausmeister. Aber ich hab ihm schon vor drei Tagen gesagt, dass da irgendwas nicht stimmt. Weil ich den Helmut eben jetzt schon eine Woche lang nicht mehr gesehen habe. Ich hab mir schon gedacht, dass da was passiert sein muss. Aber ich bin nicht so eine, die gleich die Polizei ruft. Das sollen andere machen. Jüngere.«
Leah schätzte Frau Mattis auf rund fünfundsiebzig Jahre. Ihr Haar war grau, zu einem Knoten gesteckt, ganz ähnlich wie ihre eigene Frisur. Nur dass Leahs Haar noch deutlich voller war und noch keine einzige graue Strähne aufwies – obwohl sie mittlerweile die vierzig überschritten hatte. Für Egmont, ihren Exmann, hatte sie die Haare immer wieder offen getragen. Aber wohlgefühlt hatte sie sich dabei nur selten.
In einem der Töpfe kochten Nudeln, in einem zweiten Topf bereitete Frau Mattis offensichtlich eine Tomatensoße zu. »Ich hab jetzt leider nicht genug gemacht, aber wenn Sie mit einer kleinen Portion zufrieden sind, können wir gerne teilen.«
»Herzlichen Dank, aber das ist nicht nötig.« Leah setzte sich auf einen der Stühle an den kleinen Esstisch und dachte an den Geruch, den sie in der oberen Wohnung gerade hatte ertragen müssen und der doch einen nachhaltigen Eindruck auf ihren Magen hinterlassen hatte. Der hatte daraufhin unmittelbar vor den Rachen das »Geschlossen«-Schild gehängt. Und Leah war sich sicher, dass es keine gute Idee gewesen wäre, dieses Schild zu ignorieren.
»Wie ist er denn umgekommen, der arme Helmut?«
Leah zuckte nur die Schultern.
Frau Mattis unterbrach das Rühren im Soßentopf und drehte sich zu Leah um. »Stimmt, das dürfen Sie mir ja nicht sagen. Eigentlich sollte ich das ja wissen, ich guck ja eigentlich nur Krimis. Aber wenn das plötzlich im eigenen Haus passiert …«
»Wie lange kannten Sie Helmut Glockner?«
»Ach, schon sehr lange. Aber so genau weiß ich es nicht mehr. Als junges Mädchen, da habe ich ganz fleißig Tagebuch geführt. Da konnte ich Ihnen ohne viel Nachdenken sagen, was ich vor zehn, vor dreizehn oder vor zweiundzwanzig Tagen gemacht habe. Aber seit ich in Rente bin – und das bin ich nun ja schon seit fast zwanzig Jahren – hat sich die Wahrnehmung der Zeit stark verändert. Ich schaue auf den Kalender und wundere mich, dass schon wieder drei Wochen vorbei sind. Die Tage, die gleichen einander nun doch ziemlich. Ich will mich nicht beklagen, mir geht es gut. Aber wie gesagt, was wann geschehen ist, das kann ich Ihnen nicht mehr so genau sagen. Mein Enkel Manfred, der hat neulich mal zu mir gesagt: ›Oma, du denkst auch nur noch in Epochen.‹«
»Können Sie es mir vielleicht ungefähr sagen?«
»Ich hab den Helmut kennengelernt, als er hier eingezogen ist. Vor ein paar Monaten, da haben wir seinen sechzigsten Geburtstag gefeiert.« Wieder hielt sie kurz mit dem Rühren inne. »Nein, das ist schon über ein Jahr her, denn da war ja inzwischen auch der einundsechzigste Geburtstag. Nur haben wir den nicht gefeiert.«
»Und wie alt war Helmut Glockner, als er hier eingezogen ist?«
»Ach, Frau Gabriely – oder soll ich Sie lieber Frau Kommissarin nennen?«
»Nein, Frau Gabriely ist gut.«
»Na, also seinen fünfzigsten, den haben wir auch hier gefeiert. Seinen vierzigsten aber sicher nicht, da hat er noch nicht hier gewohnt.« Sie sah Leah kurz mit einem Lächeln an, das zeigte, dass sie einmal eine sehr attraktive Frau gewesen sein musste. Leah hatte den Eindruck, dass in Frau Mattis’ Nacken zudem ein kleiner Schalk saß, der ihr zuwinkte. Nun sagte sie: »Ich glaube, mein Enkel hat recht.« Ein bisschen Resignation schwang in ihrer Stimme mit.
»Was hat Herr Glockner denn gearbeitet?«
»Gar nichts. Sein linker Ellenbogen war steif. Er war früher mal Physiotherapeut, das hat er mir erzählt. Er hatte sogar eine eigene Praxis am Michelsberg, irgendwo in der Innenstadt. Aber die ist irgendwie pleitegegangen. So deutlich hat er das nicht gesagt, aber ich hab es herausgehört. Na ja, und mit einem steifen Ellenbogen, da kann man nicht als Physiotherapeut arbeiten, weder als Chef noch als Angestellter. Er hat mir erzählt, dass er da mal richtig gut war. Seine Eltern, die waren einfache Arbeiter. Und er hat es geschafft, aus eigener Kraft, wie er immer betont hat, sich diese Praxis aufzubauen. Er hatte sich auf Physiotherapie für Kinder spezialisiert und muss da ziemlich erfolgreich gewesen sein. Und dann so was.«
»Wieso war sein Ellenbogen steif?«
»Das hat er mir nie so genau erzählt. Irgendein Unfall. Ich hatte den Eindruck, er hat sich dafür geschämt.«
»Hat Herr Glockner denn Familie?«
Frau Mattis zog den Topf mit der Tomatensoße auf eine andere Platte, nahm dann den Topf mit den Nudeln, leerte sie in ein Sieb über der Spüle und sagte: »Nein. Soviel ich weiß, war er nie verheiratet. Und er hat auch keine Kinder. Ich hatte immer den Eindruck, dass er ein sehr einsamer Mann war. Also ich, ich bin ja auch allein. Aber ich hab mit meinem Hans fast fünfzig Jahre zusammengelebt. Vor acht Jahren ist er gestorben, da war ich fünfundsiebzig, und er war gerade achtundsiebzig geworden. Als mein Hans noch gelebt hat, da hatte ich keinen so engen Kontakt zu Helmut. Aber dann … wir waren beide einfach froh, dass da jemand ist, dem man mal Hallo sagen konnte, gemeinsam einen Kaffee trinken. Und manchmal, da haben wir tatsächlich zusammen gekocht. Wir beide mochten gern asiatisch. Und er hatte so einen großen Topf, einen Wok. Helmut, der hatte schon eine nette Art. Und er hatte Humor. Wenn ich noch ein bisschen jünger gewesen wäre … wer weiß. Aber ich bin ja mehr als zwanzig Jahre älter als er.«
Was man Ihnen aber nicht anmerkt, dachte Leah, sprach es aber nicht aus.
»Schade, ich hätte nicht gedacht, dass Helmut vor mir gehen würde. Jetzt bin ich fast ganz allein. Muss wohl meine Enkel dazu verdonnern, mich öfter zu besuchen.«
*
Horndeich stellte seinen Xedos vor seinem Haus im Richard-Wagner-Weg 56 ab. Streng genommen war es nicht sein Haus, sondern es gehörte seiner ehemaligen Kollegin Margot Hesgart. Als Margot sich entschlossen hatte, nach Amerika zu gehen, war es ihr wichtig gewesent, dass nicht irgendjemand Fremdes in ihr Haus zog. Und da Sandra zu diesem Zeitpunkt gerade mit Alexander schwanger gewesen war und sie ohnehin auf der Suche nach einer größeren Wohnung gewesen waren, hatte Margot ihnen ein Angebot gemacht, das sie nicht ablehnen konnten. Und nun wohnten sie in diesem viel zu großen Haus. Die Souterrainwohnung blieb ungenutzt. Horndeich und seine Familie hielten sich überwiegend im Erdgeschoss und dem ersten Stock auf. Im Erdgeschoss hatte zuletzt Margots Vater mit seiner Lebensgefährtin gewohnt. Doch die beiden waren ebenfalls über den großen Teich nach Florida gezogen. Auch die kleine abgetrennte Dachwohnung hatten sie noch gar nicht in Beschlag genommen. Ein paarmal nur hatten Gäste dort übernachtet.
Chiara Daunberg lebte mit ihrer Familie nur ein paar Häuser weiter. Horndeich ging zu Fuß dorthin. Und noch bevor sie ihm die Haustür öffnete, wurde ihm bewusst, dass sie ihm die schlechte Nachricht sicher sofort ansehen würde.
»Chiara …« Horndeich wollte ihr mit schonenden Worten beibringen, dass sie ihren Mann tot aufgefunden hatten, aber er brauchte gar nichts mehr zu sagen. Über Chiaras Gesicht rannen Tränen. Sie ging einen Schritt auf Horndeich zu. Er nahm sie in den Arm.
»Ist er bei einem Sturz gestorben?«, flüsterte sie.
»Chiara, das kann ich dir noch nicht genau sagen«, antwortete er. Obwohl das eine Lüge war. Ludwig Daunberg war erschossen worden. Daran gab es keinen Zweifel. Man konnte sich nur noch darüber streiten, welches der vielen Projektile das tödliche gewesen war. »Er ist erschossen worden«, fügte Horndeich noch an. Er fand es nicht fair, dies seiner Bekannten nicht gleich mitzuteilen.
Chiara löste sich von ihm. »Erschossen?«
Horndeich nickte. »Können wir reingehen?«
Wenige Minuten später saßen sie im großzügigen Wohnbereich des Hauses. Horndeich war noch nie hier gewesen, wie er in diesem Moment feststellte. Er hatte sich mit Chiara an drei oder vier Abenden, an denen sie in ihrer Funktion als Elternbeirat etwas besprechen mussten, immer in seinem Haus getroffen. Horndeich sah sich um. Er hatte eindeutig das Heim eines Musikliebhabers betreten. An den Wänden hingen Porträts, wobei Horndeich nur das von Beethoven zweifelsfrei identifizieren konnte. Dieser blickte wie immer sehr grimmig, und Horndeich fragte sich einmal mehr, wie er trotzdem so fantastische Musik hatte schreiben können. An der schmalen Wand des Raumes stand eine teure Stereoanlage. Der Raum war modern möbliert, die Sitzecke bequem.
Horndeich griff nach seinem Handy. Er musste sichergehen. »Bitte sag mir noch einmal, was Ludwig anhatte, als er heute früh losgefahren ist.«
»Das hab ich dir doch schon gesagt. Weißes Shirt, blaue Hose mit roten Streifen, schwarze Fahrradhandschuhe und diese fürchterlich roten Radlerschuhe, die so überhaupt nicht zum Grün des Helms passten.«
Horndeich steckte das Handy wieder weg. Er dachte daran, dass in deutschen Fernsehkrimis die Angehörigen immer in die Gerichtsmedizin gezerrt wurden, um die Toten zu identifizieren. Zum Glück war dies, zumindest in Deutschland, reine Fiktion. Oder Dramaturgie der Regisseure und Drehbuchschreiber. Chiaras Angaben genügten. Später konnte Hinrich immer noch die DNA abgleichen lassen, doch eigentlich gab es keinen Zweifel, dass der Mann, den sie im Wald gefunden hatten, Ludwig Daunberg war. Horndeich hatte abermals den Impuls, sie in den Arm zu nehmen. Doch er war hier in seiner Funktion als Polizist, nicht als Bekannter oder gar Seelentröster.
»Chiara, es tut mir leid, ich muss dir jetzt ein paar Fragen stellen. Geht das?«
Seine Bekannte sprach nicht, nickte nur, während die Tränen unvermindert weiterflossen und auf ihr Kleid tropften. Es hatte bereits einige dunkle Stellen.
»Hast du irgendeine Ahnung, wer deinem Mann etwas Böses wollte?«
Chiara Daunberg schüttelte den Kopf. Hielt inne, blickte Horndeich an und sagte schließlich: »Nein. Ich habe keine Ahnung. Steffen, er war beliebt. Und er hatte auch keinen Job, in dem er sich hätte Feinde machen können. Vielleicht mal ein Student, der durch eine Prüfung gerauscht ist. Aber er war weder Versicherungsvertreter noch Finanzberater für Risiko-Fonds. Er hat niemanden in die Pleite getrieben, er hat nicht wie ein Richter Menschen in den Knast geschickt. Und er war auch kein Arzt, dem Patienten irgendwelche Kunstfehler zur Last gelegt hätten. Da war rein gar nichts.«
»Was hat er denn genau gemacht, beruflich? Musiklehrer, hast du mal gesagt, oder?«
Obwohl der Tränenstrom immer noch nicht versiegt war, huschte für einen kurzen Moment ein Lächeln über Chiaras Gesicht. »Nicht ganz. Er unterrichtet, Klarinette, Klavier und Komposition. Aber nicht an einer Schule für Kinder, sondern hier in Darmstadt an der Hochschule für Neue Musik. Und das macht er bereits seit fast zwanzig Jahren.«
»Und was macht er da genau?« Horndeich bemerkte, dass sie von Ludwig sprachen, als würde er noch leben. Aber er korrigierte den Satz nicht mehr.
Chiara unterlief dieser Fehler nun nicht mehr: »Er unterrichtete Nachwuchsmusiker. Das darfst du dir nicht vorstellen wie an der Volkshochschule. Das ist eine Universität. Unglaublich anspruchsvoll.«
»Und er hat ihnen beigebracht«, Horndeichs Blick wanderte kurz zum Bildnis von Beethoven, »wie sie Beethoven, Mozart und Haydn spielen?«
»Nein. Beethoven, Mozart und Haydn müssen sie schon richtig gut spielen können, bevor sie an der Hochschule überhaupt angenommen werden. Ludwig hat ihnen beigebracht, Werke von Komponisten der Moderne zu spielen, also Schönberg, Webern oder Berg. Oder eben Werke der Avantgarde, in denen auch Klarinetten eine wichtige Rolle spielen, etwa bei Ligeti oder Xenakis.«
Das sagte Horndeich nicht wirklich viel. Seine zahlreichen Fragezeichen im Gesicht zauberten wieder den Anflug eines Lächelns auf Chiaras Gesicht. »Tröste dich, ich kenne sie auch nur alle, weil Ludwig mich immer mit ihnen genervt hat. Seine modernen Komponisten haben für mich eins gemeinsam: Es ist völlig egal, wen man mir vorspielt, ich finde alles scheußlich. Aber er liebte sie.«
Wieder fing sie an zu weinen.
Horndeich unterdrückte erneut den Impuls, sie in den Arm zu nehmen. Er musste es aussitzen. Und er saß es aus.
Wenige Minuten später hatte Chiara sich wieder gefasst. »Diese Musik ist für meine Ohren völlig harmoniebefreit. Da lasse ich mich lieber acht Stunden lang mit Helene Fischer beschallen, als eine ganze CD von Ligeti zu hören. Aber die Menschen, mit denen Ludwig zu tun hatte, die gehen völlig auf in dieser Musik. Unter denen wirst du keinen potenziellen Mörder finden. Das Gleiche gilt übrigens für die Mitglieder seines Orchesters. Das war sein großes Steckenpferd: ein Laienorchester. Die spielten natürlich keinen Ligeti, sondern eher Bach – das waren dann auch die Konzerte, zu denen ich Ludwig begleitet habe. Einmal im Jahr hatten sie einen großen Auftritt, meistens sogar im Staatstheater im Foyer. Das mochte ich so an meinem Mann: Er liebte die Musik und war sich für keine Stilrichtung zu schade. Aber auch hier war sicher keiner dabei, der ihm etwas Übles wollte.«
»Und privat? Irgendjemand, mit dem er Streit gehabt hat? Irgendjemand, dem er Geld schuldete? Oder der ihm Geld schuldete?«
Chiara schüttelte nur den Kopf. »Nein, Steffen, das geht völlig in die falsche Richtung. Da war niemand.«
»Hat er gespielt? Um Geld?«