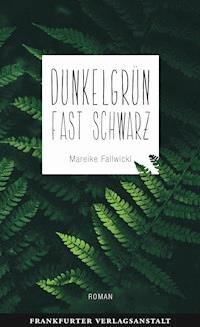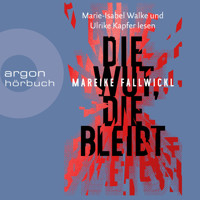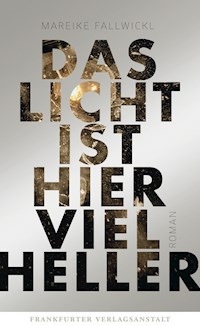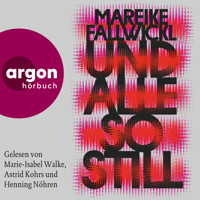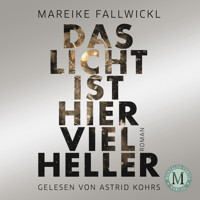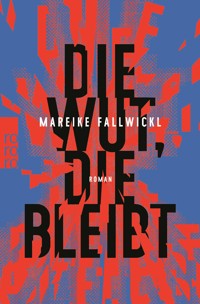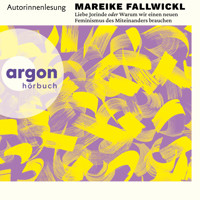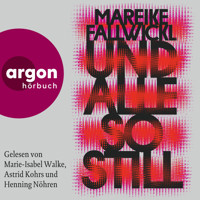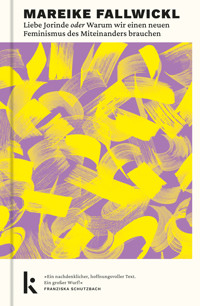
Liebe Jorinde oder Warum wir einen neuen Feminismus des Miteinanders brauchen E-Book
Mareike Fallwickl
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kjona Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Manche sagen: Wenn Mütter ihren Kindern antipatriarchales Wissen vermittelten, hätten wir dank der nächsten Generationen schnell Gleichberechtigung. Dass es so einfach nicht ist, davon handelt dieses Buch. Denn während junge Frauen zunehmend feministisch denken, wenden sich junge Männer verstärkt misogynem Gedankengut zu. Wie gehen wir in Familie und Gesellschaft damit um? Wie schaffen wir es, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen? Und was muss geschehen, damit Männer Verbündete werden? In ihrem ersten Sachbuch plädiert Bestsellerautorin Mareike Fallwickl für einen neuen Feminismus, der alle einschließt – und alle befreit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 59
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
MAREIKE FALLWICKL
Liebe Jorinde oder Warum wir einen neuen Feminismus des Miteinanders brauchen
Briefe an die kommenden GenerationenBAND 5
Liebe Jorinde,
letztens bin ich während meiner Lesereise krank geworden. In Innsbruck habe ich abends auf der Bühne kaum gewusst, wie ich weitersprechen soll, weil sich jeder Atemzug angefühlt hat, als würde mein Hals innen mit einem Messer aufgeschlitzt werden: Ich hatte mir eine Angina eingefangen. Am Tag darauf bin ich zum Arzt, in die Apotheke und zur nächsten Station meiner Lesereise gefahren, wo ich nachmittags, vollgepumpt mit Penicillin, im Hotelbett lag. Wegen der Schmerzen ist es mir nicht gelungen, einzuschlafen, also hab ich auf meinem Tablet nach etwas gesucht, das ich mir anschauen könnte, ohne viel mitdenken zu müssen. Ich hab auf Love is blind getippt, ein Reality-Format, bei dem Männer und Frauen Kabinen betreten, um sich miteinander zu unterhalten, ohne dass sie sich dabei sehen können. Die Sendung stellt die Frage, ob Menschen sich auch dann ineinander verlieben können, wenn sie nicht angezogen werden vom Aussehen. Das Format wird in verschiedenen Ländern gedreht, ich hatte die schwedische Variante erwischt. Unter den männlichen Kandidaten war einer, bei dem ich dachte: Ich wünsche mir, dass junge Männer ihn sich zum Vorbild nehmen. Er war zugewandt und offen, kommunikativ und ehrlich, er hat den Frauen zugehört und war in der Lage, über seine Gefühle zu sprechen. Er hat sich schnell verliebt und war in seiner Zuneigung sehr sicher. Was die Optik angeht, von der die Serie angeblich befreit ist – sie ist es natürlich nicht, und alle Teilnehmenden sind normschön –, war er ebenfalls ganz bei sich: Er wurde für seinen Style von den anderen verlacht, wovon er sich aber nicht beirren ließ. Wenn die Kandidat:innen sich füreinander entscheiden, fahren sie zusammen in den Urlaub und ziehen anschließend für vier Wochen in eine gemeinsame Wohnung, die der Sender zur Verfügung stellt, danach findet die Hochzeit statt – oder auch nicht. Wildes Konzept, ich weiß. Und es ist schön ironisch, dass ich wegen dieser Sendung unerwartet viel nachdenken musste. Über die Sehnsüchte dieser Menschen, die sich eine echte Bindung wünschen, über die Frage, wie wir entkoppelt vom Aussehen Intimität aufbauen, ob möglicherweise ohne den oberflächlichen Blick auf das Äußere sogar eine »bessere« Art von Verliebtheit entsteht oder ob das alles nur aufmerksamkeitsheischendes Show-Getue ist. Ich habe vor Jahren »UnReal« gesehen, eine Serie über die Produktion von Reality-TV-Formaten, die zeigt, wie die Kandidat:innen provoziert und manipuliert und ihre Aussagen auf verfremdende Weise zusammengeschnitten werden. Seither kann ich dramatisch zugespitzte Sequenzen noch weniger ernst nehmen als zuvor. Interessant an Love is blind ist außerdem der Ehezwang: die Hochzeit als ultimative Entscheidung füreinander, die zwar später durch eine Scheidung rückgängig gemacht werden kann, aber erst einmal ein verbindliches Zeichen ist. Mich hat auch die Dynamik zwischen den Paaren beschäftigt, und die rasante Geschwindigkeit, mit der sie in patriarchale Muster gefallen sind. Am intensivsten hab ich dabei ihn beobachtet, er hieß Christofer, und ich habe mich gefragt: Wie können Männer lernen, sich zu öffnen, die Maske der Gleichgültigkeit abzulegen, die das Patriarchat ihnen aufzwingt? Und wie reagieren die Frauen darauf? Denn dieser Aspekt ist von Folge zu Folge faszinierender geworden: Die Auserwählte hat Christofers Antrag angenommen, danach haben sie einander zum ersten Mal gesehen. Im Urlaub und während des Zusammenwohnens hat sich gezeigt, dass er von ihr begeistert war – aber sie nicht von ihm. Er hat gekocht und geputzt, hat mit einer Selbstverständlichkeit Care-Tätigkeiten im Haushalt übernommen, über die nicht diskutiert werden musste, und wenn es doch Diskussionen gab, ist er auf seine Verlobte Catja eingegangen und war imstande, seine Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken. Ist das nicht wünschenswert? Ist das nicht einer der Aspekte, die wir meinen, wenn wir sagen, dass es neue, emotional verfügbare Männer braucht? Aber rate mal, Jorinde, wie Catja das fand: unmännlich. In einer Szene sieht man sie mit zwei Freundinnen, die Christofer kurz davor kennengelernt hatten, und keine der drei verliert ein gutes Wort über ihn: Sie sind irritiert, dass er so viel im Haushalt macht, dass er beim Sex und generell auf Catjas Bedürfnisse achtet, sie können damit nichts anfangen. Je zugewandter, aufmerksamer und freundlicher er zu ihr war, umso genervter, abweisender und gemeiner war sie zu ihm. Er hat das natürlich gemerkt. Er hat es angesprochen. Aber er hat sie auch »meines Herzens Wonne« genannt, und das war ihr zu viel.
Dass Catja sich nicht in Christofer verliebt hat, ist vollkommen legitim. Sie muss sich dafür nicht rechtfertigen, und schon gar nicht soll sie ihn heiraten, weil er ihr ein Frühstücksomelette zubereiten und sie zum Orgasmus bringen kann. Sie hatte jedes Recht der Welt, sich gegen ihn zu entscheiden. Meine Sicht auf diese Beziehung ist sowieso extrem gefiltert, ich kann nur auf das reagieren, was Netflix mir zu sehen gibt, und es ist gut möglich, dass ein bewusst antifeministisches Storytelling dahintersteckt. Klar erkennbar war allerdings, dass Christofer nicht dem Bild hegemonialer Männlichkeit entsprochen hat. Er hat Eigenschaften gezeigt, die für uns weiblich konnotiert sind – Empathie, Fürsorge, Kommunikationsfähigkeit – und automatisch als »unmännlich« gelten, weil wir unserem binären System zufolge Männlichkeit als Gegenteil von Weiblichkeit definieren und umgekehrt.
»Wir lernen, Männer mehr zu lieben, weil sie uns nicht lieben werden. Würden sie es wagen, uns zu lieben, würden sie in der patriarchalen Kultur aufhören, ›echte‹ Männer zu sein. Die Wahrheit, die wir nicht erzählen, ist, dass Männer sich nach Liebe sehnen. Die Unzufriedenheit von Männern in Beziehungen, der Schmerz, den Männer beim Scheitern der Liebe spüren, wird in unserer Gesellschaft auch deshalb nicht bemerkt, weil die patriarchale Kultur sich absolut nicht darum schert, ob Männer unglücklich sind. Die Realität ist, dass Männer verletzt sind und dass die gesamte Kultur ihnen mit den Worten antwortet: Bitte sag uns nicht, wie du dich fühlst«, schreibt bell hooks in Männer, Männlichkeit und Liebe. Es war eine Herausforderung für mich, über mein Tablet mitanzuschauen, dass die Frau an diesem Mann vor allem eins vermisst hat: ein bisschen scheiße behandelt zu werden. Das ist, was wir Frauen lernen, durch Abertausende von Büchern und Filmen, durch reale Vorbilder und unzählige Narrative: dass Männer eben Schweine sind, dass von ihnen keine Liebe auf Augenhöhe zu erwarten ist, sondern immer ein mehr oder weniger toxisches, dominantes, unterdrückendes Verhalten. Wir kennen das hochstilisierte »Bad Boy«-Image, das bis heute (nicht nur) in Young-Adult-Romanen, die durch BookTok zu Millionenbestsellern gehyped werden, zu finden ist: Männer, die Frauen an die Wand drücken, was als romantisiert und sexualisiert gilt. Männer, die nicht (unbedingt) gewalttätig sind, es aber sein könnten. Männer, die ihren Partnerinnen den kurzen Rock verbieten, was (angeblich) zeigt, dass sie sie lieben. Männer, die nicht wissen, bei wie viel Grad man einen Pulli waschen muss. Männer, die über sexistische Witze lachen. Männer, die sagen, dass ihre Kumpel eben »so sind« und das ja »nicht so meinen«. Wie viele Geschichten kennst du, in denen einer Frau der nette Typ zu langweilig ist, während das Arschloch, das sie wahlweise ignoriert oder schlecht behandelt, als interessanter und anziehender dargestellt wird? Natürlich fühlen sich nicht alle Frauen zu toxischen Männern hingezogen. Und Männer verhalten sich nicht scheiße, weil