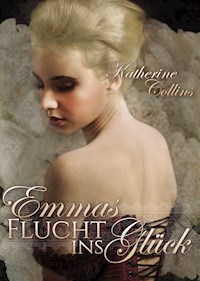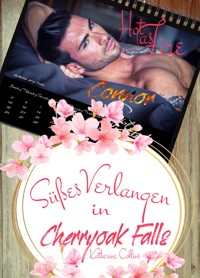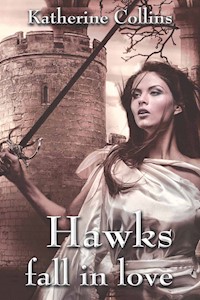4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Venedig im Karneval 1910 Frauenrechte? Nicht mit den römischen Göttern! Um dem neumodischen Treiben Einhalt zu gebieten und die alte Ordnung wiederherzustellen, begibt sich Amor in Gestalt des Druckereibesitzers Arturo in die Lagunenstadt. Dumm nur, dass er sich den Zorn der jungen Bernadetta zuzieht, die sein Geschäft ruinieren will. Sie stiftet jede Menge Verwirrung und sorgt dafür, dass auf den Maskenbällen allerlei frivoles Treiben herrscht, worunter vor allem der konservative Adlige Franco zu leiden hat. Dann richtet sich Amors Elixier auch noch gegen ihn selbst und er entbrennt in heißer Liebe - für einen Mann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Epilog
Danksagung
Liebeswirren in Venedig
Marie C. Bonnet
Katherine Collins
Ester D. Jones
Alle Rechte vorbehalten. Die Weiterverbreitung dieses Textes in elektronischer und anderer Form, auch von Auszügen oder Übersetzungen, ist nur mit schriftlicher Erlaubnis der Autorinnen gestattet.
© 2020 by Marie C. Bonnet, Katherine Collins und Ester D. Jones
Herausgeber: Katherine Collins
c/o K. Reinke
Türkenort 11
45711 Datteln
Lektorat: Jessica Weber
Covergestaltung: TomJay - bookcover4everyone / www.tomjay.de unter Verwendung von Bildmaterial von (c) Samran wonglakorn / Shutterstock.com (Rahmen) und (c) Olga Lebedeva / Shutterstock.com (Köpfe)
1. Kapitel
Göttliche Probleme
Druckereibesitzer. Immerhin. Zwar hätte mir etwas Eindrucksvolleres besser zu Gesicht gestanden – von Adel hätte ich sein sollen oder Geistlicher oder zumindest unverschämt reich –, aber es hätte auch schlimmer kommen können. Wer Eltern hatte wie meine, brauchte keine Feinde!
Und wer Feinde hatte wie meine Eltern, der war bald nicht mehr am Leben. So wie der vorherige Inhaber der Druckerei, der seinen Platz für meinen Auftrag hatte räumen müssen. Nicht dass mir der Mann sonderlich leidtat. Solche Gefühle waren mir ebenso fremd wie die meisten anderen. Und hatte er seinem Leben nicht selbst ein Ende gesetzt, Feigling, der er war? Nur weil sie ihn mit Fortunas Hilfe ruiniert hatten, er das seit Generationen im Familienbesitz befindliche Geschäft nicht hatte retten können. Das wäre nun wirklich nicht notwendig gewesen. Schließlich gab es ja noch andere Einnahmequellen in Venedig. Betteln zum Beispiel. Was ich selbstverständlich nicht nötig hatte, denn Cousine Fortuna war es auch, die mir zu einem ausreichend großen Barvermögen verholfen hatte. Pferderennen. Langweilig, aber gewinnbringend. Das Geld sollte eben ausreichen, um meinen Auftrag auf möglichst angenehme Weise zu erfüllen.
Ja, mein Auftrag … Auch so eine Idee meines alten Herrn, und meine Frau Mutter hatte nichts dagegen getan, dass er mich hier heruntergeschickt hatte. Im Gegenteil, sie unterstützte seine Ansicht, dass es die Frauen auf Erden heutzutage zu bunt trieben. Und schon war meine bisherige Arbeit nicht mehr gut genug gewesen. Nicht dass ich sie besonders aufopferungsvoll betrieben hätte. Hier ein Tröpfchen Elixier in eine Regenwolke gemischt, dort einen meiner unsichtbaren Pfeile verschossen … Es war schließlich nicht meine Schuld, dass die Menschen immer weniger empfänglich für meine subtilen Hinweise wurden. Da hatten andere Götter ihre Finger im Spiel, die die alte Ordnung durcheinanderbrachten.
Die gute Minerva zum Beispiel. Plötzlich meinte sie, die Künste, das Handwerk und die Wissenschaft sollten nicht mehr allein den Männern vorbehalten sein, da sie ja auch eine Frau sei. Also ermutigte sie die Frauen auf Erden, sich ebenfalls darin zu versuchen. Dann zog sie zu allem Überfluss Großmama Juno auf ihre Seite, die auf einmal der Ansicht war, dass sie zwar nach wie vor die Ehe segnen solle, aber nur noch die von zwei Menschen, die aus freiem Willen zusammenkämen. Wer sich nicht verlieben und heiraten wolle, bräuchte es auch nicht zu tun. Des Weiteren meinten die beiden werten Damen Göttinnen, es würde viel weniger Kriege auf Erden geben, wenn die Frauen mehr zu sagen hätten. Pah! Kein Wunder, dass meine Eltern als Götter des Krieges und der Liebe gegen diese Neuerungen waren. Leider hielten sie nichts davon, ihr Anliegen selbst unter den Menschen zu verbreiten. Sie würden mich im Auge behalten und mir im Notfall helfen, hatten sie gesagt. Als ob! Venus und Mars hatten nur Augen füreinander und waren gewiss froh, ihren missratenen Sprössling losgeworden zu sein, der weder empfänglich für die Liebe noch interessiert am Krieg war.
Deshalb saß ich nun also auf der Erde fest und war dazu verdammt, ihren Auftrag auszuführen und die abtrünnigen – oder wie man heutzutage sagte, emanzipierten – Frauen wieder in geeignete Männer verliebt zu machen. Männer, die sie schön unter ihrer Fuchtel halten und ihnen die Gedanken ans Arbeiten, Forschen und Alleinleben austreiben würden.
Immerhin hatte ich mir meine menschliche Gestalt aussuchen können. Das konnten wir alle, und da sich einige von uns einen Spaß daraus machten, die Menschen zu verwirren, glaubten diese nun zu wissen, wie wir aussahen. Unzählige Statuen und Gemälde gab es von uns. Dabei konnte kein Mensch die Schönheit der Götter erfassen. Unser Aussehen war mit menschlichen Maßstäben nicht zu messen, die üblichen Attribute passten auf uns nicht. Vor allem traf keins der üblen Gerüchte über unsere äußerlichen Merkmale zu. Ich war nie ein nackter, fetter kleiner Junge mit Flügeln gewesen. Flügel! Als ob wir Götter so etwas nötig hätten. Wir bewegten uns in unserer Welt allein durch die Kraft unserer Gedanken.
Aber genug davon. Die Zwischenwelt war fern, und ich musste mich um meinen Auftrag kümmern. Ich war nun der Druckereibesitzer Arturo Matteo Otis Rossi, von hochgewachsener Statur und dunklem, von einigen ansehnlichen grauen Strähnen an den Schläfen durchzogenem Haar, stets elegant gekleidet und so geschäftsmäßig auftretend, wie es einer eher faul veranlagten Gottheit möglich war. Die Arbeit eines Druckers hatte ich gründlich unterschätzt. Schließlich musste ich, um den Schein zu wahren, neben den Druckerzeugnissen, die mein Auftrag erforderte, auch diejenigen herstellen, die eine Druckerei üblicherweise hervorbrachte – Bücher, Pamphlete, Zeitungen und sonstige Schriften. Ich hatte zwar einige der Angestellten des Vorbesitzers übernommen, aber diese schlichten Gemüter in ihren verdreckten Kleidern konnte ich unmöglich an die besondere Druckerpresse lassen, die im Obergeschoss in dem kleinen Raum neben meinem Büro stand. Es war die einzige, an der ich eigenhändig arbeitete – die Lautstärke in der Druckhalle im Erdgeschoss hielt ich keine fünf Minuten aus! –, und dies hatte ich bisher allein getan. Es war anstrengender, als ich es mir hätte ausmalen können. Ich nahm mir vor, schnellstens einen weiteren Gehilfen einzustellen. Möglichst einen mit Erfahrung, denn ich hatte nicht vor, das lästige Setzen der Buchstaben und das Hantieren mit der Druckerschwärze weiterhin selbst zu übernehmen. Diese Arbeit konnte mir getrost ein junger Mann abnehmen. Wenn sich dieser dann auch noch mit den übrigen Maschinen auskannte und ein gewisses Maß an Autorität gegenüber den einfachen Angestellten besäße – umso besser. Schließlich musste ich den Burschen für den ganzen Tag bezahlen, und so umfangreich waren meine speziellen Aufträge nun auch wieder nicht. Dennoch mussten sie in aller Sorgfalt ausgeführt werden. Dazu sollte mein zukünftiger Angestellter selbstverständlich in der Lage sein, dann würde mein Dasein auch wieder angenehmer werden.
Von dem feinen Büttenpapier allerdings, das ich für meinen Auftrag benötigte, musste ich ihn fernhalten. Damit würde ich mich des Nachts beschäftigen – sofern mein störender menschlicher Körper es zuließ. Im Unterschied zu meiner göttlichen Existenz benötigte dieser nämlich Schlaf. Ebenso musste ich, um ihn am Leben zu halten, all die anderen profanen Dinge tun, mit denen sich die Menschheit den lieben langen Tag beschäftigte: Kälte und Wärme durch Kleidung ausgleichen, regelmäßig Essen und Trinken zuführen – ganz zu schweigen von dem, was man tun musste, um Selbiges wieder aus dem Körper loszuwerden. Wie erniedrigend! Gewiss beobachteten mich Minerva und Juno dabei und hatten ihre helle Freude daran. Wie ich diese Weiber hasste! Sie waren nicht besser als die Frauen hier unten, die den ganzen Tag tuschelten und gehässig über andere redeten.
Zum Glück zog mich nichts zu diesen Wesen hin. Nicht auszudenken, wenn dieser menschliche Körper auch noch menschliche Empfindungen hervorgebracht hätte! Wenn ich zu allem Überfluss die Notwendigkeit verspürt hätte, das zu tun, was die von mir zusammengeführten Paare in ihren Schlafzimmern taten. Mich grauste es bei dem bloßen Gedanken daran. Das wäre sogar noch unwürdiger gewesen als der Besuch des Aborts.
Meine Gefühle jedoch waren noch immer dieselben, die schon mein göttliches Ich verspürt hatte, und damit so gut wie nicht vorhanden. Alle Geschichten, die sich die Menschen über mich und gewisse sterbliche Frauen ausgedacht hatten, waren erstunken und erlogen. Liebe – pah! Schlimm genug, dass sich meine Eltern zu so etwas herabließen. Und das nicht nur auf geistiger Ebene. Die beiden wälzten ihre betörend schönen göttlichen Körper stundenlang miteinander im Bett herum wie jedes beliebige Bauernpärchen, oft genug sogar spaßeshalber in der Gestalt, die ihnen die Menschen angedichtet hatten. Mir wurde schon von dem Gedanken daran übel! Umso mehr, da die beiden meine Eltern waren. Als wäre die Sache an sich nicht schon schlimm genug gewesen!
Mir konnte all das glücklicherweise nicht passieren. Ich verspürte weder Liebe noch Fleischeslust, und das war gut so.
2. Kapitel
Signorina Bernadetta Bianco
Die Wolken hingen tief über San Michele. Ihr dunkles Grau berührte die rötlich-gelben Mauern, die den Friedhof ringsherum abschirmten. Lediglich die tiefschwarzen Schirme gaben der Szenerie einen noch düstereren Anstrich. Bernadetta starrte zum Horizont, Tränen verschleierten ihren Blick, wagten aber nicht, über ihre kühle Wange zu rollen. An ihrer Seite standen ihre Schwester Orietta und ihre Mutter Demetra vor dem tiefen Loch zu ihren Füßen. Erde war kniehoch daneben aufgeschichtet, eine Schaufel steckte darin. Sechs ganz in Schwarz gekleidete Männer standen bereit, um den Eichensarg in das Erdreich abzusenken, sobald der Pfarrer seine Grabrede beendete.
Die ersten Tropfen platschten Bernadetta ins Gesicht, obwohl sie sowohl einen Hut als auch einen Schleier trug. Der Schauer wurde heftiger, und obwohl die Trauergäste zusammenrückten, konnte das Dach aus Schirmen nicht verhindern, dass die Umhänge binnen kürzester Zeit durchnässt waren. Eilig wurden Blumen und Erde in das Loch geworfen, damit die Angehörigen, ehemaligen Geschäftspartner und Bekannten nach einer schnellen Kondolenz davonhasten konnten.
Orietta klammerte sich an Bernadettas Arm, umrankte ihn regelrecht. Das Gewicht der Schwester zerrte sie hinab, schließlich war Bernadetta einen ganzen Kopf größer als die jüngere Tochter aus dem Haus Bianco und dazu schlank wie ein Laternenpfahl.
»Signora Bianco, Signorinas, bitte folgen Sie mir.« Pater Claudio deutete zum großen, eisenbeschlagenen Tor, vor dem der Kai lag, an dem ihre Gondel befestigt war.
»Signora Bianco«, murmelte der Geistliche, wobei er sich zu Demetra beugte. Seine Hand umschloss ihren Ellenbogen, was Bernadetta verkniffen bemerkte. War dies der Grund, warum der Vater nun in seinem kalten Grab lag?
Sie beschleunigte ihren Schritt, um das leise Gespräch zu belauschen, und zerrte dabei ihre Schwester hinter sich her.
»Sie verstehen sicherlich, dass ich Ihren Tribut augenblicklich einsammeln muss.« Die Forderung beruhigte zwar Bernadetta, ließ die Mutter aber erbleichen. Sie sah mit großen, grünlich schimmernden Augen zu dem Geistlichen auf und schüttelte ansatzweise den Kopf.
»Aber Herr Pfarrer! Gewähren Sie mir ein paar Tage Aufschub, bis die Erbangelegenheiten geklärt sind«, flehte Demetra. »Ich habe keine Lira in der Tasche.« Sie klammerte sich an die stützende Gliedmaße des Geistlichen, wie Orietta sich an Bernadettas Arm rankte.
»Signora, ich kann keine Ausnahmen machen. Der Tribut muss augenblicklich entrichtet werden«, beharrte er und löste sich von der Bittstellerin, um ihr die fordernde Hand entgegenzustrecken.
»Aber«, hauchte Demetra voller tiefsitzender Verzweiflung. »Wir haben …«
»Madre«, mischte Bernadetta sich eilig ein und trennte das ungleiche Paar, indem sie zwischen sie trat. Dabei wühlte sie in ihrer Jackentasche nach den Lire, die sie in weiser Voraussicht eingesteckt hatte. »Was sind wir Ihnen schuldig, Pater?«
Der Geistliche verzog in deutlichem Missfallen die Miene. »Signorina, es stände Ihnen gut an, sich nicht in Geschäfte zu mischen.«
Bernadetta atmete tief ein, ohne den Blick von dem Mann Gottes zu nehmen. Wie alle Männer achtete er sie gering, weil sie ein Mädchen war.
»Sie wollen Ihr Geld, nicht wahr? Nun, meine Mutter wird Ihnen da nicht helfen können.« Sie straffte die Schultern und hob das Kinn. Ihr Gegenüber war in etwa so groß wie sie selbst und ebenso hager. Allerdings war sein Gesicht von tiefen Linien durchzogen, die von seinem Alter kündeten, und auf seiner knochigen Nase sprossen drei lange, weiße Haare.
Bernadetta wartete, ohne den Blickkontakt zu brechen. Das tat er. Nach einem zornigen Schnaufen streckte er die Hand aus und ließ sich bezahlen.
Demetra schluchzte, als der Pfarrer sie aus dem Friedhof schob und das Tor hinter ihnen versperrte. Orietta stand verloren bei ihr, nur Bernadetta wusste genau, was zu tun war. Sie winkte dem Gondoliere zu, der als Einziger noch am Pier stand und unter den Wassermassen, die aus dem Himmel auf sie hinunterprasselten, zu leiden hatte. Er half ihnen, eine nach der anderen in die Gondel zu steigen, und schipperte dann langsam los. Die Lagune war eigentümlich ruhig, nur die schweren Tropfen wirbelten sie auf. Bernadetta hatte sich nie zuvor mit der Natur so verbunden gefühlt wie gerade in diesem Moment. Auch sie strahlte trotz des stetigen Bombardements Ruhe aus.
»Madre, du solltest mit unseren häuslichen Belangen besonnener umgehen. Der Padre muss nicht wissen …« Bernadetta sah zum Gondoliere und unterbrach sich. Auch dieser Mann musste nicht ahnen, wie angespannt die finanzielle Situation im Hause Bianco war. Sie räusperte sich bedächtig. »Wir sollten uns in der Zeit der Trauer ganz auf die Familie besinnen.«
Mutter und Schwester stimmten sogleich zu, aber sie selbst konnte sich nicht von der Vergangenheit fortreißen. Es dauerte, bis sie an ihrem Palazzo anlangten und aus der Gondel steigen konnten. Das Wasser, das sich in ihr gesammelt hatte, krabbelte in ihren Kleidern hoch. Die Säume klatschten bei jedem Schritt gegen die Stiefel und hinterließen Pfützen auf ihrem Weg über den schmalen Steg in das Stadthaus der Biancos.
Die Tür war verrammelt, ebenso all die Fenster im Untergeschoss. Der Leichenschmaus war aus finanziellen Gründen abgesagt worden, weshalb sie nicht erwarten mussten, dass jemand vorbeischaute. Die Peinlichkeit lastete nicht nur auf Bernadetta, auch Demetra und Orietta wussten, was das Brechen der Konventionen für sie bedeutete: den gesellschaftlichen Abstieg.
»Madre, benötigst du Hilfe beim Auskleiden? Orietta, könntest du dich darum kümmern? Ich werde mich umkleiden und …« Sie brach ab, weil ihre Mutter auf den Stufen zum Obergeschoss schniefend zusammensackte. Die Schwester eilte ebenso heulend auf sie zu, um sich in die tröstende Umarmung zu werfen, die Bernadetta zwar ebenso dringend benötigte, aber nun mal nicht geben konnte. Alles in ihr wehrte sich gegen den Trost, gegen die Nähe der Familie. Sie wollte nicht weinen, sie wollte nicht in das Wehklagen der beiden Frauen einstimmen.
Dennoch tätschelte sie die Schulter der Schwester. »Padre wird immer bei uns sein.« Jede Sekunde der Umarmung machte sie wütender. Ihr Magen verkrampfte sich, eine Schlinge legte sich um ihren Hals, um sich immer weiter zuzuziehen.
»Er ist fort!«, rief die Mutter gramerfüllt. »Er hat uns im Stich gelassen und nun werden wir darben! Wir werden alles verlieren!«
»Orietta, bitte nimm dich einen Moment zusammen. Hilf Mutter ins Bett. Madre, ich spreche mit unserem Anwalt.« Bernadetta schob die Schwester von sich, weil sie die Umarmung einfach nicht mehr ertrug. Ohne die Trauerkleidung zu wechseln, stürmte sie aus dem Haus, wobei sie die Verantwortung, die nun auf ihr lastete, von sich schob.
Die Gondel war fort, schließlich besaßen sie keine eigene mehr, seit sie die Druckerei verloren hatten. Vieles hatte sich seitdem verändert.
Der schmale Steg war kaum breit genug, dass sie trockenen Fußes bis zur Hauptstraße kam, und bestand auch nur aus morschen Holzpaneelen. Allerdings war es ohne Gondel die einzige Möglichkeit, sich in der Lagunenstadt fortzubewegen. Man musste sich nahe den Häusern auf den Wegen halten, die gerade in ihrem Bezirk bewusst unsichtbar gehalten wurden, schließlich wünschte man keine Fußgänger um die Palazzi herumstreifen zu sehen. Auch die Hauptstraße war wenig beeindruckend, wenn auch eine der wenigen in Venedig, denn in der Lagunenstadt kam man besser mit der Gondel über die Wasserwege von einem Ort zum anderen als zu Fuß. Dennoch erreichte sie das Geschäftsgebäude des Advokaten binnen Minuten. Sie stürmte das Büro, obwohl sie keinen Termin hatte und der Gehilfe, der im Vorzimmer saß, sie aufhalten wollte und ihr auf dem Fuß folgte.
»Avvocato Silone, ich brauche augenblicklich Einsicht in den Erbfall meines Vaters!«
Ihr Gegenüber war bereits ergraut, kahlköpfig und zwei Köpfe kleiner als Bernadetta und erhob sich von seinem bequem anmutenden Sessel hinter dem überladenen Schreibtisch.
»Signorina Bianco! Herrje, sollten Sie nicht bei der Trauerfeier Ihres werten Herrn Papa sein?« Er zog sein Jackett an den Rockschößen herab und strich einige Male über seinen Bauch. Dann winkte er seinen Gehilfen hinaus. Er grinste väterlich zu ihr auf. Mit einem Wink bedeutete er ihr, sich auf den Stuhl zu setzen, der auf der anderen Seite des Schreibtisches stand. Er wartete, bis sie Platz genommen hatte, bevor er auch wieder auf seinen Stuhl sank. Er verschränkte die Finger vor sich auf der Tischplatte.
»Verzeihen Sie mir, Avvocato, aber dieser Tag reißt an meiner Fassung.« Bernadetta räusperte sich, wobei auch sie sich über die mitgenommene Kleidung strich, und wartete auf das Klicken des Türschlosses, das ihr verriet, endlich mit dem Anwalt der Familie allein zu sein. Avvocato Niccolò Silone war ihr fast so lieb, wie der eigene Vater es gewesen war, und ebenso vertraut. Als langjähriger Geschäftspartner ihres Vaters war er zu einem beständigen Teil ihres Lebens geworden. Endlich vernahm man, dass die Tür geschlossen worden war, und auch Niccolò seufzte auf.
»Ich hoffe, Demetra sieht mir meine Abwesenheit nach.« Er seufzte, wobei er sich über die kleinen Augen rieb. Nachdem er die Brille wieder aufgesetzt hatte, blinzelte er einige Male. »Aber San Michele werde ich lebend nicht mehr betreten.«
Bernadetta räusperte sich, schließlich konnte sie es durchaus nachfühlen und gleichsam nicht nachvollziehen, schließlich war ein guter Freund zu Grabe getragen worden.
»Deine Abwesenheit wurde nicht bemerkt«, beruhigte sie ihn. »Madre ist nicht in der Verfassung, irgendetwas …« Sie brach mit einem Kopfschütteln ab, das einen guten Teil ihrer Anspannung löste. Bernadetta seufzte. Sie schlug die Hände vor das Gesicht, um ihre Emotionen unter Kontrolle halten zu können, und presste minutenlang Lider und Lippen aufeinander.
Niccolò seufzte schließlich. »Warum bist du hier, Detta?«
Sie schluckte den Kloß hinunter, der ihr das Atmen erschwerte, und schob ihre Trauer zur Seite. »Ich will wissen, was passiert ist.« Ihre zittrigen Finger waren eiskalt. »Wie konnten wir die Druckerei verlieren?«
Für Bernadetta stand eines fest: Der Verlust hatte den Vater in den Tod getrieben.
Die Stamperia Bianco war seit dem 15. Jahrhundert ein florierender Familienbetrieb gewesen und das einzige Auskommen der letzten Nachkommen der Dynastie.
»Ah«, machte der Anwalt, wobei er sich zurücklehnte, um die Hände auf seinem Bauch zu falten. »Eine hervorragende Frage!«
Auf die sie eine Antwort wollte. Bernadetta rutschte auf die Kante ihres Stuhls. »Wie konnten wir alles verlieren, wenn unsere Auftragsbücher voll waren?« Das wusste sie mit absoluter Sicherheit, schließlich kannte sie die Bücher ebenso gut wie ihr Vater. Sie hatte seit Jahren Einsicht in die Geschäfte und konnte sich das plötzliche Aus einfach nicht erklären.
»Die Tiden des Schicksals, mein Kind«, wischte der alte Mann die Frage beiseite.
»Nicci!«, beharrte Bernadetta. »Mein Vater hing nicht von den Dachsparren unseres Hauses, weil es das Schicksal so wollte!« Sie stand auf und stapfte durch den schmalen Raum.
»Noch im Herbst waren wir liquide! Wie konnte es so schnell bergab gehen?«
»Nun, vermutlich war die Konkurrenz zu groß.« Auch die Bemerkung wischte er beiseite. »Die Preise sind gefallen und italienische Investoren drängen in unsere Stadt.«
Bernadetta horchte auf. »Die Stamperia ist doch nicht …« Sie musste die Frage nicht beenden, sie sah die Antwort bereits in den mitleidigen, blassen Augen ihres Gegenübers. Die Druckerei, die Jahrhunderte in der Familie von Vater auf Sohn weitergegeben worden war, hatte bereits einen neuen Eigner.
Heiße Wut schmorte ihre Eingeweide. Nichts sonst als dieses Wissen musste ihrem Vater den Lebenswillen genommen haben, somit war der Mistkerl, der nun ihr Geschäft führte, schuld am Tode ihres Vaters.
»Das wird er bereuen!« Ihre Stimme schwankte so sehr, dass sie sich selbst nicht verstand. Aber die Vorstellung von schmelzender Rache ließ sich nicht mehr aus ihren Gedanken vertreiben.
3. Kapitel
Kundschaft
Dafür, dass es mich selbst weder zum weiblichen noch zum männlichen oder irgendeinem sonstigen Geschlecht hinzog, besaß ich erstaunliche Fertigkeiten darin, passende Liebende auszuwählen und zusammenzubringen. Oder jedenfalls hatte ich sie früher besessen, als ich noch erfolgreich von zu Hause aus gearbeitet hatte. Meine Eltern waren stets zufrieden mit mir gewesen, und je eher dieser Zustand zurückkehrte, desto eher würde auch ich zurückkehren in mein bequemes Dasein und diesem Venedig den Rücken zuwenden.
Warum hatte es nicht London sein können, warum nicht Paris? Ausgerechnet für diese feuchte, stinkende Stadt, die auf vermodernden Pfählen stand, hatten sie sich entschieden. Weil wir römischen Götter angeblich nur im heutigen Italien Macht besaßen und nicht mehr in den einst römischen Gebieten. Pah! Ich hätte auch die frechen Pariserinnen und die englischen Suffragetten wieder zu anschmiegsamen Eheweibchen gemacht.
Aber nein – Venedig hatte meine Mutter für mich ausgewählt. Die Zeit der Maskenbälle sei ideal, um Verbindungen zu schmieden. Einfach präparierte Einladungskarten verschicken, und schon würde die Liebelei beginnen. Einfach … Ich hoffte sehr, dass die gute Venus damit recht behalten würde.
Ich zog die Laterne näher zu mir und beugte mich über die Druckerpresse. Das Hantieren mit den winzigen Lettern und der Farbe, die mir bei meinen ersten Versuchen nicht nur die Finger, sondern auch das Hemd beschmutzt hatte, war mir lästig, obwohl ich es inzwischen beherrschte. Es führte jedoch kein Weg daran vorbei. Ich betrachtete den Stapel mit dem feinen, handgeschöpften Büttenpapier auf dem Tisch neben mir. Das durfte mein zukünftiger Gehilfe keinesfalls in die Finger bekommen. Nicht nur, weil es so wertvoll war, nein …
Zumindest war der Text für die Einladungen nur einmal zu setzen, da er gleichlautend blieb. Derselbe Wortlaut einmal auf die rechte, einmal auf die linke Seite des Papiers.
Werte Dame, werter Herr!
Hierdurch lade ich Sie auf das Herzlichste zu meinem jährlichen Maskenball ein. Musik, Tanz, Speis und Trank sollen Ihnen die dunkle Jahreszeit versüßen.
Kostüm erwünscht.
Es folgten Name und Anschrift des Gastgebers, der zwar von Auftrag zu Auftrag variierte, aber innerhalb eines Auftrags von bis zu einhundert Einladungen selbstverständlich identisch blieb.
Nur die Namen der Empfänger auf den Umschlägen musste ich jedes Mal neu setzen, und das äußerst bedachtsam, damit es nicht zu Verwechslungen kam. Ebenso viel Sorgfalt musste ich walten lassen, wenn ich die Einladungen in zwei Hälften schnitt und sie in der richtigen Reihenfolge aufstapelte, damit am Ende jede in den passenden Umschlag gesteckt werden konnte. Nicht auszudenken, wenn dabei etwas durcheinanderkommen würde!
Es war nämlich kein einfaches Büttenpapier. Oder doch – das, was dort auf dem Tisch lag, war zwar edel, aber dennoch nichts Besonderes. Außergewöhnlich wurde es erst durch die Behandlung, die ich ihm vor dem Druck zukommen ließ.
Ich nahm den winzigen Schlüssel aus seinem Versteck unter einer losen Bodendiele und trat an das Schränkchen, das an der rückwärtigen Wand des Raumes hing. Ich schloss es auf, entnahm vorsichtig das bauchige Fläschchen mit dem Elixier und zog den Korken aus seinem schmalen Hals. Das leise Plopp klang in der nächtlichen Stille der Druckerei wie ein Donnerschlag. Ich zog die feinen Lederhandschuhe an und goss einige Tropfen der geruchlosen, klaren Flüssigkeit in eine Schale. Dann ergriff ich einen weichen Pinsel und machte mich ans Werk. Ein Blatt Büttenpapier nach dem anderen bestrich ich sorgfältig. Wenn mir die Arbeit auch keine Freude bereitete – es gab wenig, was das tat, abgesehen vom Beobachten von Menschen und ihren unwichtigen Sorgen -, so verschaffte sie mir doch eine Art Befriedigung und Vorfreude auf die Ergebnisse, die meine Mühe erzielen würde. Die Weiber hatten keine Chance! Ich hatte unter all denen, die auf der Liste meines Kunden, des Visconte di Como, standen, die garstigsten, unweiblichsten ausgesucht und dazu auserkoren, sich in die herrschsüchtigsten Männer zu verlieben. Dazu war ich zu jedem Haus auf dieser Liste gegangen, hatte durch Fenster gespäht, hinter Ecken gewartet, um die richtigen Opfer für mein Vorhaben auszuwählen. Sie würden schnurren wie die Kätzchen und gern am heimischen Herd verweilen, nur um ihrem Ehegatten das Leben zu versüßen. Mutter würde stolz auf mich sein!
Zwanzig Karten bearbeitete ich in dieser Nacht. Vierzig Menschen würden dadurch zu meinem Spielzeug werden, zwanzig Paare geschaffen, um die alte Ordnung zu erhalten. Ich trennte sie sorgfältig von den übrigen dreißig, die an bereits verheiratete oder zu alte Menschen gingen. Diese würden das unbehandelte Papier erhalten.
Kaum lag der Stapel gefüllter und beschrifteter Umschläge vor mir auf dem Schreibtisch, erklang ein Klopfen. Die Stimme meines dümmlichen Laufburschen mit Namen Dante drang durch die dicke Eichenholztür.
»Signor Rossi? Ein edler Herr wünscht Sie zu sehen. Es geht um einen Auftrag.«
Der erste Kunde des Tages. Nun gut. Ich traute Dante nicht zu, einen Edelmann von einem Dienstboten desselben zu unterscheiden, aber es war immerhin möglich, dass er richtig geraten hatte. Also sollte ich den Besucher vermutlich höflich empfangen. Ich seufzte und erhob mich.
»Er soll eintreten«, rief ich und setzte mein in stundenlanger Qual vor dem Spiegel eingeübtes Lächeln auf. Die Anliegen von Kunden interessierten mich nicht mehr als die aller anderen Menschen, aber um meinen Auftrag zu erfüllen, war es notwendig, mich ihnen zuvorkommend und professionell zu präsentieren.
Dante stieß die Tür auf und trat unter tiefen Verbeugungen beiseite. Ich kannte den Mann, der eben schnaufend vom Erklimmen der steilen Treppe um die Ecke bog. Es war Signor Franco Giancarlo Cicarese. Offenbar traute er seinen Dienern so wenig zu wie ich meinen Angestellten, wenn er höchstpersönlich den Weg zu mir antrat. Er trug ein Papier in der Hand – eine Namensliste, wie ich hoffte. Ein weiterer Maskenball wäre meinem Anliegen äußerst förderlich.
»Ah, guten Morgen, Signor Cicarese. Wie geht es Ihnen?«
»Guten Morgen, Signor Rossi. Gut, danke der Nachfrage.«
Er fragte nicht nach meinem Befinden – das taten die Reichen nie –, sondern trat unaufgefordert in mein Büro ein, setzte sich auf den Besucherstuhl und kam gleich zur Sache.
»Ich wünsche, dass Sie Einladungen zu meinem Maskenball in zwei Wochen drucken. Sie sollten spätestens in drei Tagen versandfertig sein. Hier ist die Liste.«
Sehr schön. Wie ich es mir gedacht hatte. Aber drei Tage? Ich brauchte dringend diesen neuen Gehilfen!
Ich setzte mich und ergriff meinen Füllfederhalter, um mir Notizen über den Auftrag zu machen. Signor Cicarese ließ sich ausgiebig über die Qualität des Papiers und die Schriftart aus, die er wünschte, und ich nickte mit dem ebenfalls eingeübten, irgendwo zwischen beflissen und selbstsicher angesiedelten Ausdruck auf dem Gesicht.
Wir verabschiedeten uns am Treppenabsatz, und ich wollte schon wieder in meinem Büro verschwinden, da drehte sich Cicarese noch einmal um.
»Ach ja – wundern Sie sich nicht, dass auch meine Mutter auf der Liste steht. Sie wünscht eine förmliche Einladung.« Er verzog das Gesicht. »Sie wird ein wenig wunderlich, seit sie die fünfzig überschritten hat.«
Cicarese polterte die Treppe hinab und verschwand aus meinem Blickfeld. Ich atmete auf. Zwar konnte meine lästige Hülle zumindest dies weitestgehend allein, doch manchmal war ein tieferer Atemzug notwendig, so wie in diesem Augenblick. Ich war dankbar für den letzten Hinweis meines Kunden. Nicht auszudenken, wenn ich hinter dem Namen seiner Mutter den einer jüngeren Verwandten vermutet hätte – die es zuhauf gab in der Familie – und sie mit einem Jüngling verkuppelt hätte. Damit wäre ein aussichtsreicher Kandidat für eine junge Aufmüpfige verschwendet gewesen.
Die elende Müdigkeit, an die ich mich noch nicht gewöhnt hatte, überfiel mich so plötzlich, dass ich es eben noch an die Druckerpresse schaffte, mein Stellenangebot anfertigen und am Tor aufhängen konnte, bevor ich die Treppen zu meinen Wohnräumen im obersten Geschoss erklomm und ins Bett fiel. Mein letzter Gedanke galt meinem Zuhause, in dem es keine solchen Anstrengungen wie Stufen oder Schläfrigkeit gab. Glücklicherweise war die Ballsaison nicht lang. Ich hoffte nur, dass sich Mutter nicht noch mehr Aufträge für mich einfallen ließ …
4. Kapitel
Eine Stellung in Ehren
Bernadetta bestieg die Gondel mit immenser Wut im Bauch. Soeben war ihnen eine weitere Forderung ins Haus geflattert, die sie ebenso wenig begleichen konnten wie das Dutzend davor. Sie befürchtete, dass das schlimme Ende nur zu bald an ihre Tür klopfte. Natürlich wusste sie, wer die Schuld am Ungemach ihrer Familie trug. Der neue Eigner ihrer Druckerei. Es war an der Zeit, ihren Hass in Bahnen zu lenken, und dazu musste sie sich zunächst ein vollständiges Bild der Situation machen. Sie musste den Feind kennen, um ihn ebenso zu vernichten, wie er sie zu vernichten trachtete.
Da niemand einem Mädchen Beachtung schenkte, schon gar nicht in Aufmachung einer Bediensteten der herrschaftlichen Häuser, hatte sie ihre einzige verbliebene Magd um ihr Kleid gebeten. Ein Korb hing an ihrem Arm und die Kapuze ihres Mantels verdeckte ihr Haar und große Teile ihres Gesichtes. Die Gondel schaukelte heftig, weil sie von dem Rio, der an ihrem Palazzo entlangführte, auf den viel befahrenen Canale abgebogen waren und damit ihr Ziel unmittelbar vor ihnen lag.
Bernadetta wagte einen Blick. Ihr Herz stockte, denn die Druckerei war kaum wiederzuerkennen. Die Banner, die bisher mit ihrem Familienwappen bedruckt an beiden Seiten der Pforte herabgehangen hatten, waren durch neue ersetzt worden. Stamperia Arturo Rossi. Verflucht sei er.
Die Gondel schlug sacht gegen den Kai. Bernadetta erhielt keine Hilfe, als sie aus dem schaukelnden Boot an Land ging, und auch auf dem Bürgersteig wurde sie zur Seite geschubst. Sie wich aus, murmelte Entschuldigungen und tat so unterwürfig, wie es ihr möglich war. Innerlich schürte jede Herabsetzung nur noch ihre Wut. Eine Traube Männer blockierte ihren Weg zum Tor, sie versuchten, einander aus dem Weg zu schubsen, um der Erste in der Reihe zu sein.
»Heda«, rief sie. »So macht Platz. Ich habe einen Auftrag für meinen Herrn zu erledigen.«
Sie erwartete nicht, dass man auf sie hörte, und wurde auch nicht enttäuscht. Sie musste sich durchkämpfen, wobei sie ihren Korb als Waffe nutzte und sie dem Mannsvolk kräftig in die Mägen rammte. Vor dem Tor angelangt erkannte sie endlich, was die Kerle so an ihrem Platz in vorderster Reihe hatte klammern lassen. Ein Pamphlet prangte gut lesbar am Tor.
Bernadetta überflog es mit wachsender Zufriedenheit. Offensichtlich hatte der feine Signor Rossi bereits Probleme. Laut der angeschlagenen Anzeige suchte er Personal für den Druckbetrieb, und Bernadetta wusste, wie schwer es war, geschulte Menschen zu finden. Zwar gab es in Venedig unzählige Druckereien, aber keine war so fortschrittlich wie ihre. Biancos Stamperia besaß sowohl altertümliche Pressen für erlesene Einzeldrucke als auch hoch maschinelle, die hunderte Seiten am Tag erstellen konnten. Jedoch waren nur wenige Menschen in der Bedienung beider Maschinen kundig.
Bernadettas unbändige Wut flaute ab. Es war, als zeigte ihr Vater ihr noch aus dem Himmel heraus den richtigen Weg. Den einzigen Weg, um das Unrecht, das ihnen widerfahren war, wieder wettzumachen. Noch in Gedanken versunken ließ sie sich aus dem Weg schieben. Sie musste zurück in den elterlichen Palazzo und sich zudem eilen. Zwar gab es unter den Männern, die sich bereits um die Stelle des Gehilfen in der Stamperia Rossi balgten, sicherlich keinen, der den Anforderungen auch nur annähernd so gut gewachsen wäre wie sie selbst, aber sie mochte auch nicht die Hand für die Geistesstärke des Signor Rossi ins Feuer legen.
Bernadetta zupfte sich das Jackett gerade und straffte die Schultern. Sie hatte elendig lange gebraucht, um nach Hause zu kommen, die Kleidung ihres Vaters zu durchsuchen, einen Anzug passend für sich abzuändern und sich die Haare abzuschneiden. Nun stand sie erneut vor der Druckerei ihrer Familie, sah an der Fassade hinauf und verspürte unbändigen Zorn. Sie wusste, dass sie ihn bändigen musste. Sie musste Ruhe bewahren und einem Plan folgen, den sie bisher nicht einmal richtig ausgearbeitet hatte. Sie wollte Arturo Rossi ruinieren. Er sollte nachfühlen, wie es war, alles zu verlieren.
Bernadetta atmete tief ein. Die Rechnungsbücher ihres Vaters mussten sich noch in der Druckerei befinden und es würde ihr sicherlich helfen, wenn sie erneut Einblick erhielte. Zu verstehen, wie dieser Unhold den Familienbetrieb in die Finger hatte bekommen können. Sie war sich sicher, dass es nicht mit rechten Dingen zugegangen war, und hoffte auf genügend Hinweise, um den Avvocato einschalten zu können.
Sie streckte die Hand aus, um sie an den eisernen Knauf zu legen.
Die Tür klemmte, aber damit hatte Bernadetta gerechnet. Etwas mehr Druck und ein leichter Zug nach rechts behoben das Problem, und sie stieß das Tor auf. Vor ihr erstreckte sich die Druckhalle mit ihren vier Druckschienen. An den Seiten des Raumes waren Regale aufgebaut, die Papier und Druckplatten beinhalteten. Farbe, Buchstaben, Hilfsmittel für den Satz und Reinigungsmaterialien verbargen sich in den Schubladen und Schränken. Bernadetta konnte sich blind zurechtfinden. Wenn ein Semikolon gebraucht wurde für die Buchstabendruckerpresse oder die Farbe, wenn der Druck mit Goldpartikeln bedeckt werden sollte – Bernadetta wusste, wohin sie greifen musste.
Dennoch sah sie sich interessiert um, als wäre alles völlig neu für sie. Die Krempe ihres Hutes sollte ihr Gesicht gut genug verstecken, dass die Mitarbeiter sie nicht erkennen sollten. So Rossi ihr Stammpersonal nicht ausgewechselt hatte. Um die vier Pressen zu bedienen, waren zwischen vier und acht Personen notwendig. Ihr Vater hatte sich ausschließlich in seinem Büro im oberen Stockwerk aufgehalten. Im zweiten Stock lagerten die verschiedenen Papiersorten, im dritten all jene Dinge, die nicht häufig in Benutzung waren. Stiche, Schnörkel und solche Dinge.
Dante, der Laufbursche, vertrat ihr den Weg.
»Signore?« Er sah an ihr herab, erfasste ihre Aufmachung, die deutlich von ihrem Rang sprach, und schluckte nervös. »Darf ich Sie zu Signor Rossi geleiten?« Er verbeugte sich unnötig oft vor ihr und streckte den Arm aus, um in Richtung Treppe zu zeigen.
Bernadetta nickte bloß. Es hatte sich nichts geändert, nicht einmal im Büro ihres Vaters. Nur der Mann hinter dem breiten, uralten Schreibtisch war ein anderer.
Ihr Magen verknotete sich, und für einen kleinen Augenblick hinterfragte sie ihre Absichten. Der Mann, der für den Untergang ihrer Familie verantwortlich war, saß über Papiere gebeugt und sah nicht auf, als Dante ihn zögerlich ansprach.
»Signor Rossi? Signore? Da ist ein Herr …«
Der Druckereibesitzer hob die Hand und machte einen energischen Wisch, der Dante zum Schweigen bringen sollte.
»Der Sie …«, fuhr Dante unbedarft fort.
»Ruhe, verdammt!«, herrschte Rossi ihn an. Endlich hob er den Blick von den Papieren auf seinem Schreibtisch, und Bernadetta bekam einen genaueren Eindruck von ihm. Er besaß unglaublich schwarze Augen, deren Blicke wie Speere durch Dante hindurchzujagen schienen. Sein Mund war verkniffen und auf der Stirn reihten sich strenge Falten aneinander.
»Signore«, haspelte Dante, wobei er hastig zurückwich. »Da ist …« Er deutete auf Bernadetta, noch immer auf dem Rückzug und fortwährend schluckend. »Signore.« Er verbeugte sich und huschte aus der Tür, um eilig die Stufen hinabzustürzen.
Der schneidende Blick Rossis richtete sich auf sie. Seine Augen verengten sich, glitten flüchtig an ihr herab und senkten sich wieder auf seine Arbeit.
»Ja?«
Bernadetta klappte der Mund auf. Sie war nie zuvor derart knapp beurteilt worden, und dabei trat sie nun als Mann auf!
»Ich habe zu tun. Wenn Sie hergekommen sind, um Maulaffen feilzuhalten, tun Sie dies gefälligst draußen.« Er griff nach seinem Füller und strich in großer Geste etwas auf dem Papier vor ihm durch.
Bernadetta ballte die Hände zu Fäusten. Dieser Mann war unglaublich rüde, schließlich kannte er ihr Begehr noch nicht. Sie konnte ein potentieller Kunde sein, vielleicht ein Adjutant eines Advokaten oder Bankiers, da war es unverzeihlich, sich so unfreundlich zu zeigen.
»Ich bin beschäftigt!«, wiederholte Rossi in einem anderen Dialekt, der näher an Rom gesprochen wurde und nicht in Venedig. »Machen Sie einen Termin aus.«
Bernadetta räusperte sich verhalten, wischte sich die feuchten Hände am Jackett ab und hob das Kinn. »Ich bin Bernardo. Ich komme, um mich als Druckereimeister vorzustellen.«
Er sah nicht einmal auf, lediglich das Verziehen seiner Lippen wies darauf hin, dass er sie verstanden hatte. Bernadetta wartete angespannt, aber Rossi ignorierte sie einfach. Dampfend vor Wut machte sie einen Schritt auf ihn zu, brachte sich aber schnell wieder unter Kontrolle. Ihn anzugreifen, und sei es mit Worten, brachte sie nicht zum gewünschten Erfolg. Ein Rückzug war notwendig. Sie konnte ihre Optionen neu abwägen und einen anderen Weg finden. Die Druckerei anzünden, ihn in den Canal Grande schubsen oder sein Brot mit Vogelbeerensaft tränken.
Mit geballten Fäusten zog sie sich zurück. Vor der Tür nahm sie sich den Moment, um mit ihrem Zorn zu kämpfen, wobei ihr Blick in seliger Beruhigung über den Werkraum der Druckerei flog. Das Stampfen, Zischen und Sausen umhüllte sie wie ein warmer Umschlag und dämpfte die Raserei ihrer Gedanken. Genau hier gehörte sie hin, aber es war ein Ort, der nun für sie für immer verloren war. Einer Frau übertrug man keine Verantwortung und schon gar nicht einen handwerklichen Betrieb wie diesen. Ihr Vater hatte sich dem stets widersetzt, schließlich war sie die Einzige, der er die Stamperia hätte übertragen können, und er hatte stets gewusst, mit welchem Herzblut Bernadetta an dem Familienunternehmen hing. Sie wischte sich unauffällig die Tränen von den Wangen und hob das Kinn. Ein Mann weinte nicht.
Ein Quietschen fing ihre Aufmerksamkeit ein. Die neuen dampfbetriebenen Druckerpressen waren sehr sensibel und benötigten viel Pflege und gutes Zureden. Und selbst dann waren sie launischer als Bernadettas Frau Mama, auch wenn ihr Vater stets behauptet hatte, dass Bernadetta den Kampf, die launischste Person weit und breit zu sein, mühelos gewänne. Mit einem wehmütigen Grinsen stapfte sie die Treppe hinab. Das Quietschen nahm überhand, vibrierte in ihrem Gehörgang. Die Winde würde sicherlich jeden Moment aus der Halterung platzen und einem pulverbetriebenen Geschoss gleich durch den Druckraum schießen. Sie hatte von dergleichen Unfällen gehört, bei denen mehr zu Bruch ging als die neue, teure Presse. Personenschäden waren unumgänglich. Bernadetta sah sich schnell um und zählte fünf Männer in unmittelbarer Nähe zur besagten Winde.
»Raus«, schrie sie, da die Winde bereits sichtlich eierte. Welche Hornochsen hatten sich an dem sensiblen Gerät nur zu schaffen gemacht?
Sie schnappte sich den Holzhammer, der direkt neben dem Treppenaufgang an der Wand lehnte und eigentlich dazu diente, die Druckplatten der Gutenbergpresse einzuspannen. Sie schwang ihn auf dem Weg durch die Druckerei, wobei sie den Mitarbeitern erneut eine Warnung zurief.
»Die Winde platzt jeden Moment ab! Sie wird zur Vordertür hinausschießen, wenn es so weit ist. Also runter und nach hinten raus!« Bernadetta schlug gegen die Winde, um sie zurück auf die Führung zu bugsieren, hatte aber nicht genug Kraft und auch nicht die richtige Position, um das Unglück direkt zu beheben. Sie kaufte sich damit lediglich Zeit.
Den Hammer ließ sie fallen, duckte sich unter die Riemen hinweg zum Dampfkessel, um die Druckkammern zu öffnen. Augenblicklich ließ das schrille Quieken nach.
»Signore!«, sprach eine raue, wohlbekannte Stimme sie an. Eine Pranke schloss sich um ihren Ellenbogen und drehte sie herum. Andrea erkannte sie auf Anhieb, schließlich war er seit Kindesbeinen in der Stamperia beschäftigt, ebenso wie sie selbst. Seine Augen weiteten sich, ein Grinsen formte sich auf seinen Lippen, und als sich eine andere Stimme nach dem Grund für den Krach erkundigte, zwinkerte er ihr zu.
»Signor Rossi«, begann Bernadetta nach einem verschwörerischen Grinsen zu ihrem alten Freund. Sie bückte sich, um unter den Riemen der Förderwalze hindurchzutauchen und an einen besser sichtbaren Ort zu treten, von dem aus der neue Eigner ihrer Druckerei sie sehen konnte. Dort wollte sie den Hut vom Kopf ziehen, den sie jedoch verloren hatte. Mit Verzögerung verbeugte sie sich, bevor sie den Mistkerl ansah. Seine Augen ließen sie erneut stocken, denn sie lagen mit einer Intensität auf ihr, dass sie meinte, er durchschaue sie bereits.
»Nun, was soll das Aufheben?«
»Ich fürchte, Signor Rossi, Ihnen fehlt das Fachpersonal für dieses Prachtstück.« Bernadetta deutete auf die nigelnagelneue Druckerpresse. »Um ein Haar wäre Ihnen diese teure Neuerung um die Ohren geflogen.« Bernadetta zog ihr Jackett gerade und streckte sich, um imposanter zu wirken. »Zufällig bin ich mit diesem Typ bestens vertraut.«
Rossi maß sie eingehend, bevor er sich an einen herbeigeeilten Mann wandte, der seine Mütze in den Händen wrang.
»Du! Was ist da passiert?«
»Äh.« Der verdreckte Arbeiter sah sich um, sein Blick fiel auf Andrea und sein anklagender Zeigefinger richtete sich aus. »Der war zuständig!«
Bernadetta schnaubte verärgert. Sie stemmte die Hände in die Hüften und schüttelte den Kopf. »Die Winde muss stetig überwacht werden«, gab sie einen Teil ihres Wissens preis. »Oder sie geht aus dem Lauf und wird zur Gefahr!«
Rossis Blick sprang von seinem Arbeiter zu ihr.
»Sie bekommen Ihre Chance. Melden Sie sich morgen um fünf bei mir.« Damit ließ er sie stehen. Bernadetta schüttelte den Kopf. Ein guter Inhaber kümmerte sich um große Schwierigkeiten auch mal selbst, und diese Winde war ein wahrlich ernsthaftes Problem!
»Soll ich den Kessel anheizen?«, erkundigte sich Andrea, während der Arbeiter Bernadetta mit Missmut betrachtete.
»Nein«, beschied sie, als der schmierige Kerl das Gegenteil anordnete. »Die Winde steht schief auf der Halterung. Setzen wir sie zunächst gerade, dann sollte sie den Auftrag für heute ohne weitere Auffälligkeiten abarbeiten.« Bernadetta knöpfte sich das Jackett auf, um es abzustreifen und über den Setztisch zu legen. Die Ärmel aufkrempelnd tauchte sie ein in die wunderbare Welt der modernen Druckkunst.
5. Kapitel
Keine Suche nach Liebe
»Ich glaube nicht an Liebe«, erinnerte Signor Franco Cicarese sein Spiegelbild leise und ordnete seine Krawatte. »Niemand braucht diese unnötige Verkomplizierung. Ich bin nicht auf der Suche nach jemandem, der mein Herz zum Schnellerklopfen bringt. Die Signorina, die sich am besten als meine Ehegattin eignet, soll zurückhaltend und höflich sein. Viel mehr muss ich nicht erwarten. Also kann ich die Signorina wählen, die mir als Erstes über den Weg läuft.«
Franco wollte einen neuen Abschnitt beginnen. Ein erster Schritt war heute notwendig. Inzwischen hatte er ein Alter erreicht, in dem er sich Gedanken über seine Zukunft machen sollte. Bisher hatte er sich ausschließlich auf die Firmengeschäfte konzentriert. Für ein Privatleben war einfach kein Platz gewesen. Nun sollte die Brautschau beginnen. Mit einer vernünftigen Strategie würde er rasch ans Ziel gelangt sein.
Er strich das Hemd glatt. Zufrieden mit seinem äußeren Erscheinungsbild schlüpfte er in den Frack und verließ dann das Arbeitszimmer.
Auf dem Gang kam ihm seine Madre entgegen. »Willst du noch außer Haus, mein Junge?«
»Ich besuche Dottor Bonifacio. Warten Sie nicht mit dem Abendessen auf mich.«
Besorgnis erschien auf Signora Cicareses Gesicht. »Bist du krank? Fühlst du dich nicht gut?«
»Es ist alles in Ordnung, Mutter. Ich wünsche lediglich eine Unterhaltung mit dem Mediziner.«
»Du kannst mir sagen, wenn es dir schlecht geht.« Seine Madre kam näher. Ihre Beunruhigung war nicht zu übersehen. »Denk nicht, mich schonen zu müssen. Ich kann auch nach Dottor Bonifacio schicken lassen. Bestimmt hat er nichts dagegen, dich in unserem Haus aufzusuchen.«
»Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen. Sie ist allerdings nicht angebracht. Ich verheimliche Ihnen keine Erkrankung«, versicherte er.
Immer noch wirkte sie nicht überzeugt. »Du weißt, wie schnell etwas, das du für eine harmlose Erkältung hältst, deinem Leben gefährlich werden kann. Wenn da etwas ist, über das ich Bescheid wissen sollte, lass mich bitte nicht außen vor.«
Er lächelte sie an. Sein Herz schmerzte. »Ich bedaure den frühen Tod meines Vaters genauso sehr wie Sie, auch wenn ich ihn nicht besonders gut kennenlernen durfte. Sein überraschender Tod war eine Tragödie. Dass Sie sich deshalb Gedanken um mich machen, rechne ich Ihnen hoch an. Sorgen sind allerdings unbegründet. Mein Besuch bei Dottor Bonifacio hat private Gründe, die Sie vermutlich erfreuen werden. Ich begebe mich endlich auf Brautschau.«
Die Stirn seiner immer noch attraktiven Mutter runzelte sich. »Bei Dottor Bonifacio?«
»Er hat zwei Töchter, die im richtigen Alter für eine Eheschließung sind.«
Seine Madre hob eine Augenbraue, nickte allerdings. »In der Tat. Es ist an der Zeit, dass die beiden unter die Haube kommen. Müssen sie das allerdings unbedingt bei dir?«
Dieser Kommentar überraschte ihn. »Wünschen Sie sich keine Schwiegertochter?«
»Natürlich! Es würde mich freuen, wenn du mir Enkelkinder schenken würdest«, bestätigte seine Mutter. »Ich habe es genossen, dich beim Aufwachsen zu begleiten und zuzusehen, wie du ein wundervoller, selbstbewusster Mann wirst. Bald in der Rolle der Großmutter die Aufgabe zu übernehmen, deine Kinder zu verwöhnen, wird mich zur glücklichsten Frau auf diesem Planeten machen. Allerdings kann ich mir keine der beiden Töchter von Dottor Bonifacio an deiner Seite vorstellen.«
»Eine von ihnen wird eine perfekte Ehefrau für mich abgeben. Sie sind hübsch und anschmiegsam.«
»Das kann man über einen zahmen Vogel auch sagen. Trotzdem kann er nichts außer Piepsen zu einer Diskussion beitragen«, bemerkte Signora Cicarese.
»Finden Sie den Gesang der Schwestern Bonifacio dermaßen entzückend? Leider hatte ich noch nicht das Vergnügen, einer Darbietung der beiden Signorinas zu lauschen.«
Seine Mutter schnaubte. »Niemand würde die beiden als interessant bezeichnen, mein Sohn. Sie sind langweilig und nicht gerade …« Jetzt hob sie beide Augenbrauen.
Langsam verlor er die Geduld. »Ich fürchte, Sie müssen deutlicher werden. Worauf wollen Sie hinaus, Madre?«
»Die beiden sind dumm wie Stroh, mein Sohn. Sie sind nicht das, was du brauchst.«
»Das sollte ich selbst entscheiden. Schließlich muss ich den Rest meines Lebens mit meiner Zukünftigen verbringen.« Der Gedanke sollte ihn eigentlich mit mehr Freude erfüllen. Oder etwa nicht? War es normal, dass er völlige Gleichgültigkeit empfand, obwohl er dabei war, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen?
Signora Cicarese lächelte ihn wehmütig an. »Natürlich. Du bist ein Mann. Du hast alles Recht, deine Zukunft so zu gestalten, wie du es willst.«
»Das ist mein gottgegebenes Recht«, bestätigte er. »Wer sollte es anzweifeln?«
»Niemand. Solange sich nichts an der Einstellung der Gesellschaft ändert.«
Der Kommentar seiner Mutter irritierte ihn. Woher kam diese seltsame, melancholische Seite an seiner Madre? »Ist etwas nicht in Ordnung? Sie klingen, als wären Sie mit Ihrer Situation unzufrieden. Sind Sie nicht glücklich?«
Mit einem Mal wurde ihr Lächeln gezwungen. »Warum sollte ich es nicht sein? Ich spiele doch die Rolle, die von mir erwartet wird, nicht wahr?«
»Sie machen mir Angst, Madre. Sie klingen wie eine der Predigerinnen der Frauenbewegung.« Er ließ seine Stimme amüsiert klingen, doch ein Funken Wahrheit steckte in seinen Worten. In den letzten Wochen war ihm aufgefallen, dass seine Mutter sich verändert hatte. War sie bis vor Kurzem noch ausgeglichen ihren Aufgaben nachgekommen, zeigte sie seit Neuestem Anzeichen von Traurigkeit. Er hatte sie mehrmals dabei ertappt, wie sie beim Abendessen gedankenverloren vor sich hin gestarrt hatte.
Irgendetwas ging in ihr vor, was er nicht verstand. Vielleicht lag es daran, dass er ein Mann war. Seine Mutter hatte einige Freundinnen, doch mit denen schien sie sich nicht austauschen zu wollen. Sie brauchte jemanden, der sie auf andere Gedanken brachte. Die Hoffnung, die Gesellschaft einer anderen Frau in diesem Haus könnte ihre Trübsinnigkeit vertreiben, war einer der Gründe für seine Entscheidung, die Suche nach einer geeigneten Ehefrau voranzutreiben.
»Es tut mir leid. Ich hatte nicht die Absicht, deinen Alltag durcheinanderzubringen.« Sie senkte den Blick. Dann wandte sie sich um und bedeutete ihm mit ausgestreckter Hand, an ihr vorbeizugehen. »Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Abend. Geh aus und amüsiere dich.«
»Sagen Sie mir, wie ich Ihnen helfen kann, Madre«, bat er. »Ihr Wohl liegt mir am Herzen.«
»Es ist nichts. Allerdings … Der Todestag deines Vaters jährt sich in wenigen Tagen wieder. Ich vermisse ihn. In dieser Zeit noch mehr als sonst. Unsere Ehe fand zu früh ein Ende. Dennoch hat er mir viel bedeutet. Ich habe die Zeit mit ihm genossen. Darum fehlt er mir an meiner Seite.«
»Das verstehe ich. Ihr Leben ist allerdings noch nicht vorbei. Mein Vater mag der erste Mann gewesen sein, den Sie geliebt haben, aber möglicherweise erhalten Sie eine neue Chance. Vielleicht findet sich ein Mann, der Sie genauso zu schätzen weiß, wie Ihr Ehemann es getan hat.«
Ein ehrliches Lächeln erschien auf Signora Cicareses Gesicht. Endlich wich die Traurigkeit aus ihren Augen. »Es ist sehr nett von dir, so etwas zu sagen. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass ich tatsächlich noch einmal so viel Glück haben könnte.«
Er hängte sich bei ihr unter und ging mit ihr den Gang entlang. »Ich hege keinen Zweifel daran, dass es genug Männer da draußen gibt, die zu gern um Sie werben würden. Wenn Sie mir die Erlaubnis erteilen, werde ich mich umhören, welche Signori infrage kommen würden.«
»Das ist nicht notwendig«, beeilte sich Signora Cicarese zu sagen. »Du musst dafür nichts von deiner kostbaren Zeit vergeuden. Wenn das Schicksal einen neuen Ehemann für mich vorgesehen hat, wird es ihn im rechten Moment zu mir schicken.«
Sie kamen in der Eingangshalle an und blieben stehen. Franco sollte sich beeilen, wenn er Dottor Bonifacio heute Abend noch besuchen wollte. Irgendetwas hielt ihn allerdings an Ort und Stelle.
Er legte seine Finger auf die Hand seiner Mutter, die auf seinem Unterarm ruhte. »Scheuen Sie sich nicht, offen mit mir zu sprechen, wenn Sie Sorgen haben. Sie sind nicht allein.«
»Was für einen wundervollen Sohn ich großgezogen habe. Ich danke dir. Und jetzt sorge dafür, selbst eine Familie gründen zu können. Hoffentlich findest du jemanden, der dich wirklich glücklich macht.«
»Ihr Besuch kommt ziemlich überraschend«, stellte Dottor Bonifacio nach einer höflichen Begrüßung fest. »Wenn Sie mir mitgeteilt hätten, meiner Hilfe zu bedürfen, hätte ich Sie selbstverständlich aufgesucht.«
»Ich wollte nicht in Ihrer Apotheke mit Ihnen sprechen. Es tut mir leid, wenn mein Auftauchen unpassend kommt. Gern kann ich auch ein anderes Mal wiederkommen.« Franco machte einen Schritt zurück zu dem Angestellten, der ihn in den Salon geführt hatte.
Obwohl der Mediziner keine Pülverchen und Tränke in seinem Haus herstellte, roch es nach unterschiedlichen Mittelchen und diversen Gewürzen. An einer Seite des Raumes stand ein riesiger Bücherschrank. Darin befanden sich neben exquisiten Drucken von Büchern zum Thema Medizin auch alte Lederfolianten. Für Dottor Bonifacio war die Medizin offensichtlich nicht nur ein Beruf, der seine Familie ernährte, sondern auch Berufung.
Jetzt schüttelte der Mediziner den Kopf und bedeutete Franco, sich zu ihm zu gesellen. »Für Sie nehme ich mir gern Zeit.