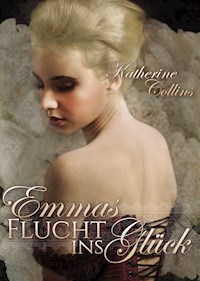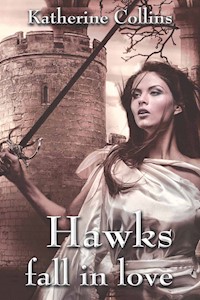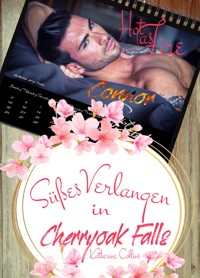
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach der Verbannung nach Cherryoak Falls ärgert sich Detective Melissa Warren mit ihren stumpfsinnigen Kollegen herum. Nach einem Überfall braucht sie dringend einen Hort für ihre Dogge Henry, da auch die Ärzte in Cherryoak zur uneinsichtigen Sorte Mensch gehören. Ihr übelgelaunte Retter, Feuerwehrmann Connor McCann, kommt da wie gerufen. Sie trägt ihn als Ansprechpartner ein und sichert sich damit seinen vollen Verdruss. Zur Wiedergutmachung geht sie etwas zu weit und, dass ihr neuner Fall auch noch entfernt mit ihm zu tun hat, sorgt für mehr Nähe, als es eingeplant war. Aber vielleicht ist dieser Trotzkopf genau die Ablenkung, die ihr im langweiligen Cherryoak Falls bisher gefehlt hatte?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Katherine Collins
Erstausgabe Oktober 2021
Copyright © 2021 Katherine Collins
Kathrin Fuhrmann
Türkenort 11
45711 Datteln
Made with l♥ve
Alle Rechte vorbehalten.
Süßes Verlangen in Cherryoak Falls
Umschlaggestaltung: Kathrin Fuhrmann
unter Verwendung von Bildmaterial von © ArtOfPhoto/ Shutterstock.com (Mann), © LeksusTuss / Shutterstock.com (Hintergrund) und © volcebyyoiu / Shutterstock.com (Aquarellblütenrahmen), © MSSA / Shutterstock.com (blühender Sakura Textillustration)
Lektorat: Jessica Weber
Satz: Katherine Collins
ISBN: 9783754613344
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung wiedergegeben werden. Sämtliche Personen und Ereignisse dieses Werks sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen, ob lebend oder tot, wären rein zufällig.
Nach der Verbannung nach Cherryoak Falls ärgert sich Detective Melissa Warren mit ihren stumpfsinnigen Kollegen herum. Nach einem Überfall braucht sie dringend einen Hort für ihre Dogge Henry, da auch die Ärzte in Cherryoak zur uneinsichtigen Sorte Mensch gehören und sie nicht entlassen wollen. Ihr übelgelaunte Retter, Feuerwehrmann Connor McCann, kommt da wie gerufen. Sie trägt ihn als Ansprechpartner ein und sichert sich damit seinen vollen Verdruss. Zur Wiedergutmachung geht sie etwas zu weit und, dass ihr neuer Fall auch noch entfernt mit ihm zu tun hat, sorgt für mehr Nähe, als es eingeplant war. Aber vielleicht ist dieser Trotzkopf genau die Ablenkung, die ihr im langweiligen Cherryoak Falls bisher gefehlt hatte?
Kapitel 1
»Melissa!«
Ich blieb stehen und drehte mich langsam um. Ich brauchte die Zeit, um meinen Unwillen aus meiner Miene zu vertreiben und ein freundliches Lächeln aufzusetzen. »Detective Carver«, sagte ich und nutzte in voller Absicht den Dienstgrad und nicht seinen Vornamen. Er eilte auf mich zu, wodurch sein behäbiger Körper in Wallung geriet. Er schnaufte, als er bei mir anlangte, und stieß ein Puh aus. Er grinste.
»Sind Sie auf dem Heimweg?«
»Ja.« Obwohl ich meine Antwort bereits gegeben hatte, schaute er mich erwartungsvoll an. »Warum?«
Sein Grinsen wurde tiefer. »Wie wäre es mit einem Feierabendbier?«
Männer waren unglaublich, aber das wusste ich bereits. Und ich wusste auch, dass jedes Augenpaar der sich im Dienst befindlichen Kollegen auf uns gerichtet war. »Sie haben mir durch das halbe Präsidium nachgerufen, um zu erfahren, was ich von Alkohol nach Dienstschluss halte?« Ich hielt seinen Blick und ignorierte alles um uns herum.
»Nein.« Carver feixte. »Um Sie einzuladen.«
»Interessant.«
Er hob erwartungsvoll die Brauen. »Wollen wir? Die Happy Hour im Kingsley’s beginnt jeden Augenblick.«
»Tatsächlich.« Da ich kein Kneipentyp war und auch erst seit wenigen Monaten in Cherryoak Falls lebte, hatte ich noch keinen Überblick über die Party-Szene der Stadt, allerdings war es gut, zu wissen, welche Etablissements ich besser mied.
»Ich fahre.« Er zwinkerte mir zu. »Keine Sorge, ich werde Sie sicher zu Hause absetzen.«
»Detective Carver, Ihre Einladung ist sicher nett gemeint …« Auch wenn ich es anders auffasste und mir gleich ein anderer feuchtfröhlicher Abend in Gesellschaft eines Kollegen einfiel, der alles andere als gut geendet hatte. »Aber ich werde den Abend mit Henry verbringen.«
Carvers Grinsen wackelte. »Nun, Henry kann sicherlich eine weitere Stunde auf Sie warten, Melissa. Kommen Sie, ein kollegiales Bier.«
Da er nun deutlich leiser sprach als bisher, tippte ich auf eine Wette. Ich ließ meinen Blick schweifen und fing einige der Kollegen auf, die dann eilig beschäftigt taten.
»Nein. Guten Abend, Detective Carver.« Ich nickte ihm zu und wandte mich ab. Es war nicht die erste Einladung und nicht meine erste Absage gewesen. Eigentlich führte ich gedanklich sogar eine Strichliste, denn einige Kollegen bewiesen Durchhaltevermögen und fragten wieder und wieder.
»Melissa!« Carver überholte mich und hielt mir die Tür auf. »Dann laden Sie Henry doch ein, uns im Kingsley’s zu treffen.«
Eine putzige Vorstellung, wie meine Monsterdogge auf einem Barhocker saß und ein Bier mit mir trank. Eines Tages sollte ich mir den Spaß erlauben, heute Abend wollte ich jedoch nur noch nach Hause.
Ich hatte den Tag damit zugebracht, Prostituierte zu befragen. Das war es nicht, was schlauchte, sondern die sexistischen Bemerkungen meines lieben Kollegen zu allen möglichen Nebensächlichkeiten. Die aufreizende Kleidung der Frauen, die Größe ihres Brustumfangs, das Make-up oder auch schon mal das Alter wurden rege kommentiert. Und ich verstand beileibe nicht, wie Carver auf die völlig abwegige Idee kam, ich würde auch nur einen Moment länger als absolut notwendig in seiner Gesellschaft bleiben wollen.
»Henry trinkt nicht!« Dieses Mal blieb ich nicht einmal stehen, sondern nahm die drei Stufen vor dem Haus und strebte auf den Parkplatz zu. »Guten Abend!«
»Also gut, dann …« Er schnaufte schon wieder wie ein Asthmatiker, dabei rannte ich nicht, sondern ging nur zügig. »Morgen vielleicht?«
»Detective Carver, um es abzukürzen: Ich trinke nicht. Ich gehe nicht mit Kollegen aus und mein Partner mutiert nicht zu meinem besten Freund.« Geschweige denn Liebhaber, aber das wollte ich gar nicht erst ins Spiel bringen. Ich öffnete die Tür meines Wagens auf altmodische Weise, indem ich den Schlüssel in das Schloss steckte und drehte, denn mein Chevrolet Camaro war vom gleichen Baujahr wie ich selbst und verfügte nicht über einen elektrischen Türöffner.
»Melissa«, sagte Carver gedehnt. »Ich bitte Sie. Sie befinden sich nun in einer Kleinstadt. Hier werden Dinge anders gehandhabt als in Denver.«
Ich kam aus Detroit, aber ich korrigierte ihn nicht.
»Wir sind Kollegen. Partner. Wir müssen uns aufeinander verlassen können, und das funktioniert viel besser, wenn …«
Ich rutschte in den Ledersitz und knallte die Tür zu. Er klopfte tatsächlich ans Fenster, als wäre ich nicht deutlich gewesen.
»Melissa …«
Ich startete den Wagen und ließ die Räder durchdrehen, bevor ich Gas gab und mit einem Sprung losraste. Vier Monate und ich war diesen Job bereits leid. Ich bremste ab, um mich in den Verkehr einzufädeln. Ich wohnte in Oak Forest, was bedeutete, dass ich einmal quer durch die Stadt fahren musste. Immerhin gab es mir jeden Abend Zeit, mich von meinem Arbeitstag zu lösen und alle offenen Fragen beiseitezulegen, bevor ich in meiner kleinen Wohnung ankam. Wie üblich grüßte Henry mich mit einem Bellen, ohne sich von seinem Körbchen fortzubewegen.
»Na komm, mein Junge!«
Mit einem gewaltigen Satz war er bei mir und stellte sich auf die Hinterläufe, um mir einmal quer durch das Gesicht zu schlecken.
»Da freut sich jemand, was?« Ich tätschelte ihn. »Gib mir fünf Minuten zum Umziehen, dann können wir los, okay?« Wieder gab er einen kurzen Laut von sich und setzte sich hin, um folgsam auf mich zu warten. »Mein Tag war erneut die Hölle auf Erden«, rief ich ihm zu, während ich in mein Schlafzimmer trat. Mein Jackett flog im hohen Bogen Richtung Bett, die Bluse folgte, dann der Büstenhalter. »Kein Wunder, dass die Aufklärungsrate von Verbrechen in Cherryoak eine Katastrophe ist.« Ich stieg aus meiner Hose und griff nach meiner Joggingkleidung, um sie eilig überzustreifen. »Die Polizisten hier sind eine Schande für die Zunft!«
Ich schnürte meine Schuhe und ging zurück in den Flur. Henrys Ohren spielten aufmerksam, während er mich ansah und auf meine Order wartete. Ich nahm den Schlüssel von der Tür, bevor ich meinen treuen Weggefährten hinausließ. »Auf gehts, Junge!«
Mit einem Satz hatte er bereits den halben Gang zur Treppe hinter sich gebracht. Ich schloss ab, schaute mich um und atmete tief durch, bevor ich ihm folgte. Mein Wohnhaus hatte vier Etagen, auf denen jeweils vier Parteien lebten, wodurch es sicher nicht durch Ambiente bestach. Allerdings war ich anspruchslos und die Nachbarn zumindest unaufdringlich. Am Stadtrand zu wohnen, hatte zudem den Vorteil, gleich in der freien Natur zu sein, wenn man sein Wohnhaus verließ, und genau das brauchte ich nach einem langen Tag im Präsidium wesentlich dringender als Alkohol.
Ich lief los. Wir hatten uns angewöhnt, einen bestimmten Weg abzulaufen, daher war ich nicht besorgt, dass ich Henry aus den Augen verloren hatte. Erst, als ich in das Waldstück abbog, rief ich ihn. Er kam in Blickweite, gab einen Laut von sich, der mich irritierte, und war dann wieder verschwunden. Nach zehn Stunden Eingepferchtsein in der Wohnung hatte er sich den Freiraum verdient. Ich lief weiter und behielt dabei die Umgebung im Blick. Die Bäume standen dicht bei dicht und das Unterholz war verwildert. Ich hing mit meinen Gedanken Henrys Aufregung nach, die schon ungewöhnlich war, schob es aber erneut darauf, dass er schlicht zu viel Zeit eingesperrt verbrachte. Auf halber Strecke kreuzten sich unsere Wege. »Henry, ich dachte schon, du bist auf und davon!«
Er bellte und hastete in großen Sprüngen erneut fort. Armer Kerl. Er musste sich den ganzen Tag über furchtbar langweilen, aber bisher hatte ich keine Alternative gefunden. In Detroit hatte ich einen Hundesitter gehabt, aber in Cherryoak Falls hatte ich noch niemanden gefunden, dem ich Henry anvertrauen konnte.
Ich beschleunigte mein Tempo, nachdem ich festgestellt hatte, dass wir bereits eine knappe Stunde unterwegs waren. Ich musste uns noch Essen zubereiten und wollte noch einmal durch die Aussagen der Prostituierten gehen, bevor ich mich schlafen legte. Auf halbem Weg bemerkte ich eine Bewegung im Wald. Überrascht blieb ich stehen und vergewisserte mich, dass dort tatsächlich ein Mann im Unterholz hockte.
»Hey!«, rief ich und schwenkte die Arme. »Alles in Ordnung?« Ich sah mich um, aber abgesehen von dem Typen konnte ich niemanden entdecken. »Brauchen Sie Hilfe?«, fragte ich und beschattete mir die Augen. Ich war nicht scharf darauf, mich in das Unterholz zu wagen.
»Nein.«
Mein Blick suchte die Strecke zu ihm ab. Er war sicherlich nicht von dem Weg abgebogen, auf dem ich mich befand, um dort zu landen, denn die Pflanzen vor ihm waren nicht niedergedrückt.
Er reagierte nicht weiter, blieb gebeugt, zeigte mir weder sein Gesicht noch seine Hände, was ich zunehmend alarmierend fand.
»Was machen Sie da?«
Er trug einen dunklen Hoodie, die Kapuze war über seinen Kopf gezogen, wodurch er nicht gerade vertrauenerweckend rüberkam.
»Pilze sammeln«, behauptete der Kerl und winkte mich näher. »Schauen Sie sich diese … Champignons an.«
Champignons. Nun, völlig abwegig war es im Juli nicht. Mein Nackenhaar richtete sich trotzdem auf und ich lauschte angestrengt. Hier war was faul, das spürte ich. Eine leichte Brise zerrte an meinem Haar und kühlte meine Wangen. Hinter mir knackte Holz, knirschten Steine. Aha. Ich machte mich auf einen Angriff gefasst.
»Kommen Sie her, Sie können welche abhaben.«
Ein Arm schlang sich um meinen Hals. Ich rammte dem Angreifer meinen Ellenbogen in den Bauch, wofür ich mich leicht drehen musste, und rollte ihn dann über meine Schulter ab. Ich folgte seinem Fall und drehte ihm in einer geschmeidigen Bewegung den Arm auf den Rücken.
»Bleib ruhig, oder es wird …«
Er ließ mich meine Warnung nicht beenden, sondern versuchte sich aus meinem Halt zu winden, also riss ich den Arm in die Höhe und verdrehte das Handgelenk.
»Und du bleibst besser, wo du bist, verstanden?«, rief ich dem anderen zu. »Keine Bewegung!« Während ich mein Telefon aus der Tasche meines eigenen Hoodies holte, suchte ich die Umgebung nach weiteren Angreifern ab.
»Loslassen, Schlampe!«, rief der Kerl im Wald und hob die Hand. Ich blickte – mit einigem Abstand – in die Mündung einer Pistole. Aber so war nun mal der Job. Ich stieß einen hohen Pfiff aus und hoffte, dass Henry nahe genug war, um mich zu hören.
»CFPD. Waffe runter und legen Sie sich ausgestreckt auf den Boden!«, verlangte ich scharf.
»Du gibst hier nicht die Befehle!«
Das dachte er vielleicht. Ich verstaute mein ungenutztes Telefon, zog die Kordel aus meiner Kapuze und schlang sie routiniert um die Handgelenke meines menschlichen Sitzkissens, das vor Schmerz grunzte.
»Was treibst du da, Schlampe? Lass ihn los, oder ich schieße!« Womöglich würde er wirklich abdrücken, aber seine schwankende Stimme und das unstete Zielen ließen in mir Zweifel aufkommen, dass er auch traf.
Da ich meine Arbeit erledigt hatte, stand ich langsam auf und hob dabei die Hände. »Und jetzt?« Ich machte einen Schritt auf ihn zu.
»Bleib stehen, du …«
»Schlampe«, beendete ich seinen Satz für ihn. Er war mir ein wenig zu berechenbar. »Schon klar. Ich höre allerdings besser auf die Bezeichnung Detective Warren.« Ich wagte mich einen weiteren Schritt vor. Wenn Henry mich gehört hatte, und davon ging ich einfach mal aus, befand er sich nun ganz in der Nähe der Gefahrenquelle und wartete auf mein Zeichen, den Kerl auszuschalten. Der Dummkopf wusste nicht einmal, worauf er sich hier eingelassen hatte. »Nehmen Sie die Waffe runter«, verlangte ich fest. »Sie bedrohen einen Police Officer, das ist Ihnen doch klar, oder?«
Er sah sich gehetzt um. »Bleiben Sie stehen!«
Zwei Schritte trennten uns noch und ich konnte ihn nun wesentlich besser erkennen. Er war noch ein Kind. Innerlich schüttelte ich den Kopf. »Hey, egal was für einen Mist ihr hier abzieht, es ist klüger, nun aufzugeben. Noch ist es lediglich Angriff und Bedrohung eines Officers. Mach es nicht schlimmer, Mann.«
»Schieß endlich, du Idiot!«, röhrte es von seinem Kumpan in meinem Rücken. Die Pistole schwankte, aber der Finger krümmte sich.
Es wurde zu brenzlig, also warf ich mich zur Seite, während ich einen weiteren Pfiff ausstieß. Henry kam aus dem Nichts und riss den Typen um. Der schrie schmerzerfüllt auf, während ich mich bereits aufrappelte, um meinem Partner zur Hilfe zu kommen. »Gut gemacht, Junge«, lobte ich ihn, als ich dem Kind die Waffe aus der Hand nahm und sie sicherte. Sie verschwand in meiner Tasche, bevor ich auch ihn auf den Bauch drehte und arretierte. Meine Schuhbänder mussten bei ihm dran glauben. Ich zerrte ihn auf die Füße. Sein Kumpan hatte sein Heil in der Flucht gesucht, schließlich hatte ich auch bei ihm nur die Hände zusammengebunden. Ich seufzte und schickte Henry los. Er hatte ihn eingeholt, bevor ich mit dem jugendlichen Dummkopf den Weg erreicht hatte, und thronte auf dem Rücken meines Angreifers. Ein Laut gab mir zu verstehen, dass er die Situation unter Kontrolle hatte. Ich befreite mein Telefon aus meiner Tasche und wählte den Notruf.
»Detective Warren. Ich melde einen 2-4-0 im Cherryoak Forest. Ich befinde mich etwa eine Meile innerhalb des Waldes ausgehend vom Oak-Parkplatz. Zwei Personen festgenommen, erbitte sofortige Unterstützung. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es weitere Komplizen gibt.« Mehr hatte ich den Kollegen nicht zu sagen. Ich steckte mein Telefon weg und zwang meinen Gefangenen auf die Knie. »Also, was zum Teufel denkt ihr euch dabei, Wanderer zu überfallen?«
Ich bekam keine Antwort, womit ich allerdings auch gerechnet hatte. Die Frage blieb, ob ich mich tatsächlich in einem simplen Überfall befunden hatte oder es im Grunde um etwas ganz anderes gegangen war. Ich ließ den Blick schweifen. Was hatten die beiden Hohlköpfe gegen Abend im Wald verloren? Nach Joggern sahen sie nicht aus und ihr Verhalten legte schon nahe, dass mehr dahintersteckte. Oder war ich zu versteift und sah jobbedingt überall Straftaten, wo es keine gab?
Kapitel 2
»Warren.« Der Kollege nickte mir zu. »Was haben wir hier?« Er stellte sich breitbeinig vor mich und musterte Henry.
»Da Silva.« Auch ich nickte. »Angriff auf einen Polizeibeamten. Bedrohung mit einer Pistole.« Ich zog besagte Waffe aus meiner Hose.
Da Silva betrachtete meine Verschnürung. »Ich bin etwas überwältigt.«
»Da sind Sie nicht der Einzige.«
Er lachte und kniete sich hin, um dem jungen Kerl, der neben seinem Kumpan kauerte, auf dem meine Dogge noch saß, direkt ins Gesicht zu schauen. »Also, die Waffe, gehört sie dir?«
Der Bursche schüttelte den Kopf.
»Können Sie den Hund zurückrufen?«, fragte der Streifenpolizist. »Dann nehmen wir die Männer in Gewahrsam.«
Ich überreichte die Waffe und stieß einen Pfiff aus. Henry schaute mich an. Seine Ohren richteten sich auf, dann gab er einen Laut von sich und lüftete sein Hinterteil von seinem menschlichen Kissen.
»Danke, Detective.«
»Die Kerle versteckten sich im Wald. Ich bin noch nicht ganz schlau daraus geworden.« Ich sah mich um. »Hat die Ecke hier irgendeine Bedeutung für die Jugend?«
Da Silva prustete, wobei er zu mir aufsah. »Die Natur? Wohl eher nicht.« Seine dunklen Augen funkelten spöttisch.
»Drogen?« Allerdings war es sicherlich kein Ort, an dem Hanfpflanzen gediehen, trotz der Temperaturen.
Da Silva stand auf. »Drogen.« Es klang zu neutral. Ganz so, als wollte er mich aufs Glatteis locken, um mich fallen zu sehen. Ich musterte ihn kurz, bevor ich ihn stehen ließ, um mir die Ecke, in der ich den jungen Dummkopf aufgegriffen hatte, genauer anzusehen. Aus einem Jugendlichen, der im Wald hockte, ein Drogendelikt zu machen, war schon weit hergeholt. Trotzdem wollte ich es nicht einfach so auf sich beruhen lassen. Auch bei genauerer Betrachtung waren keinerlei Pilze zu entdecken. Das war definitiv eine Lüge gewesen. Aber wozu den eigentlichen Grund seines Querfeldeinspaziergangs verleugnen?
»Detective, die Waffe ist nicht geladen.«
Das war mir auch aufgefallen. Ich ging in die Hocke, schob Blätter zur Seite und tastete auf dem Boden herum. Da war nichts.
Auf dem Weg sprach da Silva mit den Jugendlichen, aber die blieben verstockt und weigerten sich sogar, ihre Namen preiszugeben. Henry bellte kurz. Es weckte meine Aufmerksamkeit, also schaute ich mich zu ihm um. Er stand am Wegesrand, behielt mich im Auge und war dabei von den Ohrenspitzen bis zum Ende seiner Rute angespannt. Da hatte ich es. Ich war zu abgelenkt gewesen, aber offensichtlich hatte Henry mir schon vorher etwas sagen wollen und ich hatte es schlicht nicht verstanden.
»Such, Henry.«
Er flitzte los, schoss an mir vorbei und blieb dann stehen, um sich nach mir umzudrehen. Ich sollte folgen, was ich ohne zu zögern tat. Er stürmte weiter und leitete mich zu einem kleinen Unterschlupf – einer Holzbaracke. Henry knurrte, also zog ich ihn vom Eingang fort. »Hier spricht Detective Warren. Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus.«
Henry bellte. Da ich keine Waffe hatte und die Verstärkung schließlich nur wenige Meter entfernt, beschloss ich, mich zurückzuziehen. Henry kläffte erneut. Eigentlich war er abgerichtet, nur bestimmte Laute von sich zu geben, damit sein Hundeführer ihn verstand und entsprechend agieren konnte. Ich interpretierte sein Kläffen als Warnung und rannte los. Was auch immer Henry gewittert hatte, es war sicher keine Zuckerwatte. Eine gewaltige Explosion riss mich von den Füßen. Ich landete im Unterholz, ein Klingeln im Ohr und Schmerzen in der Schulter.
»Henry?« Ich stemmte mich auf, bereute es gleich und drehte mich trotzdem, um nach meinem treuen Gefährten zu sehen. Er lag ein ganzes Stück entfernt, schließlich war er wesentlich schneller als ich und dadurch weiter von der Baracke fortgekommen. Trotzdem fiepte er herzerweichend und schaute sich nur zu mir um. Also krabbelte ich auf ihn zu. Er hob den Kopf, als ich ihn berührte. »Bleib liegen.« Ich streichelte sein Fell. Auf dem ersten Blick konnte ich keine Verletzungen erkennen, allerdings lagen Teile der Hütte überall verstreut. Gut möglich, dass er von einer der Planken getroffen worden war. »Ganz ruhig, ich bring dich hier gleich raus.« Mein Telefon klingelte. »Warren.«
»Scheiße, wo sind Sie?« Da Silva klang besorgt und ich konnte mir geradezu vorstellen, wie dies sich in seinen markanten Gesichtszügen widerspiegelte. Er war schon ein hübsches Kerlchen.
»Tja, ich würde sagen, im Auge des Orkans.« Ich kicherte und stöhnte dann auf. Meine Belustigung zeigte, dass ich ebenfalls einige Schrammen davongetragen hatte, schmerzte durch die leichte Bewegung doch mein gesamter Körper. »Ich brauche hier Sanitäter.« Ich drehte mich um, obwohl das orangefarbene Flackern eigentlich schon alles sagte. »Und die Feuerwehr.« Ich räusperte mich. »Mein Hund ist verletzt. Ich warte also nicht auf die Einsatzkräfte.« Damit legte ich auf und steckte das Telefon weg, um Henry aufzugabeln. Sein Gewicht ließ mich schwanken. Meine Seite brannte und ich hatte Schmerzen beim Atmen. Es war unwahrscheinlich, dass ich es bis zum Hauptweg schaffte, zumal das Gesträuch nach meinen Füßen angelte. Allerdings wollte ich auch nicht nach dem Weg suchen, der sicherlich irgendwo sein musste.
Henry jaulte leise.
»Tut mir leid, mein Großer.« Ich keuchte den Schmerz weg. »Haben es gleich …«
Da Silva brach durch das Geäst. Er war bleich und musterte mich mit offensichtlicher Erleichterung.
»Warren.«
»Lassen Sie mich durch, mein Hund …« Mir ging der Atem aus. Ich schwankte wieder und der Kollege sprang an meine Seite, um mich zu stützen.
»Das ist ein Kalb!« Er fluchte. »Cleaver!«, röhrte er, wodurch das Piepsen in meinen Ohren anschwoll. »Kommen Sie her!« Er legte den Arm um mich. »Sie sollten sich setzen. Die Feuerwehr wird jeden Moment eintreffen.«
Ich hörte die Sirenen, trotzdem schüttelte ich ihn ab. »Die kümmern sich nicht um Tiere.« Zumindest nicht erstrangig. »Sind die Gefangenen bewacht?«
Ich hörte Schritte, die von mehr als einer Person zu stammen schienen, und tatsächlich brachen kurz darauf beide Uniformierten durch das Unterholz.
Da Silva fluchte an meiner Stelle. »Stone! Warum überlassen Sie die Burschen sich selbst?«
Ich schwankte derweilen weiter. Der Krach der Sirenen nahm zu, allerdings konnte ich die auch mit dem Klingeln in meinen Ohren verwechseln.
»Cleaver, nehmen Sie Detective Warren das Tier ab.« Seine Arme legten sich wieder um mich. »Seien Sie vernünftig«, murmelte er mir zu. Ich verstand es kaum. Gut möglich also, dass ich es mir ebenfalls einbildete.
»Henry ist das Wichtigste in meinem Leben«, beschied ich knapp, wobei ich mich weiterquälte. »Er muss zu einem Arzt.« Ich konnte den Weg sehen und behielt ihn als fixes Ziel im Blick. Jeder Schritt ließ mich wanken und vor Schmerz keuchen. Der Polizeiwagen versperrte die Straße, also mussten die riesigen Löschfahrzeuge dahinter stehen bleiben. Urplötzlich herrschte Stille, mit der meine Ohren nicht klarkamen, denn sie begannen sogleich in einem schrillen Ton zu quietschen. Ich sah, wie Männer in Schutzanzügen aus dem Tanklöschfahrzeug sprangen, weitere Männer fluteten den Weg und rannten auf mich zu. Ich konnte mich nicht mehr auf den Füßen halten. Henry jaulte, da ich ihn fest an mich presste, als ich auf die Knie fiel. Die Männer erreichten mich und strömten an mir vorbei. Einer packte mich.
»Hey, alles in Ordnung?«
Ich schaute in seine Augen. Mein Kopf war leer, ich konnte nur blinzeln. Ein Pfeifen überdeckte seine Stimme.
»Vorsicht.«
Ich fiel gegen ihn, dann wurde alles um mich herum schwarz.
Connor fing das Paar ab. Der Hund jaulte und stieß dann ein leises Knurren aus. Die Frau blieb stumm. »Gonzales!«, rief er, und die Sanitäterin tauchte direkt neben ihm auf.
»Nanu.« Sie zog die Frau aus seinen Armen, sodass er mit dem Hund zurückblieb, und legte sie vorsichtig auf dem Boden ab. Die zweite Sanitäterin, Rosa Petronelli, fand sich ein, beide ignorierten ihn und kümmerten sich um die Joggerin.
»Was mache ich mit dem Hund?« Sein Blick glitt über die nahe stehenden Bäume, die durch das Feuer bereits in ein leicht orangefarbenes Licht getaucht waren. Dort sollte er sein und helfen, den Brand zu löschen, oder sich zumindest an der Vorbereitung zu der eigentlichen Löscharbeit beteiligen. Er sah über die Schulter zurück und fluchte innerlich. Zwei Kollegen öffneten die Klappen, um die Schläuche an den Wassertank anzuschließen. Nur er war tatenlos. »Petronelli, was mache ich mit dem Hund?«
Die Sanitäterin schaute sich zu ihm um. »Fragst du mich?«
Der integrierte Lautsprecher in seinem Helm knackte, dann meldete sich der stellvertretende Chief. »Wir haben hier einen sich schnell ausbreitenden Waldbrand, McCann. Was glaubst du, was du da mit einem Hund anstellen sollst? Gassi gehen?« Eric Petronelli klang gestresst.
»Bring ihn aus der Gefahrenzone«, meldete sich Chief Mitchell. »Petronelli und Gonzales sollen auch zusehen, dass sie aus dem Wald rauskommen.«
»Aye, Chief«, gab Rosa Petronelli durch und sprang auf die Füße. »Ich hole die Trage.«
»Hey!« Sie ignorierte ihn wieder. Connor hob das Monstertier an, um der Sanitäterin zu folgen. »Nehmt ihr ihn mit?«
»Im Krankenwagen? Wohl kaum.« Rosa Petronelli behielt die Vorhut und wurde nicht langsamer, nur weil er mit ihr sprach.
»Er kann auch nicht im Löschfahrzeug …«
Sie zerrte die Trage aus dem Krankenwagen und ließ ihn wieder stehen. Connor fluchte. Genau das war der Grund, warum Weiber in Krisengebieten nichts zu suchen hatten. Es fehlte ihnen an Professionalität!
Er setzte das Tier ab – im Krankenwagen – und lief dann los, um sich der Mannschaft anzuschließen. Muhammed und Mann rollten bereits die Schläuche aus. In der Ferne heulten Sirenen. Der Chief hatte wohl schon Unterstützung angefordert.
»McCann, weise die Nachhut ein«, kam die Order durch den Helmfunk. »Wir ziehen eine Schneise, um das Wohngebiet nicht zu gefährden. Die 11te soll von Norden her angreifen.« Es knackte in der Leitung.
»Wende den Löschwagen, sobald der Krankenwagen los ist, damit wir schneller rauskommen, wenn es brenzlig wird«, befahl Chief Mitchell. »Gonzales, Petronelli, wie sieht es bei euch aus?«
Gonzales fasste nach ihrem Sprechfunkgerät, das an der Lasche ihrer Uniform an der Schulter befestigt war, um zu antworten. »Patientin gesichert, wir machen uns auf den Weg.« Die beiden Frauen kamen an ihm vorbeigejoggt, die Trage eierte auf dem unebenen Untergrund und rüttelte die Verletzte ordentlich durch.
Sie war blass, trotzdem war unverkennbar, dass sie das Potential hatte, Männerherzen im Sturm zu erobern. Sie war groß gewachsen, schlank mit einem ordentlichen Vorbau und engelhaften Zügen. Hübsch, sexy und vernarrt in Hunde. Eine sehr ansprechende Kombination. Natürlich war es ein unpassender Gedanke während eines Einsatzes.
»McCann!«, blaffte Gonzales. Beide Sanitäterinnen waren bärbeißig und daher absolut unattraktiv, obwohl sie hübsch zurechtgemacht nicht übel aussahen. Allerdings hielten sie nie den Mund, selbst dann nicht, wenn es angeraten war, und liebten es, ihm Probleme zu bereiten. »Was sucht der Hund in meinem Krankenwagen?«
»Er fährt mit«, rief er zurück, wobei er bereits in die Fahrerkabine des Löschfahrzeugs stieg.
»Negativ«, kam es durch den Sprechfunk. »Es fährt mit Sicherheit kein Tier bei uns mit!«
Die Leitung knackte. »McCann, verflixt, kannst du nicht einmal keinen Ärger machen?« Da wurde Eric Petronelli einmal mehr ungerecht, allerdings nicht zum ersten Mal, seit seine Frau Rosa aus dem Mutterschutz zurück war und sie in derselben Schicht arbeiteten.
»Wo soll ich mit dem Tier hin? Es ist verletzt und seinem Frauchen sicher ein Trost, sobald sie erwacht.« Warum er überhaupt noch widersprach, wusste er nicht zu sagen. Er rutschte aus dem Fahrersitz und warf gefrustet die Tür hinter sich zu. Der Abendhimmel färbte sich bereits schwarz vom Qualm, damit lief ihnen langsam, aber sicher die Zeit weg. Er joggte zum Krankenwagen, als die Order kam, das Tier stattdessen in den Polizeiwagen zu hieven.
Der Streifenwagen drehte bereits, aber der Detective hatte sich zu den Sanitäterinnen gesellt. »Wie geht es Detective Warren?«
Detective! Nicht zu fassen. Aber natürlich begnügte sich keine Frau mehr damit, schlicht hübsch auszusehen. Stattdessen drängten sie sich in Berufe, für die sie einfach nicht geeignet waren. Feuerwehrmänner, Polizisten …
Gonzales warf dem Mann einen scharfen Blick zu. »Da du nicht mit ihr verwandt bist …«
»Sie müssen den Hund mitnehmen«, unterbrach McCann sie. »Schaffen Sie es selbst, ihn …«
»Auf keinen Fall!« Der Detective hob die Hände. »Hören Sie, ich habe eine Hundehaarallergie, ich kann das Vieh nicht mitnehmen.«
Connor schaute dem Streifenwagen hinterher, der soeben aus seinem Blickfeld verschwand. Sein Leben war ein Traum. Ein Albtraum. Zum Glück raste der Einsatzwagen der Elften auf sie zu. Einsatzwagen war genau das richtige Stichwort. »Helfen Sie mir, den Hund in den Wagen zu stecken!« Damit wären doch alle zufrieden, oder nicht?
Zumindest Petronelli und Gonzales widersprachen nicht. Der Detective zuckte die Achseln und öffnete ihm freundlicherweise die Tür zu Mitchells Einsatzwagen. Also stopfte Connor den knurrenden Köter auf den Rücksitz, entging gerade so seinem Schnappen und fluchte, als er die Tür mit mehr Wucht zuwarf, als nötig gewesen wäre.
»McCann?«, rief der Fahrer des anderen Einsatzwagens.
Connor hob die Hand und joggte los.
»Chief Mitchell schlägt vor, eine Schneise zu legen, um das Wohngebiet nicht zu gefährden«, erklärte er. »Sie sollen von Norden aus agieren.«
Der Chief der 11ten nickte. »Okay, sehen Sie zu, dass Sie hier alles räumen.«
Connor nickte. Also zurück zu den Mannweibern. »Gonzales.« Sie knallte die Tür zu und unterbrach damit seine Ansprache, aber wohl auch den Detective, der Carmen ähnlich brodelnd anschaute wie Connor üblicherweise.
»Sie ist meine Kollegin«, beharrte der Polizist. »Ich möchte nur wissen …«
»Alejandro, nein.« Sie umrundete den Krankenwagen und Connor musste sich beeilen, um sie abzufangen.
»Gonzales, ihr macht euch auf den Weg? Detective, Sie müssen auch den Weg freimachen.«
Die Sanitäterin kletterte ohne Bestätigung in den Wagen.
»Carmen«, knurrte der Detective und hinderte sie daran, die Tür zuzuziehen. »Kannst du dich einen Moment mal nicht wie eine blöde Kuh aufführen?«
Connor grinste. Der Tag wurde gerade um einiges schöner.
Gonzales fing seinen Blick auf und presste die Lippen aufeinander. Vielleicht sollte er nicht ganz so begeistert grinsen, aber hey, was hatte er sonst schon noch vom Leben?
»Versuch es im Krankenhaus.« Sie riss die Tür zu.
»Schnepfe«, murmelte der Polizist und stapfte los, um sich in sein eigenes Fahrzeug zu setzen, um Connors Order nachzukommen und das Gefahrengebiet zu räumen.
Connor stolperte über die Schläuche. »Chief, wie soll ich drehen, wenn die Wasserversorgung über meinen Löschwagen läuft?«
Muhammed kam auf ihn zugelaufen und begann augenblicklich die Schläuche abzumontieren. »Soll ich dir vielleicht auch die Schuhe besohlen, während du zum Fahrerhäuschen gehst?«, schnaufte er.
»Sehr witzig.« Connor sprang aus dem Weg, da Gonzales mit dem Krankenwagen an ihm vorbeiraste, und starrte ihr überrascht nach. Langsam grenzte ihr Verhalten an Mobbing! Natürlich konnte er sich schlecht darüber beschweren. Wie sah das denn aus, wenn er sich als Mann nicht bei Frauen durchsetzen konnte?
»Frei!«, knarzte es über den Funk.
»Zwei Minuten«, gab der Chief vor. »Keine Sekunde länger, McCann!«
Er fluchte innerlich und zog sich in den Fahrersitz. Das Fahrzeug zu drehen, wenn man dafür nicht einmal eine Wagenlänge an Straßenbreite hatte, war Schwerstarbeit und zwei Minuten waren dafür ein böser Witz!
Connor sprang aus dem Löschfahrzeug. Die Kollegen strebten direkt zu den Sanitäranlagen und er wollte folgen, als ihn ein Ruf zurückhielt. Sein Name gellte quer durch die Halle, dann wurde eine Tür mit Wucht zugeknallt. Connor haderte mit sich. Sollte er so tun, als hätte er den Chief nicht gehört, und schnell zur Dusche sprinten?
»Keine gute Idee.« Eric Petronelli kam an ihm vorbei. Sein Blick streifte ihn bloß, aber es genügte, dass Connor sein Vorhaben fallen ließ.
»Ich verlange eine Erklärung!«, bellte Mitchell. Sein ausgestreckter Arm deutete auf den Fahrzeughangar, in dem neben dem Einsatzwagen des Chiefs nur die Ersatzlöschwagen nebst einem weiteren Krankenwagen standen.
»Tut mir leid …« Eigentlich wollte er damit sagen, dass er nicht wusste, was das Problem war.
»Ach wirklich«, unterbrach ihn der Chief. Er hatte seine Schutzkleidung bereits nach dem Einsatz ausgezogen und stand in feuerfester Unterbekleidung vor ihm, Ruß im Gesicht und das melierte Haar ebenfalls verschmutzt. »Bekomme ich eine gute Ausrede zu hören, oder bist du selbst dafür zu faul?«
Connor biss die Zähne aufeinander.
»Ich sagte, du solltest den Hund aus der Gefahrenzone bringen. Mein Wagen stand aber im besagten Bereich!« Seine blauen Augen gleißten auf. »Lebt das Tier überhaupt noch?«
Connor hielt den Atem an. Er hatte den Hund völlig vergessen, schließlich hatten sie Stunden damit zugebracht, den Waldbrand einzudämmen.
»Sieh zu, dass du den armen Kerl zu einem Veterinär bringst, und bete, dass er es überlebt! Verflucht! Wir können uns keine Klagen leisten!«
Connor schluckte. »Okay. Ich dusche schnell und dann …«
»Nein, sofort!«
Er klappte den Mund zu.
»Und ich will einen Statusbericht, verstanden?« Mitchell musterte ihn grimmig. »Reiß dich am Riemen, Mann!« Und stapfte los.
Connor ließ die Schutzkleidung an sich herabfallen und stieg aus der Hose. Zumindest die Kleidung zu verstauen, sollte drin sein. Er zog sich eilig die Bereitschaftsuniform an, bevor er zum Einsatzwagen lief. Der Hund machte keinen Laut, als er einstieg und nach ihm fasste. Immerhin war er noch warm, das sollte die Chance erhöhen, ihn lebend beim Tierarzt abzuliefern. Der Schlüssel steckte und das Tor war auch noch nicht herabgelassen, also schnallte er sich an und drehte den Zündschlüssel. Zum Glück besaß seine Ex eine Katze, so wusste er zumindest, wo er einen Veterinär finden konnte …
Kapitel 3
Ich erwachte mit Schmerzen. Es war nicht das erste Mal, seit ich auf dem Waldweg in Ohnmacht gefallen war, aber ich hatte mich bisher nie bemerkbar machen können. Nun krächzte ich und hob die Hand, auch wenn die direkt wieder herabfiel.
»Melissa?« Jemand ergriff meine steifen Finger und drückte sie. Alejandro da Silva lehnte sich über mich und lächelte sanft. Verflucht, war er attraktiv. Ich blinzelte und schob auch den dummen Gedanken zur Seite.
»Wo …«
»Im Krankenhaus. Ihre Freunde hatten offenbar eine kleine Überraschung für Sie, erinnern Sie sich nicht?« Er lachte leise.
Tatsächlich erinnerte ich mich zunächst nicht und schüttelte den Kopf. Er musste mir von meiner unkonventionellen Festnahme berichten, damit ich wieder wusste, was vorgefallen war. »Henry«, brachte ich hervor. »Wo ist er?«
Da Silva runzelte die Stirn.
»Mein Hund.«
»Ja, also …«
Ich schloss die Augen, die plötzlich brannten, als hätte man sie in Chilipaste getunkt. »Nein.«
»Er konnte ja nicht mit«, rechtfertigte sich mein Kollege und klang ziemlich trotzig dabei. »Im Krankenwagen lassen sie keine Tiere mitfahren, aber es geht ihm bestimmt gut.«
Ja, scheiße. Ich quälte mich in die Senkrechte und legte die Hand an meine schmerzende Seite. Meine Schulter protestierte gleich und mein Kopf schwirrte. Da Silva drückte mich wieder nieder.
»Wo wollen Sie denn hin? Der Arzt sagt, dass Sie eine Gehirnerschütterung haben, zwei gebrochene Rippen und eine geprellte Schulter.«
Klang doch gut. Immerhin war ich vor einer explodierenden Hütte davongelaufen. »Ich muss wissen, wie es um Henry steht«, krächzte ich. Mein Hals war unglaublich trocken, aber ich konnte kein Wasser in meiner Nähe ausmachen.
»Das hat Zeit, zunächst müssen Sie sich erholen.« Er tätschelte meine Schulter und lächelte mich an. »Und wir müssen klären, was passiert ist.«
Das hielt mich zumindest an Ort und Stelle. »Henry witterte ein Problem. Wir befanden uns auf dem Rückzug, als die Hütte hochging. Ich habe nicht reingesehen, aber es müsste sich jemand im Inneren aufgehalten haben, sonst hätte Henry keinen Laut von sich gegeben.« Ich schluckte, aber das Kratzen wurde immer schlimmer. »Da Silva, gibt es hier Wasser?«
»Oh.« Der Kollege sah sich um und zuckte die Achseln. »Wohl nicht.«
Ich drehte mich, um nach dem Rufknopf für die Krankenschwester zu suchen. Sogleich stand meine Seite in Flammen.
»Eines nach dem anderen«, beschied da Silva. »Wir klären die offenen Fragen, dann suche ich nach einer Schwester.« Er grinste süß, aber irgendwie störte mich die Einteilung. Ich glaubte nicht, noch viel über die Lippen zu bekommen. »Wie kommen Sie darauf, dass Henry Gefahr witterte?«
»Er ist Polizeihund außer Dienst.« Ich räusperte mich, machte es damit aber nicht besser. Mein Hals brannte nun.
»Aha. Drogen?«
»Sprengstoff«, korrigierte ich ihn. Das erklärte dann wohl auch die Explosion. Da Silva schaute mich an, als hätte ich behauptet, Henry sei ein Trüffelschwein.
»Sie wollen doch nicht andeuten …«
»Wir laufen die Strecke zweimal am Tag. Henry ist immer aufgeregt, wenn wir im Wald sind, aber bisher hat er nie angeschlagen.« Ich zuckte die Achseln und dann zusammen, da die unbedachte Bewegung ungeheure Schmerzen auslöste. Trotzdem sprach ich weiter. »Er war ganz scharf darauf, mir die Hütte zu zeigen.« Und das vermutlich schon länger, als ich es verstanden hatte. War er letztlich deswegen ständig davongaloppiert und ich hatte ihn schlicht nicht verstanden?
»Aha.« Da Silva kratzte sich die gerunzelte Stirn. »Ist ihnen einer der beiden schon mal im Wald begegnet?«
Ich stieß den Atem aus. Da ich nur ein ungefähres Bild von den Jugendlichen im Kopf hatte, das auch noch verschwamm, sobald ich mich darauf fokussieren wollte, schüttelte ich langsam den Kopf. »Mir begegnet kaum mal jemand, meist andere Jogger oder Hundebesitzer. Tut mir leid.« Natürlich würde ich weiter darüber nachdenken, vielleicht fiel mir ja doch noch eine Begegnung ein, nachdem ich mich auf dem Präsidium kundig gemacht hatte, ob die Jungs auch ein Gesicht besaßen oder nur schwarze Löcher unter ihrem Hoodie.
»Danke, Warren. Sie sind wahnsinnig tapfer.«
Ich warf ihm einen schiefen Blick zu. Tapfer? Ich war keine drei und fürchtete mich vor einer Impfung!
»Sie machen mich sprachlos.« Damit meinte ich, dass ich nicht wusste, ob ich mich beleidigt fühlen sollte oder nicht.
Da Silva grinste. Er streckte die Hand nach mir aus und legte sie mir nach einem verräterischen Schlenker in Richtung meines Gesichts auf die Schulter, um diese zu drücken. »Ich lasse Sie nun schlafen.«
»Moment.«
Sein Griff festigte sich wieder, obwohl er die Hand sicherlich zurückziehen wollte. Ansonsten wurde seine Berührung nun unpassend, denn sie überstieg den kameradschaftlichen Grad.
»Ja?«
Etwas enttäuscht erinnerte ich ihn an mein Wasser. Bisher hatte ich angenommen, da Silva sei eine Ausnahme der üblichen Polizistentölpel, aber er schien sich doch in den Haufen unfähiger Dummköpfe einzureihen, die ich nun Kollegen nannte.
Sein Grinsen flammte auf und ich versicherte mir schnell, dass ich voreilige Schlüsse zog. Er war sicher intelligent, aufmerksam und zu logischem Denken fähig. »Natürlich.«
»Und könnten Sie sich erkundigen, wo Henry abgeblieben ist?«
»Henry?« Er runzelte die Stirn. »Ach, der Hund.«
Ich nickte zögerlich. Oh, bitte, ich durfte nicht in einem Nest feststecken, in dem es nur Idioten, Hinterwäldler und null Karrierechancen gab!
»Natürlich.«
Ich stieß den Atem aus. »Danke, da Silva.«
Er verabschiedete sich und ging langsam hinaus. Er trug einen Trenchcoat, der bei jedem Schritt schwankte und den Blick auf seinen Körperbau verhüllte. Aber ich wusste, dass er breite Schultern und einen flachen Bauch besaß, da ich ihn bereits einige Male beim Sparring mit Kollegen beobachtet hatte.
Die Schmerzen nahmen überhand, deshalb schloss ich die Lider und atmete tief durch. Es gab einiges zu planen. In Cherryoak hatte ich ein Problem. Wer sollte Henry aufnehmen, solange ich hier festsaß? Es gab daher nur die eine Variante: Ich musste hier raus!
»Ms Warren?«, wurde ich sanft angesprochen. Ein Schatten fiel über mich und ich blinzelte eilig, um als ansprechbar zu gelten, auch wenn ich einen Moment länger brauchte, um mein Anliegen zumindest gedanklich zu formulieren. Ich setzte mich auf und wurde wieder hinabgedrückt. Zumindest stärkte meine Empörung meine Lebensgeister. Ich schob seine Hände weg, die er sofort mit weit abgespreizten Fingern hob. Ein Latino stand vor mir. Ja, mir fiel mein Schubladendenken auch auf, aber ermittlungstechnisch war es leider tatsächlich sinnvoll, in Kategorien zu denken.
»Entschuldigen Sie«, sagte der groß gewachsene, eher schlaksige Mann und grinste sacht. Er hatte hübsche braune Augen und eine gebräunte Haut, wie viele in Cherryoak ansässige Menschen. Für mich, die aus dem mittleren Westen stammte, war es trotzdem immer wieder irritierend. »Detective da Silva schickt mich. Sie sind durstig?«
»Ich habe auch Schmerzen«, krächzte ich und legte mir die Hand an den Hals. »Aber Wasser hat Vorrang.«
Er trug die unverkennbare Pflegermontur in Mintgrün, die alles andere als sexy war, und doch … Ich kicherte. Er war losgelaufen, um mir ein Glas zu holen, und blickte mir auf seinem Rückweg irritiert entgegen.
»Sagen Sie …« Es war unwahrscheinlich, dass ich mich irrte, trotzdem war eine Versicherung, dass ich recht hatte, auch immer schön. »Sie sind Mr September, oder?«
Verwirrung huschte über seine Miene, dann schoss ihm Röte ins Gesicht. Er krächzte eine Zustimmung.
»Entschuldigung, ich wollte Sie nicht in Verlegenheit bringen.«
»Danke.« Er reichte mir die Flüssigkeit und ich trank vorsichtig. Mit einem Seufzen lehnte ich mich zurück. »Also, ich muss hier raus.«
Der Pfleger schüttelte den Kopf. »Das wird nichts, Ms Warren.«
Er verstand wohl nicht, wie ernst es mir damit war. »Mr …« Ich starrte ihn auffordernd an. Zwar trug er ein Namensschild, aber ich zog es vor, selbst zu entscheiden, wen ich beim Vornamen nannte und wen nicht. Er tippte auf seine Brust, an der das Schildchen hing, und sagte mir seinen Namen. »Mr de Freitas, ich trage Verantwortung, ich bin gerade erst in die Stadt gezogen und habe keinen Babysitter für Henry. Es ist ausgeschlossen, dass ich länger als unabdingbar hierbleibe.«
Nicolas de Freitas nickte zustimmend. »Das verstehe ich nur zu gut, Ms Warren, aber leider sind Ihre Verletzungen zu ernst, als dass eine vorzeitige Entlassung im Bereich des Möglichen läge.« Er zuckte die Achseln. So süß er aussah, ich mochte keine Männer, die mir sagten, was ich tun und lassen sollte.
»Wer ist mein behandelnder Arzt?«
De Freitas seufzte. Vermutlich führte er ähnliche Gespräche seine komplette Schicht hindurch. »Doktor Brisbane.« Sein Schmunzeln neckte sie. »Aber ich fürchte, Sie werden ihm keine Entlassung abschwatzen können. Die letzte macht ihm noch zu schaffen. Mrs Schaefer überstand die Nacht nicht.« Er zwinkerte mir zu. »Ich nehme an, ich soll ihm trotzdem ausrichten, dass Sie ihn zu sehen wünschen?«
»Oh ja.« Ich war schließlich nicht Mrs Schaefer, die hoffentlich eine Neunzigjährige gewesen war, die an Altersschwäche verstorben war.
»Also gut. Bis dahin haben wir noch einige andere Probleme zu lösen: Es ist mitten in der Nacht.«
Mein Blick schoss zu der Fensterfront. Mir ging es deutlich schlechter als erwartet, denn das war mir bisher tatsächlich entgangen. Wo war nur Henry?
»Tja …«
»Sie haben das Abendbrot verpasst, aber ich kann Ihnen Obst und Joghurt besorgen. Brauchen Sie sonst noch etwas?«
»Außer dem Besuch meines Arztes?«, fragte ich. »Nein, ich glaube nicht.«
»Gut, dann schaue ich mal, aber wir sind chronisch unterbesetzt und es könnte etwas dauern, bis Doktor Brisbane sich freischaufeln kann.« Er hob die Hände, als ich zum Widerspruch ansetzte. »Ich werde weitergeben, dass es dringend ist, Ms Warren. Ich habe Henry nicht vergessen. Ihr Telefon ist in Ihrem Nachttischchen, wenn Sie jemanden anrufen wollen. Wie alt ist Henry denn und wer passt gerade auf ihn auf?« Sorge schlich sich in sein weiches Gesicht und ließ seine Augen noch dunkler erscheinen.
»Acht und ich weiß nicht, wo er sich gerade befindet.« Deswegen wollte ich noch dringender hier raus!
»Oje, da sollte ich vielleicht besser die Fürsorge verständigen … Zur Sicherheit, meinen Sie nicht?«
Er dachte … Ich kicherte und versteckte mein Amüsement hinter dem Glas. »Mein Hund, Mr de Freitas. Er war während der Explosion bei mir, aber ich habe das Bewusstsein verloren. Ich habe keine Ahnung, wo mein Baby ist, und das macht mich wahnsinnig.«
»Ah!« Er nickte eifrig. »Ich verstehe. Sicher war er verletzt und befindet sich in einer Auffangstation. Ich werde mich umhören, versprochen. Ich finde so schnell wie möglich heraus, was mit Ihrem kleinen Liebling passiert ist!«
»Danke.«
»Dafür ruhen Sie sich aus. Ich bringe Ihnen gleich noch ein Schmerzmittel und das Formular zur Aufnahme.« Er hob die Hände, um mich wieder abzuwürgen. »Auch wenn Sie nicht bleiben wollen.«
Ich stieß den Atem aus. »Schön. Ich verschwinde zur Not auch ohne Entlassung«, warnte ich noch, wobei ich es absolut ernst meinte. De Freitas lachte allerdings. Er ließ mich allein und ich sackte wieder zurück in das klumpige Kissen.
»McCann, wo bleibst du?«, fragte Mitchell. Connor haderte, dass er besser nicht abgenommen hätte.
»Beim Tierarzt. Die wollten mir hier das Tier nicht abnehmen und bestanden darauf, dass ich bleibe.« Er schnaubte. »Die Weiber …«
»Wie lange wirst du noch mit meinem Wagen unterwegs sein?«, unterbrach Mitchell ihn.
»Du sagtest doch …«
»Mit meinem Dienstwagen«, fiel ihm sein Chief wieder ins Wort. »Den ich gerade gebraucht hätte.«
Connor schluckte seinen Widerspruch herunter. »Tut mir leid, Chief, ich muss dich missverstanden haben.«
»Und das Update hast du auch falsch aufgefasst? Wann wolltest du mich über deine Lage in Kenntnis setzen? Verdammt, McCann, du weißt genau, in welchem Hexenkessel sich die 21ste zurzeit befindet.«
»Ja«, grummelte er. »Klosowski hat uns ganz schön ans Bein gepisst.« Er streichelte die mächtige Flanke der Dogge auf seinem Schoß. Er spürte, wie das Tier hechelte, was ihn zusätzlich beruhigte. Solange der Hund nicht hopsging, ließe sich die Sache irgendwie regeln. Eigentlich war der Chief nicht so ein Dorn im Fleisch, aber seit seiner kurzfristigen Beurlaubung dank des ehemaligen Kollegen Mike Klosowski lief auf der Wache einiges anders. Strenger und formaler, was Connor immer mehr gegen den Strich ging. Er konnte nichts dafür, dass Klosowski ein Psychopath war, der versucht hatte, die Beförderung Petronellis mit einem Mordversuch an dessen Schwester zu verhindern, den er dann dem Chief anhängen wollte.
»Wir müssen uns am Riemen reißen!« Mitchell stieß den Atem aus. »Der Hund lebt noch?«
»Ja«, brummte Connor. »Ist sehr ruhig.« Und wog eine Tonne. Wie hatte die Frau das Ungetüm nur tragen können, wenn er seine liebe Not damit hatte? Er war immerhin stolze 1,92 Meter groß und brachte dank seiner Muskelmasse seine hundert Kilo auf die Waage.
»Also gut, sobald du weißt, was mit dem Tier passiert, kommst du zurück und schreibst deinen Bericht. Ich will ihn noch vor Dienstschluss abzeichnen, verstanden?«
Connor drehte die Hand mit dem Mobiltelefon und schaute auf das Display. Es war bereits mitten in der Nacht und er war nicht allein im Wartezimmer. Trotzdem bestätigte er die Weisung. Das schaffte er nie! Mitchell legte auf und ließ Connor nervös zurück. Er rutschte auf dem Stuhl herum, bis der Hund ein Knurren ausstieß. Er stockte. Die Dogge hatte ein Maul so riesig wie eine Melone und er wollte nicht herausfinden, wer von ihnen der Stärkere war.
»McCann«, wurde er aufgerufen. Connor ächzte unter der Last des Kolosses und schleppte ihn ins Behandlungszimmer.
Die Helferin deutete auf den Behandlungstisch. »Was haben wir hier?«
»Keine Ahnung, Sie sind die Fachkraft.«
Ihre Augen verengten sich, als sie über ihn wanderten. Was zum Teufel war in dieser Stadt mit den Weibern los? Connor biss die Zähne aufeinander und hielt dem Blick stand.
»Sehe ich aus wie eine Hellseherin?«
»Nein.« Er bemühte sich redlich um Contenance. »Sie sehen aus wie jemand, der jemandem assistiert, der Ahnung hat. Also fragen Sie doch den Doktor, was dem Hund fehlt, und nicht den Feuerwehrmann!«
Sie verkniff die Lippen und starrte munter weiter. Das Tier starb ihm wegen dieser Hexe noch weg!
»Und? Wann kommt der Arzt?«
»Ich bin der Arzt!«
Aha. Da ging heute wohl eine Hundeseele über den Jordan. Er stemmte die Hände in die Hüfte und ließ den Kopf hängen, den er schüttelte. »Tja, gut, dass es nicht mein Tier ist.«
Sie schnaufte vor Entrüstung. »Gehen Sie mir aus dem Weg!«, befahl sie und drängte ihn gleich selbst zur Seite. Dann rief sie zwei Frauennamen, wobei sie sich bereits über den Hund beugte und ihn sanft ansprach, bevor sie ihn berührte. Die Dogge hob den Kopf und fiepte herzerweichend. Ein neuerlicher Blick traf ihn. »Raus!«
Connor hob die Hände und ging rückwärts, bis er auf einen Widerstand traf. Dinge fielen laut klappernd zu Boden und ein schriller Schrei ließ ihn herumfahren. Eine kleine Frau in gleicher Montur wie die Ärztin starrte ihn erbost an.
»Verflixt, verschwinden Sie endlich!«
Die Musik ging ihm gehörig auf die Nerven. Es war dieses hypnotische Gesäusel, das man häufig in Arztpraxen hörte oder an anderen Orten, an denen man sich entspannen sollte. Bei ihm wirkte es leider entgegengesetzt. Er wurde mit jedem Augenblick unruhiger und befürchtete, jeden Moment aus der Haut zu fahren. Nachdem er zwei Stunden lang regelmäßig nach Neuigkeiten gefragt hatte, war er schließlich sitzen geblieben und formulierte nun gedanklich seinen Bericht. Er wollte hervorheben, wie unfähig das Personal hier war, schließlich wartete er bereits die halbe Nacht hindurch!
»McCann!«
Connor zuckte zusammen, wodurch die vor der Brust verschränkten Arme absackten und er auf seinem Stuhl einen Hüpfer machte. Er riss die Augen auf und runzelte die Stirn.
Petronelli stand vor ihm und starrte ihn verärgert an. »Schläfst du etwa?«
»Nein«, murrte er und ließ die Schultern rollen. »Ich warte geduldig, bis das unfähige Weibsbild den Hund zusammengeflickt hat!«
Petronelli sah sich um. »Und wie lange soll das noch dauern?«
Connor zuckte die Achseln. »Das frage ich mich bereits die ganze Nacht hindurch. Aber hey, der Arzt hier ist eine Frau, was willst du da erwarten?«
Petronelli presste die Lippen zusammen und verengte die Augen, sagte aber nichts zu seiner Feststellung, sondern wandte sich brüsk ab, um zum Tresen zu stapfen. Dort lehnte er sich an und lächelte der Helferin zu. Connor verdrehte die Augen. Kein Wunder, dass Mitchell Petronelli zu seinem Stellvertreter gemacht hatte, schließlich spielten beide nun Pantoffelhelden, und die mussten wohl zusammenhalten.
Sein Vorgesetzter bedankte sich und kam zurückgestapft. Er hielt die Kladde in der Hand, die man ihm schon früher hatte aufdrängen wollen. Er wappnete sich.
»Du hast offenbar vergessen, einige Details anzugeben.« Petronelli hielt ihm die Papiere hin. »Der Hund muss vierundzwanzig Stunden zur Beobachtung bleiben. Wann holst du ihn ab?«
Connor hatte die Arme wieder vor der Brust verschränkt und spürte, wie sie erneut ins Rutschen kamen, ebenso wie seine Miene. »Wie bitte?«
»Hier!« Petronelli drückte ihm die Kladde in die Hand und schüttelte mit vor Verärgerung starrem Gesicht den Kopf. »Rosa wartet im Wagen und Eva auf ihre Ablösung zu Hause, also beeil dich hier endlich!«
»Aber …« Connor hob die Dokumente. »Das ist doch nicht mein Hund. Ich weiß nicht, wie er versichert ist oder wie die Halterin heißt, ob er einen Chip hat …«
»Ihr Name ist Detective Melissa Warren. Den Rest wirst du selbst herausfinden müssen.« Petronelli fuhr sich durch das schwarze Haar. »Rosa sagt, dass sie ins Cherryoak Falls Medical Center gebracht worden ist, also ist es kein großer Aufwand für dich, die Papiere von ihr persönlich ausfüllen zu lassen.«
»Aber …« Wie sollte er dann vor Feierabend seinen Bericht geschrieben bekommen? Moment. Er musterte seinen Vorgesetzten, der in Privatkleidung vor ihm stand, dann schoss sein Blick zu den schmalen Luken, die Tageslicht in den Wartebereich ließen. »Oh Shit!«
»Mitchell kocht vor Wut.«
Eine freundliche Warnung. Connor nickte abgehackt. »Ich sollte wohl anrufen und sagen …«
»Oh ja. Eine bessere Erklärung als die vermeintliche Unfähigkeit der Mitarbeiter hier wäre dienlich. Mann, Connor!« Damit driftete Petronelli ins Persönliche ab. »Was ist denn los mit dir?«
»Mit mir?« Das war ein Witz, oder? »Mit euch! Ich mache doch nichts falsch!«
»Du legst ein verletztes Tier in Mitchells Einsatzwagen, damit es krepiert.« Petronelli schüttelte den Kopf. »Mann, etwas mehr Mitgefühl täte dir gut.«
»Deine Frau wollte ihn nicht mitnehmen und der Detective hat eine Tierhaarallergie. Was hätte ich machen sollen? Das Vieh in Sicherheit schleppen? Ich bin Firefighter, kein Hunderetter!« Er hatte die bestmögliche Alternative gewählt, fand er.
»Wir retten Leben, Connor«, insistierte Petronelli, wobei er seinen Blick hielt. »Weil wir jedes Leben wertschätzen. Tier, Mensch … FRAU!«
Connor verdrehte die Augen. »Ich liebe Frauen. Ich weiß nicht, warum man mich ständig an den Pranger stellt. Rosa und Carmen sind zu empfindlich und einfach nicht dafür geeignet, unter Männern zu arbeiten.« Er konnte nicht mehr still sitzen bleiben und sprang auf. Er riss das Papier von der Halterung, faltete es unachtsam zusammen und stopfte es sich in die Gesäßtasche. »Dann besuche ich mal die … Polizistin.«
Petronelli hielt ihn am Arm zurück. »Keine Klagen.«
»Ich klage nicht, Petronelli, ich ertrage Unangenehmes wie ein Mann.«
»Von Detective Warren«, knurrte sein Vorgesetzter. »Verdammt, die Bewertungen stehen an und ich will nicht, dass Mitchell mir deine um die Ohren haut, verstanden? Behandle dein Gegenüber mit Respekt – besonders, wenn dein Gegenüber eine Frau ist!«
»Mann!« Er verdrehte genervt die Augen.
»Hast. Du. Verstanden?«
»Ja!«, bellte Connor. »Sie wird in den höchsten Tönen von mir schwärmen, keine Sorge!«
»Gut!« Trotzdem ließ er ihn nicht gehen und starrte ihm immer noch fest in die Augen. »Detective Melissa Warren. Cherryoak Falls Medical Center. Aber zuerst …«
»Fahre ich zur Wache und ziehe mich um.« Das war doch bei Schichtende selbstverständlich.
Petronelli schüttelte den Kopf. »Deine Schicht endet mit Abgabe deines Berichts. Ohne Überstunden.«
Connor biss die Zähne zusammen, um seinen Ärger nicht herauszubrüllen.
»Zuerst entschuldigst du dich bei dem hiesigen Personal für dein Benehmen«, befahl Petronelli. Connor starrte ihn an. Er hatte ihn mal als seinen Freund betrachtet, aber das war, bevor er die Karriereleiter hochgefallen war. Schade, dass er seine Schwester Mitchell nicht zum Fraß hatte vorwerfen können, wie Eric es mit Eva getan hatte. Denn dann müsste Connor diese Ungerechtigkeit nicht stoisch ertragen.
Er riss sich los und stapfte zum Tresen. »Es tut mir leid, wenn ich hier jemandem auf den Schlips getreten bin. Kommt nicht wieder vor.« Dann wandte er sich ab und ging hölzern weiter. Hinaus auf den sonnenbeschienenen Parkplatz.
Rosa sah ihm entgegen und runzelte die Stirn. Connor nickte ihr nicht einmal zu, was er sich in zwei Tagen sicher vorhalten lassen durfte, aber er hatte das Gefühl, bei der nächsten Demütigung die Kontrolle zu verlieren, und die Frau seines Vorgesetzten zu erwürgen, wäre sicherlich der berufliche Todesstoß!
Er zog die Tür zu Mitchells Einsatzwagen auf und knallte sie hinter sich wieder zu. Vermutlich sollte er das Auto zurückbringen, aber da er unbezahlte Überstunden auf Mitchells Geheiß machte, sah er nicht ein, warum er den Umweg in Kauf nehmen sollte.
Das Krankenhaus lag ohnehin am anderen Ende der Stadt.
Kapitel 4
Der Morgen graute und ich saß immer noch im Krankenhaus fest. Kein Arzt hatte sich bisher blicken lassen und der süße Pfleger machte sich auch rar. Sollte ich nach ihm klingeln oder war das aufdringlich? Mit einem Schnauben drückte ich gleich dreimal auf den Rufknopf. Ich war nicht von der geduldigen Sorte.
Statt des Latinos stand dann aber ein Weißer am Ende meines Krankenbettes und musterte mich. »Ms Warren.« Er trug weder Pflegertracht noch Doktorkittel, sondern eine dunkelblaue Uniform ähnlich der meiner Kollegen auf Streife. CFFD – Cherryoak Falls Fire Department stand auf der Marke, die an seine Brust geheftet war. Sie versteckte sich halb unter der Jacke auf dem hellblauen, zerknitterten Hemd. Ein Namensschild komplettierte die Aufmachung. McCann. Ich runzelte die Stirn, als ich meine Musterung abschloss. Er war groß, muskulös, trug sein schwarzes Haar kurz und einen gepflegten Drei-Tage-Bart. Seine Brauen waren über der Nasenwurzel zusammengezogen, was ihn düster wirken ließ. Seine Nase war schmal und markant, seine Lippen … pressten sich zusammen. Was an meinem Anblick mochte ihn verärgert haben?
»Ich habe Fragen.«
Brummte er mich etwa an? Ich verengte die Augen. Unhöflicher Kerl. Zwar konnte ich lesen, aber eine Vorstellung war doch obligatorisch. Er zog einen Packen zusammengefaltetes Papier aus der Hosentasche und hob es, als sei es bereits die Antwort auf all meine Fragen. Was er von mir wollte zum Beispiel. Da es jedoch nicht meine Entlassungspapiere waren, hatte er sich in dem Punkt vertan.
Er zog sich unaufgefordert den Stuhl heran, ließ sich darauf fallen und glättete das Papier auf seinem Schoß, bevor er mir den Stapel hinhielt. »Es muss schnell gehen.«
Aha. Ich sah ihn immer noch an. Er war deutlich zu kurz angebunden. Ob er mochte, so behandelt zu werden? Er stieß meinen Arm mit den Seiten an.
»Hier.«
»Guten Morgen«, sagte ich fest. Eine Erklärung wäre angebracht. Ich war verletzt, er hatte nicht einmal nach meinem Zustand gefragt und behandelte mich nun unangebracht rüde. Tja, er würde feststellen, dass ich nur zu freudig Spiegel vorhielt. »Ich bin Detective Melissa Warren. Ich wurde nach einer Explosion eingeliefert und warte auf meine Entlassung. Sie sind nicht Doktor Brisbane, also wüsste ich nicht, was Sie mir da unter die Nase halten könnten.« Ich hob die Brauen und wartete gespannt auf seine Reaktion. Da Silva hatte mich bereits befragt, was sollte ein Feuerwehrmann da noch von mir wollen?
Er beugte sich vor und streckte mir erneut die Blätter entgegen. »Es geht um Ihren Hund.«
Ich schreckte zusammen und entriss ihm die Papiere. »Geht es Henry gut?« Mein Blick flog über die Seiten. »Er wurde in der Tierklinik aufgenommen?«
»Ja, ich habe die Nacht in der Praxis verbracht. Ihr Hund muss dortbleiben.« Er legte die Hände zusammen und rieb sie. »Also, Ma’am, ich bin müde und habe Feierabend. Machen Sie mir nicht noch größere Probleme.«
Eine Welle der Dankbarkeit türmte sich in mir auf, aber etwas hielt mich davon ab, sie direkt auszudrücken. Sein stechender Blick, der unfreundliche, genervte Tonfall? »Wie geht es Henry?«, wiederholte ich meine Frage, die er schließlich nicht beantwortet hatte und die auch aus den Papieren nicht ersichtlich wurde.
»Keine Ahnung, wollte man mir nicht sagen, ohne dass ich die ganzen Fragen abgegrast habe.« Er zuckte die Achseln. »Dabei habe ich das Tier nur hingebracht.«
Hm, das klang nicht, als wäre er der strahlende Lebensretter meines Lieblings, aber ich wollte großzügig sein und ihm tatsächlich weiteren Ärger ersparen. »Ich brauche einen Stift.« Ich streckte die Hand nach ihm aus.
Seine Brauen wanderten zusammen. »Ich habe keinen.«
»Na, ich auch nicht!« Was für ein Scherzkeks. »Besorgen Sie mir einen, oder soll ich selbst auf die Suche gehen?« Da ich deutlich einen Krankenhauskittel trug, war es eine rhetorische Frage.
»Gute Idee.« Er stützte die Ellenbogen auf seinen Knien ab. »Nur beeilen Sie sich. Ich habe noch einen Bericht zu schreiben und kann die Schicht erst abschließen, wenn ich durch bin.«
»Aha.« Tja, mit seiner charmanten Art trieb er mich sicherlich nicht zur Eile an. Und schon gar nicht dazu, das Bett zu verlassen. Ich hatte Zeit. Nur das eine sollte ich zuvor abklären. Ich drehte mich, um mein Telefon vom Beistelltischchen zu nehmen, und wählte die Nummer, die als Kopfzeile auf jeder Seite der Papiere aufgedruckt war. »Guten Morgen, hier spricht Detective Warren vom CFPD. Laut Lieutenant McCann vom CFFD befindet sich mein Hund bei Ihnen in Behandlung. Eine männliche Dogge, Widerristhöhe sechsundachtzig Zentimeter, achtzig Kilo, nachtschwarze Fellfärbung. Er muss am Abend eingeliefert worden sein. Ich habe einen Wust an Papieren hier, den ich umgehend ausfüllen werde, zunächst muss ich jedoch wissen, wie es ihm geht.«
McCann murmelte etwas, was ich ignorierte. Seine Gemütsverfassung war mir ziemlich gleich.
»Detective Warren? Wir haben eine Dogge in unserem Bestand, sie gilt als herrenlos.«
»Wie bitte?«, knirschte ich.
»Es scheint Ihr Hund zu sein, da alle Angaben zutreffen. Es wäre gut, wenn wir die Unterlagen so schnell wie nur möglich zurückbekämen, um ihn ordentlich zu erfassen. Madam, tragen Sie die vollen Kosten seiner Behandlung? Oder sind Sie versichert?«
»Henry ist versichert, aber ich zahle etwaige Sonderausgaben. Wie sieht es aus?« Stand es so schlecht um ihn? Meine Finger bebten und ich biss die Zähne aufeinander, damit sie nicht unbeabsichtigt aufeinanderschlugen.
»Nun, er hat Knochenbrüche. Wie alt ist Henry?«
»Acht Jahre, drei Monate und fünfzehn … nein, sechzehn Tage.« Ich räusperte mich verlegen. »Wie lautet die Prognose?«
»Da ist unsere Ärztin noch verhalten.« Mein Gesprächspartner seufzte. »Aber wir tun unser Bestes, um all unseren Patienten gerecht zu werden.« Was wohlgemerkt nicht bedeutete, jeden Patienten am Leben zu erhalten. Ich atmete tief durch.
»Ist es möglich, dass ich kurz mit ihm spreche?«
»Wie bitte?«
»Er beruhigt sich, wenn er meine Stimme hört.« Darauf war er schließlich trainiert. »Stellen Sie mich einfach auf den Lautsprecher.«
»Es tut mir leid, Detective, aber wir haben keine schnurlosen Telefone hier. Kommen Sie doch in die Praxis. Wir haben durchgehend Sprechstunde. Bringen Sie die Papiere bitte mit.«
»Leider stecke ich selbst im Krankenhaus fest.« Aber hier kam ich nicht weiter. Es brachte nichts, sich an Dingen aufzureiben, die man nicht ändern konnte. »Also gut. Sobald ich entlassen werde, schaue ich vorbei. Danke und auf Wiederhören.« Ich legte auf und hob die Papiere an.
»Werden Sie heute noch fertig?«, brummte McCann.
Ich blickte ihn auffordernd an, aber er verstand es nicht. Also klingelte ich noch einmal nach dem Pfleger. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob ich tatsächlich auf den Füßen blieb, wenn ich versuchte aufzustehen, und ich wollte meine Kraft nicht unnötig verplempern.
»Wie kam es dazu, dass ausgerechnet Sie sich um meinen Hund kümmern mussten?« Meine Vermutung war nicht sonderlich schmeichelhaft: Er war ein Trottel und hatte die eine Aufgabe bekommen, bei der er keinen Schaden anrichten konnte.
»Ma’am, ich bin nicht hier, um Small Talk zu betreiben!« Er sprang auf und tigerte in dem Raum auf und ab, den ich für mich allein hatte, obwohl drei weitere Betten in ihm standen. »Ich habe Besseres zu tun.«
Charmant. Mein Blick glitt über den Feuerwehrmann. Er hatte einen knackigen Hintern, was trotz der Uniform zu erkennen war, und eine schmale Hüfte, die nun zur Geltung kam, weil er eine Hand in die Taille stemmte und sich mit der anderen durch das schwarze Haar fuhr.