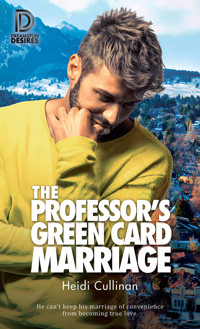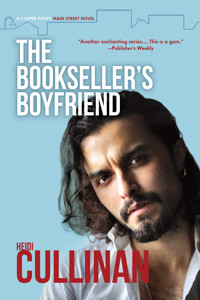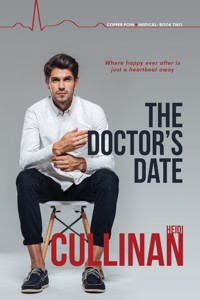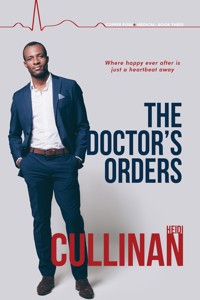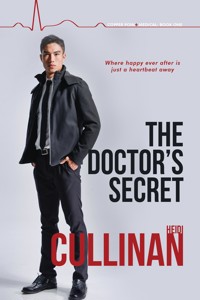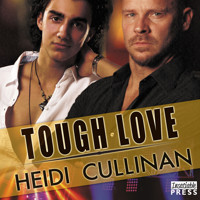6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Love-Lessons-Reihe
- Sprache: Deutsch
Kelly Davidson ist wohl die einzige Jungfrau auf dem College - ganz im Gegensatz zu seinem Zimmergenossen Walter Lucas, dessen Motto lautet: so viel Spaß wie möglich und bloß keine ernste Beziehung. Doch Walter merkt bald, dass er gerne Zeit mit Kelly verbringt und auf einmal gar nicht mehr das Bedürfnis hat, mit anderen Männern auszugehen. (ca. 400 Seiten)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Motto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Epilog
Die Autorin
Heidi Cullinan bei LYX.digital
Impressum
HEIDI CULLINAN
Love Lessons
Küss mich nur einmal
Roman
Ins Deutsche übertragen
von Michaela Link
Zu diesem Buch
Kelly Davidson ist wohl die einzige Jungfrau auf dem College – und auf der Suche nach der großen Liebe. Ganz im Gegensatz zu seinem Zimmergenossen Walter Lucas, dessen Motto lautet: so viel Spaß wie möglich und bloß keine ernste Beziehung. Doch Walter merkt bald, dass er gerne Zeit mit Kelly verbringt und auf einmal gar nicht mehr das Bedürfnis hat, mit anderen Männern auszugehen …
Für Dr. Gregory Scholtz.
Denn Sie waren mein Anker, und das werde ich nie vergessen.
Deine Aufgabe ist nicht, dich um Liebe zu bemühen, sondern vielmehr danach zu streben, alle Widerstände in dir zu finden, die du dagegen aufgebaut hast.
– Rumi
1
September
Hope University, Danby, Illinois
Die Erstsemestereinführung an der Hope University war ein All-you-can-eat-Büfett, und Walter Lucas war fest entschlossen, sich daran gütlich zu tun. Der attraktive Jüngling am Eingang zum Studentenclub zum Beispiel würde ein nettes Appetithäppchen abgeben, auch wenn der Typ aussah, als käme er aus der tiefsten Provinz. Sex musste jedoch warten, weil Walter zunächst Wichtigeres zu tun hatte – nämlich herauszufinden, wo genau er mit all den heißen Beaus Sex haben wollte, die ihm hier auf dem sprichwörtlichen Silbertablett präsentiert wurden. Laut einer Nachricht in seinem Postfach sollte er sich bei der Studiendekanin melden, und Walter befand sich gerade auf dem Weg dorthin.
Allerdings ahnte er schon, dass ihn dort nichts Gutes erwartete. Er nahm daher einen Umweg und schlenderte am Ufer des Lake Sharon entlang, um Lancelot und Gawain kurz Hallo zu sagen.
Der künstliche See maß etwa dreißig Meter und war in der Mitte knapp fünf Meter tief. Am Nordwestufer stand ein kleiner Glockenturm – schon seit Jahrhunderten ein Treffpunkt für romantisch veranlagte Hetero-Paare, die sich dort verzückt in die Augen sahen und einander ewige Liebe schwuren. Walter mochte den Glockenturm, weil er vor Sonne und Wind schützte, ihn vor neugierigen Augen verbarg und einen hübschen Hintergrund abgab, wenn er die beiden Schwäne beobachtete.
Auch heute glitten sie mit der üblichen Gelassenheit über das Wasser, die königlichen weißen Köpfe geneigt, um einmütig die Grenzen ihres Reviers zu kontrollieren. Sie beäugten Walter mit flüchtigem Interesse, aber als sie sahen, dass er keine Opfergaben in Form von Brot oder Maischips bei sich hatte, setzten sie ihren Weg fort. Anders als in Walters Fall war ihre Bleibe für das Jahr bereits gesichert, ihr See bevorratet mit allem, was immer sie brauchen würden.
So gut hätte er es auch gern mal gehabt.
Walter beobachtete die Schwäne, bis er Gefahr lief, die Sprechstunde der Dekanin zu verpassen. Schließlich ging er zurück zum Hauptgebäude der Universität – bereit, sich der Realität zu stellen und den nächsten neun Monaten, die er hier abzusitzen hatte.
Dekanin Stevens war eine der Frauen in den späten mittleren Jahren, die zwar einmal schön gewesen waren, nun aber nicht wahrhaben wollten, dass ein gewagter Ausschnitt bei einem derart runzeligen, schlaffen Dekolletee einfach nur bäh war. Obwohl er versuchte, nicht auf ihre Brüste zu schauen, als sie ihn begrüßte und in ihr Büro führte, lenkten diese die Aufmerksamkeit auf sich wie zwei Leuchttürme. Leuchttürme des Schreckens.
»Haben Sie den Mietvertrag für meine neue Wohnung bekommen?« Er nahm seine gewohnte Position auf dem Stuhl ihrem Schreibtisch gegenüber ein. »Ich habe ihn an Ihre Sekretärin gemailt.«
Ihr Lächeln wurde noch eine Spur starrer, und in diesem Augenblick wusste Walter, dass er nicht außerhalb des Campus wohnen würde.
Dekanin Stevens faltete die Hände auf ihrem Schreibtisch. »Walter, Sie sind im dritten Semester, und ich weiß, dass Sie unsere Wohnpolitik verstehen und dass Sie sich dem Gemeinschaftsmotto der Hope University verschrieben haben. Ich weiß, dass Sie verstehen, warum wir unseren Studenten nicht leichtfertig erlauben können, außerhalb der Wohnheime zu leben – weil es sie von dieser Gemeinschaft ausschließt.«
»Ich weiß, dass ich im letzten Jahr außerhalb des Campus gelebt habe«, konterte Walter. »Und ich weiß, dass Sie meinem Antrag, es diesmal wieder so zu halten, zugestimmt haben.«
Das Lächeln schien wie in ihre ledrige Gesichtshaut eingegraben. »Wir haben Ihrer Bitte, in der gleichen Wohnung wohnen zu dürfen wie im vergangenen Jahr – mit großem Widerstreben –, zugestimmt, doch wenn ich es recht verstehe, steht Ihnen diese Wohnung nicht mehr zur Verfügung.«
»Es ist nicht meine Schuld, dass der Vermieter seine Hypothek nicht aufbringen konnte. Wir haben ihm weiß Gott genug bezahlt.«
»Nichtsdestotrotz hat unsere Zustimmung diesem Mietvertrag gegolten, nicht einem neuen. Ich fürchte, wir können einem Studenten nicht erlauben, noch weiter entfernt zu wohnen.«
Walter konnte genauso starr lächeln. »Das neue Apartment ist zwei Häuserblocks entfernt von dem, das Sie bereits gebilligt hatten.«
»Irgendwo müssen wir unsere Grenzen ziehen, Mr Lucas. Ich darf darauf hinweisen, dass sich außerdem Ihre Situation verändert hat. Als Sie sich beworben haben, haben Sie mit einer anderen Studentin zusammengelebt, einer Studentin, die im kommenden Dezember ihren Abschluss machen wollte.«
Natürlich stürzte sie sich auf seine kleine Notlüge, den Versuch, das System der Hope University zu seinen Gunsten auszunutzen. Cara war eine Studentin im fünften Jahr und ein Trumpf für eine Bude außerhalb des Campus, vor allem, da sie verlobt war. Laut Plan hätte sie ihren Abschluss während des folgenden Semesters gemacht, und mit ihr als Mitbewohnerin auf dem Antrag war ihre Bitte mühelos durchgegangen. Nur dass Cara niemals vorgehabt hatte, so lange zu bleiben, und sobald die Tinte auf der Zustimmung zu ihrem Wohnarrangement trocken gewesen war, hatte sie sich für Sommerkurse und einen Abschluss im August angemeldet. Es war ein Taschenspielertrick, den niemand bemerkt hätte, bis es zu spät gewesen wäre … nur dass der idiotische Vermieter seine Hypothek nicht mehr bezahlt hatte, sodass ihr Plan aufgeflogen war.
Walter versuchte, dieses Detail so unauffällig wie möglich unter den Teppich zu kehren. »Sie hat es eingerichtet, frühzeitig fertig zu werden, damit sie ein Praktikum in Chicago machen konnte. Auch das ist nicht meine Schuld.«
»Sei es, wie es sei, Tatsache ist, dass Sie mich bitten, ein Quartier beziehen zu dürfen, das weiter entfernt ist als das des letzten Jahres, allein und auf die letzte Minute. Sie sehen doch gewiss die Schwierigkeiten, in die Sie uns bringen? Wenn ich Ihnen das erlaube, wird man uns mit Bitten überfluten, anderen das Gleiche zu gestatten.«
Das Studiendekanat wurde tatsächlich mit Anträgen bombardiert, abseits des Campus wohnen zu dürfen, denn die Hope University war die einzige Universität, von der Walter je gehört hatte, die es ihren Studenten nicht erlaubte, sich eigene Wohnungen auszusuchen. Er hätte schreien können, aber es würde seiner Sache im Moment nicht helfen, wenn er seine Meinung zum Besten gab.
»Es ist wichtig, dass wir die Gemeinschaft der Hope University pflegen«, fuhr die Dekanin fort. »Unsere Studenten und ihre Eltern erwarten von uns, dass wir allen, die die Hope besuchen, eine sichere Lernumgebung bieten. Wie können wir das bewerkstelligen, wenn die Studierenden kreuz und quer in der Stadt verteilt sind? Junge Menschen treffen nicht immer die besten Entscheidungen für sich selbst. Durch unsere Regelungen verringern wir diese Gefahr.«
»Ich bin durchaus imstande, selbst zu entscheiden, wo ich wohne«, antwortete Walter, »und was meine Eltern angeht, bin eher ich geeignet, Entscheidungen für sie zu treffen, als umgekehrt.«
Es war abscheulich, nun das Mitleid in ihrem Gesicht zu sehen. »Ja, dessen bin ich mir vollauf bewusst. Aber verstehen Sie denn nicht, dass es deswegen umso wichtiger ist, dass zur Abwechslung einmal jemand auf Sie achtgibt? Wie können Sie argumentieren, dass es ein Vorteil ist, Miete und Strom zahlen zu müssen und Ihre eigenen Mahlzeiten einzukaufen? Warum wollen Sie sich noch mehr Sorgen aufladen?«
»Ich habe mir das Recht verdient, diese Entscheidungen selbst zu treffen. Ich bin kein Erstsemester, jemand, der mit großen Augen auf den Campus kommt. Ich bin nicht einmal ein typisches Drittsemester. Dekanin Stevens, Sie kennen meine Situation.«
Zum ersten Mal im Laufe des Gesprächs bekam die Maske ihres Lächelns Risse, und er konnte hinter die Fassade blicken. Unglücklicherweise war dahinter kein gnädiger Blick, sondern ein betonharter. »Ich weiß davon, und es tut mir leid, Walter. Ich kann Ihnen nicht erlauben, abseits des Campus zu wohnen. Selbst wenn ich es wollte – was nicht der Fall ist –, ist es nicht meine Entscheidung. Der Studienausschuss hat Nein gesagt. Wir können das Thema diskutieren, solange Sie mögen, aber ich sage Ihnen als jemand, der diese ganze schwierige Zeit mit Ihnen durchgestanden hat, es wird nichts ändern. Wir haben Ihnen eine Sondererlaubnis gegeben, weil Sie sich abgekämpft haben und weil Sie mit einer befreundeten Studentin zusammengelebt haben. Allein zu leben ist keine gute Idee für Sie.«
Walter sackte auf seinem Stuhl in sich zusammen. »Also, wo bringen Sie mich unter? Denn ich weiß mit Bestimmtheit, dass Sie mich nicht in die Herrenhäuser mit den anderen Studenten der Abschlussjahrgänge stecken können.«
Stevens hob ein Stück Papier hoch und setzte sich eine Lesebrille auf die Nasenspitze. »Eigentlich könnte ich das. Ethan Millers Mitbewohner wechselt nun doch den Studienort.«
»Ethan Miller?« Bilder, wie er neben einem notgeilen Streber und einem Raum voller naturwissenschaftlicher Versuchsaufbauten aufwachte, schoben sich vor Walters geistiges Auge. Er funkelte sie an. »Bitte schauen Sie noch woanders nach.«
Die Dekanin schürzte die Lippen und überflog das Papier in ihrer Hand. »Ich habe einige andere freie Zimmer. Bedauerlicherweise befinden sie sich alle in den Quartieren für Studenten der unteren Semester und alle im gleichen Wohnheim –Porterhouse.«
Porterhouse. Zorn, Schock und auch Furcht durchfuhren Walter. Er richtete sich kerzengerade auf, als hätte ihm jemand mit einem Viehtreiber einen Stromstoß ins Steißbein versetzt. »Das kann nicht Ihr Ernst sein. Sie haben vier von diesen Massenunterkünften für die unteren Semester. Sie können mir nicht erzählen, dass die einzigen freien Plätze im Porterhouse sind.«
»Porter ist niemals ganz voll, wie Sie sehr gut wissen, obwohl wir in diesem Jahr fast an unsere Belegungsgrenze gestoßen sind. Nächstes Jahr wird es durch den Bau des neuen Wohnheims kein Problem mehr sein. Doch im Moment kann ich Ihnen entweder das Porter oder ein gemeinsames Zimmer mit Ethan Miller anbieten.«
Was für wunderbare Optionen. Walter versuchte, sich zu beherrschen, aber es war nicht leicht. Sie stellte ihn vor die Wahl zwischen Teufel und Beelzebub. »Erzählen Sie mir mehr über die Plätze, die im Porterhouse frei sind.«
»Es sind insgesamt sieben, alle belegt mit Studenten aus dem ersten oder zweiten Jahr. Dies könnte eine gute Sache sein, wissen Sie. Sie sind einer der größten Kritiker dieses Hauses und Sie haben recht, wir müssen dort etwas tun. Sie könnten anderen jungen Männern helfen, eine Stimme zu finden.«
»Also tue ich jetzt ein gutes Werk an der Gemeinschaft? Ich hoffe, Sie geben mir mein Zimmer gratis.« Er streckte die Hand aus, und sie überreichte ihm das Papier. Ein Meer von Namen trieb vor seinen Augen, alle bedeutungslos, nichts auf der Seite gab ihm einen Hinweis darauf, wer ein auch nur annähernd passabler Mitbewohner sein könnte. Am liebsten hätte er ihr die Liste vor die Füße geworfen und sich geweigert. Was konnten sie schon tun? Ihn rauswerfen? Na und? Er hätte auf Cara hören und doch nach Chicago zurückgehen sollen. Er hätte nicht warten sollen, nicht einmal für Williams. Er hätte nicht …
Er hielt inne, und sein Finger landete auf einem violetten Quadrat neben einem der bedeutungslosen Namen. »Da. Das hier. Was ist das?« Bevor sie antworten konnte, fiel es ihm wieder ein. »Das ist Ihr Code für offen für einen schwulen Mitbewohner, habe ich recht?«
Stevens linste auf die Liste hinab. »Ja, aber es ist ein Einzelzimmer.«
»Oh.« Die Einzelzimmer waren Schuhkartons, zwei Personen kamen dafür nicht infrage. Außerdem war es relativ wahrscheinlich, dass ein Einzelzimmer einen Studenten der oberen Semester beherbergte, der sich darin mit einer Xbox einigelte. Nur dass da ein E stand, direkt neben dem Quadrat. »Wie ist ein Erstsemester an ein Einzelzimmer gekommen?«
»Er hat Allergien, ziemlich schwere, wenn ich mich recht erinnere. Er braucht die Klimaanlage, und natürlich sind die einzigen regulären Zimmer mit Klimaanlagen in den Wohnheimen für die höheren Semester.« Stevens hielt inne und sah Walter versonnen an. »Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, waren seine Eltern nicht glücklich damit, dass er allein wohnt. Wenn Sie dort wohnen wollen, könnte ich dem zustimmen.«
»Dort wohnen? In diese Zimmer passen keine zwei Leute.«
»Es wäre nicht das erste Mal, dass wir Einzelzimmer mit zwei Studenten belegen. Es ist ein bisschen eng, aber es lässt sich machen.« Sie lächelte geistesabwesend und erwärmte sich offensichtlich für diese Lösung. »Das könnte in der Tat eine Menge Probleme lösen. Die Mutter war heute Morgen hier, als sie ihn abgesetzt hatte, und wirkte beinahe verzweifelt, als ihr klar wurde, dass sie ihr Baby zum Studium allein lassen musste. Sie kommen von außerhalb des Staates, und ich nehme an, der junge Mann hat gerade sein Coming-out. Sie hat sich große Sorgen gemacht, dass es nicht gut laufen wird. Ich nehme an, er ist ziemlich schüchtern.«
Fantastisch. Jetzt würde Walter nicht nur seine sturmfreie Bude einbüßen, sondern auch Kindermädchen für einen schüchternen, allergiegeplagten Neuling spielen, der wahrscheinlich Akne auf dem Rücken hatte. Walter runzelte die Stirn, nahm das Papier und überflog es aufmerksam. Keines der anderen Zimmer mit freiem Bett hatte ein violettes Quadrat, und wenn sich die Bewohner nicht bereit erklärt hatten, einen schwulen Mitbewohner aufzunehmen, wollten sie verdammt noch mal auch keinen haben. Zwei der freien Plätze waren in den Zimmern von Studenten aus dem zweiten Jahr, die Walter nicht leiden konnte, und die anderen hätten nach allem, was er wusste, Schwulenhasser sein können. Nicht dass sie an der Hope Möglichkeiten gehabt hätten, das offen zu zeigen. Aber er hatte gelernt – ebenfalls im Porterhouse –, dass es viele Möglichkeiten gab, andere zu schikanieren. Also hatte er tatsächlich nur die Wahl zwischen dem verdammten Ethan Miller und drangvoller Enge mit einem Erstsemester.
Sein Blick wanderte zurück zu dem Pickeltypen.
»Worst-Case-Szenario«, stellte Stevens fest, »Sie wohnen dort, bis Sie selbst eine bessere Lösung gefunden haben. Sie haben es bisher immer geschafft, wenn Sie Probleme hatten. Ich sehe nicht, warum Sie es jetzt nicht auch hinkriegen sollten.«
»Ich hätte keine Probleme«, antwortete Walter, »wenn Sie mir erlauben würden, außerhalb des Campus zu leben.«
Stevens seufzte und griff nach ihrem Stift. »Soll ich Sie für ein zweites Bett in dem Einzelzimmer eintragen?«
Walter starrte einen Moment auf das Papier, bevor er widerstrebend nickte. Worauf ließ er sich da nur ein?
Nach dem Treffen mit Stevens ging Walter quer über den Dozentenparkplatz und folgte der Reihe zerschlagener Straßenlaternen, die den Weg zum Gebäude der Kommunikationswissenschaftler markierten.
Auf dem Campus waren viele Gebäude sanierungsbedürftig, doch das der Kommunikationswissenschaftler hätte man wohl am besten gleich abreißen und anderswo neu errichten müssen. Ritche Hall, das am entlegensten Punkt des Campus stand, war im Jahr 1950 erbaut worden und hatte niemals auch nur eine neue Gardine gesehen. Lediglich1997, nachdem das Gebäude um ein Haar abgebrannt war, hatte es neue elektrische Leitungen bekommen. Die Flure waren schmal, die Wände bestanden aus Sowjetbeton. Das Licht flackerte oft, weil die Nachrüstung aus den Neunzigern nicht auf die Bedürfnisse moderner Technik ausgelegt war. Kommunikationstechnik war ein Stiefkind auf dem Campus, und das Gebäude, das sie beherbergte, war ein unübersehbares Zeichen dieser Geringschätzung.
Doch ausgerechnet dieses Gebäude war Walters geistige Heimat.
Er passierte das traurige kleine Studio, in dem der Wahlfachkurs stattfand, der zu seinem wahrscheinlich schlecht durchdachten Abschluss gehörte, und er lächelte. Er winkte Jax zu, der für einen Campus-Radiosender, den niemand beachtete, den DJ spielte. Schließlich ging er die Treppe hinunter zu den Kellerbüros, wo die Professoren – alle drei – ihr Bestes taten, sich nicht an Bürostunden zu halten.
Professor Williams saß jedoch an seinem Schreibtisch, die schlaksige Gestalt über die raue, alte Holzplatte gebeugt, während er an einem selbstgemachten Sandwich knabberte. Sein graues, schütteres Haar stand in alle Richtungen vom Kopf ab. Als er Walter bemerkte, winkte er ihn durch den kleinen, vollgestellten Raum zu sich heran.
»Mr Lucas. Entrez vous.« Er legte das Sandwich beiseite und nahm einen Stapel Aktenordner von einem Stuhl. »Was kann ich für Sie tun?« Als Walter nicht sofort antwortete, musterte Williams ihn einen Moment lang, bevor er begriff. »Oh, verdammt. Sie haben keine Erlaubnis bekommen, außerhalb des Campus zu wohnen.«
Walter zuckte die Achseln und versuchte, so zu tun, als spiele es keine Rolle. »Es war einen Versuch wert.«
»Wenn ich mich recht erinnere, war es Ihnen ziemlich wichtig.« Williams seufzte und wischte sich mit einer Serviette den Mund ab. »Nur fürs Protokoll, ich bin persönlich zum Studienausschuss und zur Dekanin gegangen und habe mich für Sie eingesetzt. Obwohl das rückblickend vielleicht keine so gute Idee gewesen ist. Sie schienen in diesem Jahr noch wütender als sonst auf mich zu sein.«
»Es ist okay, wirklich.«
Williams sah Walter über seine randlose Brille hinweg an, und Walter seufzte, bevor er sich auf einen Stuhl fläzte.
»Okay. Es ist super ätzend und echt nicht gut. Ich habe mich aber innerlich schon darauf vorbereitet, als ich diese Benachrichtigung von der Bank bekommen habe.«
»Trotzdem, es tut mir leid, Walter.« Nachdem er aus einer zerbeulten Thermoskanne Kaffee in zwei angeschlagene Becher gegossen hatte, reichte er Walter einen davon. »Ich wünschte, ich hätte hier drin einen Flachmann, damit ich daraus einen Irish Coffee machen könnte. Obwohl ich mir nicht sicher bin, dass es koscher wäre, einem Studenten Alkohol zu geben, ganz gleich, ob Sie von Rechts wegen trinken dürfen oder nicht – heute würde ich es tun, denn das ist ein beschissener Tag für Sie.«
»Danke.« Walter nahm einen Schluck von der lauwarmen Plörre und hatte das Gefühl, wieder zuhause zu sein. Einige der besten Momente seines Lebens hatte er in diesem Büro gehabt, mit Williams und dessen dünnem Kaffee. »Was macht die Familie?«
»Alles bestens. Die Schule hat in der letzten Woche wieder angefangen, daher ist Karen nicht ganz so mordlustig wie sonst. Gegen Ende des Sommers war es langsam kriminell.«
Walter zuckte zusammen. »Verdammt, ich wünschte, ich hätte nicht nach Chicago zurückgemusst. Dann hätte ich helfen können.«
»Wenn wir schon davon sprechen – ich kann mir schon denken, dass es kein Spaß war, aber bringen Sie mich doch auf den neuesten Stand, was an der Heimatfront so los ist.«
Walter nippte weiter an seinem Kaffee. »Meine Mutter ist wieder instabil, und mein Vater tut völlig ahnungslos, was sie betrifft. Tibby hat das Schmollen und Umherstolzieren auf eine olympiaverdächtige Ebene erhoben. Cara ist voll im Hochzeitsplanermodus, und Greg steckt bis zum Hals in seinem Examen.« Er kratzte mit dem Daumen über eine angeschlagene Stelle am Rand der Tasse. »Sie wollen, dass ich an die Northwestern wechsle oder an irgendeine Hochschule in Chicago.«
»Hm.« Williams kippte seinen uralten Stuhl nach hinten, sodass er knarrte. »Sie klingen seltsam schuldbewusst, wenn Sie das sagen. Wollten Sie denn wechseln?«
»Nicht wirklich.« Wieder rieb er über den angeschlagenen Tassenrand. »Ich gebe zu, dass es so einfacher gewesen wäre, meine Familie im Auge zu behalten.«
Williams schnaubte. »Dann ist das ein guter Grund, nicht zu wechseln. Es hat Sie nur verrückt gemacht, Ihre Familie im Auge zu behalten. Obwohl Sie wissen, dass Sie an die Hope verschwendet sind. Die Northwestern, die University of California – überall dürfte es eine bessere kommunikationswissenschaftliche Fakultät geben als hier.«
Bei dieser Bemerkung runzelte Walter die Stirn. »Mir gefällt unsere Fakultät.«
»Niemandem gefällt diese Fakultät.« Williams pulte in seinem Sandwich herum. »Ich bin dieses Jahr fällig für eine Festanstellung. Allerdings habe ich das wirklich üble Gefühl, dass man einen Weg finden wird, sie mir zu verweigern. Verdammt, aber ich will nicht umziehen.«
»Was?« Walter fuhr in seinem Stuhl hoch. »Das müssen Sie mir erklären.«
Williams wirkte überrascht. »Ich sitze auf einer Stelle, die dauerhaft finanziert ist, und bin jetzt seit sechs Jahren hier. Sie müssen mir nun entweder eine Festanstellung geben oder mich vor die Tür setzen.«
»Sie müssen Ihnen eine Festanstellung geben«, sagte Walter und hoffte, dass er weniger verzweifelt klang, als er sich fühlte.
»Das müssen sie nicht, aber es ist ziemlich schwer, sie mir zu verweigern. Trotzdem, ich bin in engem Kontakt mit der American Association of University Professors und bereit, die Entscheidung anzufechten, falls es dazu kommen sollte.«
Walter nippte nur an seinem Kaffee, obwohl er sich innerlich aufbäumte. Er konnte sich nicht vorstellen, seinen Abschluss ohne Williams zu machen. Er würde verdammt noch mal mit Ethan Miller schlafen und zur Belustigung des gesamten Porterhouses splitternackt auftreten, wenn er nur seinen Mentor nicht verlor.
»Wie dem auch sei.« Der Professor stellte seinen Kaffee ab und kratzte sich am Hinterkopf. »Ich werde versuchen, in diesem Studienjahr möglichst wenig aufzufallen. Karen sagt, das werde ich bis etwa Oktober schaffen. Wahrscheinlich hat sie recht.«
Sie sind der beste Professor auf dem Campus, wollte Walter sagen, aber er ließ es, weil es zu schleimig geklungen hätte. »Wenn Ihnen Ihre Festanstellung verweigert wird, gibt es wahrscheinlich einen Aufstand.«
Das entlockte Williams ein Lächeln. »Rose Manchester war bereits voll grimmigen Eifers bei mir, nachdem sie gehört hatte, dass ich dieses Jahr an der Reihe bin. Sie hat mir versprochen, einen Studentenausschuss innerhalb des Philosophieclubs zu gründen, falls ich die Stelle nicht bekomme. Anscheinend gibt es einen Präzedenzfall: Im Jahr 1992 wurde einem Professor die Festanstellung verweigert, und während des Berufungsverfahrens haben die Studenten sich mobilisiert und geschlossen einen Riesenaufstand gemacht. Ich bin nicht überzeugt, dass das der Grund war, warum das Blatt sich gewendet hat. Ich habe Rose gesagt, ich will nichts davon hören, denn was immer sie anstellen, es wird auf keinen Fall hilfreich sein. Der Dekan der Fakultät und der Studienausschuss würden denken, ich hätte die Leute zum Protest angestachelt.«
»Oh Gott, Sie hören sich an, als würden Sie damit rechnen, keine feste Stelle zu bekommen.«
Williams’ Lächeln war beinahe boshaft. »Nun, der Dekan hat mich erst letzte Woche einen kleinen Scheißer genannt.«
Normalerweise hätte William dieser Satz ein Lächeln entlockt, aber angesichts der Umstände war ihm nicht danach. »Dekan Prents ist selbst ein kleiner Scheißer. Gott, dieser Mistkerl ist so schmierig.«
»Psst.« Williams streckte den Fuß aus, um die Tür zu schließen, hielt sich aber gerade noch zurück. »Seien Sie brav. Ich kann die Tür nicht schließen – Karen hat mich darauf hingewiesen, dass die sicher liebend gern das Debakel von vor zwei Jahren noch mal aufwärmen würden.«
»Also bitte. Wir sind hier doch nicht an der Disney-Universität. Jedenfalls nicht, solange Sie niemand beschuldigt, mit einer Studentin zu flirten. Außerdem sind Sie alt genug, um mein Vater zu sein.«
»Hey!« Williams wirkte ernsthaft gekränkt. »Nur wenn ich Sie in der neunten Klasse unter den Tribünenbänken gezeugt hätte, Sie Klugscheißer. Und soweit ich weiß, erfreut sich der Daddy-Fetisch in der Schwulengemeinde immer noch großer Beliebtheit.« Er hielt inne, wurde ein wenig blass und zog die Tür endgültig zu. »Scheiße, ich sollte besser die Klappe halten.«
Walter lachte. »Wieso, glauben Sie, der Raum ist verwanzt?«
»Nein, aber …« Williams hielt inne und kämpfte offensichtlich innerlich mit sich. »Hier ist die Wahrheit, nur unter uns beiden. Ich bin noch ein schlimmerer Klugscheißer als Sie. Ja, Sie finden das komisch und spaßig, aber für jemanden, der alt genug ist, um Ihr Vater zu sein, wird es allmählich Zeit, sich wie ein Erwachsener zu benehmen. Ich habe diese Stelle angenommen, weil sie das war, was ich bekommen konnte, und weil ich davon geträumt habe, die Fakultät dazu zu bringen, das Curriculum zu erweitern. Und nun habe ich nur sechs Jahre meiner Zeit vertrödelt.«
»Sie haben sehr viel getan«, sagte Walter ein wenig zu scharf.
Williams wurde weich. »Ich weiß. Ich will nicht geringschätzen, was ich Studenten wie Ihnen habe geben können. Ich bereue auch meine Zeit hier nicht. Oder die Arbeit mit meinen Studenten, selbst nicht die mit den Dummköpfen. Die Sache ist, an irgendeinem Punkt sollte ich wahrscheinlich erwachsen werden und an meine Karriere denken, verstehen Sie?«
»Sie haben eine Karriere. Hier.«
»Klar. Ich bin Juniorprofessor in einer fast stillgelegten Abteilung, an einer Universität, die vor allem für himmelhohe Studiengebühren bekannt ist und für schleimige Politik und vorgebliche Vielfalt, die als Marketingstrategie dient. Ich habe mich auf der Hope University sogar zurückgehalten und zu allem Ja und Amen gesagt, weil ich auf keinen Fall meine Stelle gefährden wollte. Ich war träge. Ich habe nur einen einzigen Artikel publiziert, was eine Festanstellung sehr unwahrscheinlich macht.« Williams sah beinahe grimmig aus. »Und klar, mit meiner trüben Geschichte inspiriere ich Sie ganz bestimmt zu Höchstleistungen. Okay, Mr Lucas, ich muss den Lehrplan fertig machen. Das mit Ihrer Wohnung tut mir wirklich leid. Sagen Sie mir wenigstens, dass die Sie in eins der Herrenhäuser gesteckt haben, dann kann ich gut schlafen.«
»Ich teile mir im Porterhouse ein Einzelzimmer mit einem allergiebeladenen Erstsemester.«
»Na super.« Williams hob den Becher zu einem spöttischen Trinkspruch. »Samstagabend, Opie’s, Hinterzimmer, seidelweise Bier. Ich werde meine Frau mitbringen, damit niemand denkt, ich würde Sie verführen.« Er runzelte die Stirn. »Mist, ich muss mir einen Babysitter besorgen, und Cara ist weg. Oh Mann, ich hasse es, wenn Leute ihren Abschluss machen.«
Walter lachte und schüttelte das hohle Gefühl ab, das der drohende Verlust von Williams in ihm ausgelöst hatte. »Ich werde da sein.«
»Was ich noch vergessen habe zu fragen: Wann ziehen Sie ein? Ich nehme an, Sie wohnen im Moment in Caras und Gregs alter Wohnung?«
»Ja, bis der Mietvertrag ausläuft. Also bis Mittwoch.«
Williams zog eine Augenbraue hoch. »Heute ist Montag.«
»Das lässt sich nicht leugnen.«
Der Professor sah auf seine Armbanduhr. »Angesichts der späten Stunde nehme ich an, dass Sie heute Abend nicht umziehen werden.«
»Gott, nein. Heute Abend habe ich vor, mir was Junges, Scheues und Knackiges aufzureißen und abzuschleppen, um meine letzte Nacht in Freiheit zu genießen. Obwohl ich vielleicht vorbeigehen und meinen Anspruch auf meine anderthalb Quadratmeter Wohnfläche erheben werde, um sicherzustellen, dass jemand ein Bett für mich aufstellt. Es sei denn, ich beschließe, bei dem Futon zu bleiben. Da bleibt mehr Platz für Schlafzimmerakrobatik.«
Williams salutierte. »Gehet hin und treibet’s wild, junger Mann.«
»Das habe ich vor«, sagte Walter, als er ging.
Als Walter diesmal durch die Flure von Ritche Hall wanderte, hatte er die Hände in den Taschen, pfiff und fühlte sich erheblich besser als bei seiner Ankunft.
2
Irgendwann mitten in der Erstsemester-Orientierungsveranstaltung an der Hope University kamen Kelly Davidson Zweifel.
Seine Eltern waren gegen Mittag abgefahren, nachdem sie ihn umarmt und ihm das Versprechen abgenommen hatten, so oft anzurufen, wie er konnte. Sie hatten sich in der Pizzeria auf der anderen Straßenseite ein schönes Mittagessen gegönnt und sich an den Ufern des Lake Sharon voneinander verabschiedet. Und Kelly war sich ziemlich sicher, dass auf dem Weg zur Orientierungsveranstaltung ein ernsthaft süßer Typ seinen Hintern taxiert hatte – vermutlich aus einem höheren Semester, aber Kelly wusste noch nicht recht, wie man das erkannte.
Trotzdem konnte Kelly jetzt, da er endlich in der Aula auf dem Campus war und zuhörte, wie die Studiendekanin über die Wunder der Hope sprach, vor lauter Panik kaum noch stillsitzen. Die kleine Blase aus Vorfreude und Optimismus war irgendwann während der Kleingruppenveranstaltungen geplatzt, und der Tag, der mit einem Soundtrack von Ashman und Menken begonnen hatte, fühlte sich jetzt an wie die Filmmusik von Der weiße Hai. Das Schlimmste von allem war, dass Kelly gar nicht hätte erklären können, warum er plötzlich am liebsten zurück nach Hause gerannt und sich dort im Wandschrank verkrochen hätte.
Ein Stups an seinem Arm veranlasste ihn, sich nach links zu wenden, wo seine Orientierungsführerin ihn anstrahlte, während die Dekanin in sorgfältig modulierten Tönen vor sich hin schwadronierte. Amy ließ ihren Regenbogenring aufblitzen, der zu ihren regenbogenfarbenen Extensions und ihrem leuchtend grünen Shirt passte, auf dem zu lesen stand: It’s Okay With Me. Sie beugte sich vor, um Kelly ins Ohr zu flüstern: »Einige von uns von der GSA gehen anschließend auf eine Pizza und ein alkoholfreies Bier zu Opie’s. Willst du mitkommen?«
Kelly hielt inne, unsicher, was er tun sollte. Hatte er nicht seit seinem vierzehnten Lebensjahr davon geträumt, Kontakt zu dem Netzwerk Gay-Straight Alliance aufzunehmen? War das nicht genau der Grund, warum er hier war, nämlich sich solchen Gruppen anzuschließen?
Er war nun hier, ja, aber seine Orientierungsführerin war ihm von Anfang an nicht ganz geheuer gewesen. Nachdem sie ihn vor der Gruppe geoutet hatte – anscheinend stand seine sexuelle Orientierung auf ihrem Klemmbrett –, hatte sie sich wie eine Muschel an seinen Arm geklammert und darüber geplappert, dass sie zusammen nach einem festen Freund Ausschau halten könnten. Ihre Begeisterung und ihre Regenbogeninsignien verstärkten Kellys böse Ahnung, statt ihn zu beruhigen.
Ja, er sollte gehen, aber Mann, er wollte wirklich nicht.
»Ich glaube, ich muss zurück in mein Zimmer und einige Dinge regeln«, flüsterte er. »Trotzdem, vielen Dank.«
Die Dekanin beendete ihre Ansprache; das Publikum klatschte höflich, erhob und zerstreute sich. Die Orientierungsführerin blieb an Kellys Seite und zog einen Schmollmund. »Ah, komm schon. Du hast doch Hunger, oder? Führen dich Pizza mit doppelter Portion Käse und alkoholfreies Bier nicht in Versuchung?«
»Ich bin allergisch gegen Milchprodukte.« Und gegen Eier und Mandeln und Hausstaub und Beifußpollen und Katzen und Hunde und Daunen und Schimmel. Er griff nach seinem Rucksack und hielt Ausschau nach einem Fluchtweg. »Man sieht sich«, sagte er, und bevor sie ihn weiter in Beschlag nehmen konnte, eilte er davon.
Kelly lief nicht aus der Aula hinaus, sondern kauerte sich hin, zog seinen schmalen, mit Orientierungsliteratur gefüllten Rucksack vor sich und runzelte die Stirn, während er versuchte, das Erlebte abzuschütteln. Er strich mit dem Daumen über das gewebte Regenbogenarmband, das seine Schwester ihm an diesem Morgen beim Verlassen des Hotelzimmers gegeben hatte, bevor seine Familie ihn zu seinem Wohnheim gebracht hatte. War es ein Fehler gewesen, das Armband zu tragen? War es zu früh gewesen? Sollte er es abnehmen? Lisa würde schließlich nicht erfahren, dass er ihr Geschenk beiseite gelegt hatte. Bei wie vielen anderen Leuten stand ihr Schwulsein auf den Klemmbrettern? Während er zu den Ausgangstüren hinüberschlenderte, war er so versunken in seine eigenen Gedanken, dass er zusammenzuckte, als jemand ihm eine Hand auf den Arm legte. Ein Mädchen mit langem, blondem Haar, das aus einer braunen, gestrickten Baskenmütze lugte, hielt Kelly fest und deutete auf den Boden.
»Entschuldige, aber du wärst beinahe mitten über den Tierkreis gelaufen.«
Ihr Ton schien darauf hinzudeuten, dass dieser Satz sich selbst erklären würde, was Kelly nur noch mehr verwirrte. »Was?«
»Haben sie es euch in der Orientierungsveranstaltung nicht erzählt? Normalerweise streuen sie es als erheiternden Mythos ein.« Sie deutete auf eine Einlegearbeit aus Messingplatten im Boden, Symbole, die vage astrologisch aussahen. »Geh nicht über den Tierkreis, sonst fällst du bei deiner nächsten Prüfung durch. Ich weiß, jetzt klingt es dumm. Aber als jemand, der es getan und den Preis gezahlt hat, kann ich nicht guten Gewissens zulassen, dass du dein Studium auf diese Weise anfängst.«
»Okay.« Kelly war sich nicht sicher, was er sonst sagen sollte. »Danke?«
Mit einem breiten Grinsen streckte das Mädchen die Hand aus. »Rose Manchester, ich bin im dritten Semester. Freut mich, dich kennenzulernen.«
Kelly ergriff ein wenig zögerlich die dargebotene Hand. »Kelly Davidson. Erstes Semester. Obwohl du das ja bereits zu wissen scheinst.«
Rose zuckte die Achseln. »Es ist eine kleine Uni. Jeder, den man zu dieser Zeit des Jahres nicht kennt, ist entweder im ersten Semester oder hat die Uni gewechselt.«
»Ich sehe nicht aus, als hätte ich die Uni gewechselt, nehme ich an?«
»Nun, du trägst immer noch deinen Highschool-Klassenring. Das tun die meisten Wechsler nicht.«
Kelly legte den Daumen über seinen rechten Ringfinger. »Ist das uncool oder so?«
Sie lachte. »Ich habe davon keine Ahnung. Ich bin eine Art Freak.«
Er musterte kurz Roses Accessoires – keine Regenbogenkette und kein Klassenring. Sie hatte allerdings eine seltsam aussehende Halskette: eine schwarze Kordel mit einem schweren Metallkreis mit der Aufschrift LÖSCHT DEN HASS AUS. Schmuck schien ein sicheres Gesprächsthema zu sein – bisher funktionierte es. »Mir gefällt deine Kette.«
Rose berührte sie und lächelte, dann fiel ihr Blick kurz auf Kellys linkes Handgelenk. »Danke.«
Kelly musste an sich halten, um sein Armband nicht zu verstecken, und während sie wortlos dastanden, fühlte er sich Rose seltsam nahe. Sie erinnerte ihn an seine Schwester, sowohl dem Aussehen nach als auch wegen ihrer Fähigkeit, taktvoll zu schweigen. Er ertappte sich dabei, dass er mit ihr reden wollte, sie als Freundin gewinnen wollte, aber er hatte keine Ahnung, wie er das anstellen sollte.
Er hielt sich an die Kette. »Ist das die NOH8- Kampagne?«
Sie schüttelte den Kopf. »Matthew Shepard.«
»Oh.« Kelly schluckte ein cool herunter, weil Matthew Shepards Pein nun wirklich nicht cool war.
»Normalerweise mag ich keine Zurschaustellung«, fuhr Rose fort, »aber eine Freundin hat mir das da geschenkt, und es erinnert mich an sie.«
Zurschaustellung. Kelly dachte an Amy und schob das Armband höher hinauf. Er schwor sich, es abzuschneiden, sobald er in seinem Zimmer war. Dann begriff er, was Rose gesagt hatte. Moment mal, bedeutete das …? Konnte er fragen?
Rose lächelte. »Ich glaube, ganz offiziell falle ich gerade in die E-Kategorie, aber ja, ich bin lesbisch.«
»E?«
»Erkundung.« Rose schob ihren Rucksack höher auf ihre Schulter. »Im Moment bin ich irgendwo zwischen lesbisch und bi, aber ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich nicht in das standardmäßige heterosexuelle Schema passe.« Sie zog wissend eine Augenbraue hoch. »Du hast dich gerade geoutet, stimmt’s?«
Er versuchte zu lachen. »Woran merkst du das?«
»Weil du aussiehst, als würdest du erwarten, dass Leute aus den Büschen kommen und dir schwul entgegenschreien, bevor sie dich mit Steinen bewerfen. Es ist okay. Wir haben das alle durchgemacht. An manchen Tagen geht es mir immer noch so. Ich bin mir sicher, du hast das Gelabere gehört, aber du kannst dich an der Hope größtenteils wirklich entspannen. Bleib nur dem Porterhouse fern, dann wird alles gut.«
Kelly erstarrte. »Porter? Du redest über das Wohnheim, das Porter genannt wird?« Als sie nickte, krampfte sein Magen sich zusammen. »Dort ist mein Zimmer.«
Roses Lächeln erstarb. »Ah. Nun, ich hoffe, du hast einen guten Mitbewohner.«
Er versuchte, nicht in Panik zu geraten. »Ich habe überhaupt keinen Mitbewohner. Ich habe Allergien, daher habe ich wegen der Klimaanlage ein Einzelzimmer bekommen.«
»Das ist gut – dass du keinen Mitbewohner hast, meine ich. Dort wohnen die ganzen sportlichen Typen, und ich mag Klischees eigentlich gar nicht, aber … nun, was soll’s, es wird schon gut gehen.«
Sie sagte es auf die Weise, auf die Menschen sagen, sie hofften, es würde gut gehen, obwohl sie sich sicher sind, dass es nicht gut gehen wird. Rose kramte in ihrer Tasche herum und zog ein Smartphone heraus. »Hier – gib mir deine Nummer, dann schicke ich dir später eine SMS, um mich davon zu überzeugen, dass es dir gut geht. Ich bin drüben im Sandman, und wenn ich auch sonst zu nichts nutze bin, kann ich sie wenigstens mit meinen Titten ablenken, während du wegrennst.«
Kelly lachte, aber seine Finger zitterten, als er sich in Roses Kontaktliste eintrug. Wie hatte er nach all seiner sorgfältigen Planung in dem einen schlechten Wohnheim landen können? Er wollte dumme Fragen stellen, Unmengen Fragen, und am liebsten hätte er Rose angefleht, ihn nicht sich selbst zu überlassen, ihn unter ihrem Bett schlafen zu lassen. Wo ihn dann allerdings die Staubmäuse umbringen würden.
Sie nahm ihr Telefon zurück und zwinkerte ihm zu. »Es wird schon alles gut gehen, Kelly Davidson. Ich bin manchmal ein wenig hellseherisch, und ich sage dir, alles wird sich zum Besten wenden.«
Gott, er hoffte es. »Danke.«
»Wie dem auch sei. Tut mir leid, dass ich dich so angesprungen habe, aber ernsthaft, dieser Tierkreisfluch ist echter Mord.« Sie trat zurück und winkte. »Man sieht sich.«
»Bye.« Kelly sah ihr nach, wie sie in den Studentenclub ging, bevor er seinen Weg fortsetzte.
Er schob die Rückkehr in sein Wohnheim so lange wie möglich vor sich her. Es gab ein Abendessen für Erstsemester im Gemeinschaftsraum, zumindest hatte Dekanin Stevens ihnen das während ihrer Ansprache versichert, aber Kelly ging nicht hin. Er hatte nicht viel Hunger, und er fühlte sich immer noch seltsam und überwältigt.
Stattdessen schlenderte er in die Cafeteria, kaufte sich am Delikatessenstand einen Salat und wurde rot, als er die Verkäuferin bitten musste, einen neuen ohne Käse und Ei zu machen, obwohl er schon gesagt hatte, dass er allergisch dagegen sei. Er konnte sich jedoch nicht dazu überwinden, um ein neues Dressing zu bitten, daher warf er das Päckchen weg und aß ihn trocken. Während er ihn herunterwürgte, versuchte er, sich einzureden, dass es keinen Grund zur Sorge gebe, dass es in Ordnung sein würde, ganz allein in einem Wohnheim mit Sportskanonen zu wohnen.
Doch alle Versuche, sich selbst Mut zuzusprechen, blieben erfolglos.
Während der Orientierungsansprache hatte die Studiendekanin wieder und wieder von dem beeindruckenden Vermächtnis der Hope University gesprochen, von ihrem herausragenden akademischen Ruf und ihrer Berühmtheit für starke gesellschaftliche Einigkeit. »Wir sind an der Hope alle eine Familie«, sagte sie den Erstsemestern und strahlte ihre Zuhörer mit leicht schiefstehenden Zähnen an. »Sie stehen alle im Begriff, gemeinsam diese Reise zu unternehmen, und im Laufe der nächsten vier Jahre werden Sie Freundschaften für ein ganzes Leben schließen. Viele von Ihnen werden hier ihre Lebenspartner kennenlernen. Eine Menge von Ihnen werden ihre Kinder hierherschicken. Die Hope ist jetzt Ihr Zuhause. Wir, der Rest Ihrer Familie, sind schon sehr gespannt, was Sie vollbringen werden.« Ihre Worte hallten in Kellys Kopf wider, als er den Salat stehenließ und sich über die gewundenen Pfade des Campus zu seinem Wohnheim begab. Die Dekanin hatte nichts anderes gesagt als das, was auf der Website und den Werbebroschüren der Uni stand. Als er sich beworben hatte, hatten Kelly diese Worte getröstet, aber jetzt konnte er nur an das denken, was Rose über das Porterhouse gesagt hatte. Was, wenn das nur die Spitze des Eisbergs gewesen war, über den zu reden niemand sich die Mühe gemacht hatte?
Wahrscheinlich war er müde und hatte Heimweh. Vermutlich sollte er in sein Zimmer zurückkehren, sich eine der veganen Mahlzeiten aufwärmen, die seine Mutter, wie er wusste, in den Kühlschrank geschmuggelt hatte. Und dann sollte er ins Bett gehen.
Nachdem er den uralten Schlüsselcode eingetippt hatte, um durch die Wohnheimtür zu gelangen – wen genau dieser Code fernhalten sollte, war ihm ein Rätsel –, ging Kelly die Stufen in den dritten Stock hinauf und versuchte, den Geruch zu ignorieren. Er war während seiner Führung in den anderen Wohnheimen gewesen, aber nicht im Porter, und jetzt wusste er, warum: Es roch nach Schweißfüßen. Es roch nach fünfhundert Paar Füßen und einer entsprechenden Vielzahl an Genitalschützern, die in Wannen aus Schweiß mariniert worden waren. Als er eingezogen war, hatte Kellys Mutter sich wegen Schimmel gesorgt und pausenlos über seine Allergien geredet und ungefähr dreißig Mal seinen Luftfilter überprüft. Kelly hatte ihr gesagt, dass sie nicht so viel Aufhebens machen brauche, aber er machte sich doch Sorgen, jedenfalls ein klein wenig. Er sorgte sich auch wegen all der lauten, stämmigen jungen Männer, die er durch die Flure rufen hörte, und fragte sich, wie es wäre, mit ihnen zu duschen, wenn sie wussten, dass er schwul war, und er hatte den Eindruck, dass alles hier nur allzu gut zu Rose’ Warnung passte.
Wie lächerlich, zu denken, es sei ein Schutz, an einer liberalen Universität zu sein, auf der versprochen wurde, dass sie alle eine Familie waren.
Als er sein Stockwerk erreichte, war Kelly ein Nervenbündel. Er hielt den Kopf gesenkt, ging schnurstracks auf seine Tür zu, seinen Schlüssel bereits in der Hand. Er spürte die Blicke seiner Mitbewohner auf der Etage, hörte das Getuschel, aber das Blut rauschte zu laut in seinen Ohren, als dass er ihren Spott hätte hören können. Er wusste nicht, wie er damit umgehen sollte, ausgegrenzt zu werden. Die Situation war völlig neu für ihn. Wie hatte es nur so weit kommen können?
Wie sollte er so leben?
Kelly kämpfte gegen die Panik an, weil sie ihm die Luftwege zuschnürte. Nein. Kein Asthmaanfall jetzt. Er würde einfach hineingehen, die Tür abschließen und sich auf seinem Bett zusammenrollen, bis es ihm besser ging.
Nur dass seine Tür, als er sie erreichte, bereits offen war.
Nur ein klein wenig, gerade einige Zentimeter, aber sie war trotzdem offen, und drinnen brannte Licht. Es ist jemand eingebrochen, dachte Kelly. Ihm war übel, und er fühlte sich angegriffen, dann hörte er in dem Raum jemanden sprechen. Er drückte die Tür auf, den Schlüssel fest in der Hand, während ihm das Herz bis zum Hals schlug.
Ein Student, vermutlich aus einem höheren Semester, der aussah wie Flynn Rider aus Rapunzel – Neu verföhnt, legte sein Handy beiseite, drehte sich zu Kelly um und lächelte, als er ihm seine freie Hand hinhielt. »Hey. Ich bin Walter Lucas, dein Mitbewohner.«
3
Eigentlich war Walter drauf und dran gewesen, ins Moe’s zu gehen und nach Frischfleisch Ausschau zu halten, aber der Drang hatte sich gelegt, sobald er allein in seiner Wohnung war. Eine halbe Stunde lang war er wie ein gefangener Tiger umhergewandert und hatte mit dem Schicksal gehadert, seinen ganzen Kram einlagern zu müssen. Nach einer weiteren Viertelstunde hatte er in den sauren Apfel gebissen und mit dem Packen begonnen. Es war ihm sinnlos vorgekommen, den unausweichlichen Umzug hinauszuzögern. Er hatte die meisten seiner Sachen zu denen von Cara in die Garage geschafft, damit sie und Greg sie abholen konnten, wenn sie wieder herkamen. Dann war er zum Hausmeister vom Porter gegangen, um sich seinen Schlüssel geben zu lassen, und ins Wohnheimleben zurückgekehrt.
Als er nun diesen köstlichen Frischling, seinen neuen Mitbewohner, in Augenschein nahm, schien ihm das Wohnheimleben nicht mehr gar so übel zu sein.
Allmächtiger Gott, der da hatte alles. Er war an die eins achtzig groß, hatte dunkelbraunes Haar mit einem Kuss blonder Strähnen – natürlichen Strähnchen, als hätte er den Sommer in der Sonne verbracht, und er trug es in einem angedeuteten, zerzausten Irokesenschnitt. Er war von durchschnittlichem Körperbau, nicht stockdünn, aber auch nicht untersetzt. Vielleicht trainierte er, jedoch höchstens zu Hause und nur, wenn er die Zeit dazu hatte. Der Typ hatte entzückende, symmetrische Gesichtszüge, hübsche, leicht füllige Lippen und zauberhafte Augen, die in Schattierungen aus hellem Blau und Grau funkelten. Er trug einen Anflug von einem Stoppelbart, der ihm bis zu den Ohren hinauf reichte, die im Gegensatz zu Walters Segelohren höflich an den Seiten seines gut gepflegten Kopfes anlagen. Doch das Beste von allem war die Art, wie er sich kleidete. Geknöpftes Hemd mit einem marineblauen T-Shirt darunter. Beide Oberteile waren schmal geschnitten, nicht so eng, dass sie Fass mich an schrien, aber sie zeigten eine herrlich modellierte Jungmännergestalt.
Dann waren da die Jeans. Beim Anblick der Jeans wäre Walter beinahe ein Stöhnen entwichen. Die Jeans waren eng, enger als das Hemd. Die Jeans sprachen eine deutliche Sprache, wenn auch nur für jene, die die Zeichen zu deuten wussten. Die Jeans umspielten und umschmiegten und sagten: Ich bin ein schwuler Typ mit einem schönen Hintern und einem hübschen Sixpack dazu und obwohl ich wie ein netter Junge aussehe, will ich verdammt noch mal, dass du mir diese Jeans ausziehst und mich fickst. Aber frag bitte nett und höflich, denn ich habe meine Prinzipien.
Walter schätzte die Prinzipien eines Erstsemesters. Er wollte diese Prinzipien anbeten. Auf den Knien, wobei der perfekte kleine Mund des Frischlings offen war und keuchte, während Walter seine tiefe und dauerhafte Wertschätzung zeigte. Was für eine Sahneschnitte. Einfach zum Anbeißen.
Doch im Moment sah die Schnitte verängstigt und überwältigt aus und ungefähr genauso, wie Walter sich an seinem ersten Abend gefühlt hatte, als er in der Tür gestanden hatte. Nur dass Walter mit einem elenden Weiberhelden zusammengelegt worden war, der ihm das Leben vom ersten Tag an zur Hölle gemacht hatte, und Walter war längst nicht so schüchtern gewesen wie der junge Mann in der Tür, und er war auch nicht so leicht rot geworden.
»Das verstehe ich nicht.« Walters Mitbewohner zupfte sich am Ohr und sah sich nervös um. »Mir wurde gesagt, ich hätte ein Einzelzimmer.«
»Ja, nun, das ist eine lange Geschichte. Die Kurzfassung ist, du hast jetzt einen Mitbewohner, und der bin ich.« Als der andere immer noch nervös wirkte, versuchte Walter sich an einem sanfteren Lächeln. »Willst du mir deinen Namen verraten?«
Er schluckte hörbar, bevor er antwortete. »Kelly.«
»Freut mich, dich kennenzulernen, Kelly. Es tut mir leid, dass ich so hereingeplatzt bin. Ich habe nicht einmal ein Bett, wie du sehen kannst, aber glücklicherweise hast du ein Hochbett, und ich habe einen Futon. Ich werde einen Chiropraktiker aufsuchen müssen, nachdem ich das Ding allein diese verdammte Treppe hinaufgezerrt habe, aber es war immer noch besser, als einen dieser Sportfanatiker hier um Hilfe zu bitten.« Er deutete auf die Stelle, wo er an der Wand Platz geschaffen hatte. »Ich habe noch ein paar Sachen, die ich aus einem Abstellraum holen muss, jedoch nicht viele.«
Kelly sah den Futon und den jetzt sehr überfüllten Bodenraum stirnrunzelnd an. Er hatte gerade genug Platz, um die Leiter zu seinem Hochbett hinaufzuklettern, aber es würde die Hölle sein, wenn er erst versuchte, zu seinem Kleiderschrank zu kommen. »Wir haben nur einen einzigen Schreibtisch.«
»Ja. Wir würden einen zweiten bekommen, wenn wir darum bitten, aber ich weiß nicht, wo wir ihn unterbringen sollen. Ich brauche nicht wirklich einen, wenn du eine Schublade für mich erübrigen kannst.« Er seufzte und sah sich mit funkelnden Augen im Raum um. »Oh Gott, die spinnen doch, hier zwei Leute reinzustecken. Was für ein Haufen Arschlöcher. Aber das ist typisch Hope. Wenn wir rumzicken, sagen sie uns, das gehöre eben dazu, wenn wir eine große Familie seien, oder irgendeinen anderen Schwachsinn.« Er sah Kelly an und erinnerte sich daran, dass er sich in der Gesellschaft eines Erstsemesters befand. »Tut mir leid. Du schwelgst wahrscheinlich immer noch im bräutlichen Glanz der Orientierungsveranstaltung. Ich hatte nicht vor, dir so schnell deine Jungfräulichkeit zu rauben.«
Der Junge errötete abermals. Es war irgendwie süß, wenn auch ein wenig sonderbar. »Nein, ich …«
Er brach ab und wirkte verloren.
Walter begann sich zu wünschen, er wäre doch in der Wohnung geblieben. »Du brauchst nicht in der Tür zu stehen. Dies ist immer noch dein Zimmer, und ich beiße nicht. Nicht, wenn du nicht nett darum bittest.«
Er hätte wissen sollen, dass diese Bemerkung Kelly eher nervös machen würde, als ihn zum Lachen zu bringen, aber Kelly kam trotzdem herein und schaute sich unsicher um, bevor er die Klimaanlage sorgfältig unter die Lupe nahm und an einem der Knöpfe drehte.
Walter versuchte, das peinliche Schweigen zu füllen. »Das ist eine hübsche Vergünstigung, so eine Klimaanlage.«
»Ich habe Allergien.« Kelly sah Walter stirnrunzelnd an. »Tut mir leid, bist du … du bist kein Erstsemester?«
»Bin im dritten Jahr. Ich wollte außerhalb des Campus wohnen, aber es ist schiefgegangen. Ich wollte in eine andere Wohnung ziehen, aber sie nehmen keinen neuen Antrag an. Es macht sie ganz verrückt, wenn Leute außerhalb der Wohnheime leben. Alle anderen hatten bereits ihre Zimmer bekommen, und ich kam auf die letzte Minute, daher bin ich wieder hier im Porterhouse bei den Muskelprotzen gelandet.« Er setzte ein Lächeln auf und ließ sich auf seinen Futon sinken. »Aber ich hatte Glück und habe dich abgekriegt statt einen dieser Jungs, es hätte wirklich schlimmer kommen können.«
Kelly starrte einige Sekunden lang in die Mitte des Raums, dann setzte er sich an seinen Schreibtisch, und jede Bewegung war so vorsichtig, als würde er womöglich gleich wie ein Kaninchen aus dem Raum flitzen müssen. Er griff nach einem Müsliriegel und packte ihn langsam aus, wobei er Walter die ganze Zeit über im Auge behielt.
Walter wusste nicht, was er tun sollte, daher redete er weiter. »Ich habe diese Riegel vorhin schon bemerkt. Du bist Veganer?«
Kelly hielt inne. »Nein. Nun – irgendwie schon.« Er hatte jetzt rote Wangen. Dies könnte ein Stigma werden. »Ich bin allergisch gegen eine Menge Dinge, darunter Eier und Milchprodukte. Ich esse Fleisch, wenn auch nicht viel, weil meine Mutter Vegetarierin ist. Vegane Produkte sind größtenteils ungefährlich, nur dass ich auf Mandeln achten muss. Selbst Spuren davon reichen aus, dass ich einen krassen Ausschlag kriege. Wenn irgendetwas mit den gleichen Geräten zubereitet wurde wie Mandeln, stecke ich in Schwierigkeiten.«
Lieber Gott, der Junge war heiß, aber auch echt am Arsch. »Wofür ist die Klimaanlage? Gegen welche Allergien?«
»Hausstaub, Schimmel und Beifußpollen. Und Daunen, obwohl die Klimaanlage dabei natürlich nicht helfen wird. Ich bin auch gegen Katzen und Hunde allergisch, doch das sollte hier kein Problem sein.« Er riskierte einen Blick auf Walters Futon. »Ich – ähm, ich muss deine Matratze in eine Hülle stecken, aber ich bezahle sie. Wir werden das Bettzeug einmal die Woche heiß waschen müssen. Tut mir leid. Es ist super nervig.«
Walter dachte an seine wunderbare Daunendecke in der Wohnung und seufzte. »Ich bin mir sicher, das wird sich alles finden.«
Kelly brach ein Stück von dem Müsliriegel ab und rollte ihn einen Moment in den Fingern. »Entschuldige, wenn ich niedergeschlagen wirke. Es war ein seltsamer Nachmittag, und ich hatte gehofft, hierherzukommen und mich hinzuhauen. Ich habe nicht mit … dem hier gerechnet.«
»Kann ich mir vorstellen.« Walter legte neugierig den Kopf schräg. »Warum, was ist bei der Orientierungsveranstaltung passiert? Abgesehen davon, dass sich bestimmt eine übereifrige Schwulenmutti an dich rangeschmissen hat?« Als Kelly ihn überrascht ansah, hätte Walter beinahe losgelacht. »Das war nur geraten, aber wie ich sehe, lag ich wohl richtig.«
Kelly zerbröselte den Riegel auf dem Schreibtisch und beobachtete, wie er auseinanderfiel. »Meine Orientierungsführerin hat mich irgendwie vor unserer Gruppe geoutet. Ich habe mich ihr gegenüber gar nicht geoutet, sie hat einfach …« Er brach ab, dann zog er sich seinen Hemdsärmel übers Handgelenk. »Sie hat es allen erzählt, und ich weiß nicht warum, aber es hat mich wirklich geärgert.«
»Wahrscheinlich, weil sie sich wichtig gemacht hat, als ginge es nicht um dich, und sie hat dich in den Mittelpunkt gerückt, und du siehst nicht wie jemand aus, der das besonders mag.«
Er erwartete zumindest ein trauriges Lächeln, aber Kelly war immer noch damit beschäftigt, seinen Müsliriegel zu zerbröckeln. »Ich habe erst vor Kurzem angefangen, mich zu outen. In der Highschool habe ich es nie getan, weil meine Heimatstadt so klein ist. Es hat sich nicht richtig angefühlt. Ich habe mir gesagt, dass es nicht lange bis zum College dauert, dass ich warten könne.« Er verzog das Gesicht, schob seinen Ärmel wieder hoch und offenbarte ein dünnes Regenbogenband. »Ich nehme an, es sollte keine große Sache sein, aber das ist es … ich weiß nicht.«
Oh Gott. Im Allgemeinen war Walter ziemlich tolerant, was die blöde GSA betraf, aber im Moment verspürte er den Wunsch, die Truppe ein klein wenig zu verprügeln. »Es ist eine große Sache. Du hast ewig auf diesen Augenblick gewartet, und dann vermasselt ihn so eine durchgeknallte Tusse. Du hast das Recht, sauer zu sein.«
Kellys Schultern sackten nach vorn. »Ja, so ist es wohl.«
Walter rutschte über seinen Futon. »Hör mal, ich kann heute Nacht von hier verschwinden und dir Raum lassen. Das mit dem Futon tut mir leid – kann ich den Bezug in der Stadt bekommen? Ich besorge ihn mir heute Abend noch.«
»Nein – nein, es ist in Ordnung. Du brauchst nicht zu gehen. Eigentlich …« Kellys Gesicht erblühte zu einem langsamen, scheuen Lächeln. »Eigentlich ist es schön, einen Mitbewohner zu haben. Ich hatte Bammel davor, allein leben zu müssen.«
»Nun. In diesem Fall werde ich bleiben.« Walter stand grinsend auf. »Ich brauche ein Abendessen. Hast du Hunger? Wir könnten rüber zu Moe’s gehen, auf Burritos und ein paar Bier.«
»Oh – ich bin noch nicht alt genug, um zu trinken.«
Walter lachte, ergriff Kellys Hand und zog ihn ebenfalls auf die Füße. »Komm, Mitbewohner. Lass uns diese zu groß geratene Umkleidekabine verlassen, dann gebe ich dir deine richtige Erstsemestereinführung.«
Kelly hätte Nein sagen sollen und dass er nicht ausgehen wolle. Er hätte sagen sollen, dass es ihm in seinem Zimmer gut gefiele, und er hätte Walter allein gehen lassen sollen. Er tat es nicht, denn irgendwie hatte er das Gefühl, dass, wo immer Walter hinging, es interessant werden würde.
Außerdem war er angesichts des lauten Gelächters der Sportlertypen im Flur noch nicht davon überzeugt, dass es sicher war, allein im Wohnheim zu bleiben.
Zunächst besorgten sie mit Walters Wagen, den er auf einem der Parkplätze für höhere Semester nördlich des Studentenclubs hatte abstellen können, die Bettwäsche. Kelly wäre schon beeindruckt gewesen, dass Walter ein eigenes Auto hatte, aber dass er es so nah am Campus abstellen konnte, rief ihm ins Gedächtnis, dass Walter in einer gänzlich anderen Liga spielte. Nicht, dass da ein Flirt zwischen ihnen gewesen war, abgesehen von dem schätzungsweise üblichen für Walter-Standard. Trotzdem, das alles wirkte geradezu berauschend auf Kelly, denn auch wenn gar nichts weiter passierte – von einem heißen Studenten eines höheren Semesters begleitet zu werden, der ebenfalls schwul war und immerhin instinktiv mit ihm flirtete, das kam nah dran an … alles, was Kelly bisher erlebt hatte.
Er steckte sich die Hände in die Taschen, während Walter einen eleganten, stahlblauen Mazda 3 aufschloss. »Toller Wagen.«
»Ja, er ist okay. Ich mag die Heckklappe nicht.« Walter machte eine erschreckte Bewegung und schenkte Kelly ein entschuldigendes Lächeln, das trotzdem unglaublich sexy wirkte. »Tut mir leid. Ich fürchte, das war der schlimmste Reiche-Vorstadt-Kid-Spruch der Woche.«
»Stammst du aus Chicago?« Die meisten Leute in seiner Orientierungsgruppe schienen da herzukommen.
»Ja, in der Tat. Bin in Northbrook geboren und aufgewachsen.« Er legte den Gang ein und fuhr den Wagen aus der Parklücke. »Meine Eltern haben sich vor einigen Jahren scheiden lassen, und jetzt lebt mein Vater in einem Loft in der Innenstadt, wo er Sekretärinnen bumst – so achtzigerjahremäßig –, aber ›Zuhause‹ ist immer noch die Wohnung meiner Mutter in der Wade Street. Und ja, meine Familie hat Geld. Nicht über die Maßen, aber es reicht, um mich hier abzuladen und dafür zu bezahlen, dass das exotische Pferd meiner Schwester ein besseres Zimmer hat als ich, und es reicht auch noch, um die Midlife Crisis meines Vaters zu finanzieren. Meine Mutter hat jetzt tatsächlich einen Job, aber es ist ein Teilzeitjob, so eine Verkaufstätigkeit von zu Hause aus, ansonsten wird sie alimentiert. Es ist einfach eine x-beliebige glückliche, verkorkste Familie aus dem Norden Chicagos.« Er schaute über den Sitz zu Kelly hinüber. »Was ist mit dir? Ich weiß schon, dass du nicht aus Chicago kommst.«
Das wusste er? »Wieso?«
Dieses kleine halbe Lächeln machte unglaublich gefährliche Dinge mit Kellys Innerem. »Du bist nicht zynisch genug. Dir fehlt diese wahnhafte Anspruchshaltung, dass man für alles Geld in den Arsch geschoben kriegen muss, was wohl die Richtung ist, in die wir uns entwickeln. Du, mein lieber Mitbewohner, hast Apfelwangen und einen ziemlich frischen Teint. Also, raus mit der Sprache. Woher kommst du?«
Jetzt war es Kelly beinahe peinlich, es zu sagen. »Aus Windom, Minnesota. Eine Kleinstadt im Südwesten. Kein Vorort von irgendetwas.«
Er war sich nicht sicher, was er von Walters Lächeln halten sollte, es war irgendwie spöttisch, aber dann doch wieder nicht. »Ist das eine Art Andy-Griffith-Ort? Dein Vater geht am Wochenende mit dir angeln, ihr spielt im Park Ball, und nach der Kirche nimmt deine Familie an Picknicks hinterm Haus teil?«
Die Picknicks fanden im Untergeschoss statt, aber ja, der Rest war ins Schwarze getroffen, obwohl Kelly es nicht zugeben mochte. »Es ist eine schöne Stadt.«
»Aber nicht schön genug, dass du dich ohne Probleme hättest outen können?«
Kelly presste die Hände auf seine Hosenbeine. »Ich mache nicht gerne auf große Welle und ziehe auch nicht gerne die Aufmerksamkeit auf mich.« In Erinnerung an all die Theaterstücke und Führungsseminare, die er gemacht hatte, fühlte sich das wie eine Lüge an. Er krallte die Finger in seine Jeans. »Es ist nicht falsch, dass ich mich auf meine eigene Weise outen wollte.«
»Nein, das ist es nicht.« Walter fuhr inzwischen durch das Viertel, das die Hope umgab, um auf die Hauptstraße zu gelangen. »Es ist echt ätzend, dass so viel Wind darum gemacht wird, mit wem du Sex haben willst. Dass etwas so Profanes deine Highschoolzeit ruinieren kann. Ich weiß nicht, wie du damit leben konntest.«
»Du hast dich schon in der Highschool geoutet?«
»Zum Teufel, ja. Ich habe mich in der siebten Klasse geoutet, hatte in der achten meinen ersten festen Freund. Na ja, was heißt Freund, im Wesentlichen haben wir einander im Umkleideraum einen geblasen, wenn wir die Gelegenheit hatten. Wir haben gern gesagt, dass wir ein Paar seien. Fühlte sich cool an. Aber darüber bin ich noch in der Highschool hinausgewachsen.« Er lachte. »Scheiße, man kann sagen, Todd war mein letzter fester Partner. Das ist zum Schreien komisch. Ich sollte ihn auf Facebook suchen und vollquatschen.«
In Walters beiläufiger Antwort gab es so viel zu verarbeiten, dass Kelly der Kopf schwirrte. Geoutet in der siebten Klasse? Freund in der achten?
Sie hatten einander im Umkleideraum einen geblasen?
Kein Freund seither? Kein Freund? Er sah Walter an, nein, auf keinen Fall war Walter seit der achten Klasse mit niemandem mehr zusammen gewesen. Auf. Keinen. Fall.
Walter erwischte ihn beim Starren und zog eine Augenbraue hoch. »Was ist?«
»Du hast seit der achten Klasse keinen Freund mehr gehabt.«
»Keinen Einzigen, und ich bin stolz darauf.«
»Aber das ist unmöglich! Du …« Kelly unterbrach sich, außerstande zu sagen: Du musst Sex gehabt haben.
Walter schien es trotzdem zu hören. Er grinste dieses hinterhältige Grinsen, und wie gewöhnlich verkrampfte sich dabei Kellys Magen. »Ich bin mit Typen zusammen gewesen, ja. Mit vielen. Aber wir sind nicht zusammen. Das ist schrecklich süß, Red, dass du denkst, man müsste für Sex unbedingt zusammen sein.«
Kelly quittierte den Spitznamen mit einem Stirnrunzeln und spürte, wie sein Gesicht heiß und noch ein wenig röter wurde. »Aber warum willst du nicht mit jemandem gehen? Warum bist du stolz darauf, es nicht zu tun?«
»Was zum Teufel mache ich in einer Beziehung, was ich zu jeder anderen Zeit nicht mache? Reden? Teufel auch, du und ich, wir reden jetzt. Essen gehen? Das steht auch auf dem Plan. Das bedeutet nicht, dass wir zusammen schlafen, nicht zwangsläufig. Manchmal habe ich Sex mit Menschen, mit denen ich rumhänge, manchmal geschieht es einfach. Das ist wie ein Spiel. Es macht Spaß. Warum sollte ich es mit irgendeinem heterosexuellen Paarungstanz vermasseln?«
Kelly wusste nicht, was er darauf sagen sollte, nur dass er es gern mit einem heterosexuellen Paarungstanz vermasselt hätte. Er wollte einen gottverdammten schwulen Liebesfilm, und nein, das war kein Widerspruch in sich. Er dachte nicht, dass eine Beziehung den Sex verkorksen würde. Er glaubte, dass sie ihn besser machen würde.
Er glaubte außerdem, dass er, wenn er das aussprach, ausgelacht und verspottet werden würde, weil es eine typische Kleinstadtnummer war, daher schwieg er.
Walter sah ihn nach einem Weilchen an. »Und, was machen deine Eltern? Sind sie noch zusammen?«
»Ja. Mein Vater ist Finanzdirektor bei der Windom Saving Bank, und meine Mutter ist Sachverständige für eine Versicherung. Meine Schwester Lisa geht in die neunte Klasse.«
»Eine Bank, eine einheimische. Kommt er klar? Diese ganze Finanzkrise hat die Bank nicht kaputtgemacht?«
»Sie halten durch. Es hat schon früher harte Zeiten gegeben, als sie eine Menge Farmer als Kunden hatten.« Er hatte das Gefühl, dass das Geldthema in der Luft hing, daher beschloss er, es anzuschneiden. »Wir sind nicht reich. Wir haben Geld, aber das liegt größtenteils daran, dass meine Familie sehr vorsichtig ist. Meine Eltern haben seit einer Ewigkeit für meine Hochschulausbildung gespart, aber die Hope war teurer als geplant. Ich hoffe nur, dass ich meiner Schwester helfen kann, wenn sie an der Reihe ist.«
»Klingt so, als hättet ihr eine perfekte, glückliche Familie.« Walter zuckte mit den Schultern. »Ja, tut mir leid, Arschlochalarm. Ich bin eifersüchtig, das ist alles. Bei mir zu Hause haben wir alle eine gewisse Zeit in der Therapie verbracht. Das Auto und die Spielzeuge und die teure Uni sind alles Versuche meines Vaters, mich zurückzukaufen. Ich würde das alles eintauschen, um in einem Wohnwagenpark zu leben und eine Familie zu haben, die sich an den Abendessenstisch setzt, ohne eine Episode von Jersey Shore anzuschalten.« Er hielt inne, dann fügte er hinzu: »Na ja. Ein Wohnwagenpark müsste es nicht unbedingt sein.«
Das brachte Kelly zum Lachen. »Wir streiten uns auch. Aber ja, ich nehme an, wir sind irgendwie übelkeiterregend glücklich. Ein Teil davon rührt daher, dass sowohl Lisa als auch ich gesundheitliche Probleme haben. Meine Allergien waren früher viel schlimmer, und das Gleiche gilt für mein Asthma. Lisa hat Diabetes Typ I.«