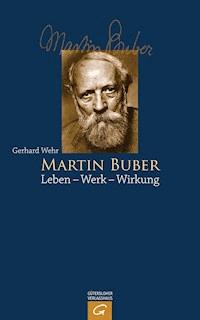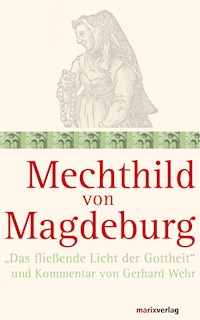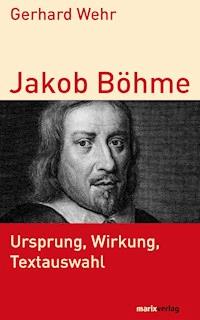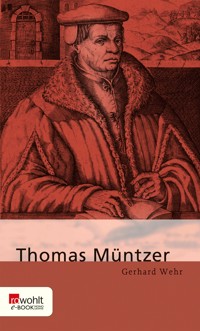Inhaltsverzeichnis
Widmung
Lob
Mit ausgestrecktem Zeigefinger
ANFANG UND ABSCHIED
»Es ist spät, Mirjam …«
»Ich bin ein polnischer Jude«
Erste Begegnung und »Vergegnung«
Geburt einer Utopie: »Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen«
Copyright
Gütersloher Verlagshasus. Dem Leben vertrauen
Für Else, Gabriele und Matthias
Martin Buber ist, ohne es zu wollen, der von dem geistigen Deutschland anerkannte deutsche Jude geworden.
Franz Rosenzweig
Ich erkannte die Idee des vollkommenen Menschen. Zugleich wurde ich des Berufs inne, sie der Welt zu verkünden.
Martin Buber
Mit ausgestrecktem Zeigefinger
Martin Buber, ihn kennt die Welt. Sie nennt ihn zumindest und beruft sich auf ihn, wie man sich auf einen ethischen Garanten beruft, der vieler Titulaturen bedarf, um wenigstens einige Seiten seines Wesens sichtbar zu machen. Und so zählt der Philosoph des Ich-Du, der Verdeutscher der Schrift, der Deuter der chassidischen Botschaft als eine »Gründergestalt« seines Jahrhunderts, als ein Schriftsteller, dessen Werke einige in die Nähe heiliger Schriften rücken, als »jüdischer Protestant«, als »religiöser Existenzialist« und »hebräischer Humanist«, als »Verkündiger des Gottes, dem die Welt gehört« (L. Ragaz) … Der Katalog will kaum ein Ende nehmen. Wer ist er nun wirklich?
Manchen Zeitgenossen erschien er als eine »lebendige Legende«. Der Mann des Dialogs und der Begegnung hat es denen nicht gerade leicht gemacht, die sich fragend an ihn gewandt haben und denen er etwa so geantwortet hat:
Ich habe keinerlei Neigung, mich mit meiner Person als »Gegenstand« zu befassen, und ich fühle mich auch keineswegs dazu verpflichtet. Ich möchte die Welt beeinflussen, aber ich möchte nicht, dass sie sich von »mir« beeinflusst fühlt. Ich bin, wenn ich das sagen darf, beauftragt, den Menschen Wirklichkeiten zu zeigen, und ich suche das so getreu wie möglich zu tun. Darüber nachzudenken, warum ich beauftragt bin oder warum ich im Laufe meines Lebens geeigneter dazu geworden bin zu zeigen, was ich zu zeigen habe, hat für mich nicht nur keinen Reiz, sondern auch keinen Sinn. Es gibt Menschen, die den Wunsch haben, sich der Welt zu erklären; Kierkegaard hatte ihn, ich nicht - ich möchte mich nicht einmal mir selber erklären.2
Diese Zeilen der Selbstcharakteristik schreibt der vierundsiebzigjährige Martin Buber an einen jungen Amerikaner nach Los Angeles, der im Begriffe ist, im Zusammenhang seiner Universitätsstudien über Bubers Werk auch biographische Angaben zu verwerten. Es ist nicht etwa pure Interesselosigkeit dem jugendlichen Fragesteller gegenüber, die sich hier manifestiert. Im ausführlichen Antwortbrief zeigt Buber vielmehr, wie ernst er den ein halbes Jahrhundert jüngeren Briefpartner nimmt. So sind es eher grundsätzliche Erwägungen, die ihn hindern, der Bitte um Auskünfte über biographische Tatbestände und familiäre Beziehungen zu entsprechen. Denn, so fährt Buber im Brief fort:
»Um zu sehen, was ein Schreibender - der doch ›ein Sprechender‹ ist - zu zeigen hat, braucht man nichts über seine persönlichen Eigenschaften oder sein persönliches Leben zu erfahren, man braucht nicht mehr zu wissen, als was seine Äußerungen, seine Werke selbst zu sagen haben.« Es sei nicht wahr, dass man für die Entgegennahme des Werkes eines Shakespeare, eines Homer oder Platon besser gerüstet ist, wenn man mehr wüsste.
Und doch ist »wirkliches Leben« Begegnung, wie Buber in »Ich und Du« betont.3 In der echten Begegnung geht es ausschließlich um »Ich und Du«, und diese Paareinheit ist mehr als die bloße Summe eines Ich und irgendeines Du. Da treten zwei Personen einander gegenüber, in ihrer Einmaligkeit und in ihrer wechselseitig empfundenen Andersartigkeit. Wirkliches Leben ist Begegnung, als personale Beziehung verstanden. Im Anreden und Angeredetwerden und Antworten, im Austausch von Blick und Händedruck, freilich auch in der Erfahrung des Widerstandes, des Widerparts, den der eine dem anderen durch seine individuell geprägte Andersartigkeit bietet, nimmt die Begegnung jeweils leibhafte Gestalt an. Und an ihr ist Buber gelegen. Auf diese Wirklichkeit hat er, wie er immer wieder betont, zu »zeigen«: »Ich habe keine Lehre, ich zeige nur etwas …« Ein Mensch mit ausgestrecktem Zeigefinger also, dem jenes zu Zeigende, das - in echt Grünewaldscher Manier - zu Bezeugende wichtiger sein muss als er selbst. Ja, »der Mann mit dem ausgestreckten Zeigefinger hat nur eins zu zeigen und nicht vielerlei«, so bekräftigt Buber. Was heißt das für die Beschreibung eines Menschenlebens?
Sich nach dem Woher und Wohin eines Menschen erkundigen, das kann nach Bubers Dafürhalten paradoxerweise heißen: den Menschen, diesen Menschen, als Person aus dem Auge verlieren und ihn zum Gegenstand biographischer Recherchen machen. Aus dem Du wird auf diese Weise unversehens ein Es, eben das Objekt, »über« das man Erkundigungen einholt und von dem man Lebensdaten ermittelt. Dabei weiß Buber sehr genau, dass menschliches Leben, auch das in aufmerksamer Mitmenschlichkeit geführte, sich keinesfalls nur in der Sphäre der personhaften Ich-Du-Beziehung abspielen kann. Immer wieder müssen wir das partnerschaftliche Du und die Aug’ in Aug’ gelebte Ich-Du-Beziehung aufgeben und uns in nüchterner Sachlichkeit einem Es zuwenden. Das geschieht beispielsweise, indem wir als biographisch Interessierte die jeweilige Person unseres Interesses - und »interesse« heißt doch: teilhabend »zwischen sein«! - zu einem Objekt machen, dessen Bild wir zu zeichnen, zu plastizieren bemüht sind. Dabei erhascht die Sehnsucht Pygmalions dann und wann jeden Biographen. Es ist die Sehnsucht dessen, der wünscht, dass das Bildwerk unter seinen formenden Händen sich unversehens in Fleisch und Blut verwandle, und sei es für Augenblicke … Als Denker des Gesprächs und der Begegnung wollte Buber, dass man in dem erwähnten Sinne von ihm, dem Zeigenden, absieht. Das bekam nicht nur jener amerikanische Student zu spüren, sondern auch mancher andere. Daher konnte es mitunter geschehen, dass der dann und wann um persönliche Auskünfte Gefragte auf seine Freunde verwies, die angeblich besser als er selbst in der Lage seien, die gewünschten Lebenszusammenhänge zu schildern und die fraglichen Daten zu besorgen; auch eine Geste eines »Zeigenden«.
Die Linien des Lebens von Martin Buber nachzeichnen wollen, das geht demnach ohne ein gewisses Maß an subtiler Respektlosigkeit nicht ab. Der Autor wird zum Tabuverletzer. Die Tabuverletzung wird aber immerhin dadurch gemildert, dass sich unser Blick nicht allein auf die Lebensumstände des Beschriebenen richtet, sondern stets und unablösbar auch auf jene Wirklichkeit, auf die zu zeigen Buber beauftragt war und die seinem Werk Substanz verleiht. Er hat damit ein für alle Mal seinen Biographen selbst den Rahmen für ihr Tun abgesteckt. Sie sind daher gehalten, so zu arbeiten, dass die zu bezeugende Wirklichkeit wichtiger bleibt als derjenige, der sie in der Spanne seines Lebens - mit ausgestrecktem Zeigefinger - bezeugt hat.
Die Perspektive, aus der heraus im Folgenden ein Buber-Bild versucht wird, ist eine zweifache: Zunächst ist da ein »offenbar-geheimes« Leitmotiv im Schaffen Bubers, die Idee des »vollkommenen Menschen«4. Sie gilt es zu verwirklichen. Sie gilt es der individuellen menschlich-allzu menschlichen Unvollkommenheit abzuringen, ohne dass der Schatten geleugnet wird, der zum Ganzwerden einer Person gehört. Und als Jude setzt Buber alles daran, der Idee des vollkommenen Menschen in seinem Volk und Land, für alle, vor aller Welt sichtbar, Gestalt zu verleihen: als Denker, als deutscher Schriftsteller, als Deuter der Tradition, in der er wurzelt. - Diese Zielsetzung muss sich andererseits die kritische Rückfrage gefallen lassen: Inwiefern hat Martin Buber als deutscher Jude in seinem persönlichen Leben und im Leben seines Volks dieses Ziel erreicht? Wie nahe ist er ihm gekommen, wie fern ist er ihm geblieben? Oder ist der Bubersche Anspruch nicht schon vom Ansatz her zum Scheitern verurteilt?
Geht es doch bei unserem Thema auch und gerade um »Größe und Tragik deutsch-jüdischer Existenz«, wie Eva G. Reichmann (Heidelberg 1972) ihre Zeugnisse einer schicksalhaften Begegnung betitelt hat. Schließlich ist Martin Buber das Glied jener Gemeinschaft, die länger als ein Jahrtausend im Raum deutscher Sprache und Kultur gelebt, gestaltet und gelitten hat. Schließlich ist er einer von denen, die ihr Deutschsein nicht minder selbstverständlich nahmen als ihr Judesein und der sich gerade darum überaus schmerzvollen Missverständnissen bei seinen jüdischen Glaubensgenossen und bei seinen israelischen Mitbürgern aussetzte, während er bei den (vielleicht auf andere Weise missverstehenden) Deutschen, bei seinen Deutschen, einen Grad höchster Berühmtheit erklomm.
Im Übrigen könnte es ja sein, dass der in aller Welt Gerühmte, der Hochgeehrte, mit vielbegehrten Kulturpreisen Ausgezeichnete von seinen Zeitgenossen, nicht nur von den Bürgern des Staates Israel, als Alibi gebraucht wird: Man zeigt seinen Martin Buber, seinen Albert Schweitzer, seinen Dietrich Bonhoeffer oder Martin Luther King - und wer es sonst sein mag - stolz vor, als sei damit schon der Geist der Menschenliebe und der Brüderlichkeit in der Welt eingezogen.
ANFANG UND ABSCHIED
»Es ist spät, Mirjam …«
Da ist Wien, »die unerschöpflich zauberhafte Stadt mit dieser rätselhaften, weichen, lichtdurchzogenen Luft. Und unterm traumhaft hellen Frühlingshimmel diese schwarzgrauen Barockpaläste mit eisernen Gittertoren und geschnörkelten Moucharabys, mit Wappenlöwen und Windhunden, großen, grauen, steinernen. Diese alten Höfe, angefüllt mit Plätschern von kühlen Brunnen, mit Sonnenflecken, Efeu und Amoretten. Und in der Vorstadt diese kleinen, gelben Häuser aus der Kaiser-Franz-Zeit, mit staubigen Vorgarterln, diese melancholischen, spießbürgerlichen, unheimlichen kleinen Häuser. Und in der Abenddämmerung diese faszinierenden Winkel und Sackgassen, in denen die vorübergehenden Menschen plötzlich ihr Körperliches, ihr Gemeines verlieren … Und dann, später am Abend die Dämmerung der Wienufer: über der schwarzen Leere des Flussbettes das schwarze Gewirre der Büsche und Bäume, von zahllosen kleinen Laternen durchsetzt, auf einen wesenlosen transparenten Fond graugelben Dunstes aufgespannt und darüber, beherrschend, die drei dunklen harmonischen Kuppeln der Karlskirche!«5
Hugo von Hofmannsthal, vier Jahre und eine Woche älter als Martin Buber, wie er gebürtiger Wiener, hat so die Kaiserstadt der alten österreichisch-ungarischen Donaumonarchie beschrieben. Die Düsternis kleinbürgerlicher Mietskasernen und die Erbärmlichkeit der Hinterhofbewohner dürfen wir uns hinzudenken. Es ist dasselbe Wien, das Franz Grillparzer das »Capua der Geister« genannt hat, um die in Schönheitsrausch und Reichtum, in Üppigkeit und Saturiertheit liegende Gefährdung anzudeuten. - Und eben hier wird Martin Buber am 8. Februar 1878 geboren. Aber ist er ein Wiener?
Eine »Welt von Gestern« gilt es zu beschwören, will man einen Blick in dieses Wien vor dem Ersten Weltkrieg und während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts tun, von dem Friedrich Heer einst gemeint hat, dass es bis 1945 fortgedauert habe … In seinem gleichnamigen Gedenkbuch hat Stefan Zweig jene gestrige Welt gezeichnet: Die Stadt an der Donau als die Hauptstadt Alt-Europas, Wien als Zusammenfluss europäischer Kultur, die Stadt des Walzers, die Atmosphäre geistiger Konzilianz, die Metropole als Erzieherin eines genüsslichen Weltbürgertums, wie es die Zeitgenossen von damals verstanden und verstehen wollten, die Vertreter der jungen romantisierenden »Wiener Schule«, der jugendliche, von Gaben und Begabungen überhäufte Hugo von Hofmannsthal und später der unglückliche Joseph Roth als Dichter des »Radetzkymarsches«, der »Reigen«-Autor Arthur Schnitzler und die applausumwogten Schauspieler/innen des Burgtheaters, nicht zu vergessen die Kaffeehaus-Literaten, etwa die vom »Griensteidl« oder vom »Central«, vom »Herrenhof« oder vom »Silbernen Kaffeehaus«. Es ist die Zeit, in der man die Literatur als solche trifft - Karl Kraus sagt: »demoliert« -, wenn man ein Haus wie das Café Griensteidl schließt. Im Jahre 1897 ist das geschehen: »demolierte Literatur«!
»Diese Wiener Kultur war die Erbin reifer Weisheit und großer Anmut«, resümiert Hans Kohn6, als er Bubers fünfzigsten Geburtstags (1928) gedenkt und ihm eine erste, fünf Jahrzehnte umschließende Monographie widmet. Doch als Richard Beer-Hofmann im Jahr 1898 sein »Schlaflied für Mirjam« anstimmt, ist der Wiener Dichter bereits dunkler Ahnungen voll:
Schlaf, mein Kind - schlaf, es ist spät! Sieh, wie die Sonne zur Ruhe dort geht, Hinter den Bergen stirbt sie im Rot. Du - du weißt nichts von Sonne und Tod, Wendest die Augen zum Licht und zum Schein - Schlaf, es sind so viel Sonnen noch dein, Schlaf, mein Kind - mein Kind, schlaf ein!
Schläfst du, Mirjam? - Mirjam, mein Kind, Ufer sind wir, und tief in uns rinnt Blut von Gewesenen - zu Kommenden rollts, Blut unsrer Väter, voll Unruh und Stolz. In uns sind alle. Wer fühlt sich allein? Du bist ihr Leben - ihr Leben ist dein - Mirjam, mein Leben, mein Kind - schlaf ein!
Und gerade dieses Wien, Stätte eines reichen, überreifen Kulturerbes, zieht viele Juden an, nicht wenige schicksalsmäßig durch Geburt. Einer von ihnen ist Martin Buber.
Ein Assimilationszentrum in der Mitte des Vielvölkerstaates bildet sich. Die rechtliche Gleichstellung von Staatsbürgern jüdischen Glaubens in den west- und mitteleuropäischen Staaten des 19. Jahrhunderts hatte die gesetzlichen Vorbedingungen für diesen Prozess einer weitgehenden gesellschaftlichen Integration geschaffen. Hatte Kaiser Franz Joseph I. in der Verfassung von 1849 die Gleichberechtigung aller Religionen, die »mosaische« eingeschlossen, garantiert, so lieferte das Staatsgrundgesetz von 1867 allen Bewohnern der Doppelmonarchie eine zusätzliche Bestätigung ihrer gesellschaftlichen Gleichwertigkeit. Eine neue Spielart eines jüdisch-deutschen, eines jüdisch-christlichen Symbioseversuchs7 nimmt Gestalt an, und zwar bis hinunter zu den Unterschichten der »geringen Leute«, aus denen sich das unermessliche Heer der Dienstboten und der Diener aller Art rekrutiert, Inkarnationen hoffnungsloser Servilität: »Küss’ die Hand, gnä’ Frau! … Habe die Ehre, Herr Hofrat …!«
Wien ist aber auch ein Beispiel dafür, dass in einer solchen Atmosphäre die Impulse für eine Selbstbesinnung und zur Bewusstseinsbildung empfangen werden können. Sei es, dass ein teils offener, teils versteckter Antisemitismus, der in der innerlich mürbe gewordenen Habsburger Monarchie einen verhängnisvoll guten Nährboden fand und den auch die weitgehende Assimilation nicht zu verhindern vermochte, jene Angst erzeugt, die - um der berüchtigten »Endlösung« zu entgehen - nach echter Lösung verlangt; sei es, dass die gesellschaftlichen und individuellen Verdrängungskapazitäten erschöpft sind und nach Bewusstmachung rufen: »Was Es ist, will Ich werden.« Aber wo und wem gelingt das?
Kein Wunder also, dass dieses Wien zum Kristallisationspunkt zweier Bewegungen werden sollte, die, initiiert und großenteils auch repräsentiert durch Juden, das Gewissen der Welt aufgerüttelt haben, jede auf die ihr gemäße Weise: der Zionismus und die Psychoanalyse. Im Geburtsjahr Martin Bubers beginnt der achtzehnjährige, aus Budapest gebürtige Theodor Herzl sein Jurastudium an der Wiener Universität. Als der nachmalige Feuilletonredakteur an der Wiener »Neuen Freien Presse« im Jahre 1896 seine utopisch anmutende Schrift »Der Judenstaat« publiziert, kann noch niemand ahnen, dass die ersten Träger der bald entstehenden, gleichwohl immer vorhandenen zionistischen Bewegung - unter ihnen der junge Martin Buber - die Wiederbegründung eines eigenständigen israelischen Staates auf palästinischem Boden tatsächlich erleben werden. Und ob sie das werden, schreibt doch Herzl in der Einleitung, was er am Schluss seiner Schrift mit prophetischem Pathos bekräftigt: »Der Judenstaat ist ein Weltbedürfnis, folglich wird er entstehen … Die Juden, die wollen, werden ihren Staat haben und sie werden ihn verdienen!« - Nicht alle Utopien erhalten einen Topos, den Ort ihrer Verwirklichung, im Verlauf eines einzigen Menschenlebens.
Zur gleichen Zeit werden inmitten dieser »Welt von Gestern«, die sich in der heiter-trostlosen Maskerade des Fin de Siècle gefällt, die Grundlagen einer Lehre gelegt, die die Demaskierung, die radikale seelische Entlarvung des Individuums und der Gesellschaft bedeuten. Psychisch Unbewusstes wird ins Bewusstsein gehoben. Und hatte Albert Schweitzer zu Beginn des Jahrhunderts, ehe er in den afrikanischen Urwald zog, in der historisch-kritischen Leben-Jesu-Forschung »eine einzigartige große Wahrhaftigkeitstat, eines der bedeutendsten Ereignisse in dem gesamten Geistesleben der Menschheit« erblickt, so ist man geneigt zu sagen: Auch auf dem Feld der menschlichen Psyche und ihrer wissenschaftlichen Erforschung ist diese Tat der Wahrhaftigkeit fällig gewesen und geleistet worden. Sigmund Freud ist es, der die psychoanalytische Bewegung ins Leben ruft, freilich nicht er allein, obwohl er als deren Inaugurator in »Sissis Narrenhaus« Wien zu gelten hat. Am Anfang der Psychoanalyse steht vor allem der andere jüdische Arzt: Joseph Breuer. Der zweiundzwanzigjährige Sigmund Freud begegnet ihm in Wien. Man schreibt das Jahr 1878.
Der in diesem Jahr Geborene lernt beide Bewegungen - die politische und die psychotherapeutische - gleichsam am Quellort ihrer Entstehung kennen. Der einen schließt er sich jugendbewegt an, um ihr alsbald Inhalt und geistige Ausrichtung zu geben, wenngleich nicht immer im Sinn ihres Begründers: Buber wird Zionist und Theodor Herzls früher Gefolgsmann. Der anderen Bewegung misstraut er lebenslang. Sigmund Freud ist für ihn einer, der mit Tempelsteinen spielt. Ist größerer Frevel durch einen Juden für einen Juden denkbar?
»Ich bin ein polnischer Jude«
Martin Buber ein Wiener? - Als er für die deutsche Ausgabe seiner romanhaften Chronik »Gog und Magog« ein erläuterndes Nachwort schreibt, bekennt der mit autobiographischen Daten eher knausernde Buber einmal Farbe, wenn er dort sagt: »Ich bin ein polnischer Jude« 8 - zweifellos ein erstaunliches Eingeständnis, hält man andere Selbstzeugnisse daneben, etwa das vom »deutschen Schriftsteller«. Und indem er die Position seiner geistigen Herkunft andeutet, fährt er fort: »… zwar aus einer Familie von Aufklärern, aber in der empfänglichen Zeit des Knabenalters hat eine chassidische Atmosphäre ihren Einfluss auf mich ausgeübt.« Was heißt das konkret?
Nur die allererste Zeit, etwa drei Jahre lang, verbringt das Kind bei seiner Mutter in Wien. Von Familie und Elternhaus hören wir recht wenig, denn früh trennt sich der Vater Carl Buber von seiner Frau Elise, geborene Wurgast. Es heißt, die junge Frau, eine ausgesprochene Schönheit, sei mit ihrem Liebhaber durchgebrannt. Die Ehe wird alsbald geschieden.9 Nicht die aus Odessa stammende Mutter sorgt fortan für den Sohn, sondern die Großeltern Salomon Buber und Adele, eine gebürtige Wizer. Sie nehmen den Enkel in ihr Haus nach Lemberg (Lwow). Als wohlhabender Kaufmann und als frommer Jude hat sich der Großvater einen Namen gemacht. Als Großgrundbesitzer, Getreidehändler und Eigentümer von Phosphatgruben zu beachtlichem Reichtum gelangt, ist er Direktor der österreichisch-ungarischen und der galizischen Bank in Lemberg. Er fungiert als ebenso einflussreicher wie angesehener Handelskammerrat. Von 1870 bis zu seinem Tod im Jahre 1906 steht er der großen jüdischen Gemeinde der Stadt vor. Berühmtheit hat Salomon Buber - wiewohl Autodidakt - als Wissenschaftler erlangt, als Talmudgelehrter und als Herausgeber alter Midraschtexte, die nachbiblisches Weisheitsgut enthalten. Die von ihm besorgten Ausgaben gehören zu den wertvollsten neueren Werken dieses Zweigs der jüdischen Textforschung. Als ein Mann von großer geistiger und wirtschaftlicher Unabhängigkeit kann er auf Verlegerhonorare verzichten. Das wird eigens vermerkt. Er finanziert die Drucklegung seiner kostspieligen wissenschaftlichen Werke selbst. »Mit der Gründlichkeit und Genauigkeit eines westeuropäischen Fachgelehrten« - so schreibt Hans Kohn10 - »und mit jenem einzigartigen, weil das ganze Wesen erfassenden und bestimmenden Wissen des ostjüdischen Talmudkenners edierte er einen Midraschtext nach dem anderen, und die Fülle der von ihm geleisteten wissenschaftlichen Arbeit ist nicht nur für einen in so vielen Zweigen der täglichen Arbeit Beschäftigten, sondern wäre auch für einen nur der Forschung Lebenden erstaunlich.« Wie werden sich die Nachkommen dazu stellen?
Kein Wunder immerhin, wenn der Enkel später als Student an deutschen Universitäten der Großmutter zu berichten hat: »Ich bin noch keinem vorgestellt worden, der mich nicht nach meinem Verwandtschaftsverhältnis zu Salomon Buber gefragt hätte … Überall höre ich Großvaters Namen.«11 Damit ist Salomon Bubers Orientiertheit an westlicher Geistes- und Lebensart angedeutet. Der Enkel hat umso mehr Grund, sich seines Großvaters dankbar zu erinnern. Dieser Dankespflicht entspricht er auch. Denn als Martin Buber im Todesjahr von Salomon Buber das erste seiner chassidischen Bücher, durch die er selbst berühmt werden sollte, herausgibt, da versieht er den Band mit der Widmung:
»Dem Gedächtnis meines Großvaters Salomon Buber, des letzten Meisters der alten Haskala, bringe ich in Treuen dieses Werk der Chassiduth dar.«
Das Bekenntnis zum polnischen Ostjudentum aus den fünfziger Jahren - »Ich bin ein polnischer Jude« - hat demzufolge bereits eine ein halbes Jahrhundert ältere Parallele: Hier wie dort sind die beiden Faktoren genannt, die Bubers bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgbare Herkunft bestimmen.12 Es ist die Haskala, d. h. eine der Moderne zugewandte jüdische Aufklärung, und auf der anderen Seite die tief eingewurzelte volkstümliche Mystik der ostjüdischen Chassidim, eine unter besonderen historischen Umständen aufgeblühte Erneuerungsbewegung jüdischer Frömmigkeit im 18. und 19. Jahrhundert. Während der Enkel später beide Elemente in seinem Erleben und literarischen Schaffen zu vereinigen vermag, ist der Großvater in besonderer Weise jener Haskala verpflichtet. Der jüdischen Orthodoxie mit ihrer sprichwörtlichen Gesetzestreue, die sich bis in die strenge Beachtung der Gebetsriten und der alltäglichen Reinigungs- und Speisevorschriften erstreckt, entsagen jedoch beide. So ist die Buber-Familie, die ältere und die jüngere, den Rechtgläubigen suspekt. Martin wird das zeit seines Lebens zu spüren bekommen, insbesondere in Israel.
Wer ist nun Carl Buber, Martins Vater, der ebenfalls in Galizien ein Landgut bewirtschaftet? Martin Bubers Vater winkt bescheiden ab, als komme ihm im Blick auf Vater und Sohn keine besondere Bedeutung zu. So pflegt er gelegentlich zu sagen: »Ich bin nur der Sohn eines berühmten Vaters und der Vater eines berühmten Sohnes.« In seinen autobiographischen Fragmenten berichtet dieser Sohn, wie Carl Buber die starken geistigen Interessen seiner Jugend aufgegeben habe, um sich schließlich den konkreten Dingen des Lebens, der Landwirtschaft, zuzuwenden und darin kaum minder erfolgreich zu sein als Vater Salomon:
Sechsunddreißig Jahre lang arbeitete er mit allerhand Düngemitteln, deren spezifische Wirkungen er genau erprobte, daran, die Produktivität seiner Böden zu steigern. Er hatte die Technik seiner Zeit auf seinem Gebiete gemeistert. Aber um was es ihm eigentlich ging, merkte ich, wenn ich mit ihm inmitten des großen Rudels herrlicher Pferde stand und zusah, wie er ein Tier nach dem andern nicht etwa bloß freundlich, sondern geradezu persönlich begrüßte, oder wenn ich mit ihm durch die reifenden Felder fuhr und ihm zusah, wie er den Wagen halten ließ, ausstieg und sich über die Ähren beugte, wieder und wieder, um schließlich eine zu brechen und die Körner sorgsam zu kosten. Es ging diesem ganz unsentimentalen und ganz unromantischen Menschen um den echten menschlichen Kontakt mit der Natur, einen aktiven und verantwortlichen Kontakt. Ihn zuweilen so auf seinen Wegen begleitend, lernte der Heranwachsende etwas kennen, was er von keinem der vielen von ihm gelesenen Autoren erfahren hatte.
Der Einfluss des Vaters, von dem der Sohn sagt, er sei »gleichsam nicht vom Geiste her« gekommen, erstreckte sich auf den geistigen Werdegang Martins ebenso wie auf die soziale, die zwischenmenschliche Sphäre. Und nicht von ungefähr heißt es in den Fragmenten Martin Bubers vom Vater Carl:
Wie er am Leben all der Menschen teilnahm, die von ihm in der einen oder andern Weise abhingen, der Hofknechte in ihren nach seinen Angaben gebauten Häuschen, die die Hofgebäude umgaben, der Kleinbauern, die unter von ihm in genauer Gerechtigkeit ausgearbeiteten Bedingungen ihm Dienste leisteten, der Pächter -, wie er sich um die Familienverhältnisse, um Kinderaufbringen und Schulung, um Krankheit und Altern all der Leute kümmerte, das leitete sich von keinen Prinzipien ab, es war Fürsorge nicht im üblichen, sondern im personhaften Sinn. Auch in der Stadt verhielt mein Vater sich nicht anders. Der blicklosen Wohltätigkeit war er ingrimmig abgeneigt; verstand keine andere Hilfe als die von Person zu Person, und die übte er. Noch im hohen Alter ließ er sich in die Brotkommission der jüdischen Gemeinde Lemberg wählen und wanderte, ohne zu ermatten, in den Häusern umher, um die eigentlich Bedürftigen und ihre Bedürfnisse ausfindig zu machen; wie anders hätte das geschehen können als durch den wahren Kontakt!13
Schon an dieser Stelle ist anzumerken, welch wichtige, elementare, gleichwohl theoriefreie Anregungen der dialogische Denker von seinem Vater in früher Jugend empfangen haben muss. Und noch einen Wesenszug hat der Sohn zu erwähnen, einen, an dem er ebenfalls auf eine besondere Weise partizipierte. Buber berichtet:
Mein Vater war ein elementarer Erzähler. Jeweils im Gespräch, wie es ihn eben des Wegs führte, erzählte er von Menschen, die er gekannt hatte. Was er da von ihnen berichtete, war immer die schlichte Begebenheit ohne alles Nebenwerk, nichts weiter als das Dasein menschlicher Kreaturen und was sich ihnen begibt...14
Martin Buber hebt das hervor, um zugleich ein eigenes, ein zentrales Motiv seines Lebens und Schaffens anklingen zu lassen, eben das des Dialogischen.
Den größten Teil seiner Kindheitsjahre und der ersten Jugendzeit verlebt Martin in Lemberg. Soweit sich diese frühen Jahre biographisch erhellen lassen, fällt auf, wie wenig da von kindlichem Erleben, von jugendlicher Ausgelassenheit oder von Spielen mit Gleichaltrigen die Rede ist. Haim Gordon, der sich nach Schilderungen dieser Art umgesehen hat, meint, Martin habe sich nur wenig um das kindliche Spiel gekümmert. Die Kinderzeit, in der man lernt, mit anderen spontan umzugehen, komme da gar nicht vor. »Seine (eigenen) Kinder können sich nicht erinnern, dass er je von Spielkameraden oder von Kinderspielen erzählt hätte, und Erlebnisse dieser Art kommen auch in seinen Schriften nicht vor. Er muss ein zartes, zurückgezogenes Kind gewesen sein, dem es nicht gegeben war, anderen spontan entgegenzukommen und eine warme, affektbetonte, intime Freundschaft zu beginnen … Martin führte ein geborgenes Leben in ihrem (d. h. der Großmutter Adele) geräumigen Haus, umgeben von Dienern, die ihm jede Laune erfüllten. Er nahm das als natürlich hin, und ich bezweifle, ob er jemals gelernt hat, ein Ei zu braten oder den Fußboden zu kehren.«15 Gordon weist darauf hin, dass dieses Umsorgtsein im Grunde für ihn lebenslang bestanden habe. In seinen Studentenjahren habe ihn jeweils ein Diener begleitet, und bis zu seinem sechzigsten Lebensjahr, als er nach Palästina auswanderte, habe er nie ohne Diener gelebt. Diese Angaben werden vom Sohn Rafael bestätigt, der meint, sein Vater sei von der Großmutter »verhätschelt« worden. So habe es sich ergeben, »dass er im Grunde genommen nie das war, was ein normaler Junge sich unter einem Jungen vorstellt: er hat niemals auf der Straße mit den Jungen Schlagball gespielt, dabei einmal beim Nachbarn irgendwo eine Scheibe eingeschlagen, - für so etwas hatte er gar kein Verständnis bei seinen Kindern. Er ist aufgewachsen - ja, er hatte einen Reitlehrer und ein eigenes Pferd, aber etwas angestellt hat er nie. So konnte er eben auch kein Verständnis dafür haben.«16
Nun wieder zurück nach Südpolen: Nur die Sommermonate bieten, etwa vom neunten bis zum vierzehnten Lebensjahr, für Martin Gelegenheit, die Stadt Lemberg zu verlassen. Er verbringt seine Ferien beim Vater auf dem Landgut in der Nähe von Sadagora und Czortkow. Lemberg, seit der Teilung Polens im Jahre 1772 zur österreichischen Krone gehörig, war bis zum Ende des Ersten Weltkriegs die Hauptstadt der Provinz Galizien und Sitz der drittgrößten Judengemeinde Polens. Zusammen mit dem russischen Wolhynien im Norden und Podolien im Osten bildet das Gebiet ein wichtiges Zentrum des einstigen Ostjudentums. Hier wurden im Laufe der Jahrhunderte ungezählte Juden Russlands und Polens die Opfer von unablässigen Ausschreitungen und Willkürakten, den berüchtigten Judenpogromen. Pogrom, zu deutsch: Verwüstung, ist ein russisches Wort. Die Geschichte der Judenheit im Exil gleicht einer Kette von Pogromen, zwei Jahrtausende lang und länger …
Hier im Wohngebiet der Ostjuden stand am Ende des 18. Jahrhunderts die Wiege des Chassidismus17. Es ist jene Frömmigkeitsrichtung, in der Begeisterung, religiöse Unmittelbarkeit und mystisches Entbrennen aufgeflammt ist. Auf Rabbi Israel ben Elieser (1700 -1760) - genannt Baalschem-Tow, Meister des wunderwirkenden Gottesnamens - ging diese Bewegung zurück. Sie breitete sich in den südpolnischen Landesteilen, in Podolien und Wolhynien aus. Diese Chassidim, die »Frommen«, sind Juden, die den Weg ihres Baalschem (kurz: Beseht) gehen. Auch für sie gelten die Gebote und Lebensregeln der rechtgläubigen Juden, an erster Stelle die heilige Thora, das Gotteswort der fünf Bücher Mose (Pentateuch). Doch wichtiger als die Gesetzesstudien, wichtiger auch als der rituelle Vollzug ist den Chassidim die Spontaneität und die Ekstatik ihres Betens, Singens und Tanzens. In ihren geistlichen Führern und seelsorgerlichen Beratern in allen Lebenslagen, den Zaddikim (Gerechten), erblicken sie geistbegabte Männer, die ihre Gemeinden anleiten, mitten in ihrem Alltag Gott zu dienen, nämlich mit Enthusiasmus und mit Freude, mit der Bereitschaft zu totaler Hingabe an das, was gerade zu tun ist. Gott mitten in der Welt freudig dienen, ihn lieben, lautet die Devise.
Martin Buber, dem es bestimmt gewesen ist, zum Künder der »Chassidischen Botschaft« in der westlichen Welt zu werden, fasst die Substanz des Chassidischen - man muss hinzufügen: wie er es zu verstehen geneigt war - in einem einzigen Satz zusammen: »Gott ist in jedem Ding zu schauen und durch jede reine Tat zu erreichen.«18
Der Knabe Martin taucht ein in das Vielerlei der Sprachen und der Traditionen. In ihnen stoßen Östliches und Westliches, jüdische Lebensart und mitteleuropäische Geistigkeit aufeinander. Einer harmonischen Synthese, der Dauer beschieden sein soll, widersetzen sie sich jedoch. Assimilation, Angleichung an die westliche Zivilisation heißt die Parole seit den Tagen eines Moses Mendelssohn und eines Lessing - jedoch nicht für alle. Im Haus der Großeltern wird mit großer Selbstverständlichkeit deutsch gesprochen. In die hohen schmalen Rechnungsbücher trägt Adele Buber in ihrer Eigenschaft als Gutsverwalterin nicht nur die Zahlen und Daten der umfänglichen Haus- und Hofwirtschaft ein, sondern, wie der Enkel vermerkt, auch »Sprüche der verehrten Geister, teils eigene Eingebungen, alles in einem keimhaften und festlichen Deutsch. In dieser Sprachluft bin ich auf gewachsen«19, erinnert sich der achtzigjährige Martin Buber.
Doch nicht nur diese Luft atmet der Junge in Lemberg. Denn auf der Straße und im gesellschaftlichen Leben spricht man naturgemäß polnisch. Polnisch ist selbstverständlich auch die Sprache der Schule. Nachdem er die erste Unterweisung des Großvaters erhalten hat, besucht Martin das Lemberger Franz-Joseph-Gymnasium. So sind auch Bubers erste schriftstellerische Fingerübungen aus den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts in polnischer Sprache abgefasst, wiewohl sich diese mit dem deutsch-österreichischen Geistesleben beschäftigen. So wissen wir von Aufsätzen über die vieldiskutierten zeitgenössischen Wiener Autoren, insbesondere Peter Altenberg, Hugo von Hofmannsthal und Arthur Schnitzler. Ja, Buber gesteht sogar einmal die in jenen Jahren gehegte Absicht des Abiturienten, Nietzsches »Also sprach Zarathustra« ins Polnische zu übersetzen. Es ist nicht dazu gekommen. Jedenfalls sind das Polnische und das Deutsche die selbstverständlichen Ausdrucksmittel für einen Angehörigen des jüdischen Besitz- und Bildungsbürgertums, dem die Buber-Familie fraglos zuzurechnen ist; - »nur das Judenviertel rauschte von derbem und zärtlichem Jiddisch, und in der Synagoge erklang lebendig wie je die große Stimme hebräischer Vorzeit«, so notiert der Erinnernde nach vielen Jahrzehnten.
Wie vermag sich Buber mit der Vierheit dieser Sprachen zu verbinden? - Das Kind beherrscht sie ohne Schwierigkeit. Das deutet auf eine außergewöhnliche Sprachbegabung, nimmt man hinzu, dass die Schule das Lateinische und Griechische sowie das Französische vermittelte. Das Englische und das Italienische eignete sich Buber in späteren Jahren an. Stellt die Welt der Sprache nicht das Medium und die Brücke dar, in dem er die Einsamkeit seiner Kindheit zu überwinden vermag? Ist es nicht auch und gerade die Sprache, die das Ich mit dem Du verbindet?
Dem Polnischen ist er früh entwachsen. In den nachfolgenden Jahrzehnten dient es ihm bestenfalls dazu, die Verwaltung des verbliebenen väterlichen Erbes aus der Ferne besser zu bewerkstelligen. Das derb-zärtliche Jiddisch, das einst die aus den deutschen Ghettos nach Osten geflüchteten Juden mitbrachten, jene eigentümliche Mischsprache, die die gebildeten Juden verachteten, war immerhin das Ausdrucksmittel jener volkstümlichen Mystik der Chassidim, zu der Buber als Übersetzer, Nacherzähler und Interpret eine Brücke zu schlagen hatte. Und was das Deutsche und »die große Stimme hebräischer Vorzeit«, das Hebräische betrifft, so betraute ihn das Schicksal mit der Aufgabe, die Stimme der Väter und der Propheten Israels in sein geliebtes Deutsch zu übertragen, nicht nur im landläufigen Sinn des Wortes zu »übersetzen«. Die Entscheidung fürs Deutsche muss bei Buber frühzeitig gefallen sein. Legt nämlich der Midrasch-Gelehrte Salomon Buber den ersten Keim für die Ehrfurcht vor jener »großen Stimme«, so sorgt die Großmutter dafür, dass die Liebe zur Sprache der deutschen Dichter und Denker in Martin Buber wachsen kann:
Das kam daher, dass die Großmutter Adele Buber, die mich bis ins vierzehnte Jahr erzog, diese Sprache wie einen gefundenen Schatz hütete. Sie hatte einst, eine Fünfzehnjährige, die in ihrem heimatlichen Ghetto als weltlich verbotenen deutschen Bücher ihrer Liebe auf dem Speicher versteckt gehalten; ich besitze noch das Exemplar von Jean Pauls »Levana«, dessen Lehren sie in der Erziehung ihrer künftigen Kinder anwenden wollte und dann auch wirklich angewandt hat.20
So ist die Liebe zur Sprache Goethes und Schillers, auch Hölderlins und Nietzsches tief eingewurzelt.
Rechtzeitig beginnt das Werk der Großmutter Früchte zu tragen, freilich solche, die einen glaubensstreng lebenden orthodoxen Juden nicht gerade entzückt haben können, denkt man an die Bar-Mizwa-Feier für Martin. Wie jeder jüdische Junge, der einst als Säugling durch die Beschneidung in den Bund Abrahams aufgenommen und dem Gottesvolk Israel einverleibt worden ist, wird auch Martin mit dem dreizehnten Lebensjahr religiös mündig, am 8. Februar 1891. In Anlehnung an ein Wort aus dem Propheten Hosea, Kapitel 2,21 (»Ich habe dich mir angelobt in Tugend und Gerechtigkeit, in Milde und Barmherzigkeit; ich habe dich mir angelobt in Treue und Wahrhaftigkeit, auf dass du Gott erkennest«21) wählt Martin Buber eine Dichtung von Friedrich Schiller. Er spricht über die drei »Worte des Glaubens«: Freiheit, Tugend und Gott. Ein orthodoxer Rabbiner dürfte den »Sohn des Gesetzes« bei dieser Textwahl wohl schwerlich beraten haben … Aber wir hören, der junge Buber habe immerhin für kurze Zeit nach vollzogener Bar-Mizwa die Gebräuche und Vorschriften jüdischer Frömmigkeit mit leidenschaftlichem Ernst vollzogen. Bei bestimmten Gebeten habe er sich in der Synagoge von Lemberg nicht allein verneigt, sondern auf den Boden geworfen.22 Die »Kehre« muss er aber nicht lange darauf vollzogen haben. Sein Blick war nicht länger stracks nach Jerusalem gerichtet, sondern eher nach Wien und nach Weimar, eben nach den Zentren westlicher Lebens- und Geistesart. Immerhin hat Buber - drei Jahrzehnte später (1922) - seinem Freund Franz Rosenzweig »etwas Ernstes« mitzuteilen, wenn er in einem Brief bekennt: »Mit vierzehn habe ich aufgehört, Tefillin zu legen.«23 Das heißt, schon ein Jahr nach der Bar-Mizwa-Feier verzichtet Buber darauf, beim obligatorischen Morgengebet die Gebetsriemen anzulegen, wie es männlichen Betern geziemt. Eine erste Wende ist damit markiert. Der beschrittene Weg kennt weitere Stationen.
Nicht länger hält es den an klassischer Literatur und Kunst Interessierten im geschützten Raum von Ritus und Tradition. Buber erinnert sich im Übrigen keiner antisemitischen Tendenzen in der Schule, weder bei Schülern noch bei Lehrern. Eine äußere Nötigung, am Vätererbe festzuhalten, gibt es für ihn zu diesem Zeitpunkt folglich nicht. Und doch beginnt eine, nicht zuletzt pubertätsbedingte Revolte gegen alles Religiöse. Der Junge nimmt beispielsweise Anstoß an den allgemein üblichen Schulandachten seiner großenteils katholischen Mitschüler, an denen er als Jude zumindest passiv teilnehmen muss: »Auf mich wirkte das pflichtmäßige tägliche Stehen im tönenden Raum der Fremdandacht schlimmer, als ein Akt der Unduldsamkeit hätte wirken können. Gezwungene Gäste; als Ding teilnehmen müssen an einem sakralen Vorgang, an dem kein Quäntchen meiner Person teilnehmen konnte und wollte; und dies acht Jahre lang Morgen um Morgen: das hat sich der Lebenssubstanz des Knaben eingeprägt...«24 - Zwar weiß er von keinem Versuch, dass jüdische Schüler in irgendeiner Weise missioniert werden sollten - »und doch wurzelt in den Erfahrungen jener Zeit mein Widerwille gegen alle Mission. Nicht bloß etwa gegen die christliche Judenmission, sondern gegen alles Missionieren unter Menschen, die einen eigenständigen Glauben haben.«
Aus dem gleichen Grund lehnt Buber den von Franz Rosenzweig einmal gehegten Gedanken einer jüdischen Mission unter Nichtjuden entschieden ab. Echter Glaube, der personal verantwortete Glaube verträgt sich nicht mit einer Werbung, ganz gleich, mit welchen Mitteln sie geschieht. Und als Buber im Jahre 1961 durch seinen einst in München beheimateten Schüler und langjährigen Freund Schalom Ben-Chorin erfährt, dass der geistige Urheber der verdienstvollen »Aktion Sühnezeichen«, der protestantische Präses Lothar Kreyssig, die Förderung eines Synagogenbaues für die Jerusalemer jüdische Reformgemeinde zugesagt hat, bei dem vor allem junge Deutsche mitwirken, ist Buber dankbar gerührt. Aber er gibt gleichzeitig zu verstehen, dass ein uneingeschränkter Verzicht auf irgendeine Weise christlicher Mission unter den israelischen Juden gewährleistet sein müsse.25
Erste Begegnung und »Vergegnung«
Hat Buber seiner Zeit und Nachwelt eine ausführliche Autobiographie vorenthalten, so hat er wenigstens einige exemplarische Eindrücke und Erinnerungen mitgeteilt, die Leitmotive seines Lebens und Schaffens signalisieren. Und hat er sich selbst als einen im hohen Maße »atypischen« Menschen bezeichnet, so können jene Eindrücke, in scheinbarem Widerspruch hierzu, etwas von dem Typus sichtbar machen, der Buber im Prozess seines Werdens geprägt hat und von dem bis heute eine prägende Kraft ausgeht.
Seine früheste Erinnerung geht ins vierte Lebensjahr zurück. Sie hat mit der Mutter zu tun, die der kleine Martin seit seiner Übersiedlung von Wien nach Lemberg entbehren muss. Die Großeltern, die »dem Bereden der eigenen Existenz beide abhold« sind - also auch sie! -, sie vermeiden es, vor dem Kind über die endgültige Trennung der Eltern zu sprechen. Das sensible Kind, das seine Mutter bald oder doch eines Tages wiederzusehen hofft, ist unfähig, mit einer Frage an die Tatsache des Mutterverlustes zu rühren. Dann aber begibt sich das, was Buber so erzählt:
Das Haus, in dem meine Großeltern wohnten, hatte einen großen quadratischen Innenhof, umgeben von einem bis ans Dach reichenden Holzaltan, auf dem man in jedem Stockwerk den Bau umschreiten konnte. Hier stand ich einmal, in meinem vierten Lebensjahr, mit einem um mehrere Jahre älteren Mädchen, der Tochter eines Nachbarn, deren Aufsicht mich die Großmutter anvertraut hatte. Wir lehnten beide am Geländer. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich zu meiner überlegenen Gefährtin von meiner Mutter gesprochen hatte. Aber ich höre noch, wie das große Mädchen zu mir sagte: »Nein, sie kommt niemals zurück.« Ich weiß, dass ich stumm blieb, aber auch, dass ich an der Wahrheit des gesprochenen Wortes keinen Zweifel hegte. Es blieb in mir haften, es verhaftete sich von Jahr zu Jahr immer mehr meinem Herzen, aber schon nach etwa zehn Jahren hatte ich begonnen, es als etwas zu spüren, was nicht bloß mich, sondern den Menschen anging. Später habe ich mir das Wort »Vergegnung« zurechtgemacht, womit etwa das Verfehlen einer wirklichen Begegnung zwischen Menschen bezeichnet war. Als ich nach weiteren zwanzig Jahren meine Mutter wiedersah, die aus der Ferne mich, meine Frau und meine Kinder besuchen gekommen war, konnte ich in ihre noch immer zum Erstaunen schönen Augen nicht blicken, ohne irgendwoher das Wort »Vergegnung«, als ein zu mir gesprochenes Wort, zu vernehmen. Ich vermute, dass alles, was ich im Lauf meines Lebens von der echten Begegnung erfuhr, in jener Stunde auf dem Altan seinen ersten Ursprung hat.26
Zugleich eine Urerfahrung, der es eigen ist, sich unverlierbar einzuprägen und einen Menschen zu formen. Als Buber etwa zwei Menschenalter danach seinem langjährigen Verleger und Freund Lambert Schneider anlässlich des Todes von dessen Mutter kondoliert, schreibt er aus Jerusalem nach Heidelberg: »Ich, der ich meine Mutter kaum gekannt habe, weiß vielleicht eben deshalb auf eine besondere Weise, was es für einen Menschen heißt, die seine zu verlieren.«27 So verbringt der Junge in Lemberg eine »mutterlose Kindheit«, wie er einmal Franz Rosenzweig beiläufig berichtet, »von der lebenden nur unzugänglich fernen Mutter träumend«. Es ist daher für Buber bezeichnend, dass das Bewusstsein, die Mutter entbehren zu müssen, bei ihm geradezu sensibilisierend gewirkt hat. Es bildete sich in ihm der Sinn für Begegnung ebenso wie für Mangel an echter Begegnung schon in früher Jugend.
Da ist noch eine andere Episode, die des exemplarischen Charakters nicht entbehrt. Sie spielt auf dem Landgut des Vaters, das Martin während der Sommerferien von Lemberg aus besuchen darf: Unbeobachtet schleicht sich der Junge in den Pferdestall zu seinem Liebling, einem breiten Apfelschimmel, und krault ihm den Nacken. In Bubers Erinnerung mischt sich unwillkürlich etwas von der anderen Grunderfahrung, um die sein späteres Denken kreisen sollte. Er schreibt:
Das war für mich nicht ein beiläufiges Vergnügen, sondern eine große, zwar freundliche, aber doch auch tief erregende Begebenheit. Wenn ich sie jetzt, von der sehr frisch gebliebenen Erinnerung meiner Hand aus, deuten soll, muss ich sagen: was ich an dem Tier erfuhr, war das Andere, die ungeheure Anderheit des Anderen, die aber nicht fremd blieb, wie die von Ochs und Widder, die mich vielmehr ihr nahen, sie berühren ließ.
Und noch konkreter sucht der Berichterstatter dieses Erlebnis als eine leibhafte Erfahrung zu fassen, um sie deutend ins Bewusstsein heben und auf sie hinzeigen zu können, wenn er fortfährt:
Wenn ich über die mächtige, zuweilen verwunderlich glattgekämmte, zu anderen Malen ebenso verwunderlich wilde Mähne strich und das Lebendige unter meiner Hand leben spürte, war es, als grenzte mir an die Haut das Element der Vitalität selber, etwas, das nicht ich, gar nicht ich war, gar nicht ich-vertraut, eben handgreiflich das Andere, nicht ein Anderes bloß, wirklich das Andere selber, und mich doch heranließ, sich mir anvertraute, sich elementar mit mir auf Du und Du stellte. Der Schimmel hob, auch wenn ich nicht damit begonnen hatte, ihm Hafer in die Krippe zu schütten, sehr gelind den massigen Kopf, an dem sich die Ohren noch besonders regten, dann schnob er leise, wie ein Verschworener seinem Mitverschworenen ein nur diesem vernehmbar sein sollendes Signal gibt, und ich war bestätigt.28
Was diese Episoden aus den autobiographischen Fragmenten zum Ausdruck bringen, ihr Gehalt hat sich tief in den Heranwachsenden eingeprägt. Ja, sie bezeichnen die Elemente, aus denen Martin Buber sein Leben und sein Werk aufbauen konnte. Wir werden jedenfalls nicht fehlgehen, wenn wir annehmen, dass Buber diese Notizen als Bildekräfte seines Lebenslaufs und seiner Gedankenwege verstanden haben will. Sie sagen qualitativ mehr aus, als es ein detaillierter Bericht vermöchte. Denn wesentlich ist ihm fortan, was sich zwischen Menschen begibt, die Qualität »des Zwischenmenschlichen«. Es ist das, was zur Begegnung führt oder das, was »Vergegnung« verursacht, indem Menschen durch eine Beziehung vereitelnde Distanz voneinander geschieden werden, selbst wenn sie in konventioneller Freundlichkeit aufeinander einreden. Freilich bedurfte es bei Buber eines langen, an Umwegen reichen Entwicklungsprozesses, ehe das in früher Kindheit Erfahrene im gelebten Leben und im Gedankenwerk verwirklicht werden konnte.
Von nicht geringerer Bedeutung wird für den jungen Buber eine Begebenheit ganz anderer Art. Er wird an eine ganz eigentümliche Atmosphäre jüdischer Volksfrömmigkeit herangeführt, nämlich an die des Chassidismus. Auch dieses Erlebnis fällt in die Zeit der sommerlichen Aufenthalte auf dem väterlichen Hof. Carl Buber nimmt seinen Ältesten gelegentlich in das nahegelegene Landstädtchen Sadagora mit. Es ist der Sitz einer Dynastie von Zaddikim, jener chassidischen Meister, die als sogenannte Wunderrabbis geheimnisumwitterte, daher auch legendenumrankte Gestalten sind. Die große Zeit des Chassidismus ist wohl schon lange vorüber. Die chassidische Bewegung ist zu dem Zeitpunkt, da der Junge sie in seiner real existierenden Gestalt kennen lernt, längst dekadent geworden. Seine Blüte, seine Geistesmächtigkeit, die ihm im 18. Jahrhundert anhaftete, scheint unwiederbringlich vergangen. Die Gemeindegestalt aber besteht weiter. Wie lange noch? Denn auch ihre Tage sind gezählt, denkt man an die Schicksale der während des Zweiten Weltkriegs ermordeten Juden. Aber im Atmosphärischen lebt noch etwas von der legendären Vergangenheit. Dann und wann mag etwas davon heraufdämmern, was sich in Legende und Lehre, in der alltagsnahen Frömmigkeit in unvergleichlicher Weise verdichtet hat. Auf der einst mit Geist und lebendiger Spontaneität erfüllten Form des Frommseins ruht gleichsam noch ein letzter Abglanz. Buber meint, davon berührt worden zu sein, wenn man seiner Schilderung folgt.
Hier in Sadagora begegnet er den Chassidim erstmals. Ganz unvorbereitet scheint er jedoch schon nicht mehr zu sein, denn Salomon Buber nahm den Enkel dann und wann in die »Klaus« mit, wenn er, der Mann der Aufklärung, sich unter die Schar der enthusiastischen chassidischen Beter mischte und zumindest hier das volkstümliche Jiddisch nicht verschmähte. Was für einem Chassidismus aber ist der junge Buber in Sadagora begegnet?
In der Rechenschaft über seinen eigenen Weg zum Chassidismus ist er auf diese Frage eingegangen. Da lesen wir:
Wohl ist die legendäre Größe der Ahnen in den Enkeln geschwunden, und etliche bemühen sich, durch allerhand kleine Magie ihre Macht zu bewahren; aber all ihr Treiben vermag das angeborene Leuchten ihrer Stirn nicht zu verdunkeln, die angeborene Erhabenheit ihrer Gestalt nicht zu verzerren; ihr unwillkürlicher Adel spricht zwingender als all ihre Willkür. Und wohl lebt in der heutigen Gemeinde nicht mehr jener hohe Glaube der ersten Chassidim, die im Zaddik den vollkommenen Menschen ehrten, in dem das Unsterbliche seine sterbliche Erfüllung findet; vielmehr wenden sich die Heutigen an ihn vornehmlich als an den Mittler, durch dessen Fürsprache sie Stillung ihres Bedürfens zu erlangen hoffen; aber es ist immer noch, ihrem niedern Wollen entrückt, ein Schauer urtiefer Ehrfurcht, der sie ergreift, wenn der »Rebbe« im stummen Gebet steht oder beim dritten Sabbatmahl in zögernder Rede das Geheimnis der Tora deutet. Auch diesen Abgearteten glüht noch, im ungekannten Grund ihrer Seelen, das Wort des Rabbi Elieser fort, um des vollkommenen Menschen (Zaddik) willen, und sei es um eines Einzigen willen, sei die Welt erschaffen worden. 29
In dieser Erinnerung vergleicht Buber diesen Zaddik als den Inbegriff tatsächlicher oder doch erhoffter Vollkommenheit mit dem durch äußere Mittel reich ausgestatteten Bezirkshauptmann und mit dem orthodoxen Rabbiner der Ortschaft. Dieser ist seiner Meinung nach zwar ein rechtschaffener und auch ein gottesfürchtiger Mensch, aber als »Kultusvorstand« der Angestellte einer äußeren religiösen Institution. Hier wurzelt Bubers Skepsis. Hat sie ihn je verlassen, wenn er sich mit institutionalisierter Religion konfrontiert sah, er, der sich als »Erzjude« verstand? Ist ursprunghafte, ursprungsnahe Religiosität überhaupt institutionalisierbar? Lässt sich Heiliges wie ein Gewerbe treiben? Diese Frage des Hölderlinschen Empedokles ist im Grunde auch Bubers Frage. Viel deutet darauf hin, dass sie es lebenslang für ihn geblieben ist. Die Hüter der Institution, das heißt der Synagoge, haben es dem Anwalt der chassidischen Charismatiker nicht vergessen und wohl auch nicht vergeben. Doch was hat es nun mit den Häuptern dieser polnischen Chassidim auf sich? Man wird differenzieren müssen, denn Buber fährt fort:
Hier jedoch war ein Anderes, ein Unvergleichliches; hier war, erniedrigt, doch unversehrt, der lebendige Doppelkern des Menschentums: wahrhafte Gemeinde und wahrhafte Führerschaft. Uraltes, Urkünftiges war hier. Verlorenes, Ersehntes, Wiederkehrendes. - Der Palast des Rebbe, in seiner effektvollen Pracht, stieß mich ab. Das Bethaus der Chassidim mit seinen verzückten Betern befremdete mich. Aber als ich den Rebbe durch die Reihen der Harrenden schreiten sah, empfand ich »Führer«, und als ich die Chassidim mit der Tora tanzen sah, empfand ich: »Gemeinde«. Damals ging mir eine Ahnung davon auf, dass gemeinsame Ehrfurcht und gemeinsame Seelenfreude die Grundlagen der echten Menschengemeinschaft sind.30
Geburt einer Utopie: »Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen«
An dieser Stelle ist ein Einschub zu machen, um historische Zusammenhänge zu beleuchten, die im Leben Martin Bubers von seiner Jugend an von großer Bedeutung werden sollten.
Pogrome in den Wohngebieten jener Ostjuden, deren Vorfahren einst in der Zeit der Kreuzzüge aus Mitteleuropa geflohen waren, sodann vordergründiger und tief verwurzelter, hintergründiger Antisemitismus in der westlichen Welt trugen wesentlich dazu bei, dass die Sehnsucht nach Zion und nach dem Land der biblischen Väter nicht völlig versiegte, und zwar trotz Emanzipation und Anlehnung an die europäische Zivilisation. So traten im Laufe des 19. Jahrhunderts eine Reihe jüdischer Sozialdenker und Publizisten auf, die diese Zionssehnsucht und das Verlangen nach Heimkehr je auf ihre Weise verstärkten.
»Das uralte Problem der Judenfrage setzt, wie vor Zeiten, so auch heute noch die Gemüter in Erregung. Ungelöst, wie die Quadratur des Zirkels, bleibt es, gleich dieser, immer noch die brennende Frage des Tages. Der Grund hierfür liegt darin, dass jenes Problem kein bloß theoretisches Interesse darbietet, sondern sich im wirklichen Leben gleichsam von Tag zu Tag verjüngt und immer gebieterischer zur Entscheidung hindrängt. Nach unserer Auffassung besteht der Kernpunkt des Problems im Folgenden:
Die Juden bilden im Schoße der Völker, unter denen sie leben, tatsächlich ein heterogenes Element, welches von keiner Nation assimiliert zu werden vermag, demgemäß auch von keiner Nation gut vertragen werden kann. Die Aufgabe besteht nun darin, ein Mittel zu finden, durch welches jenes exklusive Element dem Völkerverbande derart angepasst werde, dass der Judenfrage der Boden für immer entzogen sei … Jener Messiastag, an welchem die ›Internationale‹ verschwinden und die Nationen in der Menschheit aufgehen werden, liegt noch in unsichtbarer Ferne.«31
Diese Zeilen wurden am Anfang der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts niedergeschrieben. Ihr Verfasser, Leon Pinsker (1821-1891), ein jüdischer Arzt aus Odessa, veröffentlichte 1882 in Berlin in deutscher Sprache sein programmatisches Buch »Autoemanzipation, ein Mahnruf an seine Stammesgenossen von einem russischen Juden«, d. h. ohne Namensangabe. Und die Reaktion? - Von seinen Volks- und Glaubensgenossen hatte er fast nur Misstrauen und Widerspruch zu erwarten. Viele Juden hatten sich emanzipiert, ihrem Judesein Abschied gegeben und sich in die jeweilige Gesellschaft integriert. Sie meinten zu diesem Zeitpunkt der sogenannten »Gründerzeit« (immer noch), dem bald offenbaren, bald schwelenden Antisemitismus durch weitgehende Anpassung und durch totale Selbstaufgabe entgehen zu können. Das Judesein verfiel einer generellen Verdrängung. Doch damit hatte die missliebige Minderheit im Berlin des antisemitisch tönenden protestantischen Hofpredigers Adolf Stöcker ebenso wenig Erfolg wie in der österreichischen Metropole Wien, wo der Begründer der christlich-sozialen Partei, Karl Lueger, als Bürgermeister fungierte. Und in Paris, wo einhundert Jahre zuvor die Parole der Französischen Revolution, »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!« ausgerufen worden war, herrschte kaum ein anderes Klima.
An Pionieren für eine jüdische Selbstbesinnung fehlte es indes nicht, wenn wir beispielsweise an Moses Hess (1812-1875) denken, der unter der Leitung von Karl Marx 1842/43 bei der in Köln erscheinenden »Rheinischen Zeitung« als Redakteur arbeitete. Seine Rückkehr und sein Bekenntnis zum Judentum seiner Väter hat er 1862 in dem Buch »Rom und Jerusalem«32 dokumentiert. Doch dieses erste zionistische Manifest blieb zu Lebzeiten von Moses Hess ohne die gewünschte Wirkung. Immerhin sagte der »Kommunisten-Rabbi« den bereits in Palästina ansässigen Juden - Ende des 19. Jahrhunderts noch ein unscheinbares Häuflein - eine wichtige, ja universale Zukunftsaufgabe voraus:
»Wir glauben auch an die Wiederauferstehung des Geistes unserer Rasse, dem nur ein Aktionszentrum mangelt, um das sich eine auserlesene Schar von der religiösen Mission Israels ergebenen Männern gruppieren könnte, um aus diesem Zentrum von Neuem die ewigen Grundsätze hervorsprudeln zu lassen, welche die Menschheit mit dem Weltall und das Weltall mit seinem Schöpfer verbinden. Jene Männer werden sich einst in der alten Stadt Israel wiederfinden. Die Zahl tut nichts zur Sache.«33
Zweifellos prophetische Worte. Der in Wien geborene Jude Nathan Birnbaum (1864-1937) prägte den politischen Begriff »Zionismus«. Das war kurz vor der Jahrhundertwende. »Zionsliebende« (Chowewe Zion) gab es schon früher. Unter dem Druck der Verfolgung im zaristischen Russland schlossen sie sich seit 1882 in kleinen Vereinigungen zusammen und suchten in der westlichen Judenheit für ihre zionistischen Ideale zu werben. Einer der wenigen, die sich diesen Zionsfreunden anschlossen, war Leon Pinsker. Die Judenheit als ganze ließ sich von derlei Aktivitäten jedoch kaum in Bewegung setzen.
Um nun die lange gehegten, oft kaum mehr eingestandenen Hoffnungen und Sehnsüchte erfüllen zu können - »Nächstes Jahr in Jerusalem«! - bedurfte es einer Führerpersönlichkeit eigener Prägung. Er musste die Wendigkeit eines Diplomaten, die Schaukraft eines Propheten und zugleich die Energie eines Aktivisten besitzen. Er musste Pragmatiker genug sein, um die Forderungen der Stunde mit den nutzbaren Möglichkeiten des Tages in Einklang zu bringen.
Und eben dieser Mann wird im Jahre 1860 in Budapest geboren. Er entstammt einer Familie frommer Juden, die in den Traditionen von Volk und Religion leben. Er selbst kann aber nicht leugnen, dass sein Herz im Rhythmus der neuen Zeit schlägt. Achtzehnjährig übersiedelt er nach Wien, um dort zu studieren. Nach einem Jurastudium, abgeschlossen mit dem Doktordiplom, beschreitet er aber nicht etwa eine diplomatische Laufbahn, wie man sich dies von dem Mann vorstellen würde, der die Grundlagen für einen zukünftigen Staat der Juden legen soll. Er wird Journalist, Feuilletonredakteur und belletristischer Schriftsteller. Seine Theaterstücke entsprechen dem Zeitgeschmack. Der Mann heißt Theodor Herzl. Da erteilt ihm das Schicksal um die Lebensmitte den Auftrag, der ihn mit seinem Lebensthema konfrontiert.
1894 schickt die Wiener »Neue Presse« Theodor Herzl als Korrespondenten nach Paris. Dort wird er Zeuge des berüchtigten Dreyfus-Prozesses, der monatelang die öffentliche Diskussion beherrscht. Alfred Dreyfus, der erste Offizier jüdischer Abstammung, der in den Generalstab der französischen Armee beordert worden ist, wird des Hochverrats beschuldigt. Mit Hilfe gefälschter Dokumente verurteilt man ihn. Die Wogen des Judenhasses, aber auch die der Empörung über die fragwürdige juristische Verfahrensweise gehen hoch. Trotz eines Wirrwars von Lügen und Verdrehungen sickert die Wahrheit durch. »Die Wahrheit marschiert!« verkündet Emile Zola. Mit seinem flammenden J’accuse appelliert der gefeierte französische Schriftsteller an das Gewissen der Welt. Die anfangs für aussichtslos gehaltene Wende tritt ein. Die Ehre des Hauptmanns Dreyfus wird wiederhergestellt, nachdem seine Unschuld zweifelsfrei erwiesen ist. Kein Geringerer als Georges Clemenceau sorgt für die völlige Rehabilitation des Juden, auch wenn darüber einige Jahre vergehen.
Auf Herzl verfehlt der Prozess seine Wirkung nicht. Einmal mehr ist ihm deutlich geworden, wozu die tief eingewurzelte Judenfeindschaft der bürgerlichen Gesellschaft fähig ist. Vor allem erkennt er die Zwecklosigkeit, dem aufgepeitschten Volkshass durch Assimilationsversuche begegnen zu wollen. Für ihn persönlich bedeutet diese Erfahrung, dass er beginnt, sich von da an als Jude zu fühlen: »Mein Judentum war mir gleichgültig, sagen wir: es lag unter der Schwelle meines Bewusstseins. Aber wie der Antisemitismus die flauen, feigen und streberischen Juden zum Christentum hinüberdrückt, so hat er aus mir mein Judentum gewaltsam hervorgepresst.« Herzl erkennt: »Wir sind ein Volk, ein Volk!« Eine Idee wird geboren, eine Staatsutopie. In der schmalen Broschüre, betitelt: »Der Judenstaat«34, führt er den Gedanken näher aus, von dem er, der liberale, aufgeklärte Jude weiß, dass es ein uralter Gedanke ist, nämlich der der Wiederaufrichtung des Judenstaates. »Die Welt widerhallt vom Geschrei gegen die Juden, und das weckt den eingeschlummerten Gedanken auf.« Herzl erblickt im Antisemitismus, wie er sich ihm darbietet, gemeinen Brotneid, angeerbtes Vorurteil, religiöse Unduldsamkeit, vermeintliche Notwehr. Eine Analyse ohne Hass, aber auch ohne Furcht ist das Ergebnis seines Nachdenkens. Er kommt zu dem Ergebnis:
»Ich halte die Judenfrage weder für eine soziale noch für eine religiöse, wenn sie sich auch noch so und anders färbt. Sie ist eine nationale Frage, und um sie zu lösen, müssen wir sie vor allem zu einer politischen Weltfrage machen, die im Rate der Kulturvölker zu regeln sein wird … Durch Druck und Verfolgung sind wir nicht zu vertilgen. Kein Volk der Geschichte hat solche Kämpfe und Leiden ausgehalten wie wir. Die Judenhetzen haben immer nur unsere Schwächlinge zum Abfall bewogen. Die starken Juden kehren trotzig zu ihrem Stamm heim, wenn die Verfolgungen anbrechen …«
Bis in eine Reihe von Einzelheiten hinein bereitet Herzl seine Pläne für die Verwirklichung vor. Dabei ist es ihm in erster Linie um die politische Lösung zu tun. Die geistig-religiöse, die kulturelle Existenzfrage der Juden ist jedoch nicht die seine. Es hat den Anschein, als existiere sie für ihn nicht. Im Blick auf Bubers Intentionen ist dies kontrastierend eigens hervorzuheben.
Unglaubliches geschieht. Die Schrift »Der Judenstaat« wird zur Programmschrift, mit der Herzl vor allem die junge Generation erreicht, gerade auch die studentische Jugend, die sich nicht länger mit den Assimilationstendenzen zufrieden geben will. Und so gehört bald auch der junge Buber zu den Ersten, die sich in die werdende zionistische Bewegung einreihen. Sosehr sich die orthodoxen Schichten der Judenheit versagen - große Teile der Ostjuden vermag Theodor Herzl zu entflammen. Die Idee bricht sich Bahn.
Ende August 1897 tagt bereits der erste Zionistenkongress in Basel. Die zionistische Weltorganisation entsteht, deren Leitung Herzl selbst übernimmt. Es ist erstaunlich, mit welcher Zielsicherheit die Pioniere ihre Sache verfolgen. Das Basler Programm enthält den fundamentalen Satz: »Der Zionismus erstrebt die Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina.« Fortan setzt Herzl seine ganze Kraft ein, um die notwendigen diplomatischen, organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen für die Realisierung dieser »Heimstätte« zu schaffen. Wie sicher er sich von Anfang an ist, trotz der Schwierigkeiten, die sich ebenfalls von vornherein in den Weg stellen, wird durch eine Tagebuchaufzeichnung belegt. Unmittelbar nach Abschluss dieses ersten zionistischen Kongresses schreibt Herzl im September 1897:
»Fasse ich den Baseler Kongress in einem Wort zusammen - das ich mich hüten werde, öffentlich auszusprechen -, so ist es dieses: In Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute laut sagte, würde mir ein universelles Gelächter antworten. Vielleicht in fünf Jahren, jedenfalls in fünfzig, wird es jeder einsehen. Der Staat ist wesentlich im Staatswillen des Volkes … begründet. Territorium ist nur die konkrete Unterlage … Ich habe also in Basel dieses Abstrakte und darum den Allermeisten Unsichtbare geschaffen.«35
Wer will heute die Hellsicht dieses Utopisten der Moderne bezweifeln? Denn exakt fünfzig Jahre nach der Niederschrift dieser vor dem Spott der Zeitgenossen verborgen gehaltenen Tagebuchzeilen, im November 1947, haben die Vereinten Nationen (UNO) den Juden das Recht auf einen eigenen Staat in vertraglich vereinbarten Grenzen zugesprochen. Der verwegene Traum Theodor Herzls, die Utopie des Judenstaates, hat ihren Topos, ihren konkreten Ort der Verwirklichung gefunden. Sie ist zu einer Geschichtstatsache geworden, wenngleich einer von Anfang an überaus umstrittenen. Am 14. Mai 1948 ruft David Ben-Gurion in Tel Aviv den neuen Staat aus - »im Vertrauen auf den Allmächtigen, den Hort und Hüter Israels«, wie es in der Unabhängigkeitserklärung wörtlich heißt.
Die erwähnten fünf Jahrzehnte umspannen einen wesentlichen Teil von Bubers Leben und einen wichtigen Teil seiner Mitarbeit an dem von Herzl Begonnenen, wenngleich der frühe Gefolgsmann des Utopisten und Staatsgründers andere Akzente zu setzen hatte, als jener es für erforderlich und für opportun hielt. Es ist im Übrigen wohl kein Zufall, dass Buber in jenem fünfzigsten Jahr, 1947, jenes Buch in Jerusalem veröffentlichen konnte, das unter dem vielsagenden Titel »Pfade in Utopia« das Bild jener Idee beschreibt, durch die sich andere vor und nach Herzl impulsieren ließen, nicht am wenigsten Buber selbst. Und wenn man die Differenz zwischen Herzl und Buber auf einen einfachen Nenner bringen kann, dann ging es Buber nicht in erster Linie um den Staat, sondern um die Erneuerung des Menschen. Mit ihr müsse begonnen werden. Diese Einsicht gehört gerade im Blick auf das Utopische wie das Politische ins Zentrum der Lehre Bubers:
Es kommt einzig darauf an, bei sich zu beginnen, und in diesem Augenblick habe ich mich um nichts andres in der Welt als um diesen Beginn zu kümmern … Der archimedische Punkt, von dem aus ich an meinem Orte die Welt bewegen kann, ist die Wandlung meiner selbst.36
Und unmittelbar zuvor schreibt er:
Der Mensch soll zuerst erkennen, dass die Konfliktsituationen zwischen ihm und den andern nur Auswirkungen der Konfliktsituationen in seiner eigenen Seele sind, und dann soll er diesen innern Konflikt zu überwinden suchen, um nunmehr als ein Gewandelter, Befriedeter zu seinen Mitmenschen auszugehen und neue gewandelte Beziehungen zu ihnen einzugehen. 37
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Verlagsgruppe Random House
Die Erstausgabe erschien 1977 im Kindler Verlag GmbH, München. Die vorliegende Fassung wurde vom Autor überarbeitet und erweitert.
1. Auflage
Copyright © 2010 by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlagmotiv: Martin Buber, Foto / eigenhändige Unterschrift. © akg-images, Berlin Druck und Einband: Těšínská tiskárna, a.s., Český Těšín
eISBN : 978-3-641-03844-1
www.gtvh.de
Leseprobe
www.randomhouse.de