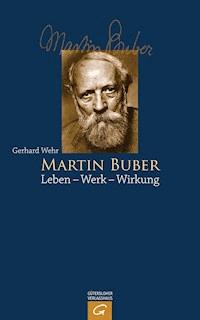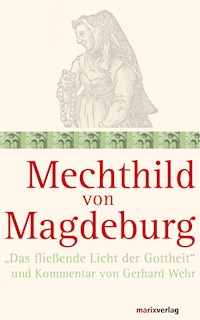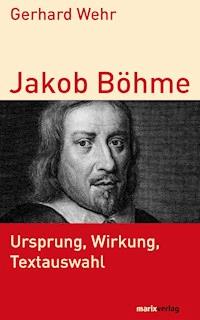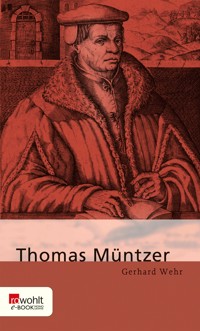Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Pleroma
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit Jahrhunderten ranken sich Spekulationen um die geheimnisumwitterten Rosenkreuzer, vieles ist Spekulation, anderes trifft den Kern. Die originalen Manifeste der Rosenkreuzer sind wie folgt benannt: Fama Fraternitatis (1614), Confessio Fraternitatis (1615) und Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreuz: Anno 1459 (1616). Sie sind in erster Linie Dokumente eines nach Innerlichkeit strebenden Glaubens. Der bekannte Autor Gerhard Wehr führt in die Grundzüge der zu Beginn des 17. Jahrhunderts entstandenen geistigen Bewegung unter dem Signum von Rose und Kreuz ein und präsentiert ihre Texte in unverstellter Gestalt, ergänzt um Goethes motivisch verwandtes Gedichtfragment »Die Geheimnisse«.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorbemerkungen zur Neuausgabe
Einführung
Wendezeit
Generalreformation im Zeichen von Kreuz und Rose
Johann Valentin Andreae und sein Kreis
Von der Bruderschaft der Rosenkreuzer zur Christianopolis
Wirkungen bis in die Gegenwart
Zur Fama Fraternitatis
Zur Confessio Fraternitatis
Zur Chymischen Hochzeit Christiani Rosenkreuz
Zu Goethes Fragment »Die Geheimnisse«
Die Texte
Fama Fraternitatis oder Brüderschaft des hochlöblichen
Ordens des R. C. An die Häupter, Stände und Gelehrten Europae (1614)
Confessio Fraternitatis oder Bekenntnis der löblichen Bruderschaft des hochgeehrten Rosenkreuzes an die Gelehrten Europas, geschrieben (1615)
Das 1. Kapitel
Das 2. Kapitel
Das 3. Kapitel
Das 4. Kapitel
Das 5. Kapitel
Das 6. Kapitel
Das 7. Kapitel
Das 8. Kapitel
Das 9. Kapitel
Das 10. Kapitel
Das 11. Kapitel
Das 12. Kapitel
Das 13. Kapitel
Das 14. Kapitel
Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreuz: Anno 1459 (Straßburg 1616)
Erster Tag
Zweiter Tag
Dritter Tag
Vierter Tag
Fünfter Tag
Sechster Tag
Siebter Tag
Johann Wolfgang von Goethe: Die Geheimnisse
Ein Fragment
Anhang
Zeittafel
Literaturhinweise
Zu den Bildern
Über den Herausgeber
Vorbemerkungen zur Neuausgabe
Es spricht für das anhaltende Bedürfnis suchender Menschen und für die ihrem Streben zugrunde liegende Bedeutsamkeit spiritueller Dokumente, wenn eine Sammlung von derartigen Schriften über Jahrhunderte hinweg immer wieder von neuem aufgelegt werden muß. Hier handelt es sich um die geheimnisumwitterten Manifeste des ursprünglichen Rosenkreuzertums, die erstmals zu Beginn des 17. Jahrhunderts durch die Presse gingen und die inzwischen auch in Übersetzungen weltweite Verbreitung gefunden haben.
Was nun die vorliegende Ausgabe anbelangt, so ließ ich ihr eine solche, ihrem Grundtext nach weitgehend identische, unter dem Titel »Rosenkreuzerische Manifeste« (Schaffhausen 1980) vorausgehen, gefolgt von mehreren Auflagen unter dem Titel »Die Bruderschaft der Rosenkreuzer« (Köln, München 1984 ff). Dieser Text samt Kommentar wird hier in durchgesehener und erweiterter Form erneut geboten. Ergänzt werden die drei Manifeste (Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis und Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreuz 1459) durch Goethes Gedichtfragment »Die Geheimnisse«. Es zeigt, daß er in einem wichtigen Augenblick (1784/85) seines Lebens, das heißt in der Zeit seiner Lebensmitte und unmittelbar vor Antritt seiner Italienischen Reise, sich entschloß, das rosenkreuzerische Motiv mit seinen eigenen dichterisch-humanitären Bestrebungen zu verbinden. Es war ihm aber nicht gegeben, das Begonnene abzurunden.
Wenngleich vom Dichter nicht eigens beabsichtigt, kann gerade von dieser Tatsache auch ein pädagogischer Impuls ausgehen. Denn insofern es sich wie bei diesem Werk um den Aufweis eines Wegs handelt, um eine Geistsuche, wie wir sie etwa von Parzival oder von Christianus Rosenkreuz kennen, so mag darin eine Aufforderung, eine Ermunterung gesehen werden, sich auf die jeweils individuelle Bedeutsamkeit einer solchen Dichtung zu besinnen, Fortschritte auf dem inneren Weg zu machen und selbst endlich »heimzukommen«.
Die »Bruderschaft der Rosenkreuzer« lebt letztlich nur dadurch, daß man – völlig unabhängig von den heute propagierten rosenkreuzerisch sich nennenden Vereinigungen – an ihr in unspektakulärer Weise teilnimmt, etwa dem Dichterwort gemäß:
»Wir wollen doch, wenn wir genug geklommen, Zur rechten Zeit dem Ziele näher kommen.«
Schwarzenbruck, Ostern 2007 Gerhard Wehr
Einfiihrung
Wendezeit
Der Übergang vom 16. zum 17. Jahrhundert markiert eine solche Wende. »De revolutionibus orbium caelestium« (Von den Umwälzungen am Himmel) hatte bereits Niko- laus Kopernikus sein programmatisches Werk betitelt. Auch wenn Martin Luther ihn einen Narren schalt, der die ganze »Kunst Astronomia« habe umkehren wollen, so steht doch für viele außer Frage: Das »Revolutionäre« kann am Lauf der Gestirne abgelesen werden. Durch die Verbindung von Mathematik und naturwissenschaftlicher Beobachtung lassen sich Doktrinen und Spekulationen der Alten durch konkrete Erfahrungen verdrängen, durch empirisches Wissen das bloße Buchwissen von einst. Diese Wende markiert bereits Paracelsus: »So wisset nun …, daß die Bücher, so an euch und an mich von den Alten her gelangt sind, mich genugsam zu sein nicht gedeucht haben, denn sie sind nicht vollkommen, sondern sie stellen eher eine ungewisse (d. h. unzuverlässige) Schrift dar, die mehr zur Verführung dient als zum Betreten des rechten (zuverlässigen) Wegs. Aus eben dem Grund habe ich sie verlassen.«
So kann und darf sprechen, wer auf seine Weise die Wende vollzieht und damit Generationen von Ärzten, Pharmazeuten, Naturforschern einen Weg bahnt. Mit der Entwicklung der modernen Naturwissenschaft geht die Entwicklung der dafür nötigen technischen Apparaturen Hand in Hand, etwa die Herstellung von Teleskopen (bald nach 1600). René Descartes, der vielgenannte Cartesius, liefert später die Methodik für die neue Denkrichtung. Mit der Formel »cogito, ergo sum – ich denke, also bin ich« wird der Zweifel zum Ansatzpunkt für das kritische Denken und das freie Forschen erklärt. Damit läßt sich eine Formel von Mensch und Welt entwerfen, in der Maß, Zahl und Gewicht die entscheidenden Kriterien für »Wirklichkeit« darstellen.
Aber reichen diese Kriterien aus, um die ganze Wirklichkeit in den Blick zu bekommen? Was ist faktisch erreicht, nachdem die Welt mathematisch fassbar und technisch bezwingbar geworden ist? Geht mit dem Gewinn an äußerer, naturwissenschaftlich ergründbarer Wirklichkeit nicht gleichzeitig ein Verlust der inneren, spirituellen Dimension einher? Noch ahnt niemand, zu welchen lebensbedrohenden Konsequenzen eine derartige Wissenschaft führen wird. Immerhin ist festzuhalten: Am Gegenstand der materiellen Welt erwacht der Mensch mehr und mehr zu sich selbst. Er wird sich der Größe des Universums bewußt. Er tritt aus den Bindungen alter Ordnung heraus und erlebt sich als ein autonomes Ich. Dies ist der Prozeß, der sich im Zeitalter der Renaissance ankündigte und dem der Humanismus seinen Namen gab. Ein halbes Jahrtausend später wird ein geschundener Mensch im KZ die Summe ziehen: »Gott als moralische, politische, naturwissenschaftliche Arbeitshypothese ist abgeschafft, überwunden ... Es gehört zur intellektuellen Redlichkeit, diese Arbeitshypothese fallen zu lassen bzw. sie so weitgehend wie irgend möglich auszuschalten …« So weit Dietrich Bonhoeffer, als Widerstandskämpfer 1945 hingerichtet. Daß damit das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, wußte der evangelische Theologe genau. Damit ist lediglich ideengeschichtlich eine Linie gezogen.
Was den Übergang zum 17. Jahrhundert interessant erscheinen läßt, hängt mit der Art und Weise zusammen, wie spirituell Suchende den Gang der Entwicklung verfolgten, wie sie innere Erfahrung und äußere Naturforschung in der »universellen Lehre« (Pansophie) einzubringen suchten.
Allerdings um 1600 ist die Aufbruchsstimmung, die einst den jungen Augustinermönch Martin Luther beflügelt hatte, vorbei. Die religiöse Erfahrung des Wittenbergers, die zur reformatorischen Erkenntnis (ab 1513) und zur Proklamation der »Freiheit eines Christenmenschen« (1520) geführt hatte, war schon zu Luthers Lebzeiten einem Streit der Theologen gewichen. In diesem Streit geht es seit Mitte des 16. Jahrhunderts um religionspolitische – und das heißt allemal auch um machtpolitische – Interessen der Landesfürsten und Magistrate. Mit dem Feilschen um Bekenntnisformeln sucht man den Mangel an ursprünglicher religio zu bemänteln. Die Rabies theologorum (Wut der Theologen) feiert fragwürdige Triumphe. Das jahrzehntelange Ringen innerhalb des Protestantismus mündet irgendwann in den Dreißigjährigen Krieg ein. Daran kann auch die sogenannte Konkordien- und Eintrachtsformel von 1577 nichts ändern. Einer der maßgeblichen Mitautoren dieser innerprotestantischen Bekenntnisschrift ist der schwäbische Theologe Jakob Andreae (1528 bis 1590), einst Kanzler der Universität Tübingen.
Um die Jahrhundertwende hat der christliche Glaube also, jedenfalls in weiten protestantischen Kreisen, an Ursprünglichkeit eingebüßt. Er ist zum Streitobjekt zänkischer Pastoren geworden, die ihrerseits von Brot- und Landesherren abhängen (Wess’ Brot ich eß, dess’ Lied ich sing!). Der kopernikanische Schock hat die Zeitgenossen verunsichert: Der Himmel ist nicht mehr oben! Wo aber ist dann Gott? Droht in solcher Lage nicht die Flucht in eine weltferne Innerlichkeit? Oder gibt es eine Chance, Geist und Materie in der Schau des »Unus mundus«, d. h. der einen geistig-materiellen Welt miteinander zu verbinden?
Generalreformation im Zeichen von Kreuz und Rose
»Reformatio generalis«, so lautet die Parole zu Beginn des 17. Jahrhunderts, noch ehe die vom unversöhnlichen Konfessionalismus erhitzten deutschen Landesfürsten zum großen Krieg rüsten. Um 1604 und 1606 erregt ein Komet die Gemüter vieler. Apokalyptische Weissagungen machen die Runde. Will sich nicht endlich das Reich des Heiligen Geistes verwirklichen, das der kalabresische Seherabt Joachim von Fiore schon vor Jahrhunderten schauend vorausnahm?
Unbekümmert um den Theologenzwist, der vor allem von lutherischen Kanzeln und Kathedern geführt wird, vertiefen sich jene Stillen im Lande in heimlich kopierte Manuskripte, etwa im Schlesischen, wo seit 1612 die geistvoll-wunderliche »Morgenröte im Aufgang« des Görlitzer Schusters Jakob Böhme von Hand zu Hand geht. Diese von der lutherischen Orthodoxie als gefährliche Ketzerei verleumdete »Aurora« ist Niederschlag einer geistigen Schau, in der Schöpfer und Schöpfung, Natur und Geist eben jene pansophische Synopse darstellen, nach der die Sucher und die spirituell Wachen verlangen. Aber die Nachstellungen der protestantischen »Inquisition« sorgen dafür, daß die Geschichte des Jakob Böhme für geraume Zeit nur den verschwiegenen Zirkeln einer mystisch-theosophischen Esoteriker-Kirche bekannt wird.
Da erscheint im Jahre 1614 ein anonymes Buch mit dem gewichtigen Titel »Allgemeine und Generalreformation der ganzen weiten Welt« mit einem Appendix, dem relativ kurzen Text »Fama Fraternitatis des löblichen Ordens des Rosenkreuzes an alle Gelehrte und Häupter Europas geschrieben ...«
Ein erstaunliches Konvolut, denn bei dem erstgenannten Titel handelt es sich um eine Übersetzung einer satirischen Schrift, in der der kurz zuvor verstorbene T. Boccalini die Vorschläge zur Weltverbesserung, zu all den ersehnten Reformen, lächerlich macht. Dennoch erkennt der habsburgfeindliche italienische Liberale die Notwendigkeit einer neuen Reformation an. Er schreibt im Geist des Giordano Bruno, der im Jahre 1600 auf dem Campo dei fiori als Ketzer öffentlich verbrannt worden ist. Während Boccalinis Ausführungen eher von Melancholie und Trübsinn gekennzeichnet sind, ist die rosenkreuzerische »Fama« vom Feuer einer jugendlichen Begeisterung durchglüht. Mit erstaunlichem Selbstbewußtsein meldet sich der ungenannte Autor zu Wort. Oder sind es mehrere?
»Wir, die Brüder der Fraternität des R. C. (d. i. Rosenkreuz) entbieten allen und jedem, die diese unsere Fama christlicher Meinung lesen, unsern Gruß, Liebe und Gebet.«
Kaum ist der Gruß entboten, gehen der bzw. die Autoren zum Angriff über. Er richtet sich gegen die »unbeson-nene Welt« derer, die auf die alten Autoritäten in Kirche und Schule, in Theologie und Philosophie schwören und dadurch den Gang der Entwicklung hemmen. Um nichts Geringeres als um »das Ziel einer Generalreformation« geht es den Brüdern der »Fraternität des hochlöblichen Ordens vom Rosenkreuz«. Und kein anderer als »der tief-sinnige, geistvolle und hocherleuchtete Vater und Bruder C. R. C., ein Deutscher, unserer Fraternität Haupt und Begründer« hat sich um die Annäherung an dieses große Ziel bemüht: durch seinen Studiengang, durch Reisen in den Osten, durch die Verschmelzung vorderorientalischer Weisheit mit der christlichen Spiritualität, schließlich durch die Stiftung besagten Ordens vom Rosenkreuz. Die Fama gibt darüber nähere Auskunft.
»Sprechender« Buchtitel, wie er zur Barockzeit üblich ist
Die Doppelsinnigkeit des »Rosenkreuzes« liegt auf der Hand; denn einerseits handelt es sich bei »Frater C. R. C.« (d. i. Bruder Christianus Rosencreutz) um die Persönlichkeit des Stifters; auf der anderen Seite bezeichnet der Name das Doppelsymbol von Kreuz und Rose. Ist das Kreuz durch die Passion und den Tod Jesu Christi eindeutig bestimmt, so repräsentiert die Rose in besonderer Weise das neue Leben, das dem (mystischen) Tod abgerungen werden soll. Und eben auf diesen Mysteriengang weist die Fama im Text selbst ausdrücklich hin:
Ex deo nascimur, In Jesu morimur, Per spiritum reviviscimus.
Aus Gott sind wir geboren, In Jesu sterben wir, Durch den (Hl.) Geist werden wir wiedergeboren.
Nun ist die Verbindung von Kreuz und Rose spätestens seit Martin Luther bekannt:
Des Christen Herz auf Rosen geht, Wenn’s mitten unterm Kreuze steht.
Über sein Wappen hat sich der Wittenberger Reformator selbst unmißverständlich geäußert, nämlich im Coburger Brief vom 8. Juli 1530 an den Nürnberger Ratsschreiber Lazarus Spengler, indem er das »Merkzeichen« seiner Theologie wie folgt interpretiert:
»Das erste soll ein schwarz’ Kreuz sein im Herzen, welches Herz seine natürliche (d. h. rote) Farbe hat, damit ich mir selbst Erinnerung gebe, daß der Glaube an den Gekreuzigten uns selig macht ... Ob’s nun wohl ein schwarz’ Kreuz ist, mortifiziert (tötet) und soll auch weh tun, dennoch läßt es das Herz in seiner Farbe, verderbt die Natur nicht, das ist, es tötet nicht, sondern es erhält lebendig … Solch ein Herz soll aber mitten in einer weißen Rose stehen, anzuzeigen, daß der Glaube Freude,Trost und Friede gibt und sogleich in eine weiße, fröhliche Rose setzt, nicht wie die Welt Friede und Freude gibt …«
Die Rose in Luthers Wappen
Wenngleich Luther hier von einer weißen Rose spricht – er tut’s im Zusammenhang des roten Herzens –, so spricht doch die Kombination von Kreuz und Rose für sich. Der Autor der Fama beschränkt sich im übrigen nicht darauf, die Theologie Luthers zu symbolisieren. Ihm geht es um mehr, nämlich um ein neues, dem Schwarz des Kreuzes abgerungenes Leben. Und er läßt keinen Zweifel darüber aufkommen, daß jener Christian Rosenkreuz selbst eine Imagination, eine ideelle Verkörperung dieses Lebens ist, also keine historische Persönlichkeit. Der Text nennt ihn geradezu »Granum pectoris Jesu insitum«, d. h. das dem Herzen Jesu eingepflanzte Samenkorn. Als solches sei Rosenkreuz für sein Jahrhundert (das 14.) der Träger göttlicher Offenbarung, der Hüter himmlischer wie irdisch-menschlicher Mysterien gewesen. Diese mit dem Namen Christian Rosenkreuz verbundene Spiritualität gilt es zu erwekken. Zu eben diesem Zweck tritt der (imaginäre) Orden der Rosenkreuzer an die Öffentlichkeit.
Die »Fama« ist somit das erste ihrer Manifeste, zugleich eine Einladung an die Geistesverwandten in allen Regionen Europas, die Ziele dieser aus der Verborgenheit heraustretenden Bruderschaft zu prüfen, ihr zu antworten, gegebenenfalls sich ihr anzuschließen. Ihre Arbeit, das »Ergon« oder Werk, ist nicht die Pseudo-Alchymie »gottloser und verfluchter Goldmacher«. Zur Alchymie und Theosophie im Sinne des Paracelsus bekennen sich die Rosenkreuz- Brüder gleichwohl. Aber mit ihrem Ordensstifter sagen sie:
»Was soll das Gold, denn welchem die ganze Natur offensteht, der freut sich nicht, daß er Gold machen kann …, sondern daß er den Himmel offen sieht und die Engel Gottes auf- und herniedersteigen, und daß sein Name eingeschrieben steht im Buch des Lebens.«
Ein Jahr später (1615) reicht die sogenannte Bruderschaft des Rosenkreuzes ihr zweites Manifest nach, betitelt »Confessio Fraternitatis«. Was in der Fama in ersten Umrissen an den Tag tritt, das wird nun in mancher Hin- sicht als eine Art »Bekenntnis« ergänzt. Die mythische Redensweise ist beibehalten. Der Schleier des Geheimnisses liegt weiterhin über den bilderreichen Texten. Und als im Jahr darauf (1616) der anonyme Autor sein drittes Buch, diesmal ausführlicher, eher noch geheimnisvoller, im Druck erscheinen läßt, da rückt er den Ordensgründer gleich in den Titel: »Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz. Anno 1459«. Die Faszination, die von diesen beiden Manifesten und von dem alchymistisch-hermetisch getönten, barock-weitschweifig sich gebenden Einweihungsroman der »Chymischen Hochzeit« ausgeht, ist erstaunlich groß, auf Jahrhunderte hinaus, wenngleich mit Unterbrechungen und in vielfältigen Abwandlungen. Reformation im Zeichen von Kreuz und Rose ist offensichtlich die geheime Sehnsucht Ungezählter. Vieles spricht dafür, daß eine wie auch immer geartete Rosenkreuzer-Gemeinschaft ebenso den Erwartungen entspricht, wie »Bruder Christian Rosenkreuz« das Urbild eines spirituellen Meisters darstellt. Und in der Tat, Christian Rosenkreuz, dessen Geburtsjahr die Confessio mit der Jahreszahl 1378 angibt, trägt archetypische Züge; gerade deshalb konnte er zu einer zentralen Figur neuzeitlicher Esoterik werden. Eine Gestalt, die die Ideale einer ganzen Epoche in sich vereint, die Vereinigung von Gottes- und Naturerkenntnis, eine christliche Spiritualität mit pansophischen Zügen.*
Eine historisch nachweisbare rosenkreuzerische Vereinigung hat es vor Erscheinen der Manifeste ebensowenig gegeben wie eine dokumentarisch belegbare Persönlichkeit namens Christian Rosenkreuz. Gleichwohl haben die Brüder des Rosenkreuzes große geschichtliche Vorbilder, denkt man beispielsweise an die Gottesfreunde-Bewegung in den Mystikerkreisen des hohen Mittelalters, an die Bruderschaften der Bauhütten, an den Templerorden, an die Brüder vom gemeinsamen Leben, die sich ihrerseits von den der Häresie verdächtigten Brüdern und Schwestern des freien Geistes abzuheben versuchten. Ist die Bruderschaft des Rosenkreuzes bzw. der Rosenkreuzer eine bloße Fiktion, ein »Märlein«? Hier stellt sich die Frage nach Herkunft und Autorschaft der drei esoterischen Texte.
* Vgl. Gerhard Wehr, Christian Rosenkreuz. Urbild und Inspiration neuzeitlicher Esoterik. Freiburg 1980.
Johann Valentin Andreae und sein Kreis
Mag es auch der Forschung schwerfallen, einen Rosenkreuzer-Orden zu ermitteln, wie er in Fama und Confessio Fraternitatis als existent vorausgesetzt wird, so steht doch die starke Neigung zu derartigen Verbindungen in dieser Umbruchszeit außer Frage. Der esoterische, auf Geheimhaltung ausgerichtete Charakter derartiger Zirkel liegt ebenfalls nahe,gilt es doch, das Erkenntnisstreben dem Häresieverdacht gegenüber der lutherischen Orthodoxie und der landesherrlichen Zensur abzuschirmen. Zur traditionellen Alchymie und Astrologie ist als weiteres spekulatives Forschungsgebiet die Kabbala hinzugetreten. Seit der Renaissance sucht man diese Form der jüdischen Mystik mit dem Christentum zu versöhnen, durch den Filter »christliche Kabbala«. Auch innerhalb der älteren protestantischen Mystik hat sich bereits eine eigentümliche Verschmelzung jüdisch-kabbalistischer und christlich-mysti- scher Traditionen vollzogen*, so vor allem bei Jakob Böhme, auch wenn er sich in seinen Schriften nicht ausdrücklich auf die jüdische Mystik beruft. Damit sind die Gebiete beisammen, aus denen die nach umfassender Reform Strebenden um 1600 die Fermente entnehmen, um sie mit lutherischem und paracelsischem Geist, vor allem aber mit Einsichten der neueren Naturwissenschaft zu einer Ganzheitsschau pansophisch zu vereinigen.
Die Suche nach den Urhebern der anonymen Rosenkreuzer-Schriften führt nach Tübingen. Hier, am Sitz der alten Universität Württembergs, existiert ein Freundeskreis, der sich der Fragen der Zeit annimmt, allen voran der Jurist Christoph Besold, die Mediziner Tobias Heß und Wilhelm Bidembach, dann neben einer Reihe anderer der junge Theologe Johann Valentin Andreae, offensichtlich die Seele dieses Gelehrtenzirkels. Er ist der Enkel jenes Jakob Andreae, der sich einst als Kanzler der Universität um die – allerdings nur zeitweilige – Aussöhnung der zerstrittenen Religionsparteien verdient gemacht hat. Wenn es auch in der Natur der Sache liegt, daß sich ein solcher Kreis von Gleichgesinnten gegenseitig geistig anregt und bestätigt, so kommt doch kein anderer als J. V. Andreae als Autor der rosenkreuzerischen Manifeste und der »Chymischen Hochzeit« in Betracht. Daß die Andreae-Familie ein Andreas-Kreuz mit vier Rosen im Wappen führt, unterstreicht den geradezu existentiellen Bezug, den der Autor zur Leitfigur seiner esoterischen Schriften hat. Hier wird offenbar Andreaes eigene Sache verhandelt, jedoch so, daß eine ganze Epoche, zumindest die spirituell Suchenden, zutiefst angesprochen sind.
Von der Bruderschaft der Rosenkreuzer zur Christianopolis
Die Veröffentlichung und rasche Verbreitung der drei rosenkreuzerischen Schriften brachte alles andere als eine »Erleuchtung im Zeichen des Rosenkreuzes« (Frances A. Yates). Der Autor, der sich von Anfang an wohlweislich hinter seiner Anonymität versteckt hielt, mußte sehen, daß sich spekulative Geister, Illusionisten und erklärte Gegner seiner Sache annahmen. Wohl wirkte das Doppelsymbol von Kreuz und Rose in Verbindung mit der Manifestation des Ordens wie ein Fanal, eine wahre Rosenkreuzer-Epidemie brach aus. Aber nur die wenigsten waren offensichtlich in der Lage, sich von dem zugrunde liegenden Impuls anstoßen zu lassen. So blieb Andreae nichts anderes übrig, als sich sehr bald von seinen literarischen Produktionen zu distanzieren, sie als »jugendliche Kühnheit«, als »eine Posse voll abenteuerlicher Auftritte«, ja als Spielerei (Ludibrium) abzutun. Und doch sind Satire, Scherz und Spiel für Andreae stets auch eine Möglichkeit, an bestehenden Verhältnissen Kritik zu üben, Mißstände bewußt zu machen und die kreative Phantasie mit Blick auf Reformen anzuregen. In seiner Schrift »Mythologiae« (1619) heißt es hierzu:
»Ich habe gleichsam durch ein Spiel und Kurzweil den sinnreichen und lernbegierigen Leser mit Lust zu göttlichen Sachen anführen und lehren wollen, wie und welcher Gott das wahre und höchste Gut sich in allen menschlichen Dingen scheinbarlich betasten, greifen und genießen lasse.«
Demnach wäre in der »Chymischen Hochzeit« ein siebenstufiger Erkenntnisweg zu sehen, zumindest eine Anregung, einen solchen inneren Weg der spirituellen Entwicklung zu suchen. Vor allem eines liegt dem Autor am Herzen, und zwar schon, um seine eigene argwöhnisch betrachtete Rechtgläubigkeit vor dem Kirchenregiment zu bewahren, nämlich die Sache des Christentums. Und als er – ebenfalls 1619 – seinen »Turris Babel« (Turm zu Babel) abfaßt, um sich in aller Form von einer chaotisch gewordenen »Rosenkreuzerei« loszusagen, schreibt er im Schlußkapitel:
»Wohlan, ihr Sterblichen, ihr dürft auf keine Bruderschaft mehr warten. Die Komödie ist aus. Die Fama hat sie aufgeführt und auch wieder abgeführt. Die Fama sagt Ja; jetzt sagt sie Nein!« Und weiter: »Wie ich die Gesellschaft der Bruderschaft zwar fahren lasse, so doch niemals die wahre christliche Bruderschaft, welche unter dem Kreuz nach Rosen duftet.«*
Obwohl sich Andreae in den Jahren nach der Veröffentlichung der »Chymischen Hochzeit« mehr und mehr von seinen rosenkreuzerischen Schriften entfernt, so geschieht das letztlich nur in formaler und in terminologischer Hinsicht. An der Sache selbst, nämlich am Plan einer christlichen Gemeinschaft (»Societas Christiana«), hält er fest. Wohl zwingt ihn das Mißverständnis der Pseudo-Rosenkreuzer, aber auch der Häresieverdacht, von seinen mythischen und mysterienhaften Dichtungen Abstand zu nehmen. Aber weiterhin liegt ihm eine neue Gesellschaft der Christen, ja eine christliche Verbrüderung am Herzen, »welche unter dem Kreuz nach Rosen duftet«. In den Blick faßt der junge Pfarrer Andreae eine christliche Gesellschaft, einen christlichen Musterstaat, analog den großen Staatsutopien – Thomas Morus’ »Utopia« (1516), Francis Bacons »Nova Atlantis« oder Tommaso Campanellas »Civitas Solis« (Sonnenstaat), das in Manuskriptform schon 1612 in Deutschland bekannt wurde und dem umsichtigen Büchersammler Andreae in die Hände gefallen ist.
Wirkungen bis in die Gegenwart
Idee und Manifestationen des Rosenkreuzertums haben eine überaus wechselvolle Geschichte gehabt, eine Geschichte, deren Ende noch nicht abzusehen ist. Schon deshalb ist es gerechtfertigt, sich ihrer Anfänge in den Schriften Andreaes zu vergewissern. Mit Richard von Dülmen kann man drei Gruppen unterscheiden: zum einen die Rosenkreuzer-Enthusiasten, die die mystische Redeweise der Manifeste wortwörtlich nahmen, also das Ideenbild mit der konkreten Wirklichkeit verwechselten. Trotz gründlicher historischer Forschung begegnet man immer noch Verfechtern eines Rosenkreuzertums, das die archetypische Gestalt jenes Christian Rosenkreuz als eine historische Persönlichkeit mißversteht. Entsprechend suchen sich diverse Rosenkreuzerbünde mit dem angeblich hohen Alter des Ordens, der bis in die antike Mysterienwelt zurückreichen soll, zu legitimieren.
Neben solchen fundamentalistischen Enthusiasten, die gar nicht merken, daß sie ihre Sache durch derartige Objektivierungsversuche in Mißkredit bringen, stehen maßvolle Verteidiger, d. h. Menschen, die die spirituelle Berechtigung dessen anerkennen, was in der imaginativen, von Symbolen und Gleichnissen durchzogenen Sprache veranschaulicht ist. Ob man dergleichen als Rosenkreuzertum bezeichnet oder nicht, ob man dem Berichteten historische Faktizität zuerkennen kann oder nicht, ist nicht das Entscheidende. Ein Archetypus, ein echtes Symbol wirkt durch seine Präsenz. Die äußere Datierbarkeit ist von zweitrangiger Bedeutung.
An dritter Stelle rangieren schließlich die erklärten Gegner des Rosenkreuzertums, die in ihm Ausgeburten einer fehlgeleiteten Phantasie erblicken und die Rosenkreuzer insgesamt als »Erznarren« ansehen. Je nach Rang und Einfluß der Gegner wird die Schutzbedürftigkeit der Diffamierten im Zeitalter des Absolutismus dringlich. Schon von daher ist Andreae bemüht, seine eigene Rechtgläubigkeit auf Schritt und Tritt zu beteuern. Seine Christianopolis- Schrift widmet er daher einem vielgelesenen Theologen seiner Zeit: Johann Arndt, dem Verfasser der berühmten »Vier Bücher vom wahren Christentum«, die innerhalb weniger Jahre eine weite Verbreitung gefunden hatten – mit ihr die Hochschätzung der Mystik im orthodoxen Luthertum, zugleich als Vorbereitung des Pietismus. W. E. Peuckert nannte Arndt einen »halben Rosenkreuzer«. Wer als ein ganzer bzw.ein echter Rosenkreuzer anzusprechen sei, bleibt – je nach Standort– naturgemäß umstritten, zumal der Dreißigjährige Krieg die Bildung einer rosenkreuzerischen Vereinigung unmöglich machte. Aber zahlreiche Einzelne, rosenkreuzerische Sympathisanten, lassen eine Annäherung an die Idee Andreaes erkennen, angefangen bei Johann Amos Comenius und Michael Maier, dem Leibarzt Rudolf II., dann bei Daniel Mögling aus Konstanz, der sich auch Theophilus Schweighart (d. i. schweigsamer Gottesfreund!) nennt. Selbst René Descartes bekundet zeitweise ein gewisses Interesse an der Rosenkreuzeridee. In England gelten u. a. Robert Fludd (1574–1637) und Elias Ashmole (1617–1692) als Protagonisten eines Rosenkreuzers. Aber alle diese an sich honorigen Vertreter eines weltoffenen und doch den Mysterien des Christentums zugetanen Rosenkreuzer, Ärzte, Theologen, Naturforscher können nicht verhindern, daß die Bezeichnung »Rosenkreuzer« in Mißkredit gerät.