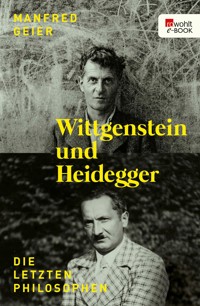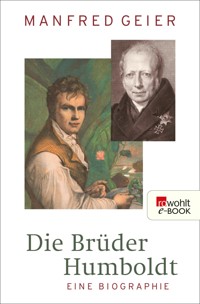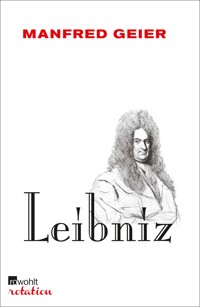5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Rowohlt E-Book Monographie Martin Heidegger, der aus dem Kleinen eines provinziellen Lebens kam, inszenierte sein Leben und Denken als schicksalhafte Suche eines Metaphysikers nach dem «Geheimnis des Großen». In dramatischen Rückfällen und stets neuen Anläufen erschien es dem einflussreichen Denker als Gott, Dasein, Sein, Nationalsozialismus, schließlich als Dichtung und als Technik. In dieser kurzen Biographie erfährt der Leser alles Wichtige über Leben und Werk den großen Philosophen. Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Manfred Geier
Martin Heidegger
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Vorwort
Als Martin Heidegger am 27. Mai 1933 bei der feierlichen Übernahme des Rektorats der Universität Freiburg am Ende seines Vortrags die Herrlichkeit und Größe des völkischen Aufbruchs pries, zitierte er eine alte griechische Weisheit: «Alles Große steht im Sturm …» (GA 16, 117)[1] Das war, wie er wusste, eine recht eigenwillige Interpretation von Platons nachdenklicher Feststellung «megala panta episphale», die alles Große, wörtlich übersetzt, als «bedenklich, zum Fallen geneigt und gefährdet» charakterisiert hatte. Heidegger kannte auch den politischen Hintergrund des Zitats. Der philosophische Einsatz Platons für den Tyrannen aus Syrakus war gescheitert. Doch warum verschob Heidegger jene tiefe und weite Besonnenheit, die er auch in Platons Aussage vernahm, 1933 ins Heroische eines großen Sturms?
Heideggers kurzfristiges Sympathisieren mit der inneren Wahrheit und Größe des Nationalsozialismus (GA 40, 208) hat die Auseinandersetzung mit seiner Person und seinem Werk nachhaltig politisiert. Gestritten wird um das komplementäre Problem: Wie konnte dieser große Denker vor allem 1933/34 der nationalsozialistischen Propaganda auf den Leim gehen? Oder gibt es in seiner Philosophie eine Disposition zum Totalitarismus des Dritten Reichs? So unausweichlich diese Fragestellung auch sein mag, hat sie doch Heideggers Leben und Philosophieren problematisch verkürzt oder in ein schiefes Licht gerückt. Denn wenn man sein ganzes Werk überblickt, dann bildet «Heidegger und der Nationalsozialismus» nur eine Etappe auf einem langen Weg, zu dem von Anfang an die Herbheit des Gespaltenseins, der Rückfälle u. neuen Anläufe (Blo, 7)[2] gehörte.
Das Bild von Rückfall und Anlauf verweist auf die «Größe», die Heidegger anstrebte. Sein ganzes Leben war von der Idee beherrscht, Großes zu denken und zu tun. «Größe» war zwar keine philosophische Kategorie für ihn. Aber ohne ihre orientierende Macht hätte Heidegger seinen Denkweg nicht gehen können. Der Mensch muß erst selbst im Grunde seines Wesens groß werden, um die großen Dinge zu sehen und in ihre Gefolgschaft zu treten. (GA 16, 284) Darin sah er die zentrale Aufgabe seiner geistigen Arbeit.
Der Philosoph, der aus kleinen Verhältnissen kam, wollte nicht in der Beständigkeit des Kleinen verharren, in dem stumpfen Eigensinn des alltäglich Immer-Selbigen, das sich gegen jeden Wandel sperrt. Er wollte das Geheimnis des Großen verstehen, um sich daran selbst zu erhöhen. Aber was waren die großen Dinge, denen er zu folgen suchte?
Heidegger war ein Meister der Verschiebung. Sein Wunsch nach Größe blieb zwar lebenslang gleich wirksam, und seine immer wieder neuen Anläufe und Rückschläge demonstrieren ein einzigartiges geistiges Abenteuer. Aber im Lauf der Zeit veränderten sich die Größen, nach denen er strebte. Stand am Beginn die Heimat, weil Heidegger in ihrer vertrauten Einfachheit das Rätsel des Bleibenden und des Großen (GA 13, 89) verwahrt glaubte, so traten nacheinander Gott, Dasein, Sein, Nichts, deutsches Volk, ursprüngliches Denken und große Dichtung an ihre Stelle. Am Ende aber stand das Gestell der planetarischen Technik, das ins Riesenhafte wuchs. Wie eine letzte, ernüchterte Einsicht liest sich, was Heidegger im «Spiegel-Gespräch» am 23. September 1966 festgestellt hat: Für uns Heutige ist das Große des zu Denkenden zu groß. (GA 16, 683) So blieb schließlich nur eine stille Gelassenheit, mit der sich Heidegger ins große Welt-Geviert von Erde und Himmel, Göttlichen und Sterblichen einfügen wollte.
Ich habe versucht, den einzelnen Etappen von Heideggers Denkweg zu folgen, den er selbst als schwankend und umstellt von Rückschlägen und Irrgängen (GA 66, 411) erlebte. Es war auch ein Weg durch die großen Illusionen und Katastrophen des 20. Jahrhunderts, die in Heideggers Werk ihren philosophischen Ausdruck gefunden haben. Heideggers Irren hat exemplarischen Wert. Alles Streben zum Größten ist zum Fallen geneigt. In seinem Todtnauberger Text Aus der Erfahrung des Denkens kommentierte Heidegger seine Spruchweisheit Wer groß denkt, muss groß irren mit dem Hinweis: Die Irrnis der großen Denker (positiv gedacht) ist noch nicht bemerkt. (GA 13, 254) Vielleicht hat er sich auch darin getäuscht.
Heimat 1889–1903
Am 26. September 1959 wurde Martin Heidegger Ehrenbürger seiner Heimatstadt Meßkirch. Es war an seinem 70. Geburtstag. Das war ein guter Anlass, sich wieder einmal an das Heimatliche zu erinnern, in dem er sich noch immer verwurzelt fühlte. Er dankte seinen Mitbürgern und dachte sich zurück in das Gewesene, das heißt in jenes, was versammelt noch währt und uns bestimmt (GA 16, 559). Es war eine besinnliche Rede, in der das so lang zurückliegende Leben des Kindes und jungen Mannes in Meßkirch nicht als vergangen zur Sprache kam, sondern als gewesen, noch immer lebendig und bestimmend also, auch wenn es nur in der Erinnerung präsent war.
Es war ein gebrochener Tonfall, mit dem Heidegger von seinen heimatlichen Wurzeln sprach. Denn er dankte und dachte im Bewusstsein der Heimatlosigkeit, die für ihn zum Wesen des modernen Menschen gehörte. Die Heimatlosigkeit wird ein Weltschicksal, hatte er schon im Herbst 1946 in seinem Brief über den «Humanismus» an den französischen Freund Jean Beaufret geschrieben und dabei vor allem Karl Marx zugestimmt, der von Hegel her und aus der Heimat vertrieben die Entfremdung des Menschen (GA 9, 339) erfahren und wie kein anderer in ihrer geschichtlichen Tiefendimension erkannt hatte. In zahlreichen Reden und Aufsätzen hat Heidegger vor allem in den fünfziger Jahren die Spannung zwischen Heimat und Heimatlosigkeit dramatisiert, zwischen den unscheinbaren Kräften des Heimischen und der Gewalt des Unheimischen, zwischen Bodenständigkeit und Entwurzelung. Noch seine allerletzte handschriftliche Notiz galt diesem Widerstreit. Wenige Tage vor seinem Tod am 26. Mai 1976 hat er ein Grußwort an den neuen Ehrenbürger der gemeinsamen Heimatstadt Meßkirch gesandt, seinen befreundeten Landsmann und Kollegen Bernhard Welte: Es bedarf der Besinnung, ob und wie im Zeitalter der technisierten gleichförmigen Weltzivilisation noch Heimat sein kann. (GA 13, 243)
Es war kein «naiver» Begriff der Heimat, den Heidegger entfaltete. Denn Heidegger fühlte sich bedrängt durch das Bewusstsein, dass Heimat als solche unwiederbringlich verloren zu gehen drohte. Die Vergegenwärtigung des Heimatlichen entsprach jenem «sentimentalischen Interesse»[3], das Friedrich Schiller gegen naive Illusionen als ein Zeichen des Verlustes reflektiert hatte. Der Mensch der Neuzeit kann nicht mehr, wie die Griechen, natürlich und heimatlich empfinden. Er kann nur noch an das Natürliche und das Heimatliche denken wie an ein verlorenes Gut. Sein Gefühl für Natur und Heimat «gleicht der Empfindung des Kranken für die Gesundheit»[4]. Doch nicht von Schiller, sondern von Novalis ließ sich Heidegger das entscheidende Stichwort geben. Denkwürdig schien ihm eine fragmentarische Notiz dieses romantischen Philosophen zu sein, der die Grundstimmung des Philosophierens als Heimweh identifiziert hatte: «Die Philosophie ist eigentlich Heimweh, ein Trieb überall zu Hause zu sein.» Heidegger wusste, dass dieses «Heimweh» in der Moderne zu einem fast schon unverständlichen Wort geworden war, selbst im alltäglichen Leben. Aber er hielt es dennoch für eine treffende Chiffre, um eine grundlegende philosophische Stimmung zu bezeichnen. Denn auch für ihn war Philosophieren Ausdruck dieses Heimweh-Triebes. Wer philosophiert, zielt auf das In-der-Welt-Sein, um in diesem Ganzen wohnen zu können, aus dem er immer schon vertrieben worden ist: Ein solcher Trieb kann Philosophie nur sein, wenn wir, die philosophieren, überall nicht zu Hause sind. (GA 29/30, 7)
Auch die Heimat bedrängte Heidegger nur als gewesen und fern. Je mehr ihm bewusst wurde, dass wir die Erwartung an das Heimatliche der Heimat nicht mehr weiterhegen (GA 16, 711) dürfen, desto sentimentalischer wurde sein Heimweh. Vor allem dem alemannischen Dichter Johann Peter Hebel fühlte er sich verwandt, dessen heimatliche Naturempfindung und natürliche Muttersprache Heidegger bewunderte, weil er in seinen «Alemannischen Gedichten» (1803) und seinem «Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes» (1811) das Unscheinbare zum Scheinen gebracht hatte aus der Sehnsucht nach der verlorenen Heimat. Das Wesen der Heimat gelangt erst in der Fremde zum Leuchten. (GA 13, 123f.)
Als Heidegger am 27. September 1959 sein Wort des Dankes an die lieben Mitbürger und Gäste in Meßkirch richtete, zitierte er auch Friedrich Nietzsches «Der Philosoph ist eine seltene Pflanze». (GA 16, 560) Er braucht seinen eigenen Boden, in dem er wurzelt, um ins Freie und Weite wachsen zu können. Das gleiche Bild fand Heidegger auch bei Hebel; und mehrmals hat er es im Andenken an seine eigene Herkunft zitiert, die ihm so viel auf seinen langen Wegen des Denkens mitgegeben hatte: «Wir sind Pflanzen, die – wir mögen’s uns gerne gestehen oder nicht – mit den Wurzeln aus der Erde steigen müssen, um im Äther blühen und Früchte tragen zu können.» (GA 13, 150; GA 16, 521) Als Erde galt Heidegger alles, was uns sinnlich nährt und trägt, vor allem jene Tiefe des heimatlichen Bodens, auf dem der Mensch stehen kann in seiner Beständigkeit. Über ihm erstreckt sich der ätherische Himmel, den Heidegger als offenen Bereich des Geistes (GA 16, 521) verstand, in dessen nicht-sinnliche Höhe der Mensch hinaufsteigen können muss, wenn sein Werk gelingen soll.
Am 26. September 1889 wurde Martin Heidegger in Meßkirch geboren. Siebzig Jahre später hat er in seiner Ehrenbürger-Dankesrede selbst darauf hingewiesen, dass dieser heimatliche Boden, die Erde und der Himmel über ihm nichts Auffallendes haben, nichts Ungewöhnliches, nichts Hervorragendes (GA 16, 560). Meßkirch ist nur ein kleines Landstädtchen, gelegen in einer kargen und rauen Landschaft zwischen Bodensee, oberer Donau und Schwäbischer Alb. Hoch ragt nur das mächtige Schloss, flankiert durch die im spätgotischen Stil erbaute St.-Martins-Kirche, an der Heideggers Vater, neben der Arbeit als Küfermeister, seinen Kirchendienst leistete. Nichts Ungewöhnliches also, aber doch Heimat, in der der junge Martin die spendenden und heilenden und bewahrenden Kräfte des Heimischen (GA 16, 576) erleben konnte.
Es war eine «sorglose Jugendzeit»[5], die Martin und sein fünf Jahre jüngerer Bruder Fritz (1894–1980) vor allem dem einfach umgrenzten Lebenskreis (GA 16, 594) ihres Elternhauses verdankten, das weder arm noch reich war. Als «kleinbürgerlich wohlhabend» in materieller Hinsicht hat es der Bruder charakterisiert, wobei in der Familie das Zeitwort «sparen» groß geschrieben wurde.
Der Vater, Friedrich Heidegger (1851–1924), war «ein großer Schweiger»[6], der jahraus, jahrein fleißig als Küfer in seinem Ein-Mann-Betrieb arbeitete, zehn Stunden am Tag und sechs Tage in der Woche. In der Werkstatt dieses wortkargen Mannes, wo er das Kiefern- und Eichenholz für die Kübel, Zuber und Fässer zurichtete, bastelten auch seine beiden Söhne gern. Die Härte und der Geruch des Eichenholzes werden Martin Heidegger sein Leben lang sinnlich gegenwärtig bleiben. Aus der Eichenrinde schnitzten die Kinder ihre Schiffe, die sie dann im Bach oder im Schulbrunnen schwimmen ließen.
Oft folgten sie ihrem Vater auch auf dem Feldweg ins Gehölz, wo er das Material für seine Arbeit holte. Dann sahen und hörten sie, wie mitten im Wald eine Eiche unter dem Schlag der Holzaxt fiel und sonnige Waldblößen (GA 13, 88) den Wald hell werden ließen. Der dunkle, dicht verwachsene Wald, der altertümlich «Dickung» genannt wurde und in dem man sich so leicht verirren konnte, lichtete sich in die Offenheit der «Lichtung», wo im Licht der Sonne und unter dem Blau des Himmels alle Dinge am reinsten sichtbar werden konnten. Etwas lichten bedeutet: etwas leicht, etwas frei und offen machen, z.B. den Wald an einer Stelle frei machen von Bäumen. Das so entstehende Freie ist die Lichtung[7], wird Heidegger noch 1964 erläutern, um die Aufgabe des Denkens zu bestimmen. In den Lichtungen kann das Licht des Denkens einfallen, um mit dem Dunklen streiten und spielen zu können. Denn auch das Dunkle braucht die Lichtung. Wie könnten wir sonst in das Dunkle geraten und es durchirren?[8]
So also hatte Martin Heidegger in den heimatlichen Wäldern das Lichten jener Lichtung (GA 4, 56) kennengelernt, das er später in den Mittelpunkt seiner Philosophie der ursprünglichen Natur («physis») und der Wahrheit stellen wird. Das griechische «physis» wird ihm als Aufgehen in das freie Offene verstehbar sein, als ein Hervorgehen und Sichöffnen, bei dem sich die Dinge in ihrem Aussehen («eidos», «idea») zeigen können; und als Wahrheit wird er das Unverborgene («aletheia») zu denken versuchen, in dem die heimatliche Erfahrung der Waldlichtungen nachwirkt.
Ebenfalls in den Wäldern um Meßkirch wurden Martin Heidegger die Holzwege vertraut, die meist verwachsen jäh im Unbegangenen aufhören (GA 5, Motto). Vor allem die Holzmacher und Waldhüter wussten sie zu nutzen. Doch auch der Philosoph wird sich viele Jahre später noch an diese früh erfahrenen Holzwege (GA 5) erinnern und 1949 eine Sammlung seiner Vorträge unter ihrem Namen veröffentlichen: Sie gehen in die Irre. Aber sie verirren sich nicht. (GA 13, 91)
Im gleichen Jahr wird Heidegger auch dem Feldweg seiner Jugend, der unmittelbar hinter dem Hofgartentor begann und in sanften Windungen durch Wiesen und Felder zum Ehnfried verlief, eine Schrift der Erinnerung und Orientierung widmen. Es kam ihm darauf an, wieder auf den Zuspruch des Feldweges zu hören und gegen die zerstreute Weglosigkeit des Menschen noch einmal den Sinn dessen zu vernehmen, wovon auch die hohe Eiche am Waldrand einst zu ihm gesprochen hatte: dass in ihrem langsamen und steten Wachstum allein gegründet wird, was dauert und fruchtet: daß wachsen heißt: der Weite des Himmels sich öffnen und zugleich in das Dunkel der Erde wurzeln (GA 13, 88). Nur im Schutz der tragenden Erde ließ sich der Anspruch des höchsten Himmels erfüllen. Auf diesem Feldweg lernte Heidegger, wovon und wohin er sich sein Leben lang führen ließ. Er strebte nach dem Großen, Weiten und Freien, das sich ihm im anfänglich Kleinen, Sanften und Begrenzten gezeigt hatte.
Vom Ehnfried kehrt der Weg zurück zum Hofgartentor, und hinter dem Schloss ist der Turm der St.-Martins-Kirche zu sehen, in dem nicht nur der Vater als Mesner, vor allem bei Taufen, Trauungen und Beerdigungen, tätig war und auch bei der Turmuhr und den Glocken seinen Dienst tat. In diesem Kirchturm spielten seine Buben gern, und oft haben sich ihre Hände an den Seilen heiß gerieben, wenn sie die alte Glocke unter den Schlägen des Stundenhammers erzittern ließen. Der Glockenturm war die Mitte des Lebenskreises unserer Jugend: die Glocken und die alte Turmuhr. Was uns dorthin rief und dort festhielt, war stets halb Dienst, halb Spiel. Sogar der Rhythmus der Spiele, die wir anderswo – im Hofgarten oder in der Hägelemühle oder am Mettenbach – pflegten, war vom Turm her bestimmt. (GA 16, 595) Besonders in der Sommerzeit verbrachten die Brüder ihre Spielnachmittage, nach dem Unterricht in der Meßkircher Volks- und Bürgerschule, die Martin Heidegger von 1895 bis 1903 besuchte, in der Glockenstube oder im höchsten Gebälk des Turms bei den Zifferblättern der Turmuhr. Dort oben hauste ich viel bei den Dohlen und Mauerschwalben und träumte in das Land[9], wird Heidegger mehr als ein halbes Jahrhundert später am 27. Juli 1950 an Hannah Arendt schreiben; und 1954 hat er dem Geheimnis des Glockenturms einen seiner schönsten Erinnerungstexte gewidmet. Hier klang noch einmal das Spiel der Glocken nach, das die Kindheit durchtönt hatte. Die kirchlichen Feste, der Lauf der Jahreszeiten, die mittäglichen und abendlichen Stunden waren durch den Klang der Glocken geheimnisvoll ineinander gefugt, so daß immerfort ein Läuten durch die jungen Herzen, Träume, Gebete und Spiele ging (GA 13, 115).
Täglich um drei Uhr nachmittags läuteten die beiden Mesnerbuben die kleinste Glocke. Dafür unterbrachen sie ihre Spiele auf dem «Marktbrückle» vor dem Rathaus, wo sie ihre Murmeln laufen ließen, oder ihre Fang- und Ballspiele im Hofgarten. Martin und Fritz waren keine Wunderkinder. «Nicht einmal zu Musterknaben hat es gereicht», wird der Bruder Fritz zum 26. September 1969 in seinem Geburtstagsbrief an den achtzigjährigen Jubilar schreiben, dessen Jugendjahre vor allem durch seine Freude am Sport mitgeprägt waren. Martin Heidegger war ein begeisterter Fußballspieler, ein gewandter Turner am Reck und am Barren, «im Sommer ein guter Schwimmer und im Winter ein flotter Schlittschuhläufer auf dem Eisweiher neben der Hegelemühle»[10]. Und auch an die Lausbubereien, Indianergefechte und Kämpfe mit den Kindern aus dem Nachbardorf Göggingen wird Fritz dabei erinnern. «Bei unserer Truppe spieltest Du den Hauptmann, geschmückt mit einem stattlichen eisernen Säbel»[11], was kein geringer Vorteil gegenüber dem Gegner war, dessen Soldaten nur mit Holzsäbeln bewaffnet waren. Man war mit vollem Ernst bei der Sache, aber genoss zugleich «die Wohltat einer seitdem nie mehr erlebten stetigen Schwerelosigkeit» und eines heimatlichen Glanzes, der auf allen Spielen lag.
Umgrenzt und geschützt waren die kindlichen Spiele und Abenteuer von Auge und Hand der Mutter. Es war, als hütete ihre ungesprochene Sorge alles Wesen. (GA 13, 88) Die Mutter (1858–1927) war eine Bauerntochter aus dem nahe gelegenen Dorf Göggingen, wo sie und ihre zwei Jahre ältere Schwester Gertrud nach der Aussage der Bauern weitum als die schönsten Mädchen galten (GA 16, 343). Am 9. April 1887 hatte Johanna Kempf den bereits 36 Jahre alten Handwerksmeister Friedrich Heidegger geheiratet, dessen Schweigen und Ernsthaftigkeit sie durch lebensfrohe Heiterkeit aufzulockern wusste. «Kontaktfreudig liebte sie sinnvolle Gespräche und gesellige Unterhaltung; sie verschmähte auch nicht ein Schwätzerle mit ihresgleichen, aber ohne Schwatzbasenallüren.»[12] Johanna Heidegger war eine praktische Frau, und was sie tat, hatte Hand und Fuß. Auch war sie eine «Künstlerin im Zieren der Altäre vor den kirchlichen Hochfesten», wobei ihr die 1892 geborene Tochter Marie, das «braunäugige Mesner-Mariele», fleißig half. «Oft sagte sie, das Leben sei so schön eingerichtet, daß man sich immer auf etwas freuen dürfe.»[13]
Vor allem durch das Heimatdorf der Mutter, wo sich der junge Martin gern aufhielt und mit seinem Vetter Gustav Kempf spielte, wurde ihm das Leben der Bauern vertraut und jenes Land, durch dessen Felder die Vorfahren den Pflug geführt und im sicheren Wechsel der Jahreszeiten die einfache Ordnung ihres bäuerlichen Lebens verwirklichten (GA 16, 343). Was er in Göggingen erlebt und gelernt hatte, ist durch keine Klugheit und keinen Scharfsinn zu ersetzen, wird sich Heidegger 1936 in seiner Rede zum 80. Geburtstag seiner Tante Gertrud erinnern. Die Aufenthalte im Dorf der Mutter gehörten für ihn zu den kostbarsten Ereignissen seiner Kindheit. Sie öffneten ihm einen freien Spielraum für das Wesentliche, Echte und Einfache, was das Leben brachte und forderte (GA 16, 343).
Die vertrauten Orte in Meßkirch und Göggingen, die Wälder der Umgebung mit ihren Lichtungen und Holzwegen, Feldweg und Glockenturm, das Zuhause des Elternhauses, in dem ein fleißiger Vater keine unnützen Worte verlor und eine lebensfrohe Mutter sich um ihre Kinder sorgte, ein spielerisches und sportliches Tun in jugendlicher Sorg- und Schwerelosigkeit: All das war für Heidegger «Heimat». In ihrer Erde fühlte er sich verwurzelt. Unter ihrem hohen Himmel träumte er sich ins Freie. Aber erst nachträglich ist ihm dieses Heimische des Zuhaus (GA 13, 156) als solches bewusst geworden. Die sentimentalische Erinnerung an das Gewesene bezog ihre Kraft und Ausdauer aus der Sorge, dass der Mensch unaufhaltsam ins Unheimische entfremdet wird. Was der alte Heidegger über seine Kindheit und Jugend in Meßkirch gesagt hat, ist, wie bei Hebel, aus dem Heimweh erblickt und durch diesen Schmerz ins Wort gerufen worden (GA 13, 124). Erst die Heimatlosigkeit des modernen Menschen lässt den verloren gegangenen Zauber der Heimat in der Erinnerung bedrängend gegenwärtig werden.
Gott 1903–1919
Bis zum Herbst 1903 hat Martin Heidegger seine Heimatstadt Meßkirch und das Nachbardorf Göggingen kaum verlassen. Es war eine katholisch geprägte Welt, in der Heidegger aufwuchs. Die Eltern waren gläubige Katholiken, aber auch tolerant gegenüber Andersdenkenden. Nicht nur in materieller Hinsicht, sondern auch in der seelisch-geistigen Atmosphäre galt im Mesnerhaus das Maßhalten als ungeschriebene Grundregel. Die Eltern hatten noch den «beiderseitigen Fanatismus des Meßkircher sogenannten Kulturkampfes»[14] erlebt, der sie von jedem religiösen Dogmatismus geheilt hatte. Sie selbst hatten am «römischen» Katholizismus festgehalten, gegen den sich nach der Verkündung des Dogmas von der Unfehlbarkeit des Papstes durch das Vatikanische Konzil von 1870 die liberale, aufgeklärte «altkatholische» Bewegung gebildet hatte. Auch der junge Martin erlebte noch die Nachwehen dieses Konflikts zwischen römischen Traditionalisten und altkatholischen Modernen, der zugleich eine soziale Spaltung widerspiegelte. Während die Altkatholiken sich vor allem aus dem vermögenden Bildungsbürgertum rekrutierten, waren die «Römischen» meist ärmere Leute. Zu ihnen gehörte auch die Familie Heidegger.
Der katholische Glaube bot dem jungen Heidegger Orientierung und Sicherheit. So war es auch selbstverständlich, dass die beiden Mesnerbuben ihrem Vater bei seiner kirchlichen Arbeit halfen. Sie dienten als Ministranten, erledigten kleinere Aufträge für den Stadtpfarrer Camillo Brandhuber und läuteten die Glocken. In der Sakristei sammelten sie die abgebrannten Kerzen für ihren selbst errichteten Altar, an dem wir zum ernsten Spiel «die Messe lasen» (GA 13, 113). Gebete und Spiele waren aufgehoben im Heimischen des alltäglich gelebten Glaubens.
Mit dieser gläubigen Schwerelosigkeit war es vorbei, als Martin Heidegger, gerade vierzehn Jahre alt geworden, im Herbst 1903 die Meßkircher Bürgerschule verließ und auf das humanistische Gymnasium in Konstanz wechselte. Pfarrer Brandhuber hatte die Begabung des jungen Martin erkannt und ihm schon seit 1900 kostenlosen Privatunterricht in Latein gegeben, um so den Besuch des Gymnasiums zu ermöglichen. Die Stadt am Bodensee lag zwar nur vierzig Kilometer südlich seines Heimatortes, aber es war doch eine neue, fremde Welt, in die Heidegger nun eintrat. Er geriet unter die Kontrolle der katholischen Kirche. Zwar war das Gymnasium eine «weltliche» Schule; aber Heidegger wurde als Zögling der Kirche im Erzbischöflichen Studienheim St. Konrad untergebracht. Finanziell unterstützt wurde er durch ein kirchliches Stipendium. Sein Weg schien vorgezeichnet zu sein. Heidegger sollte und wollte Priester werden. Während der gymnasiale Unterricht im aufgeklärten Geist des Humanismus stattfand und ein fruchtbares Lernen bei ausgezeichneten Lehrern der griechischen, lateinischen und deutschen Sprache (GA 1, 55) ermöglichte, war das Leben als Konviktler im Konradihaus ganz auf den katholischen Glauben ausgerichtet. Man lebte abgeschlossen in strenger Zucht und wurde auf den Konflikt mit dem Weltlichen programmiert.
Darüber hat Heidegger die Lektüre nicht vergessen, die ihn außerhalb der Schule begeisterte. Durch sie lernte er kennen, was zum Bleibenden werden sollte (GA 1, 56). 1905 las er zum ersten Mal Adalbert Stifters Sammlung «Bunte Steine» (1853), in der gegen das weltliche Chaos und die Übermacht der Naturgewalten von den Kräften des Heimatlichen, Sanften und Einfachen erzählt wird. Stifter nannte es das wahrhaft «Große» (GA 13, 197), das sich im Kleinen und Unscheinbaren zeige: im Wehen der Luft und Rieseln des Wassers, im Grünen der Erde und im Wachsen des Getreides.
Doch stärker als diese Erinnerung an die stille Größe der heimatlichen Dinge wirkte auf Heidegger die religiöse Berufung. Sie wurde vor allem durch den Rektor des Konvikts gefördert, Dr. Conrad Gröber, der auch aus Meßkirch stammte und noch Jahrzehnte später als Erzbischof von Freiburg für Professor Martin Heidegger eine wichtige Rolle spielen wird. Gröber unterstützte seinen jungen Landsmann, besorgte ihm auch das vom Theologen Christoph Eliner 1575 in Meßkirch testamentarisch eingerichtete Stipendium, mit dem begabten Meßkirchern das Studium der Theologie an der Universität Freiburg finanziert werden sollte. So wurde 1906 Heideggers Wechsel von Konstanz nach Freiburg im Breisgau notwendig, vom Bodensee ins Vorland des Schwarzwalds. Dort besuchte er die Oberstufe des angesehenen Berthold-Gymnasiums, blieb aber auch weiterhin als Zögling des Erzbischöflichen Konvikts St. Georg unter der straffen Kontrolle der katholischen Kirche. Der Gymnasiast war strebsam und fleißig. Er war sich seiner priesterlichen Berufung sicher und neigte zum Ordensleben in der Gesellschaft Jesu.
Aber diese religiöse Ausrichtung schloss nicht aus, dass Heidegger sich nun auch für jene Fächer zu interessieren begann, die für seinen Lebens- und Denkweg zunehmend wichtiger werden sollten. Mathematik und Physik wurden zu seinen Interessenschwerpunkten, seit der mathematische Unterricht vom bloßen Aufgabenlösen mehr in theoretische Bahnen einbog (GA 16, 37). Durch die schulische Lektüre einiger Werke Platons fühlte er sich in philosophische Problemsituationen gelockt, wenngleich noch nicht mit theoretischer Strenge. Philosophisches Denken begann ihn zu fesseln. Intensiv las er nun auch, was im Unterricht keinen Platz hatte. Sein väterlicher Freund Conrad Gröber, der aufmerksam die Entwicklung seines Zöglings verfolgte, schenkte ihm 1907 Franz Brentanos Dissertation «Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles» (Freiburg i. Br. 1862). Mehr als fünfzig Jahre später wird Heidegger dieses Werk hervorheben als Stab und Stecken meiner ersten unbeholfenen Versuche, in die Philosophie einzudringen[15]. Hier war er auf die Frage gestoßen, die seinem weiteren Denkweg Richtung geben wird, auch wenn sie sich zunächst noch dunkel und schwankend gestellt hatte: Gibt es etwas Einfaches und Wesentliches in den mannigfachen Formen und Bedeutungen des Seienden? Eine leitende Grundbedeutung? Hinsichtlich dieser Frage war es unabsehbar folgenreich, dass Heidegger schon 1908 die Aristoteles-Ausgabe aus der Internatsbibliothek auf seinem Schreibtisch stehen hatte und ein Jahr später als Oberprimaner auf ein Buch des Freiburger Professors für Systematische Theologie und Katholische Dogmatik Carl Braig stieß. Er las dessen 1896 erschienene Schrift «Vom Sein. Abriss der Ontologie». Damit war der Schritt vom mannigfachen «Seienden» zum ontologischen Grundbegriff «Sein» vorgezeichnet, der durch viele Umkippungen, Irrgänge und Ratlosigkeiten hindurch der unablässige Anlaß (GA 1, 56) seines philosophischen Denkens bleiben wird.
Aristoteles (384–322 v. Chr.) studierte an Platons Akademie in Athen, wo er später auch seine eigene Philosophenschule leitete, das Lykeion. Stärker als sein Lehrer war er an einer realistischen Erkenntnis der Welt interessiert. Während seine «Physik» die natürlichen Dinge und ihre Bewegungen beschrieb und erklärte, handelte seine «Metaphysik» von den allgemeinen Prinzipien alles Seienden und gewann eine epochemachende Bedeutung für die europäische Seinsphilosophie (Ontologie). Traditionsbildend wurde vor allem seine Lösung des Problems, welchen Stellenwert Allgemeinbegriffe (Universalien) besitzen. Aristoteles nahm zwar allgemeine Wesenheiten als gegeben an, die jedoch keine eigenständige Realität besitzen, sondern nur «in» den mannigfachen einzelnen Dingen erscheinen können.
Aber noch stand der katholische Glaube im Zentrum von Heideggers Denken und Wollen. Und so trat er, nach bestandenem Abitur, Ende September 1909 ins Noviziat der Gesellschaft Jesu in Tisis bei Feldkirch ein. Er wollte Jesuit werden, um den Glauben der Heimat, seine sittlich-religiöse Lebensweise und seine philosophischen Interessen verbinden zu können. Doch schon nach Ablauf einer zweiwöchigen Probezeit wurde er entlassen. Bei einer Wanderung auf das «Älple» in der Nähe von Feldkirch soll er über Herzbeschwerden geklagt haben, sodass ihn die Jesuiten wegen schwacher gesundheitlicher Verfassung und mangelnder Arbeitsbelastung nicht in ihren Orden aufnehmen wollten.