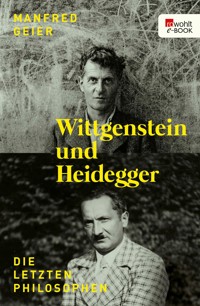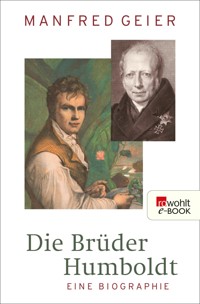11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie entstehen philosophische Gedanken und Einsichten? Woher stammt die Inspiration für die Ideen, mit denen große Denker unsere Welt begreifen und erklären? Die überraschende These von Bestsellerautor Manfred Geier lautet: oft sind es ganz konkrete einzelne Augenblicke, in denen Philosophen auf neue Ideen kommen, um schwierige geistige und existenzielle Probleme lösen zu können. In sieben exemplarischen Fallstudien berichtet Geier über die Genesis wichtiger philosophischer Gedanken. Er beschreibt am Beispiel von Parmenides, René Descartes, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Johann Georg Hamann, Friedrich Nietzsche und Karl Popper, wie eng deren Leben und Werk miteinander verknüpft waren. Sein Buch zeigt auf faszinierende Weise, wie sich jedem dieser Philosophen in einer angespannten Situation plötzlich eine kreative Einsicht offenbarte, die dann zu einem wegweisenden Werk ausgearbeitet wurde. «Man nimmt, man fragt nicht, wer da gibt; wie ein Blitz leuchtet der Gedanke auf», hat Friedrich Nietzsche festgestellt, als er sich durch Zarathustra inspiriert fühlte. Dieses Buch beschreibt Sternstunden des menschlichen Denkens, die eine epochale Bedeutung erlangt haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Manfred Geier
Geistesblitze
Eine andere Geschichte der Philosophie
Über dieses Buch
Wie entstehen philosophische Gedanken und Einsichten? Woher stammt die Inspiration für die Ideen, mit denen große Denker unsere Welt begreifen und erklären? Die überraschende These von Bestsellerautor Manfred Geier lautet: oft sind es ganz konkrete einzelne Augenblicke, in denen Philosophen auf neue Ideen kommen, um schwierige geistige und existenzielle Probleme lösen zu können.
In sieben exemplarischen Fallstudien berichtet Geier über die Genesis wichtiger philosophischer Gedanken.
Er beschreibt am Beispiel von Parmenides, René Descartes, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Johann Georg Hamann, Friedrich Nietzsche und Karl Popper, wie eng deren Leben und Werk miteinander verknüpft waren. Sein Buch zeigt auf faszinierende Weise, wie sich jedem dieser Philosophen in einer angespannten Situation plötzlich eine kreative Einsicht offenbarte, die dann zu einem wegweisenden Werk ausgearbeitet wurde.
«Man nimmt, man fragt nicht, wer da gibt; wie ein Blitz leuchtet der Gedanke auf», hat Friedrich Nietzsche festgestellt, als er sich durch Zarathustra inspiriert fühlte. Dieses Buch beschreibt Sternstunden des menschlichen Denkens, die eine epochale Bedeutung erlangt haben.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2013
Copyright © 2013 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Redaktion Regina Carstensen
Umschlaggestaltung Anzinger | Wüschner | Rasp, München
(Umschlagabbildung: plainpicture/Aurora Photos)
ISBN 978-3-644-03441-9
Die Seitenzahlen im Namenregister beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Motto
Vorwort
UND FREUNDLICH EMPFING MICH DIE GÖTTIN
Eine Reise, fernab vom Verkehr der Menschen
Was ist, das ist; und Nichts gibt es nicht!
Ein Lichtblitz der wahren Erkenntnis
WELCHEN LEBENSWEG WERDE ICH EINSCHLAGEN?
Feuerfunken eines mysteriösen Geistes
Wofür ich mir nicht den geringsten Zweifel ausdenken konnte
Die blitzartige Intuition des «Ich bin»
VON DIESEM AUGENBLICK AN WAR ICH VERLOREN
Wie von tausend Lichtern geblendet
Dreifaltigkeit einer Idee
Eine Erregung, die an Wahnsinn grenzte
Funken von Genie
Augenblicke auf dem Papier
ROUSSEAU HAT MICH ZURECHT GEBRACHT
Ich lerne die Menschen ehren
Der kleine Wilde und andere Denkwürdigkeiten
Was soll ich tun?
ICH FAND DIESEN FREUND IN MEINEM HERZEN
Ein Licht im tiefsten Dunkel
Gott ein Schriftsteller!
Ein Widerstreit, der keine Lösung finden wird
Vernunft ist Sprache, Logos
MIR WAR ZU MUTE, ALS HÄTTE ES GEBLITZT
Die Inspiration am Surlej-Felsen
Der ungeheure Augenblick
Ein ewiger Kreislauf
Also lehrte Zarathustra seinen Blitz-Gedanken
DA GING MIR ÜBER GEWISSE DINGE EIN LICHT AUF
Das Grundproblem von 1919
Der menschliche Geist ist kein Kübel
Wir können aus unseren Fehlern lernen
Der große Xenophanes oder: Zurück auf Anfang
ANHANG
Namenregister
«Alle Dinge steuert der Blitz.»
Heraklit
«Man nimmt, man fragt nicht, wer da gibt;
wie ein Blitz leuchtet der Gedanke auf.»
Friedrich Nietzsche
Vorwort
Im Licht der Vernunft wird etwas klar und deutlich erkennbar. Begeisterung, Enthusiasmus und Ekstase feuern uns an. Blitzartig leuchtet der Gedanke auf, die entscheidende Idee, mit der wie auf einen Schlag das Problem gelöst wird, mit dem man sich herumgeplagt hat. Alltagssprachlich gebrauchen wir die poetisch und rhetorisch gesteigerte Sprachfigur der Metapher, wenn wir «Licht», «Feuer» oder «Blitz» zur Charakterisierung geistiger und seelischer Prozesse einsetzen.
Es war Heraklit von Ephesos, der um 500 v. Chr. als erster griechischer Philosoph die Bilder des Feuers und des Blitzes in sein allgemeines Weltmodell eingesetzt hat: Der Kosmos ist weder von den Göttern noch von den Menschen gemacht worden. Er ist ein ewig lebendiges Feuer. Am stärksten wirkt es als Blitz, wobei theoretisch-kosmologische und praktisch-ethische Impulse zusammenspielen. Die blitzende Energie des Feuers bringt alles zum Vorschein; und niemand wird sich einst seiner Gewalt entziehen können, wenn ein Gericht über die Welt durch den kosmischen Feuerstrahl stattfinden wird, der jeden erfasst.[1]
Es verwundert nicht, dass Heraklit bereits von seinen Zeitgenossen «der Dunkle» genannt wurde. Es waren Rätsel, die er von sich gab. Man verstand ihn nicht. Doch diese Schwierigkeit hat nicht verhindert, dass seine Bildersprache eine begriffsgeschichtliche Tradition begründet hat. Die Kraft des Urfeuers, die sich im Blitz konzentriert, mag sich zwar abgeschwächt haben. Sie hat ihre universelle Wirkung verloren. Doch sie wirkt anschaulich weiter, wenn wir von Geistesblitzen und Illuminationen sprechen, von Erleuchtungen und zündenden Ideen. Selbst in den Neurowissenschaften, die präzise Fachbegriffe und keine poetischen Bilder verwenden wollen, hat sie ihre Spur hinterlassen. Das Gehirn wird als ein hochkomplexes System aus Milliarden von Neuronen untersucht, die durch «Feuern» ihre Spannungszustände entladen und untereinander Signale austauschen. Man spricht von «Neuronengewittern», um damit die kreativen, intuitiven und phantasievollen geistigen Aktivitäten des Menschen gehirnphysiologisch beschreiben zu können.
Thema dieses Buches sind philosophische Geistesblitze, die sich in zweifacher Hinsicht abgrenzen lassen: gegenüber religiösen Erleuchtungen einerseits und wissenschaftlichen Erfindungen andererseits. Denn der Geist der Philosophen muss ohne Gott auskommen. Seine geschichtlich ältesten Wurzeln mögen zwar Mythen gewesen sein, in denen Götter eine große Rolle spielten. Daran konnten die Religionen anknüpfen. So fühlte sich Aurelius Augustinus, um nur ein Beispiel zu erwähnen, im Sommer 386 n. Chr. plötzlich vom strahlenden Licht der Gegenwart Gottes durchströmt. Die Dunkelheit der vielen Zweifel, unter denen er litt, war vertrieben. Aber eine philosophische Begründung für diese augenblickliche Illumination konnte der größte Lehrer der christlichen Kirche nicht liefern.[2] Sie ließ sich nur religiös annehmen. Sein gläubiges Herz fühlte sich angesprochen, nicht seine Vernunft als Mittel philosophischer Erkenntnis.
Auch in der Geschichte der Wissenschaften hat es immer wieder revolutionäre Entdeckungen gegeben, mit denen schwierige Probleme plötzlich gelöst werden konnten. Für solche Erkenntnisblitze ist das «Heureka!» des griechischen Physikers und Mathematikers Archimedes zum Erkennungszeichen geworden: Ich hab’s gefunden! Es sind Inspirationen, die als «Heuristik» methodisch unter Kontrolle gebracht werden. Doch eine philosophische Dimension ist mit dieser Problemlösungsfindung nicht verbunden. Selbst wenn sie wissenschaftliche Revolutionen[3] in Gang setzt und Neues entstehen lässt, bleibt sie eingebunden in eine abgegrenzte und klar definierte Forschungsarbeit, die technisch verwertbare Erfolge anstrebt.
Geistesblitze der Philosophen unterscheiden sich von religiösen Erleuchtungserlebnissen und archimedischen Entdeckungen durch die Einheit von theoretischer Weltdeutung und praktischer Lebensorientierung.[4] So wirkten bereits das Feuer und der Blitz des Heraklit in beide Richtungen. Sie wurden geistig gedacht als Urgrund des Kosmos und als Richter über das menschliche Verhalten. Das machte sie zu einem anfänglichen Musterbeispiel für die Einsichten der Philosophen, deren Geist plötzlich den Blick für eine neue Grundlehre und Lebensperspektive öffnet.
Dabei lässt sich in allen Fällen philosophischer Geistesblitze ein typischer Dreischritt feststellen. Er beginnt mit Krisenerfahrungen, sei es gedanklicher, sei es existenzieller Art, die zutiefst irritieren. Was zuvor selbst oder von anderen gedacht und gelebt worden ist, wird als grundsätzlich fehlgeleitet, widersprüchlich, zweifelhaft oder verdunkelt empfunden und durchschaut. «Ich bin in einem Wirrwarr. Ich kenne mich nicht aus.»[5] Das ist, Ludwig Wittgenstein zufolge, der allgemeine Ausdruck einer philosophischen Problemsituation. In der Regel wird sie durch ruhiges, konzentriertes Nachdenken zu bewältigen versucht. Doch viel dramatischer sind jene singulären Erkenntnismomente, in denen die Spannungen sich plötzlich entladen. Dabei wird das Licht der Erkenntnis, wie G. W. F. Hegel rückblickend auf den Beginn der Philosophie in Griechenland bemerkte, «zum Blitze des Gedankens, der in sich selbst einschlägt und von da aus sich seine Welt erschafft».[6] Er löst nicht nur das irritierende Grundproblem des jeweiligen Denkers, sondern öffnet auch seinem Lebensweg eine neue Perspektive. Mit dieser plötzlich gewonnenen Einsicht kann er sich als Philosoph jedoch nicht zufriedengeben. Er muss sie zu einer Werkidee weiterentwickeln, die es in mühsamer Denkarbeit maßgebend auszuführen gilt. Erst damit gewinnt sein Geistesblitz eine epochale Wirkung, die den augenblicklichen Einfall zu einem philosophiegeschichtlichen Ereignis macht.
Wer von Geistesblitzen reden will, muss sich auf einzelne Personen und ihre individuellen Lebensgeschichten konzentrieren. Die bloße Darstellung der neuen Ideen, mit dem argumentativen Dafür und Dagegen, genügt nicht, um begreifen zu können, was in diesen außergewöhnlichen Momenten geschieht und warum es sich ereignet. Textverstehen muss mit Personenverstehen[7] zusammengehen. Dafür spricht bereits die einfache Tatsache, dass die Philosophen, in deren Geist es geblitzt hat, in ihrem eigenen Namen sprechen. Nicht zufällig verwenden sie das Personalpronomen der 1. Person Singular, wenn sie davon berichten, was sich ihnen in diesen unvergesslichen Augenblicken erschlossen hat. Sie sprechen nicht nur über das Erkannte, sondern zugleich über sich als Erkennende, deren Subjektivität eine wesentliche Komponente des geistigen Blitzschlages ist. Nicht eine anekdotisch zu befriedigende Neugier, sondern die Sache, um die es geht, fordert von sich aus die Berücksichtigung aller verfügbaren biographischen Informationen.
Es sind sieben Fälle, von denen hier erzählt wird. Sie sind aus zwei Gründen ausgewählt worden. Zum einen lassen sich an ihnen die großen Themen der europäischen Philosophie von den griechischen Anfängen bis in die Gegenwart verdeutlichen: das SEIN bei Parmenides, das ICH bei René Descartes, die NATUR bei Jean-Jacques Rousseau, die MORAL bei Immanuel Kant, die SPRACHE bei Johann Georg Hamann, das LEBEN bei Friedrich Nietzsche und das WISSEN bei Karl Popper. Zum anderen lässt sich an ihrer Aufeinanderfolge nachvollziehen, dass die Geschichte der Philosophie keine lose Aneinanderreihung von Ideen ist. Sie ist auch von sachlichen oder persönlichen Beziehungen durchzogen, die am Ende sogar noch Popper mit Xenophanes von Kolophon verbinden, der bereits 2500 Jahre früher vorweggenommen hat, worüber Sir Karl erst spät ein Licht aufgegangen ist.
Hamburg, den 1. Mai 2013
UND FREUNDLICH EMPFING MICH DIE GÖTTIN
Wie sich Parmenides von Elea plötzlich die Wahrheiten des Seins, des Nichts und der menschlichen Meinungen offenbarten
Als der medische Heerführer Harpagos im Dienst des Perserkönigs Kyros II. die große und reiche, von Griechen an der kleinasiatischen Küste Ioniens gegründete Stadt Kolophon unterwarf, musste Xenophanes um das Jahr 545 v. Chr. seine Heimatstadt verlassen. Da war er fünfundzwanzig Jahre alt. Es begann ein jahrzehntelanges Herumtreiben, das ihn bis nach Malta und Sizilien führte, vielleicht auch nach Ägypten. Er schlug sich als fahrender Sänger durchs Leben. Als Rezitator trug er aus den Epen Homers und Hesiods vor, dazu auch eigene Dichtungen, mit denen er sich als Denker einen Namen machte. Dichtend dachte er über den Kosmos und die Erde nach, über Mythen und Gottesvorstellungen, auch über die besonderen geistigen Fähigkeiten des Menschen. Am Ende seines langen Lebens, das er in der griechischen Kolonie Elea an der unteritalienischen Küste Lukaniens verbrachte, blickte er darauf zurück mit den Versen: «Siebenundsechzig Jahre sind schon verflossen, seitdem ich durch das hellenische Land wandere, sorgenbeschwert»[1], wobei er sich mit seinen Sorgen (phrontis) vor allem auf die philosophische Dichtkunst bezog, auf seine «Weisheit» (sophia), die er für wichtiger und nützlicher hielt als die vom Publikum geliebten Wettkämpfe vergötterter Athleten. «Fehlt doch jenem Kult jede innere Berechtigung. Daher ist es völlig ungerecht, die rohe Kraft höher zu werten als die köstliche Weisheit.»[2]
Als Liebhaber der Weisheit hat sich Xenophanes von Kolophon (geboren um 570 v. Chr., gestorben um 475 v. Chr.) auch gegen die mythischen Dichtungen gerichtet, durch deren rhapsodischen Vortrag er seinen Lebensunterhalt verdiente. Vermutlich waren es seine Erfahrungen mit anderen Lebens- und Glaubensformen, der selbsterlebte Zusammenprall verschiedener Kulturen und Religionen, der Xenophanes auf seine kritische Überlegung brachte, die er in die folgenden, von Sir Karl Popper übersetzten, Hexameter-Verse fasste:
Stumpfe Nasen und schwarz: so sind Äthiopias Götter,
Blauäugig aber und blond: so sehn ihre Götter die Thraker.
Aber die Rinder und Rosse und Löwen, hätten sie Hände,
Hände wie Menschen, zum Zeichnen, zum Malen, ein Bildwerk zu formen,
Dann würden die Rosse die Götter gleich Rossen, die Rinder gleich Rindern
Malen, und deren Gestalten, die Formen der göttlichen Körper,
Nach ihrem eigenen Bilde erschaffen: ein jedes nach seinem.[3]
Damit hatte Xenophanes als erster Theologe den kritischen Verdacht ausgesprochen: Nicht die Götter schaffen die Menschen nach ihrem Bilde, sondern umgekehrt. Auch Homer und Hesiod hätten den olympischen Göttern nur «angedichtet», was sie als typisch für die Griechen hielten. Sie würden in streitbaren familiären Zusammenhängen leben, auch stehlen, ehebrechen, sich gegenseitig betrügen, und hätten Kleidung, Stimme und Gestalt ähnlich wie sie selbst. Populäre Gottesvorstellungen waren für Xenophanes Fiktionen, durch die menschliche Eigenarten ins Göttliche übersteigert wurden.
Doch Xenophanes war nicht nur ein stolzer und freier «Sturmvogel der Aufklärung»[4], der sich kühn und spöttisch gegen die mythische Phantasiewelt der vielen anthropomorphen Götter stellte. Er entwarf auch das Gegenbild eines einzigen Gottes und lieferte die erste eigentliche Bestimmung von dessen Allmacht, die sich in der abendländischen Philosophie finden lässt. Es war ein Gott der Ganzheit, der ganz sieht, ganz denkt und ganz hört. Als solcher musste er sich menschlichen Abbildungen entziehen. Er war «weder an Aussehen den Sterblichen ähnlich noch an Gedanken».[5] Für Xenophanes fand er seine Verkörperung im «All-Einen», das er ins Zentrum seiner philosophischen Dichtkunst rückte. Sein theo-logisches Denken nahm eine onto-logische Wendung, die auf das Ganze alles Seienden (to on) zielte. Wie er sich dieses All-Eine als Gottheit gedacht hat, ist in seinen eigenen Schriftfragmenten nicht überliefert, sondern kann nur den Berichten anderer Philosophen entnommen werden: Als Gesamtheit aller Dinge ist es ein einziges Wesen, ewig, ohne Veränderung, immer gleich, nicht entstanden, unbewegt, ohne Leiden, geistiger als Geist und, sofern man es sich bildlich vorzustellen versucht, exakt kugelförmig.
Gegen die vollendete Vollkommenheit des göttlichen All-Einen stellte Xenophanes die beschränkten Erkenntnisfähigkeiten des Menschen. Er selbst war zwar stolz auf seine geistige Kraft. Aber er war zugleich ein erkenntnistheoretischer Skeptiker. Denn der Mensch mag zwar nach der Wahrheit streben, die ganze Welt erforschen und das All-Eine zu begreifen versuchen. Eine klare Einsicht ist ihm jedoch verwehrt. Menschliches Wissen ist grundsätzlich trügerisch: «Dókos d’epi pasi tétyktai / Von Vermutung ist alles durchzogen.» Und selbst wenn der Mensch einmal das Wahre, Klare, Deutliche (saphès) erkannt habe, so könne er das selbst nicht wissen, wie Xenophanes im Fragment 34 zurückhaltend zu bedenken gibt:
Sichere Wahrheit erkannte kein Mensch und wird keiner erkennen
Über die Götter und alle die Dinge, von denen ich spreche.
Selbst wenn es einem einst glückt, die vollkommenste Wahrheit zu künden,
Wissen kann er sie nie: Es ist alles durchwebt von Vermutung.[6]
Die Menschen sind irrende Wesen, die niemals sicher sein können, das Wahre erkannt zu haben. Heißt das, dass wir deshalb auf unsere Erkenntnisanstrengungen verzichten sollten? Nein, denn Xenophanes hielt daran fest, dass es so etwas wie ein objektiv wahres Wissen über die Welt geben kann. Nur verfügen wir über keine subjektive Gewissheit, ob wir dieses Wissen wirklich erreicht haben. So war Xenophanes zwar ein Skeptiker, aber er war kein erkenntnistheoretischer Pessimist. Er blieb ein Sucher, ein Forscher, dem es gelang, im Laufe seines langen Lebens auch viele seiner kühnen wissenschaftlichen Vermutungen kritisch zu prüfen und zu verbessern. Die Lizenz zum unabschließbaren Forschen, das dem richtigen Weg folgt, also «metá hodós»[7] ist, hat er mit den folgenden beiden Versen des Fragments 18 methodologisch auf den Punkt gebracht:
Nicht von Beginn an enthüllten die Götter den Sterblichen alles;
Aber im Laufe der Zeit finden wir, suchend, das Bess’re.[8]
Mit diesen drei Gedanken – dass die mythischen Götter anthropomorphe Erfindungen sind, dass es das All-Eine gibt und dass den Menschen das Klare nicht offensichtlich wird, sondern sie nur über Meinungen, Vermutungen und Vorurteile verfügen – kam der Wanderdichter Xenophanes schließlich nach Elea in Unteritalien, wo er einen jungen Philosophen traf, der bei ihm «hörte».[9] Was Xenophanes von Kolophon sagte, wurde für Parmenides von Elea zum philosophischen Problem, das er lösen wollte. Es musste doch einen Ausweg aus diesem bloßen Wähnen und Vermuten geben, hin zur Wahrheit und Gewissheit, von dókos zu saphès! Ein göttlicher Geistesblitz ließ Parmenides den richtigen Weg erkennen.
Eine Reise, fernab vom Verkehr der Menschen
Er war zwar ein Schüler des viel älteren Xenophanes. Doch für Parmenides waren die Einsichten seines Lehrers keine Dogmen, denen er blind folgte, sondern Probleme im ursprünglichen Sinn dieses griechischen Wortes. Problema, das meinte etwas vor die Füße Geworfenes, ein Hindernis. Durch den weitgereisten Fremden aus Kolophon fühlte Parmenides sich in eine philosophische Problemsituation verstrickt, die es zu lösen galt. Vielleicht war das der Grund, warum er seinen Abschied von der Politik nahm und sich in eine kontemplative Lebensform zurückzog, um frei und selbständig über das nachdenken zu können, was ihm Xenophanes als Rätsel hingeworfen hatte.
Man weiß wenig über das Leben des Parmenides, der um 520 v. Chr. in Elea geboren wurde, einer von Griechen gegründeten Kolonie, die ihre ionische Heimat an der Westküste Kleinasiens wegen der persischen Eroberung verlassen hatten. Noch heute kann man die Fundamente dieser Stadt sehen, unweit von Paestum gelegen, das wegen seiner Tempelanlagen berühmt ist. Parmenides stammte aus einer reichen, vornehmen Familie und soll politisch vor allem als Gesetzgeber für seine Heimatstadt gewirkt haben. Doch bedeutsam als einer der großen anfänglichen Denker, der den nach ihm kommenden Philosophen einen Weg vorauswies, wurde er durch das eine Werk, das er um 480, jedenfalls vor 470 v. Chr. geschrieben hat. Es ist nur in Bruchstücken überliefert, zusammen 153 Verse umfassend.[1] Denn Parmenides schrieb keine Prosa, sondern, wie Xenophanes, als denkender Dichter im Hexameter-Versmaß der homerischen Epen.
Sein Lehrgedicht hatte den Titel Über die Natur (Peri physeos), wobei mit «physis» nicht allein die Natur in ihrer materiellen Gestalt gemeint war, sondern das eigentliche Wesen einer Sache, sei es eines einzelnen Dinges oder des Seienden überhaupt. Und darum ging es ja diesem Dichter-Philosophen vor allem, der sich nicht mit dem bloßen Vermuten und Meinen der Menschen zufriedengab. Er wollte den wesentlichen Grund alles Seienden erkennen und beanspruchte Wahrheit und Gewissheit für seine Erkenntnisse.
Angesichts dieses reinen Erkenntniswillens mag es überraschen, dass Parmenides seine Schrift mit einem Vorspann (Fragment 1) begann, einem mythopoetischen Proömium (prooimion), in dem er von einem persönlichen Erlebnis berichtete.[2] Anschaulich erzählte er von einer rasanten Wagenfahrt, die ihn aus der Tiefe der menschlichen Welt ins Reich einer Göttin führte, die in der Höhe über allem thronte und ihm die ganze Wahrheit über das Wesen des Seienden offenbarte. Glaubte dieser klare Denker denn noch an die Existenz der Götter, die sein Lehrer doch als anthropomorphe Phantasiegestalten entlarvt hatte? Wollte er nicht die Verantwortung für sein eigenes Denken übernehmen? Jedenfalls kam er mit seiner einleitenden Geschichte den Erwartungen seiner Leser entgegen. Die Bildersprache seiner kleinen Erzählung war allgemein vertraut, sodass sie das Verständnis dessen erleichterte, was er dann mit gedanklicher Schärfe als seine eigenen Einsichten folgen ließ.[3]
Parmenides hatte die Epen von Homer und Hesiod gelesen. Er hatte gehört, wie Rhapsoden die alten mythischen Geschichten vortrugen. Er wusste von den göttlichen Musen, die Homer und Hesiod zu Dichtern werden ließen. Er kannte den Musenwagen, mit dem sein lyrischer Zeitgenosse Pindar die Dichter ihre Fahrt der Lieder anfangen ließ. Daran konnte er anknüpfen. Und so begann er im Stil der frühgriechischen Epen mit den drei Versen (V. 1–3):
Die Stuten, die mich fahren so weit nur mein Wille dringt,
trugen mich voran, da sie mich auf den Kunde-reichen Weg
der Göttin gebracht hatten, der den wissenden Mann durch alle Städte führt …
Mit Pferdegespann und Wagen starteten viele epische Lieder. Dass der Aufbruch eines neuen Denkens als eine Fahrt geschildert wird, ist eine gängige formelhafte Wendung. Und auch das Bild des Weges ist durch die Werke Homers und Hesiods vorgezeichnet, wo es noch einen direkten gegenständlichen Bezug besaß. Als leibliches Wesen, das durch seine körperliche und geistige Arbeit zum Guten gelangen will, befindet sich der Mensch auf dem richtigen Weg. Er folgt dem Weg, auf dem er das Ziel erreichen kann, das er anstrebt, und das Problem zu lösen weiß, das ihn herausfordert. Für Parmenides ist es ein göttlicher Weg echter und reichhaltiger «Kunde». Er führt nicht in die Irre. Er ist weder Abweg noch der ausgetretene Pfad, auf dem die gewöhnlichen Menschen gehen. Die Stuten scheinen den Weg zu kennen. Sie brauchen keine lenkende Hand. Es müssen göttliche Pferde sein, die den Reisenden zu seinem Ziel bringen.
Dass dieser Weg «durch alle Städte» führt, erinnert an den alten ionischen Weg des Wanderns über die Erde. So ist Xenophanes von Kolophon nach Elea gereist, so zogen die Ionier vom griechischen Festland an die Küste Kleinasiens, von wo sie, von den Persern überwältigt, nach Italien emigrierten. Und so begann auch die Odyssee, in der Homer seinen Helden nach dem Untergang Trojas durch die Welt fahren ließ: «Sage mir, Muse, die Thaten des vielgewanderten Mannes, welcher so weit geirrt nach der heiligen Troja Zerstörung, vieler Menschen Städte gesehn und Sitte gelernt hat.»[4]
Doch der fahrende Parmenides ist kein Odysseus, der viele Jahre durch die weite Welt irrte, weil er einen Gott herausgefordert hatte. Es ist kein trauriges Schicksal, das ihn auf den Weg der Erkenntnis zwingt, sondern sein eigener Wille (thymòs), der diesen «wissenden Mann» ein Ziel anstreben lässt, wobei der thymòs an den Mut und die leidenschaftliche Energie erinnert, die Homers Helden beflügelt hat. Dieser Mann weiß bereits etwas, und sein Wille zum Wissen wird auch nicht ausgeschaltet werden, wenn er zur Göttin kommt. Denn was sie ihm als Wahrheit offenbaren wird, soll er mit seinem Verstand (nóus) überprüfen: Beurteile selbst, was ich dir sage; ich heiße dich überlegen; schau mit dem Geist, was ich dir zeige. Die göttliche Gabe bleibt auf den Gebrauch des eigenen Verstandes bezogen, ohne den sie nur ein unbegreifliches mystisches Erlebnis sein könnte.
Sicher spielen dabei mythische Vorstellungen eine Rolle, an die Parmenides erinnert, um seine philosophischen Gedanken anschaulich auszumalen. Denn die Wagenfahrt, die ihn «durch alle Städte» führt, bringt ihn auch «über alle Städte» hinaus. Er überblickt nicht nur vieler Menschen Städte, durch die er reist. Er transzendiert die weltlichen Orte und begibt sich auf einen «Kunde-reichen Weg der Göttin», der ihn sowohl räumlich wie zeitlich in eine andere Dimension führt, wobei dieser Weg zugleich die Bahn seines eigenen «daimon» ist, seines persönlichen Geschicks:
Darauf fuhr ich: da nämlich fuhren mich die aufmerksamen Stuten,
die den Wagen zogen; und Mädchen lenkten die Fahrt. (V. 4–5)
Diese Mädchen, die den Weg kennen, werden bald als die «Sonnenmädchen» (V. 9) identifiziert. Es sind die richtungsweisenden Heliaden, Töchter des Sonnengottes Helios, mythisch oft als Wagenlenker dargestellt, der seinen vierspännigen Wagen täglich von Ost nach West über den Himmel treibt. Es ist also keine Entdeckungsreise, auf der Parmenides neue Länder und Menschen kennenlernt. Es ist eine Himmelfahrt, die seinen philosophischen Beruf als seine schicksalhafte Berufung darstellt. Er will sich nicht in der unbegrenzten und unüberschaubaren Vielfalt der weltlichen Dinge und Tatsachen verlieren, sondern er hat nur ein Ziel: Er will mit seinem Geist das wahre Wesen alles Seienden erkennen. Der Weg (hodós), auf dem er fährt, ist zu einem Weg-Gedanken geworden. Der räumliche Bezug, der einen Ausgangsort mit einem Zielpunkt verbindet, ist zurückgedrängt zugunsten einer geistigen Tätigkeit, die als metá hodós zwar dem Bild des Weges verbunden bleibt, aber es metaphorisch in die rationale «Methode» des richtigen Denkens überführt.
Wie er seinen göttlichen Weg zum wahren Wissen findet, hat Parmenides detailliert ausgemalt, wobei er auch auf technische Einzelheiten großen Wert legte. Zunächst handelt es sich um eine Fahrt aus dem Reich der Dunkelheit und der Nacht hin zum Licht. Die Bilder des Lichts und des Hellen häufen sich, je weiter sie geht. So schlagen die Heliaden ihre Schleier zurück, mit denen sie sich nächtlich bedeckt haben. Es wird zunehmend heller in diesem Proömium. Die Reise vollzieht sich in einem ungeheuren Tempo, und sie wird immer schneller, je näher sie ihrem Ziel kommt. Die Achsen des Wagens beginnen zu glühen, und man glaubt, ihr helles Pfeifen hören zu können. Denn obwohl Parmenides während seiner Fahrt riesige Entfernungen durcheilt, so ist sie doch die rasanteste, die sich denken lässt. Schon Homer hat die Schnelligkeit der Gedanken mit der Geschwindigkeit des Lichts verglichen, und auch Parmenides spielt hier mit dem Bild eines blitzartigen Denkakts, der die sorgfältige, Schritt für Schritt sich vollziehende gedankliche Arbeit weit hinter sich lässt und Raum und Zeit überwindet.
Schließlich gelangen die Stuten, die Sonnenmädchen und Parmenides an ein großes steinernes Tor, dessen Flügel himmelshell leuchten, wie aus «Ätherlicht» (V. 13) bestehend. Es wird von Dike bewacht, der Göttin der Gerechtigkeit, die das Rechte und das Unrechte genau zu unterscheiden weiß. Von den Heliaden mit sanften und klugen Reden überzeugt, schließt sie dem Reisenden das Tor auf. Plötzlich springt es auf, und hinter ihm öffnet sich ein unermesslich großer «gähnender Schlund» (V. 18) aus Licht. Es gibt hier keine Brücken, Geländer oder Leitern, die den Weg absichern. Augenblicklich zeigt sich eine andere Welt. Ein lichter Torweg führt ins Unbekannte. Zum Glück kann sich auch jetzt Parmenides auf seine Wagenlenkerinnen verlassen. «Dort denn mitten durch lenkten die Mädchen, gradaus der Straße nach, Wagen und Pferde.» (V. 21) Es ist also kein krummer Weg, der schwanken lässt und Schwindel erzeugt, sondern eine Gerade, ausgerichtet und gesichert durch eine Göttin, die nun dem Reisenden hilfreich ihre Hand reicht und ihm «alles» zu offenbaren verspricht.
Und freundlich empfing mich die Göttin, sie ergriff mit ihrer Hand
meine Rechte, redete mich an und sprach diese Worte:
Jüngling, Gefährte unsterblicher Lenkerinnen!
da du mit den Stuten, die dich fahren, zu unserem Hause gelangst,
Heil dir! denn es war kein schlechtes Geschick, das dich leitete,
diese Reise zu machen – sie liegt ja wahrlich fernab vom Verkehr der Menschen –
sondern Fug und Recht: Du darfst alles erfahren,
sowohl der runden Wahrheit unerschütterliches Herz
wie auch das Dünken der Sterblichen, worin keine wahre Verläßlichkeit ist.
Aber gleichwohl wirst du auch dies verstehen lernen, wie das ihnen Dünkende
gültig sein mußte und alles durchaus durchdringen. (Fr. 1, V. 22–32)
Wer ist diese Göttin (deá)? Diese Frage ist unterschiedlich beantwortet worden. Einige Kommentatoren hielten sie für Dike, die nicht nur das Tor aufschloss, sondern auch hinter ihm stand in der Offenheit des hellen Lichts. So hat der Altphilologe Karl Deichgräber das Proömium als Parmenides’ Auffahrt zur Göttin des Rechts[5] interpretiert. Andere vermuteten, dass es sich um Persephone handelte, die in orphischen Initiationsriten die Eingeweihten oft «freundlich» aufnahm, oder sie ließen die Göttin namenlos, wie sie es auch im ersten Vers von Homers Ilias gewesen ist: «Singe mir, Göttin, den Zorn …» Für Martin Heidegger, der den Versen 22 bis 32 seine Freiburger Vorlesung im Wintersemester 1942/43 widmete, war sie identisch mit der Wahrheit (alétheia), die Parmenides offenbart wird. Sie war also nicht eine Göttin der Wahrheit, womit wir zweierlei hätten: «eine Göttin» und «die Wahrheit», die unter göttlichem Schutz steht. Damit vermied Heidegger den Genitiv und beantwortete die Frage mit dem Hinweis: «Die Göttin ist die Göttin ‹Wahrheit›. Sie selbst – ‹die Wahrheit› – ist die Göttin.»[6]
«Die alétheia ist deá, ist Göttin. Wohl aber doch nur für die Griechen und selbst bei ihnen nur für einige ihrer Denker.»[7] Parmenides gehört zu ihnen, obwohl er sich von seinen Vorgängern und Zeitgenossen auf eine radikale Weise unterscheidet. Denn von dieser Göttin wird ihm eine doppelte Erkenntnis vermittelt, konzentriert auf die beiden Begriffe alétheia und dóxai. Beides soll der Reisende, fernab vom gewöhnlichen Leben der Menschen, erfahren: die überzeugende «Wahrheit» und das «Dünken der Sterblichen». Wie sehr Übersetzungen aus dem Griechischen bereits Deutungen sind, haben die unterschiedlichen Versuche dokumentiert, diese Differenz auszudrücken. Steht für alétheia meist «Wahrheit», aber auch überzeugende «Evidenz» oder lichtvolle «Unverborgenheit», so ist dóxai mit einem breiten Spektrum von Begriffen übersetzt worden, das von den bloßen «sinnlichen Eindrücken» und dem «scheinenden Erscheinen» über «unzuverlässige Meinungen» und «annehmbare Auffassungen» bis hin zu «Wahn der Meinungen» oder gar den «Wahnvorstellungen» reicht.[8] Die Schwierigkeit der Übersetzung hängt dabei vom ursprünglichen Doppelsinn von dóxa ab, womit einerseits das Aussehen, der Anblick der erscheinenden Sachen gemeint war, andererseits die Meinung oder die Ansicht, die ein Betrachter vom Erscheinenden hat.
Unerschütterliche Wahrheit und unzuverlässige Meinungen: Beides soll Parmenides von der Göttin zu hören bekommen. Das ist das radikal Neue seiner Philosophie. Denn zwar war die Trennung von alétheia und dóxai ein philosophisches Allgemeingut seiner Zeit. Doch damit war zugleich eine unüberbrückbare Differenz zwischen dem göttlichen und dem menschlichen Wissen festgestellt worden. Wahre Erkenntnis war den Göttern vorbehalten. Die sterblichen Menschen hatten nur ihre Meinungen oder Ansichten. So hat es ja auch Parmenides’ Lehrer Xenophanes gelehrt: Niemals werde es den Mann geben, der das Klare, Deutliche (saphès) erkennt; denn nur Wähnen (dókos) sei den Menschen beschieden, denen die Götter nicht alles offenbaren. Um 500 v. Chr. hat es der philosophierende Arzt Alkmaion aus dem süditalienischen Städtchen Kroton festgestellt: «Über das Unsichtbare wie über das Irdische haben nur die Götter Gewißheit, uns aber als Menschen ist nur Mutmaßung gestattet.»[9] Sein Zeitgenosse Hekataios aus Milet unterschied streng zwischen der Wahrheit, die kein Mensch kenne, und dem meinenden Für-wahr-Halten, für das es keine wahre Verlässlichkeit gebe: «Wie es mir wahr zu sein scheint …» Davon war der große Gegenspieler des Parmenides, Heraklit von Ephesos, ebenfalls überzeugt: «Auch was der Bewährteste erkennt und bewahrt, ist nur eine Meinung. (…) Das menschliche Wesen hat keine Erkenntnisse, wohl aber das Göttliche. (…) Die Natur liebt es, sich zu verbergen.»[10]
Mit dieser scheinbar unüberwindbaren Trennung zwischen göttlichem Wissen und menschlichem Vermuten hat Parmenides sich nicht einverstanden erklärt. Er suchte einen Weg zum wahren, überzeugenden, verlässlichen, evidenten Wissen. Und er fand ihn. In seinem Proömium hat er ihn bildlich dargestellt, wobei er auf mythische Vorbilder zurückgriff. In rasender Fahrt, «fernab vom Verkehr der Menschen», gelangte er aus der Dunkelheit der gewöhnlichen menschlichen Meinungen zum Licht einer Erkenntnis, die ihm göttlich offenbart wurde.
Sein Geist wurde erleuchtet durch einen Gedankenblitz, der ihn augenblicklich erkennen ließ, was gewiss ist und als unumstößliche Wahrheit gelten kann. Von dieser alétheia handelt der erste Teil seines Lehrgedichts. Er bereitet zugleich den zweiten Teil vor, in dem die Göttin Parmenides erklärt, wie es zur dóxa, dem «Dünken der Sterblichen», kommen konnte, das den Menschen als «gültig» erscheint und ihre Welterfahrung durch und durch beherrscht.
Was ist, das ist; und Nichts gibt es nicht!
Parmenides soll «der runden Wahrheit unerschütterliches Herz» (V. 29) erfahren. Das ist die göttliche Gabe, die ihm am Ziel seiner Reise ins Licht versprochen wird. Er soll sich aus den Gewohnheiten seiner vielen Erfahrungen lösen und den Worten der Göttin folgen, jedoch nicht als Gläubiger, sondern als Verstandesmensch. Denn mit seiner Vernunft (nóus) soll er urteilen, ob die Rede der Göttin wirklich wahr und evident ist oder auch nur eine fehlerhafte Meinung vorspiegelt. Er muss das Rätsel lösen, mit dem schon Hesiod zweihundert Jahre früher in seiner Theogonie die Menschen irritiert hat, als er die göttlichen Musen sagen ließ:
Ihr Hirten draußen, üble Burschen, nichts als Bäuche,
wir wissen viel Falsches zu sagen, dem Wirklichen Ähnliches,
wir wissen aber auch, wenn wir wollen, Wahres zu verkünden.[1]
Was ist wirklich wahr, und was scheint nur wahr zu sein? Das ist die entscheidende erkenntnistheoretische Frage, die Parmenides als Philosoph stellt und zu beantworten versucht. Sein Denken ist nicht, wie bei den gewöhnlichen Menschen, eingebunden in eine alltägliche Lebenspraxis. Sein gutes «Geschick» (moira) hat ihn, wie er im Proömium erzählt hat, aus dem alltäglichen Verkehr der Menschen hinausgeführt. Mit Fug (thémis) und Recht (díke) kann er sich darauf konzentrieren (V. 28), über die fundamentale Unterscheidung des Wahren und des Falschen und ihre jeweiligen Gründe nachzudenken.
Entweder-Oder. Parmenides hat nicht nur vernünftig gedacht, sondern auch die Welt erforscht. Er war mit den vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen seiner Zeit vertraut, von der Seelenlehre bis zur Himmelskunde, von der Biologie bis zur Geologie. So nahm er an, dass die Seele eine feurige Natur besitzt, dass der Schlaf eine Abkühlung der Seelenenergie bedeutet und dass die Erkenntnis des Menschen davon abhängt, in welchem Wärmezustand sich sein Körper befindet. Seine astronomischen Entdeckungen waren bahnbrechend. «Er war es, der zuerst die Lehre von der Kugelgestalt der Erde und von ihrer Lage in der Mitte des Weltalls aufstellte.»[2] Als Erster soll er festgestellt haben, dass der Morgenstern (Phosphorus) mit dem Abendstern (Hesperus) identisch ist. Auch Sonne und Mond zeigten sich ihm in einem neuen Licht: Der Mond ist eine Kugel, die selbst nicht leuchtet, sondern ihr Licht von der Sonne empfängt, der sie stets mit ihrer hellen Seite zugewandt ist, was das periodisch zu- und abnehmende Mondlicht erklärt.
Aber zugleich waren Parmenides die erkenntnisskeptischen Überlegungen bekannt, die vor allem durch seinen Lehrer Xenophanes angestellt worden waren. Er musste zugeben: Nicht allein seine, sondern alle wissenschaftlichen Erkenntnisse können nur Hypothesen sein. Der Mensch kann über die Einrichtung der Welt nur Vermutungen äußern, für deren Richtigkeit es keine definitiven Beweise geben kann. Er nimmt nur Phänomene wahr, die es zu deuten gilt. Wie ein Arzt aus den wahrgenommenen Symptomen eines Kranken auf dessen Krankheit schließt oder ein Richter über einen Täter oft nur anhand von Indizien urteilen kann, so musste auch Parmenides einsehen: Aus gewissen Anzeichen schließe ich zum Beispiel, dass die menschliche Seele feuriger Natur ist, dass der Morgenstern der Abendstern ist, dass die Erde als runde Kugel im Zentrum des Kosmos liegt und dass das scheinbare Zu- und Abnehmen des Mondes ein Effekt seiner Stellung zur strahlenden Sonne ist. Aber ich sehe es nicht und kann mir nicht absolut sicher sein, dass es wirklich so ist. Eine unbedingte Wahrheit ist durch empirische Forschung nicht erreichbar. Auf dem weiten Feld der wissenschaftlichen Erkenntnis gibt es nur «das Dünken der Sterblichen, worin keine wahre Verläßlichkeit ist». (V. 30)
Es kennzeichnet die Radikalität des Parmenides, dass er sich durch diese skeptische Einsicht nicht fesseln lässt. Sein «Denken um die Wahrheit» (Fr. 8, V. 51) zielt auf eine Erkenntnis, die sich dem bloßen Vermutenkönnen entzieht. Er will nicht nur Wahrscheinliches oder Mögliches annehmen, sondern wissen, was evident, stringent und beweisbar ist. Dabei muss ihm plötzlich ein Licht aufgegangen sein. Zwar mochten alle sachbezogenen Erkenntnisse nur Hypothesen sein. Aber an ihnen lässt sich etwas aufzeigen, das unbedingt gilt und unmittelbar einsichtig ist. Vielleicht ist die Seele eine feurige Substanz, vielleicht ist der Morgenstern der Abendstern, vielleicht ist die Erde eine Kugel. Aber gegen den Unsicherheitsfaktor dieses Vielleicht steht die unumstößliche Gewissheit einer grundsätzlichen Alternative: Entweder besteht die Seele aus Feuer – oder nicht; entweder ist der Morgenstern der Abendstern – oder er ist es nicht; entweder ist die Erde eine Kugel – oder sie ist es nicht. Entweder es ist so, oder es ist nicht so, wobei eine dritte Möglichkeit ausgeschlossen ist. Und nun noch einen kleinen Schritt weiter zu der einfachen, grundsätzlichen und entscheidenden Gewissheit, die Parmenides mit einem Mal überwältigt haben muss:
Entweder ist es, oder es ist nicht! (Fr. 8, V. 16)
«Es bedurfte offenbar nur ganz weniger gedanklicher Schritte, um aus einer erkenntniskritischen Situation, wie sie Alkmaion und Xenophanes präzise formuliert hatten, die Grundalternative zu entwickeln und damit zugleich den Satz vom ausgeschlossenen Dritten zu entdecken. Es ist, wie es scheint, die logische Leistung des Parmenides, daß er diese Schritte getan hat und damit jenseits aller Empirie den Zugang zu einer Sphäre gefunden hat, in der Evidenz als logische Evidenz für den Menschen möglich ist.»[3] Es ist, oder es ist nicht. Die Entdeckung dieser logischen Kontradiktion muss Parmenides in einem Augenblick der allerreinsten, durch keine Welterfahrung getrübten Einsicht gekommen sein.
Dass er diesen Moment einer Göttin verdanken will, die ihm die unerschütterliche Wahrheit offenbart habe, dokumentiert im Geist seiner Zeit, dass es ein Gebiet gibt, in dem Götter und Menschen die gleiche Sprache sprechen. Gegen die traditionsmächtige Bestimmung, dass nur die Götter die Wahrheit kennen und den Menschen nur Vermutungen möglich sind, steht die parmenideische Erkenntnis, dass es auch für die Sterblichen eine unmittelbare Klarheit und unerschütterliche Sicherheit gibt, die durch Wahrnehmungen, Eindrücke, Erfahrungen und wissenschaftliche Erkenntnisse niemals zu erreichen sind. In der logischen Sphäre bewegen wir uns, Parmenides folgend, nicht mehr auf den unsicheren Wegen der Forschung. Das entgegengesetzte Paar «ist/ist nicht», das disjunktive «oder» und der Satz vom ausgeschlossenen Dritten: Mit diesen drei logischen Evidenzen hat Parmenides unmittelbar erfasst, was dem «wissenden Mann» als göttliche Gabe versprochen worden ist.
Entweder es ist, oder es ist nicht! Wer das nicht einsieht, gehört zu den Unwissenden, die doppelköpfig in der Welt umherirren:
… denn Ohnmacht lenkt in ihrer Brust
ihren schwankenden Verstand, und sie treiben dahin
so taub als blind, blöde, verdutzte Gaffer, unterscheidungslose Haufen,
bei denen Sein und Nichtsein dasselbe gilt
und nicht dasselbe, und es in allen Dingen einen umgekehrten Weg gibt. (Fr. 6, V. 5–9)
Die scharfe Polemik dieses Urteils richtet sich nicht allein gegen die gewöhnlichen Menschen. Sie soll vor allem den großen Widersacher treffen, der wie Parmenides selbst das wahre Wesen des Seienden zu denken versucht. Der «schwankende Verstand» verweist auf Heraklit von Ephesos, für den alles in einem rastlosen Strom des Werdens fließt, in dem nichts bleibt, was es ist. Ununterbrochen wechselt es seine Richtung, verändert sich in sein Gegenteil und lässt kein klares, bestimmtes Urteil zu. Ständig wandelt sich alles. Wir steigen in denselben Fluss und nicht in denselben, wir sind es und auch wieder nicht. Das Kalte wird warm, das Warme kalt. Der Weg auf und ab ist derselbe. Mochte für Heraklit auch «alles eins» sein, so ist es doch durch Gegensätze beherrscht, die durch kein «oder» getrennt, sondern durch ein «und» verknüpft sind. «Ein und dasselbe offenbart sich in den Dingen als Lebendes und Totes, Waches und Schlafendes, Junges und Altes. Denn dieses ist nach seiner Umwandlung jenes, und jenes, wieder verwandelt, dieses.»[4]
Gegen Heraklits natürlichen Fluss aller Dinge hat Parmenides die Grundalternative «Es ist, oder es ist nicht» gestellt. Er konnte dabei nicht stehen bleiben. Die logische Formel will entfaltet werden. Parmenides unterzieht sich der schwierigen Aufgabe, die beiden Seiten des kontradiktorischen Gegensatzes in ihrer wesentlichen Bedeutung zu erhellen. Was ist es, das mit dem estin («Es ist») ausgesagt wird; und was kann mit jenem ouk estin («Nicht es ist») gemeint sein, das ihm als negatives Double zur Seite steht?
Das Seiende. Fragen wir zunächst nach dem «Es ist» und nach dem, «was es ist», wobei Parmenides als Philosoph dieses «Was» weder auf individuelle Dinge bezieht noch als Summe von seienden Einzelheiten erforscht oder sich vorstellt, sondern eben als das verstehen will, was es wesentlich «ist». Dieses Erkenntnisinteresse könnte befriedigt werden durch eine zurückhaltende Nachdenklichkeit, die sich damit begnügt, die beiden logischen Möglichkeiten der Alternative festzuhalten, ohne damit eine abstrakte Behauptung aufzustellen wie: «Das Seiende ist.» Die Übersetzer hatten schon immer Probleme mit diesem unausgesprochenen Subjekt des estin, das sie am liebsten eingeklammert haben: (das Seiende) ist; (das Seiende sein) ist; reality (= all that exist) is; es ist; Ist ist; Truth is. Man hat es auch gänzlich auszusparen versucht: «IST».
Für die Einsetzung des Subjekts «das Seiende» hat jedoch Parmenides selbst Indizien geliefert, indem er to on (das Seiende) als substantiviertes Partizip Präsens von einai (sein) ins Spiel gebracht hat. Dass er das latente «es» nicht sofort manifest nennt, lässt vermuten, dass hier erstmals ein Schleier gelüftet wird, der das Seiende langsam, wie in einem Mysterienspiel, offenbart. Es wird ein ontologischer Fundamentalbegriff gewonnen, der sich zunächst hinter der subjektmäßigen Leerstelle einer rein logischen Formel verbirgt und dann schrittweise im weiteren Verlauf der Argumentation in seiner Substanzialität hervortritt.
Als erster Denker stellt Parmenides die grundlegende Leitfrage der abendländischen Philosophie als Metaphysik: Was ist das Seiende (ti tò on), das in dieser Befragung nur im Singular vorkommt: als das Eine Seiende? Besonders im Fragment 8, dem Kernstück des Lehrgedichts, werden die entscheidenden Wesensmerkmale (semata) aufgezählt, die ihm zukommen sollen: Es ist ungeworden und unvergänglich; ganz, voll und einheitlich; unerschütterlich und nicht unvollendet. Als modifizierende Kennzeichen werden auch genannt: anfangslos und endlos, unbeweglich, ein Selbiges, im Selbigen verharrend, in sich ruhend, unverletzlich und mit sich selbst von allen Seiten her gleich. Im missverständlichen, weil noch einer sinnlichen Anschauung verbundenen Bild eines wohlgerundeten Balls hat Parmenides die allseitige Vollkommenheit des Seins auszudrücken versucht, «von der Mitte aus nach allen Seiten gleich sich schwingend. Denn als solches kann es weder, hier oder dort, irgend etwas stärker noch irgend etwas geringer sein.» (Fr. 8, V. 44–45) Die veränderliche Vielfalt der Dinge wird zurückgedrängt zugunsten einer allerreinsten Abstraktion, die wesentlich durch die drei Kennzeichen der ewigen Präsenz, der vollen Ganzheit und der unbeweglichen Identität bestimmt wird.
Parmenides trägt einleuchtende Gründe für seine Wesensbestimmung des Seienden vor. Argumentativ zieht er Schlussfolgerungen aus dem Elementarsatz «Es ist», dessen «ist» kein prädizierendes «sein» meint, wie in «Der Kreis ist rund», sondern ein einfaches «sein», mit dem ein Seiendes und sonst nichts gesagt wird. Deshalb kann der griechische Philosoph Aristoteles später feststellen, dass Parmenides mit «hellerer Einsicht»[5] gesprochen habe als sein Lehrer Xenophanes. Aber nicht zu übersehen ist auch, dass ihm der nach Elea zugereiste Flüchtling aus Kolophon die entscheidenden Stichworte souffliert hat. Das parmenideische «Ganze-Eine» besitzt Eigenschaften, die Xenophanes für das «All-Eine» reserviert hat. Selbst sein Bild der wohlgerundeten Kugel hat im Denken des Xenophanes sein Vorbild, «der die eleatische Schule begründet hat und behauptete, das All sei eins, kugelförmig und begrenzt, nicht entstanden, sondern ewig und durchaus unbewegt».[6]
Auch sein Seiendes hat Parmenides als evident begriffen. Unverborgen, einleuchtend und offenbar ist nicht nur die logische Grundalternative, sondern auch das Seiende selbst. Es ist deutlich, sichtbar, zugänglich, zeigbar, unverborgen, erkennbar, sagbar. All das verdichtet sich in das Einzige, was zu denken und zu sagen richtig ist: «dass Seiendes ist; denn das kann sein». (Fr. 6, V. 1) Klare Erkenntnis und ontologischer Erkenntnisgrund verbinden sich in der Präsenz, Vollkommenheit und Identität des Seienden.
Das Selbige aber ist zu erkennen, und zugleich der Grund, weshalb eine Erkenntnis seiend ist.
Denn nicht ohne das Seiende, worin eine Aussage ihr Sein hat,
wirst du das Erkennen finden. Denn nichts anderes ist noch wird sein
außer dem Seienden, weil eben dies das Schicksal gebunden hat,
ganz und unbeweglich zu sein. (Fr. 8, V. 34–38)
Wie schön passen hier Sein, Erkenntnis und Sprache zusammen. Die Wahrheit des Seienden in seiner absoluten Vollkommenheit ist zugleich die Erkenntnisgrundlage einer richtigen Einsicht, durch die das Seiende mit der Kraft des Verstandes als seiend begriffen und erkannt werden kann, eben so, dass es evident und gegenwärtig ist. «Denn dasselbe kann gedacht werden und sein.» (Fr. 3) Was in der geistigen Wahrnehmung erfasst wird, steht nicht in Frage, sondern wird bereits vorausgesetzt und ist im erkennenden Akt implizit gegeben. Und schließlich, als Drittes im Bunde: das richtige Reden. Richtig ist, zu sagen (legein) und zu denken (noein), dass Seiendes (einai) ist; denn nur im Seienden hat die Aussage ihre Voraussetzung, Bedingung und erste Autorität: ihr Sein. So vereinigen sich das seiend Seiende, das geistige Erkennen und das richtige Reden in einer ungebrochenen Dreieinigkeit, die im estin ihren leuchtenden Brennpunkt hat.
Das Nichts. Wie schön würde sich das alles zusammenfügen, wenn nicht das ganze wunderbare Zusammenspiel auf einer logischen Form beruhen würde, in der das «nicht» sich unüberhörbar zur Sprache bringt und den logisch ausgerichteten Königsweg zum «ist» des Seienden, der Erkenntnis und der Sprache zuallererst eröffnet. Entweder ist es, «oder es ist nicht». Wie steht es um dieses «nicht», das wie ein negativer Zwillingsbruder die Evidenz des Seienden vervollständigt und die logische Formel ins Gleichgewicht bringt? Welchen Sinn kann dieser zweite, negative Teil besitzen, der die ausschließende Disjunktion des «Entweder-Oder» als solche mitträgt? Es scheint, als habe sich in die göttlich offenbarte Grundalternative ein Unsinn eingeschlichen, der den Sinn der logisch begründeten Offenbarung in Frage stellt. Es ist bemerkenswert, wie Parmenides dieses Problem zu lösen versucht hat.
Zunächst: Kann Seiendes denn auch nicht sein, wie es die Alternative des «Oder» vorspiegelt? Es ist nicht? Parmenides beantwortet diese Frage durch eine erneute Trennung. Hat er mit einem ersten Schnitt die kontradiktorische Alternative als solche vom schwankenden Dahintreiben der doppelköpfigen, unentschiedenen Menschen abgespalten, so wird nun diese Alternative selbst in zwei Wege aufgeteilt: in den methodisch richtigen Weg des «ist» und in den unbegehbaren, in die Irre führenden Weg des «ist nicht»:
So komm denn, ich will dir sagen – und du nimm die Rede auf, die du hörst –
welche Wege des Suchens allein zu denken sind.
Der eine: daß (etwas) ist, und daß nicht zu sein unmöglich ist,
ist der Weg der Überzeugung, denn die geht mit der Wahrheit.
Der andre: daß (etwas) nicht ist, und daß nicht zu sein richtig ist,
der, zeige ich dir, ist ein Pfad, von dem keinerlei Kunde kommt.
Denn was eben nicht ist, kannst du wohl weder wahrnehmen – denn das ist unvollziehbar –
noch aufzeigen. (Fr. 2, V. 1–8)
Die Stimme der Göttin «Wahrheit» ist ursprünglich gespalten und erstritten. Sie bezieht ihre Überzeugungskraft aus einem Widerstreit. In ihrer «Rede» (mythos) taucht etwas auf, das nicht evident ist, nicht-wahrnehmbar, un-erkennbar, un-sagbar und un-aufzeigbar, und doch gerade aufgrund seiner dunklen Negativität das sag- und erkennbare Seiende begründet und logisch zwingend sein lässt. Der Intimfeind des Seienden treibt im Inneren des Denkens und Sagens sein verführerisches Spiel.
Wie sehr muss sich die Göttin bemühen, jenen Weg zu versperren, den sie dem Nachdenken eröffnet hat!
Entweder ist es, oder es ist nicht! Aber es ist nun entschieden, wie es Notwendigkeit ist:
daß man den einen Weg liegen lasse als undenkbar, unnennbar, denn er ist nicht der wahre Weg;
daß der andre dagegen, wonach es ist, eben der richtige ist. (Fr. 8, V. 16–18)
Doch es kommt noch schlimmer. Denn Parmenides begnügt sich nicht damit, das «ist» als ein Seiendes zu begreifen. Er macht auch das «ist nicht» zum Brennpunkt eines ontologischen Geistesblitzes. Mit einer folgenreichen Substantivierung verweist er auf das «Nichts», das seitdem die abendländische Philosophie verhext. Er denkt das Undenkbare, das Unzeigbare, das Nichtseiende – und entscheidet zugleich mit der Autorität der Notwendigkeit (ananke), die das Seiende begrenzt: Wer denkt, dass etwas nicht ist, denkt nichts; und wer nichts denkt, der denkt ein Nichtseiendes, das auch im sprachlichen Gewand des «Nichts» (me einai) auftritt.
Merkwürdigerweise erwähnt die Göttin dieses Nichts nur, um es sofort durchzustreichen. Die ontologische Bannformel wird gesprochen und damit, entgegen ihrer Intention, dem philosophischen Nachdenken ein Nichts als Problem hingeworfen, über das nicht nachgedacht und gesprochen werden soll:
Nichts ist nicht: das, sage ich dir, sollst du dir klarmachen. (Fr. 6, V. 1)
Die Folgen dieses Verbots, das von Anfang an zu seiner Überschreitung provoziert, werden einen wesentlichen Strang des abendländischen Philosophierens bilden. Warum nicht den Weg beschreiten, vor dem die Göttin ihr Warnschild aufgestellt hat? Schon immer hat das Verbotene mehr gereizt als das Offensichtliche.[7]
Die Meinungen der Menschen. Nach der unerschütterlichen Wahrheit, die sich auf das eine ewige Sein bezieht und das Nichts ausschließt, soll Parmenides auch das unzuverlässige «Dünken der Sterblichen» (Fr. 1, V. 30) erfahren, nach der einen alétheia die vielen dóxai. Dabei geht es nicht um eine bloße Aufzählung all der Meinungen, Hypothesen oder Hirngespinste der Menschen, die sie sich über die Welt und sich selbst ausgedacht haben. Stattdessen soll der viel wissende Philosoph erkennen, wie und warum den Menschen «das ihnen Dünkende gültig sein musste und alles durchaus durchdringen» (Fr. 1, V. 31–32). Geklärt werden soll das erkenntnistheoretische Grundproblem des Xenophanes, dass alle Weltbeschreibungen und -erklärungen durch mehr oder weniger wahrscheinliche Vermutungen «durchwebt» sind.
Was die Göttin am Ende des Prologs versprochen hat, beginnt sie im zweiten Teil des Lehrgedichts einzulösen. «Bis hierher» hat Parmenides von der Wahrheit gehört. «Von hier an» (Fr. 8, V. 51) soll er «sterbliches Wähnen» zu verstehen lernen. Es handelt sich also nicht um eine Darstellung oder Widerlegung menschlicher Irrtümer, sondern um das Verstehen und Erklären dessen, was menschliche Welterkenntnis grundsätzlich unzuverlässig macht und niemals die Klarheit einer logischen und ontologischen Evidenz erreichen kann.[8]
Der wesentliche Grund ist schnell festgestellt. Im Unterschied zu der einen Wahrheit des Seins, die in der logischen Disjunktion des «Entweder-Oder» als das «ist» (estin) auftaucht, ist jede empirische Erkenntnis der Welt durch eine fundamentale Zweiheit beherrscht. Wer erforschen oder aussagen will, was in der Welt tatsächlich der Fall ist, muss Trennungen vornehmen. Denn die Offenbarung des «All-Einen» in seiner unveränderlichen und undifferenzierten Einheit hilft nicht weiter, wenn es um die Erfahrbarkeit weltlicher Tatsachen und die Erkennbarkeit ihrer Gesetzmäßigkeiten geht. Bereits die elementare Notwendigkeit, die einzelnen Dinge zu benennen und über ihre besonderen Eigenschaften Aussagen zu machen, zwingt zu Unterscheidungen, die in der Regel zweiseitig sind. Wir separieren das Ruhende vom Bewegten, das Helle vom Dunklen, das Heiße vom Kalten, das Leichte vom Schweren, das Linke vom Rechten, das Männliche vom Weiblichen, das Lebendige vom Unlebendigen, das Gerade vom Krummen, das Aufblühen vom Verwelken, das Geistige vom Körperlichen, das Schöne vom Hässlichen und so weiter. Durch solche Klassifikationen werden den Menschen die weltlichen Erscheinungen begreifbar, wobei nicht alles streng getrennt ist, sondern auch vielfältige Mischungsverhältnisse eingeht, die sich im Lauf der Zeit auch ständig ändern können.
Parmenides ist nicht der erste ursprüngliche Denker, der von binären Prinzipien ausgegangen ist, die sich bekriegen oder versöhnen können, streng getrennt bleiben oder sich miteinander vermischen, die sich im Ungleichgewicht oder im Gleichgewicht befinden. Von Alkmaion von Kroton, der allein den Göttern Gewissheit, den Menschen nur Mutmaßung zugestand, ist der Satz überliefert: «In menschlichen Dingen vollzieht sich das meiste paarweise.»[9]