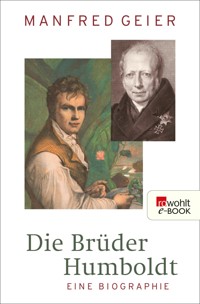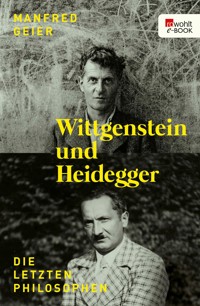
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sie wurden im selben Jahr 1889 geboren und im gleichen Alter 1911 von einer ungeheuren Leidenschaft des Philosophierens ergriffen, die ihre Denk- und Lebenswege beherrschte und einzigartig machte: Martin Heidegger und Ludwig Wittgenstein. Dabei waren sie der Herkunft nach grundverschieden: Wittgenstein entstammte einer großbürgerlichen Familie in der Metropole Wien, Heidegger kam aus einer badischen Kleinstadt und einfachen Verhältnissen. Aber beide gehören zu den bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, und für beide wurde die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus (auch Hitler war Jahrgang 1889) und den Katastrophen der Epoche ein zentrales Thema. Bestsellerautor Manfred Geier geht den Biographien der beiden Denker nach und beschreibt, wie andersartig ihre Lebenswege waren und wie divergierend ihre Gedanken sich entwickelten. «Sein und Zeit» hieß der Hauptwerk des einen, «Tractatus logico-philosophicus» das des anderen Autors. Während Heideggers Denken im Verlauf seines Lebens immer allgemeiner und abstrakter wurde, das Dasein hinter sich ließ und das «Sein» selbst zur Sprache bringen wollte, begann Wittgenstein, sich immer genauer und differenzierter den alltäglichen Sprachgebrauch anzuschauen und in den Zusammenhang menschlicher Lebensformen einzubinden. Eine faszinierende Spurensuche mit überraschenden Einsichten und Ergebnissen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 766
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Manfred Geier
Wittgenstein und Heidegger
Die letzten Philosophen
Über dieses Buch
Sie wurden im selben Jahr 1889 geboren und im gleichen Alter 1911 von einer ungeheuren Leidenschaft des Philosophierens ergriffen, die ihre Denk- und Lebenswege beherrschte und einzigartig machte: Martin Heidegger und Ludwig Wittgenstein. Dabei waren sie der Herkunft nach grundverschieden: Wittgenstein entstammte einer großbürgerlichen Familie in der Metropole Wien, Heidegger kam aus einer badischen Kleinstadt und einfachen Verhältnissen. Aber beide gehören zu den bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, und für beide wurde die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus (auch Hitler war Jahrgang 1889) und den Katastrophen der Epoche ein zentrales Thema.
Bestsellerautor Manfred Geier geht den Biographien der beiden Denker nach und beschreibt, wie andersartig ihre Lebenswege waren und wie divergierend ihre Gedanken sich entwickelten. «Sein und Zeit» hieß der Hauptwerk des einen, «Tractatus logico-philosophicus» das des anderen Autors. Während Heideggers Denken im Verlauf seines Lebens immer allgemeiner und abstrakter wurde, das Dasein hinter sich ließ und das «Sein» selbst zur Sprache bringen wollte, begann Wittgenstein, sich immer genauer und differenzierter den alltäglichen Sprachgebrauch anzuschauen und in den Zusammenhang menschlicher Lebensformen einzubinden.
Eine faszinierende Spurensuche mit überraschenden Einsichten und Ergebnissen.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Redaktion Regina Carstensen
Umschlagabbildungen Deutsches Literaturarchiv Marbach
ISBN 978-3-644-04511-8
Hinweis: Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort
Die Philosophie lebt zugleich in einer Spannung mit der lebendigen Persönlichkeit, schöpft aus deren Tiefe und Lebensfülle Gehalt und Wertanspruch.[1]
Martin Heidegger
Die Arbeit an der Philosophie ist – wie vielfach die Arbeit in der Architektur – eigentlich mehr die Arbeit an Einem selbst. An der eignen Auffassung. Daran, wie man die Dinge sieht. (Und was man von ihnen verlangt.)[2]
Ludwig Wittgenstein
Im Juni 1938 notierte sich Martin Heidegger in einem seiner mit schwarzem Wachstuch eingebundenen Hefte, die erst vor kurzem veröffentlicht werden durften und eine heftige philosophisch-politische Debatte auslösten,[3] einige Lebensdaten, die ihm bemerkenswert erschienen. Er wusste, dass es sich dabei nur um Zufallsereignisse handelte. Aber es sollte sich ihm doch etwas gezeigt haben, das er mit der unterstrichenen Überschrift hervorhob: «Spiel und Unheimlichkeit historischer Zeitrechnungszahlen im Vordergrund der abgründigen deutschen Geschichte.»[4] Dabei wies Heidegger unter anderem auf die folgenden Ereignisse hin: «1843 – Hölderlin geht aus der ‹Welt› und ein Jahr darauf kommt Nietzsche auf sie. 1883 – ‹Zarathustra I› kommt heraus und Richard Wagner stirbt. 1888 – Ende Dezember Nietzsches ‹Euphorie› vor dem Zusammenbruch und – – – (26. 9. 1889).»
Heidegger schrieb nur dieses besondere Datum auf, ohne es näher zu kennzeichnen. Schließlich wusste er selbst ja am besten, was am 26. September 1889 geschehen war. Es war sein Geburtstag gewesen. Unheimlich erschien ihm, dass er ausgerechnet in dem Jahr auf die Welt gekommen war, in dem sich Nietzsche aus ihr zurückgezogen hatte, nachdem er in Turin aus Mitleid einem geschundenen Droschkengaul um den Hals gefallen und nervlich völlig zusammengebrochen war.
Das Jahr 1889 lässt sich durch drei andere Geburtstage anreichern, die «abgründig» miteinander verbunden sind, wenn man sie rückblickend aus der Perspektive der deutschen Geschichte von 1938 sieht. – Am 16. April 1889 wurde Charlie Chaplin geboren, der 1938 das Drehbuch für seinen Film Der große Diktator schrieb, in dem Anton Hynkel gerade Osterlitsch überfallen hat als einen ersten Schritt zur angestrebten Weltherrschaft. – Vier Tage nach Chaplins Geburtstag kam am 20. April 1889 im österreichischen Braunau am Inn Adolf Hitler zur Welt, den Chaplin hasste, während ihn Heidegger als die Führergestalt bewunderte, in der sich, wie er glaubte, der neue Geist und die Größe einer völkisch-staatlichen Gemeinschaft aller Deutschen charismatisch konzentrierten. – Und am 26. April 1889, eine Woche nach Hitler, wurde in Wien Ludwig Wittgenstein geboren, der 1903/1904 gemeinsam mit Hitler die Oberrealschule in Linz besuchte, jedoch nicht in der gleichen Jahrgangsstufe. 1938 hielt er sich in Cambridge auf, wo er seit einigen Jahren philosophisch tätig war. Nun musste er erfahren, dass nach Hitlers Überfall seine Heimat dem Deutschen Reich einverleibt worden war, was für ihn bedeutete, infolge der «Nürnberger Gesetze zum Schutz deutschen Blutes und der deutschen Ehre» plötzlich ein jüdischer Deutscher geworden zu sein. Das war für ihn ein entsetzlicher Zustand, dem er so schnell wie möglich entkommen wollte durch den Erwerb der englischen Staatsbürgerschaft.
Dass Wittgenstein und Heidegger im selben Jahr geboren wurden und dass sie beide etwas mit Hitler zu tun hatten, mag zufällig gewesen sein. Es hätte auch anders sein können. Doch es gab einen ersten Anstoß, die Denk- und Lebenswege dieser beiden Philosophen in Beziehung zu setzen und sie in einer Doppelbiographie darzustellen. Gemeinsame «Zeitrechnungszahlen» lieferten dazu den geschichtlichen Rahmen. Im gleichen Alter verließen sie 1903 ihre Elternhäuser. 1911, am Ende ihrer Studien, wurden beide von der Philosophie ergriffen. Sie erlebten die Katastrophe des Großen Krieges, die ihre existenzielle Lebenseinstellung grundlegend veränderte. Die Zwischenkriegszeit, das «Dritte Reich», der Zweite Weltkrieg und die Nachkriegszeit hinterließen ihre Spuren im Welt- und Denkbild der beiden Philosophen. Die größte Differenz in politischer Hinsicht stellte dabei ihre Haltung in der ersten Hälfte der dreißiger Jahre dar. Während sich Heidegger für die «Größe» des Nationalsozialismus begeisterte, reiste Wittgenstein in die Sowjetunion, wo er die letzten Reste seines bürgerlichen Stolzes abbauen wollte. Enttäuscht wurden beide. Heidegger fand nicht die Menschen, «die den Willen und die innere Kraft aufbringen, das Große ständig zu vergrößern»[5]; und Wittgenstein fühlte sich wie in einer Armee eingesperrt, wo er niemals wirklich seine Meinung äußern durfte, «und das ist für gebildete Menschen ziemlich schwierig»[6].
Eine Doppelbiographie muss die Ähnlichkeiten deutlich machen, die Wittgenstein und Heidegger verbinden, und die Unterschiede klarstellen, die sie voneinander trennen. Das betrifft sowohl ihre Lebensgeschichte und ihren Charakter als auch ihre Philosophie.
Beide haben in ihren frühen Hauptwerken versucht, eine «Fundamentalphilosophie» zu entwickeln. Wittgenstein rückte in seinem Tractatus logico-philosophicus die Welt-abbildende Sprache in den Mittelpunkt, während Heidegger in Sein und Zeit das In-der-Welt-sein des menschlichen Daseins zu verstehen versuchte. Und beide haben fast zur gleichen Zeit ihre revolutionären Kehren oder Wenden zu ihren späten Werken vollzogen. Während Heidegger dabei immer allgemeiner und abstrakter wurde, das Dasein hinter sich ließ und das «Sein» selbst zur Sprache bringen wollte, begann Wittgenstein, sich immer genauer und differenzierter den alltäglichen Sprachgebrauch anzuschauen und in den Zusammenhang menschlicher Lebensformen einzubinden.
Persönlich begegnet sind sie sich nie, und es ist schwer vorstellbar, was geschehen wäre, wenn es zu einem Aufeinandertreffen des hochgradig empfindsamen Wittgenstein mit dem rustikal auftretenden, streitbaren Heidegger gekommen wäre.
Den entscheidenden Impuls, Heidegger und Wittgenstein nicht einfach nebeneinanderzustellen oder einzelne ihrer philosophischen Gedanken herauszugreifen und gegeneinander auszuspielen,[7] lieferte Heideggers Hinweis, dass er in jenem Jahr geboren wurde, als Nietzsche sich nach seiner letzten euphorischen Phase in seine eigene Welt zurückzog. Denn 1889 hatte Nietzsche die Frage «Was ist ein Philosoph?» mit einer Charakterisierung beantwortet, die heute als antiquiert erscheinen muss: «Ein Philosoph, das ist ein Mensch, der beständig außerordentliche Dinge erlebt, sieht, hört, argwöhnt, hofft, träumt; der von seinen eignen Gedanken wie von außen her, wie von oben und unten her, als von seiner Art Ereignissen und Blitzschlägen getroffen wird; der selbst vielleicht ein Gewitter ist, welches mit neuen Blitzen schwanger geht; ein verhängnisvoller Mensch, um den herum es immer grollt und brummt und klafft und unheimlich zugeht. Ein Philosoph: ach, ein Wesen, das oft von sich davon läuft, oft vor sich Furcht hat, – aber zu neugierig ist, um nicht immer ‹zu sich zu kommen› …»[8]
Es war, wie gesagt, eine zufällige Zeitgleichheit, dass Nietzsche ausgerechnet in dem Jahr in den dunklen Abgrund seines göttlichen Größenwahnsinns stürzte, in dem Wittgenstein und Heidegger das Licht der Welt erblickten. Aber philosophiegeschichtlich bedeutsam ist, dass beide dem Bild entsprachen, das Nietzsche vom sonderbaren Wesen eines Philosophen gezeichnet hatte. Sie selbst haben es ebenso gesehen. Denn auch für sie war das Philosophieren keine professionalisierte Kultur der Nachdenklichkeit, die den Regeln klarer und deutlicher Begriffsbildung und rationaler Argumentation folgt. Eine akademische Welt, in der hochgradig spezialisierte Berufsphilosophen mit Argumenten und Gegenargumenten gemeinsam bestimmte Probleme zu lösen versuchen, war beiden fremd. Seit Anfang der zwanziger Jahre zogen sie sich deshalb am liebsten in ihre Hütteneinsamkeiten zurück, um ungestört denken zu können. Philosophieren war für sie eine Leidenschaft, die sie ergriffen hatte und Werke entstehen ließ, die nur aus der Spannung zu ihren besonderen Charakteren verstanden werden können. In ihnen war am Arbeiten, was Nietzsche als «Trieb, der philosophiert»[9] diagnostiziert hatte, der sich nicht eingrenzen und disziplinieren ließ, sondern bis zu jenem Unsagbaren drängte, das sich, Heidegger wie Wittgenstein zufolge, nur in großen künstlerischen, dichterischen und religiösen Werken zeigen konnte.
Als letzte Philosophen gehörten beide zu einem Typus, der Geschichte geworden ist. Sie waren Solitäre wie all die Philosophen, die seit den griechischen Anfängen kosmologischer und metaphysischer Welterklärung einen eigenen Sprachstil entwickelten, mit dem zugleich ein neuer Denkstil erprobt wurde. Als lebendige Persönlichkeiten, die lehrten, die Welt mit anderen Augen zu sehen und sprachlich neu zu denken, verantworteten sie das Eigenwillige ihres Philosophierens, das sich selbsttätig anzutreiben schien. Ihre Zeit ist abgelaufen. Denn heute kann kein Einzelner mehr in der Lage sein, die Welt als alles, was der Fall ist, so zu durchschauen, dass er eine philosophisch tief begründete theoretische oder praktische Orientierung geben könnte.
Wittgenstein und Heidegger waren Einzelgänger mit ihren individuellen Besonderheiten des Denkens, Schreibens und Lebens. Gemeinsam war ihnen, was sie zu den Letzten der großen Philosophen werden ließ: jene einzigartige gedankliche und existenzielle Intensität, die aufs Ganze ging und sich durch keine allgemein als richtig favorisierte Methode kontrollieren ließ. Unterschieden haben sie sich dagegen durch die Tendenz, mit der sie ihre jeweiligen Gedanken entwickelten und ihrem Leben einen Sinn geben wollten.
Heidegger kam aus einfachen Verhältnissen einer provinziellen Lebensweise im kleinstädtischen Meßkirch. Als Philosoph strebte er zum Großen und Größten, um sich daran selbst zu erhöhen. So konnte das «Sein» zum übermächtigen Orientierungspunkt seines Philosophierens werden, bis am Ende ein letzter Gott an dessen Stelle rückte. – Wittgenstein dagegen stammte aus einer der reichsten Familien Österreichs, die in palastähnlichen Gebäuden der Metropole Wien ihren hochkultivierten Lebensstil zelebrierte. Als Philosoph und Mensch bekämpfte er jeden Anflug von Hochmut und Eitelkeit und wollte sich selbst kleinmachen, um ein anständiges Leben führen zu können. So konnte schließlich der gewöhnliche, alltägliche Sprachgebrauch ins Zentrum seiner Philosophischen Untersuchungen rücken, die vom humanen Geist der Mitmenschlichkeit beseelt waren.
Herkunft und Heimat
Ich glaube, daß ich Urgroßeltern gehabt habe, daß die Menschen, die sich für meine Eltern ausgaben, wirklich meine Eltern waren etc.[1]
Ludwig Wittgenstein
Es bedarf der Besinnung, ob und wie im Zeitalter der technisierten gleichförmigen Weltzivilisation noch Heimat sein kann.[2]
Martin Heidegger
Die ersten vierzehn Jahre ihres Lebens verbrachten die beiden Kinder im Kreis ihrer Familien. 1903 begannen sie, selbständige Schritte zu unternehmen. Nachdem er in seinem Wiener Zuhause nur von Privatlehrern unterrichtet worden war, führte der notwendig gewordene Schulbesuch Ludwig Wittgenstein nach Linz, wo ihn die praktisch orientierte Ausbildung an der Staatsoberrealschule auf einen technischen Beruf vorbereiten sollte. Er sollte Ingenieur werden wie sein Vater, der als Industrieller und Geschäftsmann ein riesiges Vermögen erwirtschaftet hatte. Martin Heidegger musste zur gleichen Zeit seinen Heimatort Meßkirch verlassen, weil ihm der Besuch eines Gymnasiums nur in Konstanz möglich war. Er sollte später Katholische Theologie studieren und Priester werden. Das wünschte sich vor allem sein fleißiger, sparsamer Vater, der neben seiner handwerklichen Arbeit auch als Mesner in der Kirche tätig war und von seinem Sohn erwartete, im Kirchendienst eine höhere Position als er selbst einzunehmen.
Dem Plan seines Vaters folgend, begann Wittgenstein Ende 1907, an der Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg Maschinenbau zu studieren; und auch Heidegger entsprach dem väterlichen Wunsch und schrieb sich 1909 als Student der Katholischen Theologie an der Universität Freiburg ein. Doch weder wurde der eine Ingenieur noch der andere Priester. Stattdessen wurden beide, wiederum im selben Jahr, 1911, von einer Leidenschaft für das Philosophieren gepackt, die ihre beruflichen Orientierungen zunichtemachte, aber nicht völlig auslöschte. Denn Heidegger setzte sich in seinem Denken immer wieder mit dem Glauben seiner Kindheit und Heimat auseinander, ohne den, wie er selbst bekannte, nicht zu verstehen sei, was ihn philosophisch herausforderte. «Ohne diese theologische Herkunft wäre ich nie auf den Weg des Denkens gelangt. Herkunft aber bleibt stets Zukunft.»[3] Auch Wittgensteins erster Schritt in die Philosophie ging von Fragen aus, auf die er während seines Studiums des Maschinenbaus, der Mathematik und der Logik gestoßen ist. Von der Philosophie erhoffte er sich eine Klärung der fachlichen Probleme, die ihn beunruhigten.
Wir wollen jedoch zunächst auf die ersten vierzehn Jahre ihres Lebens zurückblicken, auf die Kindheit eines Jungen aus einfachen, provinziellen Verhältnissen, in denen er sich geborgen fühlte; und auf die großbürgerliche, nahezu aristokratische Lebensform der Wittgensteins, in der es dem kleinen «Luki» nicht einfach gemacht wurde.
Das Haus Wittgenstein in Wien
Nach einigen ruhigen Weihnachtstagen 1950 bei seiner Familie im Wiener Wittgenstein-Palais in der Alleegasse, in dem er einst seine Kindheit verbracht hatte, reiste er zurück nach England. Zunächst fuhr er nach Oxford, um sein Testament zu verfassen und seinen Nachlass zu regeln, von dort nach Cambridge, wo er seit Ende November im Haus seines Arztes Dr. Edward Bevan lebte. Ludwig Wittgenstein litt an Prostatakrebs. Er wusste, dass er bald sterben musste. Er nahm es hin mit stoischer Gelassenheit. Unglücklich war er nur darüber, dass er nicht mehr arbeiten konnte. Die Hormonbehandlung mit Östrogen und die Bestrahlung machten ihn träge. Zum Philosophieren fehlte ihm die nötige Energie. Seine Gedanken fand er fade. Doch als Ende Februar 1951 die ärztlichen Maßnahmen als aussichtslos abgesetzt wurden, fühlte er sich ungeheuer erleichtert, und wie in einem Rausch brachte er seine letzten philosophischen Gedanken Über Gewißheit zu Papier, die um die Frage kreisten: Woran kann man in sinnvoller Weise zweifeln, und worauf kann man sich wirklich verlassen?
Wie konnte er sich sicher sein, wieder in England zu sein? «Wäre es nicht möglich, daß Menschen zu mir ins Zimmer kämen, die Alle das Gegenteil aussagten, ja, mir ‹Beweise› dafür gäben, so daß ich plötzlich wie ein Wahnsinniger unter lauter Normalen, oder ein Normaler unter Verrückten, allein dastünde? Könnten mir da nicht Zweifel an dem kommen, was mir jetzt das Unzweifelhafteste ist?»[1] Wittgenstein wusste, dass sein Zimmer im Haus der Bevans im zweiten Stock lag und dass hinter der Tür ein kurzer Gang zur Treppe führte. Er zeigte es tagtäglich durch seine Handlungen und in seinen Gesprächen.
Auch über seine Kindheit begann Wittgenstein am Ende seines Lebens nachzudenken. Wie, wann und von wem hatte er einst gelernt, woran er später, in seinem gewöhnlichen Leben, nicht zweifelte, auch wenn er als Philosoph daran hätte zweifeln können? Warum hatte er damals geglaubt, was er in den Lehrbüchern der Physik las? Warum war er davon überzeugt gewesen, dass ein mathematischer Satz wie 12 × 12 = 144 vom Zweifel ausgenommen ist? Und wie konnte er sich sicher sein, dass seine Eltern wirklich seine Eltern gewesen waren? «Dieser Glaube mag nie ausgesprochen, ja, der Gedanke, daß es so ist, nie gedacht werden.»[2]
Im April 1951 begann sein Name eine wichtige Rolle zu spielen, womit er nicht nur zu seinem anfänglichen philosophischen Problem zurückkehrte, wie Name und Benanntes zusammenhängen. Er dachte über seinen Eigennamen nach, als wäre er ihm heilig gewesen wie ein Schmuckstück, das ihm bei der Geburt umgehängt worden war. Wittgenstein philosophierte über die sonderbare Frage, wieso er wissen konnte, «daß ich L.W. heiße»[3]. Er wusste es ganz einfach. Schließlich war er seit seiner frühen Kindheit immer wieder mit diesem Namen angesprochen worden, und wenn es jemand bestreiten würde, dann hätte er sofort unzählige Verbindungen herstellen können, die seinen Namen sicherten. «Es gehört zu dem Sprachspiel mit den Personennamen, daß jeder seinen Namen mit der größten Sicherheit weiß.»[4] Würde sich seine Gewissheit, Ludwig Wittgenstein zu heißen, als irrig erweisen, so wäre er unglaubwürdig oder ein Träumer oder völlig verrückt.
Am 25. April fing Wittgenstein an, sein letztes Manuskript MS 177 zu schreiben, in dem er vor allem den alltäglichen Gebrauchssinn des Satzes «Ich kann mich darin nicht irren» zu klären versuchte.[5] Er spielte verschiedene Situationen durch, in denen dieser Satz verwendet werden kann. Dabei ließ ihn bis zuletzt das Problem seines Namens nicht los, als wäre er sich seiner Identität nicht sicher gewesen und hätte sich selbst überreden müssen, der richtige Ludwig Wittgenstein zu sein. «Ich könnte fragen: ‹Wie könnte ich mich darin irren, daß ich L.W. heiße?› Und ich kann sagen: Ich sehe nicht, wie es möglich wäre.»[6] Aber könnte er sich trotz seiner unumstößlichen Gewissheit nicht dennoch im Irrtum befinden? War nicht alles vielleicht nur ein Traum, gar ein Traum im Traum? «Wenn man aber mit dem Bedenken kommt: Wie, wenn ich plötzlich aufwachte und sagte ‹Jetzt hab ich mir eingebildet, ich heiße L.W.!› – Wer sagt denn, daß ich nicht noch einmal aufwache und nun dies als sonderbare Einbildung erkläre, usf.»[7] Doch einen Tag später, an seinem zweiundsechzigsten Geburtstag, hatte er sich aus diesem Strudel des grundlosen Zweifelns befreit und war sich wieder völlig sicher, Ludwig Wittgenstein zu heißen.
Am Abend des 28. April fiel er ins Koma, aus dem er nicht mehr erwachte. Am Morgen des folgenden Tages, während einige seiner engsten Freunde bei ihm waren und ein katholischer Priester auf den Knien für ihn betete, starb er. Dr. Bevan erklärte ihn für tot. Einen Tag später wurde er bei der St. Giles’ Church in Cambridge nach römisch-katholischem Ritus beerdigt.
«Die Alleegasse». Ludwig Josef Johann Wittgenstein wurde am 26. April 1889, halb neun Uhr abends, in der Neuwaldeggerstraße 38 geboren, einer Villa mit großem Garten und eigenem Waldbesitz am stillen Rand des Wienerwalds, wo seine Familie vor allem die heiteren Frühlings- und Herbsttage zubrachte. Die meiste Zeit des Jahres lebte sie damals im Haus 2 am Schwarzenbergplatz. Das war ein von repräsentativen Prachtbauten umgebener Platz in der Wiener Innenstadt, wo die Wittgensteins wohnten, bevor sie Ende 1891 in die Alleegasse 16 umzogen.[8] Ludwig war das achte[9] und letztgeborene Kind des Industriellen und Geschäftsmanns Karl Wittgenstein und seiner Frau Leopoldine, der typische Benjamin unter vier älteren Brüdern und drei älteren Schwestern, der liebevoll «Luki» oder «der Lukerl» genannt wurde und ein zartes, empfindsames Temperament besessen haben soll.
Das Familienleben war stark auf sich selbst bezogen in diesem prunkvollen Stadtpalais, das von einem Grafen Nakó erbaut worden war, von außen finster aussehend, innen pompös eingerichtet mit wuchtigen Möbeln und schweren Gobelins, Gemälden und Bronzestatuen. An den ornamental ausgestatteten Decken hingen glitzernde Kronleuchter. Ein imposanter Treppenaufgang führte in das obere Stockwerk mit seinen Salons und einem großen Musikzimmer, in dem die feierlich zelebrierten musikalischen Abendgesellschaften stattfanden und hervorragende Künstler zu Gast waren, unter anderem Johannes Brahms, Gustav Mahler, Bruno Walter und Pablo Casals. «Die Alleegasse», wie es von der Familie genannt wurde, war ein Haus der Musik und des Reichtums, der Kultur und der Geschäfte. Ein Dienstmann saß draußen vor der Tür auf seinem Hocker. Die Besucher gaben ihre Visitenkarten in einer Schale am Eingang ab. Die Büroräume des Vaters lagen im Erdgeschoss.
Dienstboten kümmerten sich um den alltäglichen Haushalt. Um die Kinder, solange sie klein waren, sorgten sich Ammen, um ihre Erziehung Kindermädchen und Hauslehrer. Denn keines der Kinder ging in einen Kindergarten oder eine öffentliche Schule. Sie hatten keine Spielkameraden oder Schulfreunde, sondern blieben unter sich. So wollte es der Vater, der schulischen Unterricht für einen überflüssigen Zeitvertreib hielt. Privatlehrer sollten seinen Kindern nur Mathematik und die lateinische Sprache beibringen, alles andere konnten sie sich durch eigene Lektüre aneignen. Auch las man oft gemeinsam, was für das Leben wichtig sein sollte. Neben der Musik spielte die Literatur die Hauptrolle für die Bildung der acht Kinder und Jugendlichen. Man las Werke von Gotthold Ephraim Lessing und Friedrich Schiller, Eduard Mörike und Gottfried Keller und diskutierte über bestimmte wichtige Stellen, die auswendig gelernt wurden. Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche wurden als Philosophen geschätzt, deren Arbeiten kontrovers besprochen wurden. Das Leben wurde mit Hilfe der Literatur erörtert, abgegrenzt durch den familiären Rahmen. Die meiste Zeit des Jahres lebte man in der Alleegasse. Im Frühjahr und Herbst wohnte die Familie für einige Wochen in ihrer herrschaftlichen Villa in Neuwaldegg, Ludwigs Geburtshaus. Im Sommer zog man das Leben auf der einsamen «Hochreith» vor, einem abgeschiedenen Gutshof im niederösterreichischen Gebirge, den der Vater 1894 für die Familie zur Erholung gekauft und luxuriös ausgebaut und eingerichtet hatte.
Der Vater. Auch wenn Karl Wittgenstein wegen seiner vielen Geschäfte kaum Zeit hatte, sich um die von ihm vorgeschriebene Erziehung seiner Kinder zu kümmern, so war er doch als übermächtige Autorität ständig präsent und bestimmte die Atmosphäre im Hause Wittgenstein, dieser großbürgerlichen Welt mit ihren prächtigen Häusern, Parkanlagen und Gütern. Er war eine imponierende Persönlichkeit, die es aus eigener Kraft geschafft hatte, einer der erfolgreichsten Großunternehmer in der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie zu werden, ein Mann voller Tatendrang, Entschlossenheit und Selbstdisziplin, der zum Despotismus neigte, jedoch auch durch seinen Humor und seine Großzügigkeit zu gefallen wusste.
Dabei hätte alles ganz anders kommen können. Denn nichts im Leben des jungen deutschen protestantischen Karl Wittgenstein deutete auf die Erfolgsgeschichte hin, die sich später mit seinem Namen verbinden sollte.[10] Geboren wurde er 1847 in Gohlis, einem Vorort von Leipzig, wo sein Vater Hermann Christian Wittgenstein als Wollgroßhändler tätig war, bevor er 1851 nach Wien umzog, um als deutscher Neuankömmling zur Modernisierung der Habsburger Monarchie beizutragen. Karl muss ein wildes, eigensinniges Kind gewesen sein, das schon mit elf Jahren keine Lust auf die Schule hatte und von zu Hause ausgerissen war. Er kam bis nach Klosterneuburg, wo er sich bettelnd und armselig bekleidet als Leipziger Waisenkind ausgab, damit aber nicht durchkam. Nach einigen Tagen brachte ihn die Polizei zu seinen Eltern zurück. Das Gymnasium musste er kurz vor der Matura verlassen, weil er in einem Aufsatz die Unsterblichkeit der Seele bestritten hatte. Statt an einer anderen Schule einen Schulabschluss anzustreben, ergriff er zum zweiten Mal die Flucht.
Im Januar 1865 schlug sich der Achtzehnjährige mit einer Geige, 200 Gulden seiner Schwester und einem falschen Pass nach Hamburg durch, von dort mit dem Schiff weiter nach New York, wo er ohne Geld ankam. Um zu überleben, kellnerte er in Restaurants, spielte Violine in Bars, fuhr als Steuermann auf einem Kanalboot nach Washington, wo er als Barkeeper in Lokalen arbeitete, die nur von Schwarzen besucht wurden. Ein wenig Geld verdiente er auch durch Unterricht in allen möglichen Fächern, vom Geigenspiel bis zur Mathematik. Viele Jahre später, als er seine Reise-Eindrücke aus Amerika in der Wiener Freien Presse veröffentlichte, berichtete er davon, wie er dort eine Lebensform erlebt hatte, durch die er viel mehr gelernt habe als in einer normalen Schule. «Der Kränkliche, der Brustschwache taugt nicht dazu und bleibt zurück. Überdies macht jeder Einwanderer in den ersten Jahren eine Schule durch, wie sie für die Erziehung eines Menschen nicht glücklicher gedacht werden kann; er unterliegt einem furchtbaren Zwange, seine Kräfte aufs äußerste anzuspannen, um überhaupt nur leben zu können.»[11]
Anfang 1867 kehrte Karl Wittgenstein nach Wien zurück. Er war zwar abgemagert und psychisch geschwächt, aber er war auch entschlossen, wie ein draufgängerischer amerikanischer Unternehmer zu arbeiten, um ein gutes Leben führen zu können. Stufe für Stufe stieg er auf der Leiter seiner glanzvollen Erfolgsgeschichte hinauf, wobei er alles auf zwei Karten setzte: auf technisches Wissen und finanziellen Geschäftssinn. Er besuchte die Technische Hochschule in Wien, arbeitete in Fabriken, wo er praktische Erfahrungen im Maschinen-, Turbinen- und Bahnbau sammelte, wurde Ingenieur und in den Direktionsrat von Walzwerken gewählt, koordinierte die böhmische und alpenländische Schwerindustrie und organisierte schließlich als Central-Director die Prager Eisenindustrie-Gesellschaft. Risikofreudig und entschlusskräftig, wurde er zur führenden Persönlichkeit der modernen Eisen- und Stahlindustrie ganz Österreich-Ungarns, mit einem gewaltigen privaten Wohlstand, der es ihm erlaubte, sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere 1898 aus den aktiven Geschäften zurückzuziehen.
Die Mutter. Ludwig Wittgensteins Vater war ein Mann der Tat, der das familiäre Leben beherrschte. Die Mutter war eher zum Dulden geboren. Sie bemühte sich, die Strenge und den Ehrgeiz ihres rastlosen Mannes durch freundliches, selbstloses Handeln zu mildern. Karl lernte die Katholikin Leopoldine Kalmus, 1850 in Wien geboren, durch die Musik kennen, die für sie die Haupttriebfeder ihres Lebens war. Die gescheite und gebildete junge Frau konnte sehr gut Klavier spielen, und es ergaben sich, vermittelt durch eine Schwester Karl Wittgensteins, mehrfach Gelegenheiten zum gemeinsamen Musizieren, bei dem Karl die Geige spielte. Als er sich in der Lage sah, eine Familie zu ernähren, verlobten sie sich. Am Valentinstag, den 14. Februar 1874, heirateten sie, begleitet von den Glückwünschen der Eltern. Bemerkenswert war der Hinweis von Karls Mutter, die ihrer Schwiegertochter schrieb: «Carl hat ein gutes Herz, hellen Verstand, aber er ist zu früh aus dem Elternhaus gekommen. Die endgültige Erziehung, Regelmäßigkeit, Ordnung, Selbstbeherrschung, das, hoffe ich, wird er durch Ihren liebevollen Umgang lernen. So segne Gott dies Bündnis, wie ich als Mutter es von ganzem Herzen segne!»[12]
Offensichtlich nahm «Poldy» Wittgenstein, geborene Kalmus, sich diesen Ratschlag zu Herzen. Selbstlos kümmerte sie sich vordringlich um das Wohlergehen ihres Mannes, während sie für ihre Kinder kein rechtes Verständnis aufbringen konnte. Hermine, die erstgeborene Tochter, die im Dezember 1874 zur Welt kam, konnte schon früh erkennen, dass das familiäre Klima durch die nicht auflösbare Spannung zwischen dem energisch handelnden Vater und der still duldenden Mutter merkwürdig erregt war. Es gelang Leopoldine nicht, ein ausgleichendes Gegengewicht zum Tatendrang und zur Vitalität ihres Mannes zu bilden, was ihre Nerven strapazierte, auch wenn sie es nach außen zu verbergen suchte, und sie davon abhielt, sich wirklich auf ihre Kinder einzulassen und ein Gespür für deren Bedürfnisse und Eigenarten zu entwickeln. Lieber überließ sie die Erziehung dem Fräulein Elise, einer gänzlich unfähigen, grantigen Kinderfrau, «die uns Kinder, wie wir der Reihe nach durch ihre Hände gingen, weder beschäftigte noch erzog, ja nicht einmal körperlich gut pflegte»[13].
Die Geschwister. Die Spannung zwischen den beiden elterlichen Temperamenten konnte nicht ohne Einfluss auf die Kinder bleiben. Dabei hatten es die drei Töchter leichter als die fünf Söhne. Denn sie konnten ohne größere Probleme ihren künstlerischen und sozialen Neigungen nachgehen, die ihnen von ihrem Vater zugestanden wurden. Sie litten nicht unter dem furchtbaren Zwang, den er auf seine Söhne ausübte, von denen er erwartete, dass sie wie er selbst all ihre Kräfte aufs äußerste anspannten, um in technischen Berufen und als Geschäftsmänner erfolgreich zu sein.
Hermine, meistens «Mining» genannt, seine Älteste, war Karl Wittgensteins liebstes Kind. Sie wurde später «die eigentliche Gefährtin ihres Vaters»[14], die ihm in familiären Konflikten zur Seite stand. Zeichnen und Malen lernte sie beim Künstler Franz Hohenberger, und zahlreiche ihrer Skizzen und Zeichnungen bieten einen schönen Einblick in die familiären Lebensräume. Ihre geschulte ästhetische Urteilkraft ließ sie bald zur wichtigsten Ratgeberin ihres Vaters werden, vor allem, wenn es um die Auswahl der Bilder ging, die das Wittgenstein-Palais schmücken sollten. Sie spielte Klavier und organisierte die abendlichen Musikveranstaltungen. Für ihre jüngeren Geschwister übernahm sie oft die Rolle der Mutter und wurde später, nach dem Tod des Vaters, das eigentliche Oberhaupt der Familie. Sie blieb ihr Leben lang unverheiratet. Lieber engagierte sie sich in sozialen Bereichen. Nach dem Ersten Weltkrieg gründete und leitete sie eine «Kinderbeschäftigungsanstalt», in der arme Buben lernen konnten und verpflegt wurden.
Helene, «Lenka» genannt, galt in ihrer Jugend als leichtsinnig. Stundenlang konnte sie mit ihrem zehn Jahre jüngeren Bruder «Luki» herumalbern. Als sie zwanzig Jahre alt war, heiratete sie einen soliden und humorvollen Beamten und konnte ihr eigenes Leben führen.
Die dritte, jüngste, 1882 geborene Tochter Margarethe war die Rebellin im Haus Wittgenstein, die verkörperte Auflehnung gegen alles traditionell Erstarrte. «Sie strotzte von Ideen und vor allem konnte sie was sie wollte und wußte was sie wollte.»[15] Durch sie fanden Bücher von Søren Kierkegaard, Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche Eingang in die Alleegasse. Und begeistert nahm sie auch die neuen psychoanalytischen Ideen Sigmund Freuds auf, der vor allem dem Wiener Bürgertum einen Spiegel seiner seelischen Abgründe vorhielt. 1904 heiratete sie den vermögenden Amerikaner Jerome Stonborough, wodurch sie endgültig aus allen familiären Abhängigkeiten befreit war.
Ganz anders als mit seinen Töchtern ging Karl Wittgenstein mit seinen Söhnen um. Es schien ihr von der Mutter geerbtes Temperament der Empfindsamkeit und des Selbstzweifels gewesen zu sein, das sie in einen leidvollen Konflikt mit der väterlichen Autorität verstrickte, der sie verunsicherte und in schwere Krisen stürzte. Denn sie alle wollten sich nicht auf den für ihren Vater einzig erstrebenswerten Doppelberuf des Technikers und Kaufmanns einlassen. Keiner von ihnen fühlte sich in der Lage, dem «harten Muß»[16] zu folgen, das der Vater von ihnen forderte. In ihren Familienerinnerungen hat Hermine ein dramatisches Bild dieser unlösbaren Vater-Söhne-Konflikte gezeichnet. «Es war tragisch, daß unsere Eltern, trotz ihres großen sittlichen Ernstes und ihres Pflichtgefühls, mit ihren Kindern keine Einheit zu bilden vermochten, tragisch, daß mein Vater Söhne bekommen hat, die von ihm so verschieden waren, als hätte er sie aus dem Findelhaus angenommen! Es muß ihm eine bittere Enttäuschung gewesen sein, daß keiner von ihnen in seine Fußstapfen treten und an seinem Lebenswerk weiter arbeiten wollte. Eine der größten Verschiedenheiten aber, und die tragischste, war der Mangel an Lebenskraft und Lebenswillen seiner Söhne in ihrer Jugend, und diesem Mangel wurde durch die unnormale Erziehung noch Vorschub geleistet.»[17]
Der älteste Sohn Hans, 1877 geboren, soll ein musikalisches Wunderkind gewesen sein. Er hatte schon früh nichts als Musik im Kopf. Er lernte Geige und spielte ausgezeichnet Klavier. Doch seine Talente wurden vom Vater unterdrückt, was ihn schon früh zu einem verkrampften Jungen werden ließ, dem ein gesundes jugendliches Lebensgefühl fehlte. Als er später in Fabriken in Böhmen, Deutschland und England lernen sollte, was väterlich von ihm gefordert wurde, versank er immer tiefer in eine unheilvolle Schwermut. 1902 verschwand er mysteriöserweise von einem Ausflugsschiff in der Chesapeake Bay an der amerikanischen Ostküste. Man ging von Selbstmord aus. 1903 wurde er von der Familie für tot erklärt.
Konrad, auch «Kurt» genannt, schien am wenigsten von den Sorgen und Zweifeln geplagt worden zu sein, die seine Brüder heimsuchten. Zwar wäre auch er lieber Pianist geworden, doch er ließ sich ohne großen Widerstand auf einen technischen Beruf ein. Sein Vater sorgte dafür, dass er Direktor einer Firma wurde, was er anscheinend recht gut ertrug. Im Ersten Weltkrieg war er ein pflichtbewusster, schneidiger Kavallerieoffizier, doch gegen Ende des Krieges, als ihm die Gefangenschaft drohte, entschloss auch er sich, Selbstmord zu begehen.
Rudolf, der drittgeborene Sohn, besaß einen ausgeprägten Sinn für Literatur. Doch statt ein Literaturkritiker zu werden, wie er es sich wünschte, musste er Chemie in Berlin studieren. Am 2. Mai 1904 saß der dreiundzwanzigjährige Student dort in einem Lokal. Er machte einen verstörten Eindruck. Während der Klavierspieler sein Lieblingslied «Verlassen bin ich» spielte, tötete er sich durch die Einnahme von Zyankali. Es wurde vermutet, dass er wegen einer unglücklichen Liebe zu einem Kommilitonen Selbstmord begangen hatte.
Paul Wittgenstein, zwei Jahre älter als sein Bruder Ludwig, wusste schon früh, was er werden wollte. Doch nach seiner Matura musste er zunächst eine Banklehre hinter sich bringen, bevor er sich gegen den Willen seines Vaters durchsetzen konnte und zum Pianisten ausbilden ließ. Sein erstes öffentliches Konzert gab er Anfang Dezember 1913. Während des Krieges verlor er zwar bald seinen rechten Arm, was ihn jedoch nicht daran hinderte, später sein Spiel nur mit dem linken Arm zu vervollkommnen und sehr erfolgreich mit Klavierstücken aufzutreten, die extra für ihn komponiert worden waren, unter anderem von Richard Strauss und Sergej Prokofjew, Paul Hindemith und Maurice Ravel.
Ludwig war das letztgeborene Kind von Karl und Leopoldine Wittgenstein. Das Glück der späten Geburt hat ihn davor geschützt, wie seine älteren Brüder dem Willen des Vaters ausgeliefert zu sein. Man ließ dem lieben «Lukerl» seinen Spielraum, in dem er sich recht ungebunden entwickeln konnte. Seine Schwestern, vor allem die fünfzehn Jahre ältere Hermine, kümmerten sich fürsorglich um ihren kleinen Bruder, der ein recht unproblematisches Kind gewesen zu sein scheint. Auf frühen Fotos blickt er gewinnend in die Kamera, ein wenig ernst vielleicht, aber keinesfalls unglücklich oder eingeschüchtert. Ihm fehlten sowohl der Widerstandsgeist seiner älteren Brüder als auch deren Neigung zur Selbstzerstörung, die drei von ihnen den Selbstmord als Ausweg wählen ließ. Eine herausragende Begabung war in seiner Kindheit nicht festzustellen. Es gab keine Anzeichen frühreifer musikalischer, künstlerischer oder literarischer Talente wie bei seinen Geschwistern. Zu sprechen soll er erst mit vier Jahren begonnen haben. Er war gern im Freien und liebte besonders die sommerlichen Tage auf der Hochreith, wo er mit seinem Pferd Monokel, das ihm sein Bruder Kurt geschenkt hatte, ausreiten konnte.
Wie all seine Brüder und Schwestern besuchte auch Ludwig Wittgenstein zunächst keine öffentliche Schule. Bis in sein vierzehntes Lebensjahr wurde er zu Hause von Privatlehrern unterrichtet. Es scheint ihm nicht missfallen zu haben. Denn im späteren Rückblick auf seine Kindheit und frühe Jugend wird er die «gute geistige Kinderstube»[18] loben, die er im familiären Kreis genossen habe. Doch am liebsten hatte er Dinge, die er sich selbst beibringen konnte, und schon im frühen Alter konzentrierte er sich «auf praktische Fertigkeiten und technische Interessen, die sein Vater bei den älteren Brüdern erfolglos zu wecken versucht hatte»[19]. Er war handwerklich sehr geschickt, und es scheint ihm Spaß gemacht zu haben, an seiner Drehbank in der Werkstatt arbeiten zu können.
Die Herkunft. Dem protestantischen Vater scheint es gleichgültig gewesen zu sein, dass seine acht Kinder die Religionszugehörigkeit der Mutter übernahmen und römisch-katholisch getauft wurden. Er selbst war ein Freidenker, seine Frau keine strenggläubige Katholikin. Die Religion spielte nur eine nebensächliche Rolle im Hause Wittgenstein. Man verstand sich als Teil der kulturellen und finanziellen Elite Österreich-Ungarns. Kein Mitglied der Familie dachte ernsthaft daran, dass für sie irgendeine jüdische Herkunft, mit der sie doch gar nichts zu tun hatten, eine Rolle spielen sollte.
Zum Problem wurde die jüdische Abstammung der Wittgensteins erst 1938, als Hitler mit reichsdeutschen Truppen am 12. März in Österreich einmarschierte und einen Tag später der «Anschluss» Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich proklamiert wurde. Die noch lebenden Mitglieder der Familie waren damit in eine schwierige Lage geraten, die Wittgenstein, der zu dieser Zeit in Cambridge lebte, sehr beunruhigte. Bereits am 14. März informierte er seinen Kollegen und Freund Piero Sraffa über seine unerfreuliche Situation. «Durch die Einverleibung Österreichs ins Deutsche Reich bin ich deutscher Staatsbürger geworden. Das ist für mich ein furchtbarer Zustand, denn ich bin nun abhängig von einer Macht, die ich in keinem Sinne anerkenne.»[20]
Vier Tage später berichtete er John Maynard Keynes in Cambridge davon, dass er nicht nur Deutscher geworden war, sondern durch die «Nürnberger Gesetze zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre» auch ein «deutscher Jude»[21], weil drei seiner Großeltern erst als Erwachsene christlich getauft worden waren. Dasselbe gelte auch für seinen Bruder Paul und seine drei Schwestern Hermine, Helene und Margarethe, jedoch nicht für deren Kinder, die als «Arier» betrachtet würden. Vor allem Hermine und Helene sollen zunächst in Panik geraten sein, als ihnen von ihrem Bruder Paul mitgeteilt wurde, sie würden nun als Jüdinnen gelten. Doch bald beruhigten sie sich wieder und glaubten, dass ihnen als patriotischen Mitgliedern einer angesehenen, äußerst reichen Wiener Großbürgerfamilie nichts geschehen könnte.
In den beiden folgenden Jahren gab es verschiedene juristische und finanzielle Probleme zu klären, die vor allem mit dem Devisenbesitz der Wittgensteins zu tun hatten. Es kam zu Verhören und Prozessen. Nachdem ein Großteil des Wittgenstein-Vermögens, das im Ausland angelegt worden war, an die Deutsche Reichsbank transferiert wurde, endete das «Judenproblem» der Geschwister Wittgenstein damit, dass ihr Großvater väterlicherseits, ein gewisser Hermann Christian Wittgenstein, uneingeschränkt als «deutschblütig» anerkannt wurde und sie deshalb als «Mischlinge» galten, deren Kinder als reine Deutsche anzusehen seien.[22]
Die Erforschung der familiären Abstammungslinien ergab, dass Ludwig Wittgenstein tatsächlich Urgroßeltern hatte, die jüdisch waren. Ein gewisser Moses Meier aus Korbach in Hessen war mit Brendel Simon verheiratet gewesen. Aufgrund des napoleonischen Dekrets von 1808, das es den Juden vorschrieb, einen weiteren Nachnamen anzunehmen, um Verwechslungen zu vermeiden, hatte er sich «Wittgenstein» ausgesucht, weil er eine Zeitlang als Gutsverwalter am Hof der Fürstenfamilie Sayn-Wittgenstein gearbeitet hatte. 1802 wurde der Sohn Hermann Christian geboren, der später auf den Namen Meier ganz verzichtete und sich nur noch Wittgenstein nannte, Ludwigs Großvater, der sich als «Christian» entschieden vom Judentum abgrenzte und zum Protestantismus konvertierte. Er war ein äußerst ernster, energischer Mann, der davon überzeugt war, dass sich nur durch unermüdliche fleißige Arbeit eine allseits geachtete Lebensform erreichen ließ. 1839 heiratete er Franziska Figdor, die aus einer alten jüdischen Wiener Kaufmannsfamilie stammte, jedoch ebenfalls kurz vor ihrer Eheschließung zum Protestantismus übergetreten war.
1851 zog die Familie, zu der mittlerweile zehn Kinder gehörten, nach Wien, wobei Hermann Christian Wittgenstein größten Wert darauf legte, dass ihre Lebensführung absolut nichts «Jüdisches» an sich hatte. Mit Juden wollte er keine Geschäfte machen. Seinen Kindern verbot er, Juden zu heiraten, woran sich alle hielten, mit Ausnahme von Karl Wittgenstein, Ludwigs Vater, der schon früh gegen die väterliche Macht aufbegehrte und im Januar 1865 nach Amerika flüchtete. Denn er missachtete die Vorschrift seines Vaters und heiratete die katholische «Halbjüdin» Leopoldine Kalmus, deren Vater Jakob das hübsche Mädchen Marie Stallner geheiratet hatte, die Tochter eines erfolgreichen Kaufmanns und Grundbesitzers in der Steiermark, die als Karls Mutter der einzige beglaubigte nichtjüdische, «rein arische» Großelternteil Ludwig Wittgensteins war, der, wenn man solche Berechnungen anstellen möchte, als «Dreiviertel-Jude» in eine vollständig assimilierte großbürgerliche Wiener Familie ohne Jüdisches hineingeboren worden war.
Feldweg und Kirchturm in Meßkirch
Am 14. Januar 1976 bekam der sechsundachtzigjährige Martin Heidegger Besuch in seinem Alterssitz, einem bescheidenen Häuschen auf seinem Grundstück in Freiburg-Zähringen, das im unteren Gartenteil gegen den Fillibach gelegen war. Der Kreis seines Lebens war eng gezogen. «Ein Arbeitszimmer, wenige Quadratmeter groß, mehr eine Zelle, ein Arbeitstisch vor dem Fenster, ganz wenige Bücher daneben im Regal, ein überzeugender Ausdruck einer letzten Verinnerlichung.»[1] Das eigentliche Philosophieren hatte er eingestellt. Mit großer Gelassenheit bereitete er sich auf seinen Tod vor, der ihm ein Geheimnis blieb, von dem er nichts wissen konnte. Stattdessen erinnerte er sich an das, was er erlebt und gedacht hatte. Hauptsächlich war er mit dem Ordnen seines Nachlasses beschäftigt und dabei, den Plan einer Gesamtausgabe seiner Werke zu verwirklichen, von denen die meisten nicht veröffentlicht worden waren. 1975 war als erster Band seine Vorlesung Die Grundprobleme der Phänomenologie erschienen, die er im Sommersemester 1927 an der Marburger Universität gehalten hatte.
Es war ein langes Gespräch, das Heidegger am 14. Januar 1976 mit Bernhard Welte führte, emeritierter Professor für Christliche Religionsphilosophie an der Universität Freiburg, dem er sich nicht nur in philosophischer Hinsicht verbunden fühlte, sondern vor allem wegen ihrer Herkunft aus der gemeinsamen Heimatstadt Meßkirch. Schon ihre Mütter waren miteinander befreundet gewesen; und der Tod von Weltes Mutter im Mai 1946 war einer der ersten Anlässe gewesen, mit seinem Landsmann engeren Kontakt aufzunehmen. Damals hatte er ihm die tröstenden Worte geschrieben: «Oft denke ich jetzt daran, wie gut und fast ein reines Glück es ist, im heimatlichen Boden und im Andenken der Nächsten ruhen zu dürfen und aus erfülltem Leben der ewigen Bestimmung gehören zu dürfen. Wie anders dagegen ist dieses heimatlose Umkommen irgendwo zwischen fremden Menschen, das sich jetzt täglich im Osten abspielt.»[2] Dreißig Jahre später griff Heidegger diesen Gedanken wieder auf, als er mit Welte über den eigenen Tod und seine Beisetzung sprach. Auch er wollte auf dem Friedhof im heimatlichen Meßkirch begraben werden, und zwar christlich nach römisch-katholischem Ritus. Welte sollte an seinem Grab die Gedenkrede halten, und sein Sohn Hermann sollte langsam und schlicht als letzten Gruß an die Verwandten und die nächsten Freunde einige ausgewählte Strophen aus Hölderlins Dichtung lesen, in denen dieser Dichter, den Heidegger über alles schätzte, das erlösende Wort gefunden hatte, um in einer Zeit der Heimatlosigkeit und Gottesferne an das verlorengegangene Heile, Heitere und Heilige zu erinnern.
Anfang Mai informierte ihn Welte, dass er am 28. Mai nach Meßkirch fahren werde, um dort die Ehrenbürger-Urkunde seiner Heimatstadt entgegenzunehmen. Er empfand das Heimatliche als ein Geschenk: «Die Klarheit und Härte der Luft, die gedankenreichen und wortkargen Menschen, die lebendige Einsamkeit der Wälder. Und der Klang der Glocken. Sie wissen davon, darum schreibe ich Ihnen das.»[3] Am 23. Mai dankte Heidegger Welte für seinen Brief, in dem er die Grundstimmung der heimatlichen Gegend so schön geschildert habe. Doch leider könne er an diesem festlichen Ehrentag nicht in Meßkirch sein. Sein gesundheitlicher Zustand erlaube zurzeit keine Reise. Deshalb könne er nur einen Wunsch mitteilen: «Erfreuend und belebend sei dieser Festtag der Ehrung. Einmütig sei der besinnliche Geist aller Teilnehmenden. Denn es bedarf der Besinnung, ob und wie im Zeitalter der technisierten gleichförmigen Weltzivilisation noch Heimat sein kann.»[4]
So endete der letzte Brief, den Heidegger geschrieben hat. Drei Tage später, am Morgen des 26. Mai 1976, starb er ruhig und gelassen. Seine Leiche wurde nach Meßkirch überführt, wo am 28. Mai, Weltes Ehrenbürger-Festtag, seine Beisetzung stattfand. Wie er es sich gewünscht hatte, sprach Welte an seinem Grab die Abschiedsworte, mit denen er an den langen Weg mit seinen Wendungen und Kehren, seinen Irrungen und Wirrungen erinnerte, den Heidegger gegangen war, um in der dunklen Tiefe der Gottesferne auf eine Botschaft des letzten Gottes zu warten, auch wenn er kein Christ im üblichen Sinn des Wortes mehr gewesen ist.
Und dann las Heideggers Sohn Hermann die Verse vor, die sich sein Vater zur Beisetzung ausgewählt hatte. Er begann seine Lesung mit der vierten Strophe aus Hölderlins Elegie Brot und Wein:
Seliges Griechenland! du Haus der Himmlischen alle,
Also ist wahr, was einst wir in der Jugend gehört?
Festlicher Saal! der Boden ist Meer! und Tische die Berge,
Wahrlich zu einzigem Brauche vor Alters gebaut!
Aber die Thronen, wo? Die Tempel, und die Gefäße,
Wo mit Nectar gefüllt, Göttern zu Lust der Gesang?
Wo, wo leuchten sie denn, die fernhintreffenden Sprüche?
Delphi schlummert und wo tönet das große Geschick?[5]
Nicht an den christlichen Gott wurde erinnert. Der Dichter Hölderlin, der für den Denker Heidegger so etwas wie ein Seher oder Prophet war, hatte an die «Himmlischen» gedacht, die winkenden Götter auf ihren Thronen und in ihren Tempeln, die in Griechenland zu lichten Gestalten geworden waren und mit ihren leuchtenden «fernhintreffenden Sprüchen» die Welt aufheiterten. Was die Grenze des Denkbaren überschritt und sich in einer Sprache der Weltabbildung nicht sagen ließ, fand in den Versen der Dichtung ihren wahren Ausdruck. Sie sagten Heidegger etwas vor und wiesen ihm einen Weg, auch wenn er wusste, dass er die Himmlischen und Göttlichen niemals erreichen konnte, die der Welt entflohen waren, aber vielleicht auch zurückkommen konnten. Er hatte einst davon in seiner Jugend und Heimat gehört. Die nahe Erfahrung des Todes hat es ihm wieder in die Nähe rücken lassen.
Meßkirch. Am 26. September 1889 wurde Martin Heidegger im badischen Meßkirch geboren, einem kleinen katholischen Landstädtchen in einer kargen und rauen Landschaft zwischen Bodensee, oberer Donau und Schwäbischer Alb. Im 13. Jahrhundert war der Marktflecken zur Stadt geworden, die unter der Herrschaft der Grafen von Zimmern eine kurze wirtschaftliche Blütezeit erlebt hatte. Hoch ragt noch immer das mächtige gräfliche Schloss in der Mitte der Stadt, flankiert durch die imposante Pfarrkirche, die dem heiligen Martin gewidmet ist. Mit ihrem hohen Turm strahlt sie in der Pracht des oberschwäbischen Barock. Schon Heideggers Großvater war nach diesem Heiligen benannt worden, und auch der Vater hatte seinen erstgeborenen Sohn auf den Namen Martin taufen lassen, um ihn der christlich-katholischen Tradition einzugliedern.
Die ersten vierzehn Jahre seines Lebens lebte der junge Martin in seiner Heimatstadt, zunächst in einem kleinen Haus im Grabenviertel am Stadtrand, ab 1896 im Mesnerhaus, Kirchplatz 3, mit Blick auf die Längsseite der St.-Martins-Kirche, an der Heideggers Vater, neben seiner Arbeit als Küfermeister, seinen Kirchendienst leistete. Es war eine sorglose Jugendzeit, die Martin mit seiner zwei Jahre jüngeren Schwester Maria (1891–1956) und seinem fünf Jahre jüngeren Bruder Fritz (1894–1980) in dem einfach umgrenzten Lebenskreis ihres Elternhauses verbrachte, das weder reich noch arm war. Als «kleinbürgerlich wohlhabend» in materieller Hinsicht hat es der Bruder charakterisiert: «Es herrschte weder Not noch Üppigkeit; das Zeitwort ‹sparen› wurde groß geschrieben.»[6]
Das war nichts Ungewöhnliches in dieser kleinen Provinzstadt, die der junge Martin als seine natürliche, ursprüngliche Heimat erlebte, an deren bewahrenden und heilenden Kräften er sein Leben lang sich zu stärken versuchte. Noch gab es keine Autos. Pferdefuhrwerke brachten die nötigen Mittel zum Leben übers Land, und auf Karren wurden sie im Ort transportiert. Die Kommunikation fand zwischen Menschen statt, die sich nahe waren und in die Augen sehen konnten. Es gab weder Telefone noch Radios, weder Fernseher noch Kinos. Noch war die Bodenständigkeit des heimatlichen Lebens und der menschlichen Werke nicht durch die Mittel und Mächte der modernen Technik, Industrie und Information verdrängt worden, die Heidegger desto radikaler kritisierte, je älter er wurde. Er benutzte zahlreiche Gedenktage als Gelegenheiten, den heimischen Ort seiner Kindheit zu vergegenwärtigen mit dem unglücklichen Bewusstsein, dass Heimat im Zeitalter einer technisierten gleichförmigen Weltzivilisation unwiederbringlich verlorenging.
Der alte Heidegger dachte im Zustand der Heimatlosigkeit, die er als globales «Weltgeschick» verstand. Zum ersten Mal brachte er sie in seinem Brief über den «Humanismus» zur Sprache, den er im Herbst 1946 an den französischen Freund Jean Beaufret schrieb: «Die Heimatlosigkeit wird ein Weltschicksal.»[7] Er dachte dabei nicht nur an die Millionen von deutschen Heimatvertriebenen und Flüchtlingen aus dem Osten, die sich in der Fremde ein neues Zuhause aufbauen mussten, sondern auch an eine weltgeschichtliche Dynamik, die den neuzeitlichen Menschen aus den vertrauten Bindungen und Sicherheiten «des Seins» herausreißt. Er erinnerte an Friedrich Hölderlin, der in seinem großen Gedicht Heimkunft/An die Verwandten seine schwäbische Heimat noch als einen Ort der Freude beschrieben hatte, die aus der Nähe zum Ursprung entstehe; an Friedrich Nietzsche, der die Zerstörung aller höheren Werte und traditionell vertrauten Sinngebungen bereits als nihilistische Katastrophe gedacht und empfunden hatte; und an Karl Marx, der als Vertriebener die Entfremdung des Menschen schmerzhaft erlebt und in ihrer geschichtlichen Tiefendimension erkannt und beschrieben hatte.
In zahlreichen Reden, Grußadressen und Aufsätzen hat Heidegger vor allem in den fünfziger und sechziger Jahren die Spannung zwischen Heimat und Heimatlosigkeit beschworen, zwischen den tragenden Kräften des Heimischen und der Gewalt des Unheimischen und Entwurzelten. Auf der Gedenkfeier zum 175. Geburtstag des Komponisten Conradin Kreutzer, der ebenfalls in Meßkirch geboren worden war, wo auf dem großen Platz vor der Kirche noch heute sein Denkmal steht, dankte er am 30. Oktober 1955 seiner Heimatstadt für alles, was sie ihm auf seinem langen Lebens- und Denkweg mitgegeben hatte. Nachdenklich fragte er, ob nicht zu jedem gelungenen Werk «die Verwurzelung im Boden einer Heimat»[8] gehöre, die nicht in den technisch erzeugten Vorstellungsbezirken verlorengehe, die eine künstlich gemachte Welt vortäuschen, die keine Welt mehr sei. Dabei erwähnte Heidegger auch den Dichter Johann Peter Hebel, dem er sich verwandt fühlte und dessen natürliche Muttersprache er bewunderte, weil er in seinen Alemannischen Gedichten (1803) und seinem Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes (1811) das Unscheinbare zum Scheinen gebracht hatte aus Sehnsucht nach der verlorenen Heimat. «Das Wesen der Heimat gelangt erst in der Fremde zum Leuchten. Alles, was die großen Dichter singen und sagen, ist aus dem Heimweh erblickt und durch diesen Schmerz ins Wort gerufen.»[9]
Als Heidegger am 27. September 1959, einen Tag nach seinem siebzigsten Geburtstag, die Ehrenbürgerurkunde der Stadt Meßkirch entgegennahm, zu deren Verleihung Bernhard Welte die Festrede hielt, dachte er sich nicht zurück in eine blass gewordene Vergangenheit, sondern «in das Gewesene, das heißt in jenes, was versammelt noch währt und uns bestimmt»[10]. Wieder erinnerte er an Hölderlin, den er für den Dichter der wahren Dichtung hielt und der die vierte Strophe seiner großen Hymne Der Rhein mit den Versen begonnen hatte: «Wie du anfiengst, wirst du bleiben, So viel auch wirket die Noth.»[11] Er dachte an Friedrich Nietzsche, der die Heimatlosigkeit des modernen Menschen als auswegloses metaphysisches Schicksal erfahren und philosophisch skizziert hatte. «Der Philosoph ist eine seltsame Pflanze.»[12] Er braucht seinen eigenen Boden, in dem er wurzelt, um ins Freie und Offene wachsen zu können. Das gleiche Bild hatte er auch bei Hebel gefunden, das er mehrmals im Andenken an seine eigene Herkunft erwähnte: «Wir sind Pflanzen, die – wir mögen’s uns gerne gestehen oder nicht – mit den Wurzeln aus der Erde steigen müssen, um im Äther blühen und Früchte tragen zu können.»[13] Als Erde galt Heidegger alles, was den Menschen sinnlich nährt und trägt, vor allem der heimatliche Boden, auf dem der Mensch stehen kann in seiner Bodenständigkeit. Über ihm erstreckt sich der ätherische Himmel, den Heidegger als «offenen Bereich des Geistes»[14] verstand, in dessen über-sinnliche Höhe der Mensch hinaufsteigen können muss, wenn sein Werk gelingen soll.
Zwei Jahre später hielt Heidegger seine Ansprache zum Heimatabend von Meßkirch, das 1961 sein 700-jähriges Stadtjubiläum feierte. Er dachte dabei nicht nur an die Herkunft aus dem Gewesenen, sondern sprach über die unheimliche Gewalt, die im riesenhaften System der modernen Industrie- und Informationstechniken auf die Menschen zukomme, in einem rasenden Wechsel vom Neuesten zum Allerneuesten, dem sie global nachhetzen. Unter der weltweiten Vorherrschaft der modernen Technik und der durch sie bewirkten Weltveränderung könne die Heimat nur noch im «Heimweh» den Menschen berühren, im Wissen um das Verlorene, «aus dem wir herkommen. Auch für diese Herkunft gibt es Zeichen.»[15] Sie finden sich, wie Heidegger als alt gewordener Meßkircher feststellen musste, vor allem auf dem Friedhof, der früher «Gottesacker» genannt wurde, was mancherlei Deutungen zuließ, wie auch die folgende: «Auf diesen Acker wird immer neu die Erinnerung an das Gewesene gesät. So wächst auf diesem Acker das Andenken an das Elternhaus und an die Jugendzeit und mit ihr das Andenken an all die Kräfte und Mächte, die das Heilsame spenden, das Fruchtbare und das Bleibende, bisweilen auch das Bedeutende.»[16]
Der Vater. Friedrich Heidegger, ein gebürtiger Meßkircher, war 1851 als Sohn des Schustermeisters Martin Heidegger und seiner Frau Walburga, geborene Rieger, zur Welt gekommen. Der Familienstammbaum väterlicherseits lässt sich bis in das Jahr 1649 zurückverfolgen, als ein Oswald Haydecker aus dem Oberösterreichischen ins Badische eingewandert war.[17] Seinen drei Kindern Martin, Maria und Fritz konnte der Vater Friedrich nur wenig Zeit und Aufmerksamkeit widmen. Denn jahraus, jahrein arbeitete dieser ernste Mensch in seinem Einmannbetrieb. Zehn Stunden am Tag und sechs Tage in der Woche hielt er sich in seiner Werkstatt auf, wo er als Küfer das Kiefern- und Eichenholz für Kübel, Zuber und Fässer zurichtete. Er war «ein großer Schweiger»[18], der auf unnütze Worte keinen Wert legte. Wenn er eine Beziehung zu seinen Kindern aufnahm, dann vor allem über seine handwerkliche Arbeit, wenn er sie in der Werkstatt zuschauen ließ und ihnen die einzelnen Werkzeuge und Arbeitsvorgänge erklärte.
Die Härte der väterlichen Tätigkeit wird Martin Heidegger sein Leben lang sinnlich gegenwärtig bleiben, und oft wird er sich daran erinnern, wie er und sein Bruder aus Eichenrinde ihre Schiffe schnitzten, die sie dann im Bach oder im Schulbrunnen schwimmen ließen. Manchmal folgten sie ihrem Vater auch auf dem Feldweg ins Gehölz, wo er das Material für seine Arbeit holte. Dann sahen und hörten sie, wie mitten im Wald eine Eiche unter dem Schlag der Holzaxt fiel. Gern spielten sie in den sonnigen Lichtungen, wo die Dinge sich zeigen konnten, wie sie sind, unverborgen durch das Dunkel des dicht verwachsenen Waldes. «Etwas lichten bedeutet: etwas leicht, etwas frei und offen machen, z.B. den Wald an einer Stelle frei machen von Bäumen. Das so entstandene Freie ist die Lichtung», wird Heidegger noch 1964 erläutern, um die Aufgabe des Denkens zu versinnbildlichen.[19] In den Lichtungen kann das Licht des Denkens einfallen, um dem Dunklen widerstreiten zu können. Denn auch das Dunkle braucht die Lichtung. «Wie könnten wir sonst in das Dunkle geraten und es durchirren?» So hatte also der junge Martin in den heimatlichen Wäldern bereits das Lichten jener Lichtung kennengelernt, das später einen zentralen Punkt seines Philosophierens bilden wird. Und in der Nähe seines Vaters wurden ihm in den Wäldern von Meßkirch auch die Wege vertraut, «die meist verwachsen jäh im Unbegangenen aufhören»[20]. Vor allem die Holzmacher und Waldhüter wussten sie zu nutzen. Doch auch der Philosoph wird sich viele Jahre später noch an diese früh erfahrenen Holzwege erinnern und 1949 eine Sammlung seiner Vorträge unter ihrem Namen veröffentlichen: «Sie gehen in die Irre. Aber sie verirren sich nicht.»[21]
Die Mutter. Umgrenzt und geschützt waren die kindlichen Spiele und Abenteuer durch die Mutter Johanna, geborene Kempf. «Es war, als hütete ihre unausgesprochene Sorge alles Wesen.»[22] Sie war eine Bauerntochter aus dem einige Kilometer östlich von Meßkirch gelegenen Dorf Göggingen, wo sie und ihre zwei Jahre ältere Schwester Gertrud als die schönsten Mädchen galten. Ihre Familie lebte seit 1662 auf dem Lochbauernhof, einem stattlichen Besitz mit 80 Morgen Feld, mit Wiesen und Wald.
Am 9. April 1887 hatte die neunundzwanzigjährige Johanna Kempf den bereits sechsunddreißig Jahre alten Handwerksmeister Friedrich Heidegger geheiratet, dessen Schweigen und Ernsthaftigkeit sie durch lebensfrohe Heiterkeit aufzulockern wusste. «Kontaktfreudig liebte sie sinnvolle Gespräche und gesellige Unterhaltung; sie verschmähte auch nicht ein Schwätzerle mit ihresgleichen, aber ohne Schwatzbasenallüren.»[23] Johanna Heidegger war eine praktische Frau, und was sie tat, hatte Hand und Fuß. Auch war sie eine «Künstlerin im Zieren der Altäre vor den kirchlichen Hochfesten», wobei ihr die Tochter Maria, das «braunäugige Mesner-Mariele», fleißig half. «Oft sagte sie, das Leben sei so schön eingerichtet, daß man sich immer auf etwas freuen dürfe.»[24]
Besonders durch das Heimatdorf der Mutter und den Lochbauernhof, wo sich der junge Martin gern aufhielt und mit seinem Vetter Gustav Kempf fröhlich spielte, wurde ihm das Leben der Bauern vertraut und «jenes Land, durch dessen Felder die Vorfahren den Pflug geführt und im sicheren Wechsel der Jahreszeiten die einfache Ordnung ihres bäuerlichen Lebens verwirklichten»[25]. Was er in Göggingen erlebt und gelernt habe, sei durch keine Klugheit und keinen Scharfsinn zu ersetzen, wird sich Martin Heidegger 1936 in seiner Rede zum achtzigsten Geburtstag seiner Tante Gertrud erinnern. Die Aufenthalte im Dorf der Mutter gehörten für ihn zu den kostbarsten Erlebnissen seiner Kindheit. Sie öffneten ihm einen freien Spielraum «für das Wesentliche, Echte und Einfache, was das Leben brachte und forderte»[26].
Feldweg und Kirchturm. Neben den vertrauten Orten in Meßkirch und Göggingen, den Wäldern der Umgebung mit ihren Lichtungen, dem Zuhause des Elternhauses, in dem ein fleißiger Vater keine unnützen Worte verlor und eine lebensfrohe Mutter sich um ihre Kinder sorgte, war es vor allem der Feldweg, an den der Philosoph immer wieder dachte, wenn er in seinem Denken nicht mehr weiterwusste. Er bot ihm eine Orientierung, um seinem Philosophieren einen Weg durch die Probleme und Rätsel zu zeigen, in denen er sich zu verirren drohte. Noch im hohen Alter versuchte er, auf den «Zuspruch des Feldweges»[27] zu hören und gegen die zerstreute Weglosigkeit des Menschen den Sinn dessen zu vernehmen, wovon auch die hohe Eiche am Waldrand einst zu ihm gesprochen hatte: dass in ihrem langsamen und steten Wachstum «allein gegründet wird, was dauert und fruchtet: daß wachsen heißt: der Weite des Himmels sich öffnen und zugleich in das Dunkel der Erde wurzeln»[28]. Nur im Schutz der tragenden Erde ließ sich der Anspruch des höchsten Himmels erfüllen. Auf diesem Feldweg lernte Heidegger, wovon und wohin er sich sein Leben lang führen lassen wollte. Er strebte nach dem Großen, Hohen und Freien, das sich ihm anfänglich im Kleinen, Sanften und Begrenzten gezeigt hatte.
In Heideggers Kindheit begann dieser Feldweg, das «Bichtlinger-Sträßle», unmittelbar hinter dem Hofgartentor des Schlosses. In sanften Windungen verlief er durch Wiesen und Felder zum Ehnried. Am Kruzifix wandte er sich zum Wald hin. War schönes Wetter, konnte man in der Ferne die Alpen sehen. Gern ging Heidegger diesen Weg, vom Ziel wieder zurück zum Hofgarten, wobei er hinter dem wuchtigen Schloss den Turm der St.-Martins-Kirche sehen konnte, in der nicht nur sein Vater als Mesner, vor allem bei Taufen, Trauungen und Beerdigungen, tätig war und bei der Turmuhr und den Glocken seinen Dienst tat. In diesem Kirchturm spielten auch seine beiden Buben gern. Oft haben sie sich ihre Hände an den Seilen heiß gerieben, wenn sie die alte Glocke unter den Schlägen des Stundenhammers erzittern ließen. «Der Glockenturm war die Mitte des Lebenskreises unserer Jugend: die Glocken und die alte Turmuhr. Was uns dorthin rief und dort festhielt, war stets halb Dienst, halb Spiel. Sogar der Rhythmus der Spiele, die wir anderswo – im Hofgarten oder in der Hägelemühle oder am Mettenbach – pflegten, war vom Turm her bestimmt.»[29]
Besonders im Sommer verbrachten die Brüder ihre Spielnachmittage in der Glockenstube oder im höchsten Gebälk des Turms bei den Zifferblättern der Turmuhr. «Dort oben hauste ich viel bei den Dohlen und Mauerschwalben und träumte in das Land», wird Heidegger ein halbes Jahrhundert später berichten;[30] und 1954 hat er dem Geheimnis des Glockenturms einen seiner schönsten Erinnerungstexte gewidmet. Hier klang noch einmal das Spiel der Glocken nach, das die Kindheit durchtönt hatte. Die kirchlichen Feste, der Lauf der Jahreszeiten, die mittäglichen und abendlichen Stunden waren durch den Klang der Glocken geheimnisvoll ineinandergefugt, «so daß immerfort ein Läuten durch die jungen Herzen, Träume, Gebete und Spiele ging»[31].
Täglich um drei Uhr nachmittags läuteten die beiden Mesnerbuben die kleinste Glocke. Dafür unterbrachen sie ihre Spiele auf dem «Marktbrückle» vor dem Rathaus, wo sie ihre Murmeln laufen ließen, oder ihre Fang- und Ballspiele im Hofgarten. Martin und Fritz waren keine Wunderkinder. «Nicht einmal zu Musterknaben hat es gereicht», wird der Bruder Fritz zum 26. September 1969 in seinem Geburtstagsbrief an den achtzigjährigen Jubilar schreiben, dessen Jugendjahre vor allem durch den Sport geprägt waren. Martin Heidegger war ein begeisterter Fußballspieler, ein gewandter Turner am Reck und am Barren, «im Sommer ein guter Schwimmer und im Winter ein flotter Schlittschuhläufer auf dem Eisweiher neben der Hegelmühle»[32]. Auch an die Lausbubereien, Indianergefechte und Kämpfe mit den Kindern aus dem Nachbardorf Göggingen hat Fritz dabei erinnert. «Bei unserer Truppe spieltest Du den Hauptmann, geschmückt mit einem stattlichen eisernen Säbel», was kein geringer Vorteil gegenüber dem Gegner war, dessen Soldaten nur mit Holzsäbeln bewaffnet waren.[33] Man war mit vollem Ernst bei der Sache, aber genoss zugleich «die Wohltat einer seitdem nie mehr erlebten stetigen Schwerelosigkeit» und eines heimatlichen Glanzes, der auf allen Spielen lag.
Meßkircher Katholizismus. Die Heideggers waren Katholiken, deren Religiosität selbstverständlich war. Weder mussten sie ihren Glauben verteidigen noch gegen andere durchsetzen. Doch es war ihnen nicht erspart geblieben, in den erbitterten Kulturkampf hineinzugeraten, der seit dem Ersten Vatikanischen Konzil von 1869/1870 auch die Pfarrgemeinde Meßkirchs in zwei feindliche Lager gespalten hatte, die sich nicht nur in kirchenpolitischer, sondern auch in sozialer Hinsicht unterschieden. Denn in Südbaden hatte sich seit der napoleonischen Zeit ein eigenständiger Katholizismus entwickelt, der sich mit dem immer stärker werdenden Herrschaftsanspruch Roms nicht abfinden wollte. Als das Vatikanische Konzil das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes in Glaubens- und Sittenlehre verkündete, verweigerten die fortschrittlichen Katholiken den Gehorsam. Sie organisierten sich gegen die «Ultramontanen», die sich der päpstlichen Macht jenseits der Berge (ultra montes) in Rom unterordneten. Sie bildeten ihre eigene Kirche und nannten sich «Altkatholiken», weil sie beim alten, vorkonziliarischen Glauben bleiben wollten, der die Autorität des Papstes in Grenzen gehalten hatte. Meist gehörten sie zum vermögenden, gebildeten Bürgertum, das sich als liberal und aufgeklärt verstand. Gegen die «römischen Katholiken», ihre ärmeren Mitbürger, die nicht wagten, dem päpstlichen Unfehlbarkeitsanspruch zu widersprechen, besetzten sie alle wichtigen politischen und gesellschaftlichen Positionen in Meßkirch. Auch die St.-Martins-Kirche war von ihnen übernommen worden, sodass Friedrich Heidegger seinen Mesnerdienst nur in einem zur Notkirche umgebauten Fruchtspeicher leisten konnte. Erst 1895 erhielten die «Römischen» ihre Kirche wieder zurück, wobei der altkatholische Mesner den Schlüssel nicht Friedrich Heidegger übergab, sondern dessen sechsjährigem Sohn Martin, der nun mit seiner Familie wieder im angestammten Mesnerhaus gegenüber der Kirche wohnen konnte.