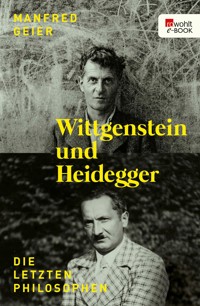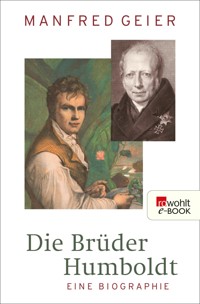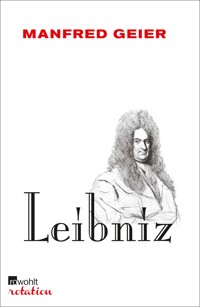11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Liebe ist ein Dauerbrenner der Philosophie. Doch was geschah wirklich, wenn Philosophen nicht nur dachten, sondern auch liebten, von den anfänglichen Spielen der Verführung bis zum Höhepunkt der sexuellen Lust? Manfred Geier hat dem Lustprinzip nachgeforscht, das in Leben und Werk der großen Denker als Antriebskraft wirksam war. An elf sexualbiographischen Fällen, von Sokrates und Augustinus bis Martin Heidegger und Michel Foucault, dokumentiert das Buch, dass die Philosophen ohne ihre erotische Lust keine Liebhaber der Weisheit geworden wären. Ein ungewöhnlicher, faszinierender und erhellender Einblick in den libidinösen Untergrund philosophischer Höchstleistungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Manfred Geier
Die Liebe der Philosophen
Von Sokrates bis Foucault
Über dieses Buch
Liebe ist ein Dauerbrenner der Philosophie. Von der Antike bis in die Gegenwart wurde über die Liebe philosophiert, die sich in einer Vielfalt von Formen und Normen zu erkennen gibt. Doch was geschah wirklich, wenn Philosophen nicht nur dachten, sondern auch liebten, von den anfänglichen Spielen der Verführung bis zum Höhepunkt der sexuellen Lust?
Es gibt keine größere Untersuchung der erotischen Erfahrungen von Philosophen. Über ihr Liebesleben wurde geschwiegen. Wurde es verdrängt, weil es als ein obszönes oder unanständiges Thema galt, das schamvoll hinter einem Feigenblatt verborgen werden musste?
Manfred Geier, der bereits in mehreren Biographien dem Leben von Philosophen erfolgreich auf der Spur war, ließ sich nicht abhalten, dem Lustprinzip nachzuforschen, das in Leben und Werk der großen Denker als Antriebskraft wirksam war. An elf sexualbiographischen Fällen, von Sokrates und Augustinus bis Martin Heidegger und Michel Foucault, dokumentiert das Buch, dass die Philosophen ohne ihre erotische Lust keine Liebhaber der Weisheit geworden wären.
Ein ungewöhnlicher, faszinierender und erhellender Einblick in den libidinösen Untergrund philosophischer Höchstleistungen.
Vita
Manfred Geier, geboren 1943 in Troppau, studierte Germanistik, Philosophie und Politik in Frankfurt/Main, Berlin und Marburg. Er lehrte viele Jahre Sprach- und Literaturwissenschaften an den Universitäten Marburg und Hannover. Jetzt lebt Manfred Geier als freier Publizist in Hamburg.
Buchpublikationen u.a.: Das Sprachspiel der Philosophen. Reinbek 1989; Der Wiener Kreis. Reinbek 1992; Karl Popper. Reinbek 1994; Das Glück der Gleichgültigen. Reinbek 1997; Orientierung Linguistik. Reinbek 1998; Fake. Leben in künstlichen Welten. Reinbek 1999; Kants Welt. Reinbek 2003; Martin Heidegger. Reinbek 2005; Worüber kluge Menschen lachen. Reinbek 2006; Was konnte Kant, was ich nicht kann? Reinbek 2006; Die Brüder Humboldt. Reinbek 2009; Aufklärung. Das europäische Projekt. Reinbek 2012; Geistesblitze. Eine andere Geschichte der Philosophie. Reinbek 2013; Leibniz oder Die beste der möglichen Welten. Reinbek 2016 (als E-Book); Wittgenstein und Heidegger. Die letzten Philosophen. Reinbek 2017.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2020
Copyright © 2020 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Lektorat Uwe Naumann
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung pink_cotton_candy/iStock
ISBN 978-3-644-00252-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Hinter einem Feigenblatt Ein Vorwort
Erstes Kapitel Nichts anderes behaupte ich zu verstehen als die Liebesdinge
Xanthippe, die Frau des Sokrates
Von den Hetären lernen
Alkibiades, der enttäuschte Liebhaber
Zweites Kapitel Was mich fest umstrickt hielt, war die Frau
Im Strudel des Lasters
Im Kampf mit sich selbst
In der Liebe Gottes
Drittes Kapitel Die Natur hat mich nicht für den Genuss geschaffen
Im Reich der Schrift
Ersatzbefriedigungen
Das erste Mal
Thérèse Le Vasseur
Liebesleidenschaft
Nachschrift zu einem Seitensprung
Viertes Kapitel Die Phantasie ist der Stachel der Lüste
Das amoralische Leben des Marquis de Sade
Philosophie im Boudoir
Metaphysik der Sitten
Das asexuelle Leben des Immanuel Kant
Fünftes Kapitel Dieses ewige Treiben in mir
Tugendbund und Mannespersonenbekanntschaften
War Alexander von Humboldt homosexuell?
Die sinnliche Genussliebe Wilhelm von Humboldts
Vom Nutzen und Nachteil der Heterosexualität
Triebschicksale
Sechstes Kapitel Vielleicht bin ich überhaupt zu reflektiert für die Liebe?
Der Fluch des Hauses Kierkegaard
Unsre eigne kleine Regine
Sie war die Geliebte
Siebtes Kapitel Vielleicht ein Glück mit Schmerzen, aber ein Glück
David Pinsent und die Apostel
Sinn und Sinnlichkeit
Marguerite oder Die Lust am Küssen
Anständig leben, kein Schwein sein!
Francis Skinner, Keith Kirk und Ben Richards
Achtes Kapitel Das Dämonische hat mich getroffen
Elfride, sein «herzallerliebstes Seelchen»
Hannah Arendt, die «Passion seines Lebens»
Ich will, dass es Dich gibt
Leben und Denken im Eros
Nach 45 Jahren, wie seit eh und je
Neuntes Kapitel Ich hoffe, dass ich an einer Überdosis Lust sterbe
Ein unglücklicher junger Homosexueller
Grenzüberschreitungen
Sexualität und Wahrheit 1
Spätes Glück, früher Tod
Namenregister
Hinter einem FeigenblattEin Vorwort
«Die wahre philosophische Haltung ist nie die eines logischen Tyrannen, der durch sein Anstarren das Leben verängstigt. Sondern es ist Platons Eros. Aber der hat noch eine viel lebendigere Funktion als bei Platon.»[1]
Martin Heidegger
Liebe ist ein altehrwürdiges Thema der Philosophie. Seit den Anfängen des philosophischen Denkens in der griechischen Antike spielt sie eine wichtige Rolle, wenn es um die Beantwortung der Frage geht: Was ist der Mensch? Denn es war zwar schon allgemein bekannt, dass er nicht nur ein arbeitendes, denkendes und sprechendes Tier war, sondern auch ein zur Liebe fähiges Wesen. Doch es galt, dieses Bekannte ins Erkannte zu überführen, sodass auch die Frage gestellt werden musste: Was ist das Wesen der Liebe? Auf einem amüsanten und unterhaltsamen Gastmahl und Trinkgelage (symposion), das in Athen im Frühjahr 416 v.Chr. im Hause des Tragödiendichters Agathon stattfand, diente sie zum Anlass einer geistreichen Unterhaltung, an der mehrere Freunde teilnahmen. Am Anfang fühlten sich die meisten von ihnen ziemlich unwohl, weil sie tags zuvor zu viel Wein getrunken hatten. Deshalb wollten sie sich an diesem Abend keinen Rausch ansaufen, sondern nur nach Lust und Laune trinken und ihr Treffen durch kluge Gespräche gestalten.[2] Dazu sollte ihnen der Eros genügend Gesprächsstoff bieten können.
Auf ihren Liegen machten sie es sich bequem und brachten zunächst, wie es üblich war, Dionysos, dem Gott des Weins, ein Trankopfer dar. Dann hielt reihum jeder von ihnen eine schöne Rede. Aus unterschiedlichen Perspektiven versuchten sie die Eigenart des Eros zu erhellen. Zunächst erinnerte der junge Phaidros, ein ausgezeichneter Kenner der kulturellen Tradition, an die überlieferten Mythen, die ihn als den ältesten aller Götter eingeführt hatten; für den Sophisten Pausanias, einen Experten des Wissens, war der Gott der Liebe mehr der Seele als dem Leib, dem männlichen mehr als dem weiblichen Geschlecht zugeneigt, wobei auch der Liebe zu jugendlichen Männern ein himmlischer Wert zukomme; dagegen verwies der aufgeklärte Arzt Eryximachos darauf, dass Eros als Grundkraft auf alles Seiende einwirke, von der Natur des Leibes, wie es die Heilkunde zeige, bis hin zur Kunst der religiösen Mantik, die den Gegensatz von Göttlichem und Menschlichem aufzuheben helfe; für den komödiantischen Dichter Aristophanes soll Eros für das Zerschneiden der ursprünglich jeweils eins gewesenen Doppelwesen – Mann-Mann, Frau-Frau, Mann-Frau – verantwortlich gewesen sein, sodass es zu schwulen, lesbischen und heterosexuellen Wiedervereinigungsbestrebungen kommen musste; dagegen beschwor der Tragödiendichter Agathon die souveräne Humanität dieses jüngsten, schönsten, besten und glücklichsten aller Götter, der die Menschen von der Fremdheit befreit und mit Vertrautheit erfüllt habe, «indem er bewirkt, dass alle Zusammenkünfte in Liebe miteinander stattfinden»[3].
Schließlich war Sokrates an der Reihe. Anders als alle seine Vorredner gab er sich äußerst bescheiden. Er war weder Wissenschaftler, der zu wissen beanspruchte, was tatsächlich der Fall war, noch Dichter, der seine phantasievollen Geschichten als denkbare Möglichkeiten ins Spiel brachte. Seine Rede war die Stunde der Philo-sophie. Denn er gab sich nicht als Wissender, als Sophist aus, sondern stellte sich zunächst als ein Unwissender dar, der sich seines Nichtwissens bewusst war, sich mit ihm jedoch nicht zufriedengeben wollte und deshalb nach Wissen strebte. Er war auch kein Weiser, der die göttliche Weisheit (sophía) besaß, sondern nur ein nachdenklicher Mensch, der sie liebte und begehrte. Diese Liebe (philia) erhob keinen Besitzanspruch. Sie war auch kein statischer Zustand, sondern blieb in Bewegung. Sie war ein Verlangen, ein Streben, ein Begehren – und gerade deshalb in der besonderen Lage, das dynamische Wesen des Eros verstehen zu können.
Es war ein geschickter, vielleicht auch ironischer Schachzug, dass Sokrates seine Rede auf den Eros nicht selbst autorisierte und für sich beanspruchte, sondern einer weisen Frau in den Mund legte, die ihn in Liebesdingen (erotika) unterwiesen haben soll. Er blieb also in der Rolle des Philó-sophos, der liebte, was ihm die Priesterin und Seherin Diotima von Mantinea gesagt hatte und er nun auch seinen Freunden über das eigentliche Wesen des Eros mitteilen wollte. Und er konnte es, weil es ihm so ähnlich war und er sich in der Rede der Diotima selbst wiedererkannt hatte. Denn auch Eros, dieser Streber zum Schönen und Guten, konnte ja, wie Diotima zeigte, kein Gott sein, der als solcher vollkommen gut und schön sein musste. «Was wäre also Eros?», fragte Sokrates, «etwa sterblich?» – «Keineswegs.» – «Aber was denn?» – «Wie vorher gezeigt», sagte sie, «etwas zwischen einem Sterblichen und einem Unsterblichen.» – «Was also, Diotima?» – «Ein großer Dämon, Sokrates, denn alles Dämonische steht zwischen Gott und den Sterblichen.»[4]
Als Philosoph stellte Sokrates den Eros als daímon vor. Er hielt ihn jedoch für keine unheimliche, bedrohliche Macht des Schicksals, der man unentrinnbar ausgeliefert sei. Er dachte ihn als eine übermenschliche Kraft, die zwischen Göttern und Menschen vermittelnd wirke; und zugleich als eine philosophierende Zwischenexistenz, die zwischen dem endgültigen Wissen der Götter und der unaufhebbaren Unwissenheit der Menschen stehe. Damit war zum ersten Mal der Eros philósophos zur Sprache gebracht worden, wobei Platon seinen Lehrer Sokrates als Personifikation dieser dämonisch-philosophischen Energie auftreten ließ.[5]
Das war die Ursprungsszene einer langen Geschichte, in der immer wieder auch über die sokratischen Liebesdinge (erotika) nachgedacht und gestritten wurde. Begriffsklärungen führten zu nachhaltigen Differenzierungen. Schon früh wurde zwischen dem aufstrebenden Eros, der freundschaftlichen Philia und der göttlichen Agape unterschieden.[6] Von der Antike bis in die Gegenwart, von Platon bis Hannah Arendt, von Aristoteles bis Martha C. Nussbaum wurde über die Liebe philosophiert, die sich in einer Vielfalt von Formen und Normen zu erkennen gibt: als Weltzugang und soziale Beziehung, als Tugend und Gabe, als Weg zu Gott, sinnlicher Genuss und sexuelle Ekstase. Es gibt zahlreiche Philosophien der Liebe. Der Begriff «Liebe» wurde untersucht und reflektiert, bis hin zu einer analytischen Philosophie der Liebe; und die Geschichte dieses Begriffs wurde zu einem Lieblingsthema von Philosophiehistorikern.[7]
Doch niemand schien sich für das Liebes- und Sexualleben der Philosophen zu interessieren. Was geschah wirklich, wenn Philosophen liebten, von den anfänglichen Spielen der Verführung bis zum Höhepunkt der sexuellen Lust? Nicht zufällig war es Sigmund Freud, der auf den Nachteil hinwies, den die Verwendung des mythopoetischen «Eros» mit sich bringt, der die sexuellen Lebenstriebe zu verdecken droht. Denn er selbst hatte den Widerstand oder die Abwehr erfahren müssen, als er Phänomene der Liebe und den Ablauf seelischer Vorgänge aus dem Lustprinzip ableiten wollte, statt sie einem zum Guten und Schönen strebenden Eros zuzuschreiben. «Wer die Sexualität für etwas die menschliche Natur Beschämendes und Erniedrigendes hält, dem steht es ja frei, sich der vornehmeren Ausdrücke Eros und Erotik zu bedienen. Ich hätte es auch selbst von Anfang an so tun können und hätte mir dadurch Widerspruch erspart. Aber ich mochte es nicht, denn ich vermeide gern Konzessionen an die Schwachmütigkeit. Man kann nicht wissen, wohin man auf diesem Wege gerät; man gibt zuerst in Worten nach und dann allmählich auch in der Sache.»[8]
Ich kenne keine größere Darstellung oder Untersuchung der libidinösen Erfahrungen von Philosophen. Ihr Werk blieb von ihrer sexuellen Energie abgetrennt, als seien Philosophen noch immer gespalten in Denken und Lieben, Geist und Körper, Sinn und Sinnlichkeit, wobei nur der eine Teil die Aufmerksamkeit auf sich ziehen könne. Die tatsächlichen Liebesgeschichten blieben ausgespart. Wurden sie einfach als bedeutungslos übersehen? Oder wurden sie verdrängt und verworfen, weil sie ein heißes oder schmuddeliges Thema sind, von dem man in Philosophenkreisen lieber die Finger ließ oder das man, wie nach dem biblischen Sündenfall im Paradies, schamhaft mit einem Feigenblatt verdeckte? Jedenfalls sieht es oft so aus, als seien Philosophen geschlechtslose Wesen, sodass man bereits lachen kann, wenn Fred Astaire in dem amerikanischen Filmmusical Funny Face seine Filmpartnerin Audrey Hepburn darüber informiert: «Jeder Mensch möchte geküsst werden – selbst ein Philosoph.»[9] Der «sinnliche Philosoph»[10] ist eine Sonderexistenz, der «impotente Philosoph» eine Lachnummer: «Die Geburt der Philosophie aus dem Geiste des Eros: So hat man(n)’s gern! Doch das sind alles verschämte Ausreden. Das Denken ist unfruchtbar. Man zieht sich zum Denken zurück … Liebe zur Wahrheit, Liebe zur Weisheit (welch ein Wahnsinn!). Liebe der schönen Seelen. Aber vom Lieben ist noch niemand schwanger geworden. Man bedient sich auch hier eines Tricks: Man sagt ‹Liebe›, meint in Wahrheit aber etwas, bei dem man sich hinterher nicht die Hände waschen muss. Der feine Unterschied zwischen ‹lieben› und ‹Liebe machen›.»[11]
So bleibt also nur die philosophische Hintertreppe, über die man in den Alltag und das Denken der Philosophen hinaufsteigen kann, um ihnen in ihrem Lebens- und Liebesraum so zu begegnen, wie sie als Menschen wirklich sind: «mit ihren Menschlichkeiten und zugleich mit ihren großartigen und ein wenig rührenden Versuchen, über das bloß Menschliche hinauszugelangen»[12]. Aber dieser Aufgang zur Philosophie könnte sich ja auch als ein Königsweg erweisen, wie ihn die Psychoanalyse an der Wende zum 20. Jahrhundert gefunden hat, um das menschliche Subjekt über sein libidinöses Begehren und seine sexuellen Impulse aufzuklären, die es zu verkennen droht. Allerdings kann es nicht darum gehen, die «großartigen Werke» der Philosophen nur als manifesten Ausdruck ihrer latenten Triebstruktur zu analysieren. Schließlich sind Philosophen in der Regel keine Hysteriker, die man von ihren unbewussten Antriebskräften befreien müsste. Als Richtlinie, um einen Zugang zum Leben und Werk, zum Lieben und Denken der Philosophen zu finden, soll stattdessen die Empfehlung des Philosophen und Kulturhistorikers Michel Foucault dienen, der sich nicht nur auf die Geschichte der Sexualität seit Sokrates konzentriert hat, sondern auch die eigene Sexualität als Zugang zu einem schöpferischen Leben zu gestalten versuchte: «Das private Leben eines Individuums, seine sexuellen Vorlieben und sein Werk sind untereinander verbunden, nicht weil das Werk das Sexualleben ausdrückt, sondern weil es das Leben ebenso wie auch den Text umfasst. Das Werk ist mehr als das Werk: Das Subjekt, das schreibt, ist Teil des Werkes.»[13] Und sein Sexual- und Liebesleben ist mehr als das Leben in seiner bloßen Faktizität, wenn es dem philosophischen Eros folgt und von seiner geistigen Energie zehrt.
Am Ende einer Doppelbiographie über die beiden Philosophen Ludwig Wittgenstein und Martin Heidegger, in der auch ihr Liebesleben zur Sprache kam, habe ich mich selbst ermahnt mit dem Hinweis: «Der Schutz der Privatsphäre, in der mündige Individuen ihr Recht auf sexuelle Aktivitäten in Anspruch nehmen können, ist nicht nur durch Menschenrechtserklärungen und grundgesetzliche Regelungen garantiert. Auch die Arbeit des Biographen sollte auf diese Schutzpflicht Rücksicht nehmen und nicht leichtfertig einen voyeuristischen Blick in die Privatsphäre libidinöser Vorlieben und sexueller Handlungen werfen. Legitimiert werden kann die Erhellung des Liebeslebens nur, wenn sie aufzeigen kann, dass dabei charakterliche Eigenarten mitspielen, die mit dem Denken und der Weltsicht der Akteure wesentlich zusammenhängen.»[14] An diese Maxime habe ich mich auch in diesen sexual-biographischen Untersuchungen zu halten versucht. Denn bei all den Philosophen, die hier auftreten, bestand eine äußerst angespannte Beziehung zwischen leidenschaftlichem Philosophieren und erotischem Begehren, die oft auch schwer zu bewältigende Probleme mit sich brachte. Einige von ihnen zogen sich in ein zölibatäres oder keusches Leben zurück, weil sie keine andere Lösung finden konnten. Oder sie steigerten ihre Lust in Ausnahmezustände, die sie ins Gefängnis brachten oder mit dem Tode bedrohten.
Es ist ein breites Spektrum erotischer Erfahrungen, das zur Sprache kommen soll. Es zeigt, dass es die Liebe oder den Eros nicht als eines gibt, das den verschiedenen Weisen zu lieben gemeinsam ist. Das gleiche Wort bezeichnet vielfältige Erscheinungen, die in verschiedenen Weisen verwandt sind, wie jene «Familienähnlichkeiten», von denen Ludwig Wittgenstein gesprochen hat: «Wir sehen ein kompliziertes Netz von Ähnlichkeiten, die einander übergreifen und kreuzen. Ähnlichkeiten im Großen wie im Kleinen.»[15] Es charakterisiert die Philosophen, dass sie sich dessen bewusst sind. Denn sie nehmen ihre Schriften untereinander zur Kenntnis und verknüpfen sie zu einem intertextuellen Netzwerk, das den «daimon» des Sokrates mit dem dämonischen Eros von Søren Kierkegaard und mit Martin Heideggers Dämonischem verbindet, die sexualpathologischen Confessiones des Augustinus mit den Bekenntnissen Jean-Jacques Rousseaus und den Geständnissen des Fleisches, die Michel Foucault nachgezeichnet hat. Wittgenstein hat sich auf Augustinus und Søren Kierkegaard bezogen, Wilhelm von Humboldt auf Immanuel Kant, Foucault auf den Marquis de Sade.
Der Liebesbegriff, der uns als Leitfaden dienen soll, hat nur einen «graduellen Charakter», wie ihn Niklas Luhmann in seiner systemtheoretischen Analyse der Liebe als Passion entwickelt hat. «Er geht davon aus, daß nie die Gesamtheit dessen, was konkret einen Einzelmenschen, seine Erinnerungen, seine Einstellungen ausmacht, für einen anderen zugänglich sein kann.»[16] Es gibt nur ein mehr oder weniger dessen, was man vom anderen Menschen wahrnehmen, beachten, verstehen oder wissen kann. Das mag erhellen, warum in den folgenden Untersuchungen nur von Philosophen die Rede ist. Denn nicht zu übersehen ist ja jene Ähnlichkeit, die sie als Männer charakterisiert. Ich habe sie ausgewählt, weil mir ihre Praktiken und Phantasien vertrauter waren als die Art und Weise, wie Philosophinnen begehren. Deren Erkundung soll Philosophiehistorikerinnen überlassen bleiben, denen die weibliche Erotik leichter oder besser zugänglich ist.
Dass mehrmals von «Lustprinzip»[17] und «Triebschicksalen» die Rede ist, soll zwar an das sexualtheoretische Abenteuer erinnern, auf das sich Sigmund Freud einließ, als er der oralen, analen und genitalen Befriedigung, der Libido, der Lust und dem Lust-Ich, den Trieben und ihren Quellen, ihren Regungen und Zielen auf der Spur war. Aber diese Begriffe werden nicht als psychoanalytische Termini technici eingesetzt, die bei Freud in einer ökonomischen Theorie von gesteigerten und verminderten Erregungsquantitäten ihren Platz haben. «Lustprinzip» wird hier im umgangssprachlichen Gebrauchssinn verwendet, um auf das praktische Liebesleben, wie es wirklich der Fall war, hinzuweisen. Und «Triebschicksale» halten daran fest, dass dabei sexuelle Antriebskräfte wie Schicksalsmächte zu wirken scheinen. Dass das philosophische Lustprinzip im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, mag auf den ersten Blick unpassend erscheinen. Es soll das weitverbreitete Vorurteil herausfordern, dass es sich dabei nur um ein Oxymoron handeln könne, weil die beiden Begriffe einander zu widersprechen scheinen, wie im Fall des «schwarzen Schimmels» oder «hölzernen Eisens». Die Liebhaber des Geistes sollen keine sinnliche Lust empfinden, ihre erotische Begierde passe nicht mit ihrer Berufung zur Philosophie zusammen.
Die Liebe der Philosophen erinnert daran, dass Sokrates, der Prototyp der europäischen Liebe zur Weisheit, sich auch praktisch auf die Erotika verstand; dass der heilige Augustinus, vor seiner Bekehrung, der fleischlichen Begierlichkeit (concupiscentia carnis) verfallen war; dass der Marquis de Sade die tierische Geilheit als Naturgabe feierte und in ausschweifender Libertinage zu praktizieren strebte; dass Wilhelm von Humboldt, der die Ideen liebte, zugleich ein Mann der groben Sinnlichkeit war, ohne die er nichts Großes schaffen zu können glaubte; dass Martin Heidegger nicht nur nach dem Sein strebte, sondern auch vom dämonischen Eros ergriffen war, den er nicht platonisch vergeistigen, sondern in seiner «viel lebendigeren Funktion» lustvoll genießen wollte; dass Michel Foucault sein Glück nur in den Lüsten des Körpers zu finden hoffte. Und auch die Philosophen, die sich gegen die sexuelle Wollust zur Wehr setzen wollten, waren sich ihrer verführerischen Stärke bewusst, die sie durch permanente Reflexion oder einen reinen guten Willen abschwächen oder außer Kraft setzen wollten.
Der Verlauf des Liebeslebens der elf ausgewählten Philosophen ist chronologisch. Er umfasst genau 2400 Jahre. Er beginnt mit dem heiteren Trinkgelage im Frühjahr 416 v.Chr., bei dem Sokrates seine Rede auf den dämonischen Eros philósophos hielt, und endet am 25. Juni 1984, um 13:15 Uhr, in einem Pariser Krankenhauszimmer, in dem Michel Foucault, der kritische Historiker der Sexualität und glückliche Philosoph des körperlichen Lustprinzips[18], vermutlich an Aids gestorben ist.
Hamburg, 6. April 2020
Erstes KapitelNichts anderes behaupte ich zu verstehen als die Liebesdinge
Sokrates, der wahrhafte Erotiker, und seine Spiele mit der Liebe
«Erotiker ist er gewiß in höchstem Maße gewesen, die Schwärmerei der Erkenntnis besaß er nach einem außerordentlichen Maßstabe, kurz gesagt, er besaß alle verführerischen Gaben des Geistes; jedoch mitteilen, erfüllen, bereichern, das vermochte er nicht.»[1]
Søren Kierkegaard
Schön war er nicht. Er entsprach ganz und gar nicht dem klassischen griechischen Ideal männlicher Schönheit. Skulpturen und Beschreibungen zeigen Sokrates als einen Mann, dessen Körper weder anmutig noch athletisch war. Er war gedrungen, mit einem fülligen Bauch, «der größer als nötig ist»[2], und mit einem Kopf, der ihn mit den Silenen aus den griechischen Satyrspielen vergleichen ließ, jenen hässlichen tierisch-menschlichen Doppelwesen mit Pferdeohren, Schwänzen und Hufen, die ständig Unfug trieben und taumelnd-begeistert dem Gott Dionysos nachfolgten. Er hatte einen runden, kahlen Schädel, seine vorstehenden Augen neigten zu stieren, seine breiten Backenknochen ließen die Kopfform klobig erscheinen, seine platte Stupsnase, die im Krieg deformiert worden war, ließ in große Nasenlöcher hineinsehen, und seine Lippen reizten durch ihre wulstige Sinnlichkeit.
Aber in diesem auffällig und anstößig wirkenden hässlichen Mann soll sich ein schöner Geist befunden haben, der seinen animalischen Ausdruck durch eine gleichsam göttliche Kraft beseelte oder aufhob. Deshalb konnte ihn Alkibiades, sein Freund und Kampfgefährte, mit jenen Silenen-Statuen in den Werkstätten der Bildhauer vergleichen, die wie Schachteln aufklappbar waren und in deren Innerem Götterstatuen zu sehen waren. Golden strahlte aus ihm seine innere Weisheit und Besonnenheit, und auch seine Reden sollen «jenen aufzuschließenden Silenen äußerst ähnlich»[3] gewesen sein: äußerlich oft frech, unangenehm provokant oder scheinbar trivial erscheinend, aber von einer tiefen Weisheit erfüllt, wenn man ihren wahren Sinn zu verstehen gelernt hatte.
Denn wie sein hässlicher Körper war auch sein Diskussionsstil nicht schön, weder rhetorisch ausgefeilt noch kommunikativ angenehm. Er war kein freundlicher, guter Gesprächspartner, sondern provozierte gern mit penetranten Fragen, mit denen er verletzen konnte wie ein «Zitterrochen»[4], der schmerzhafte elektrische Schläge versetzt. Er selbst verglich sich mit einer Bremse, die ein Pferd sticht.[5] Es schien ihm Spaß zu machen, den Mitbürgern seine Widerlegungskunst zu demonstrieren und ihnen nachzuweisen, dass sie in der Regel nicht wussten, was sie zu wissen glaubten. Er entlarvte ihr Scheinwissen. Wie in einem unangenehmen Verhör zog er allgemein anerkannte Meinungen vor den Richterstuhl der Philosophie. Das betraf vor allem das scheinbare Wissen vom Guten, dessen wahres Wesen den meisten Menschen unbekannt sein sollte. Kein Wunder, dass er vielen seiner Zeitgenossen mit seinen Untersuchungsmethoden gehörig auf die Nerven ging und schließlich für seinen provozierenden Eigensinn zum Tode verurteilt wurde.
So wurde 399 v.Chr., als Sokrates 70 Jahre alt war, politisch durchgesetzt, was der Dichter Aristophanes, der Sokrates schon als junger Mann kennengelernt hatte, bereits vierundzwanzig Jahre früher in seiner scheinbar amüsanten, witzigen Komödie Die Wolken vorausgedichtet hatte. Das Lachen sollte den Zuschauern im Halse stecken bleiben angesichts der Brutalität, mit der am Ende des Lustspiels Sokrates und seine Schüler elend in ihrem einstürzenden und brennenden Haus zugrunde gingen, das von ihren Gegnern zerstört und in Brand gesetzt worden war. Sie waren zu Hassobjekten geworden, «aus tausend Gründen, vor allem, weil sie unsre Götter schmähten»[6]. Denn statt die mythisch beglaubigten Götter Griechenlands zu verehren, wie es im Stadtstaat Athen üblich war, hatten sie die am Himmel dahinziehenden Wolken zu ihren Götterwesen erklärt, «die Verstand, Debattierkunst und Urteilskraft uns Erwählten gnädig gewähren, auch Tricks und pfiffige Ausflücht’, dazu Effekte und plumpes Düpieren»[7]. Sokrates wusste Dinge und Argumente so geschickt und raffiniert umzudrehen, dass das Wissen seiner Gesprächspartner, die sich durch seine dialektischen Sprachspiele übertölpeln ließen, als Nichtwissen erkennbar wurde.
Äußerlich also widersprach Sokrates dem altgriechischen Ideal des Schön-Guten (kalòn-kagatón) sowohl mit seiner körperlichen Gestalt als auch mit seiner verletzenden Redekunst, mit der er seine Mitbürger bloßstellte. Nur wer ihm als Schüler oder Weggefährte zu folgen bereit war, konnte die geistige Schönheit und wahre Güte erkennen, über die er innerlich verfügte. Wie sich im skurrilen Fabelwesen eines hässlichen Silen ein Gott verbergen konnte, so begannen sich in seiner Person Schein und Sein zu trennen und wechselseitig herauszufordern. Das aber konnte nur gelingen, wenn Sokrates über Mittel verfügte, mit denen er die Menschen, die er philosophisch auf den rechten Weg zu bringen versuchte, verführen und «bezaubern»[8] konnte. Er musste eine «erotische» Fähigkeit entwickeln, um in seiner hässlich-unangenehmen Erscheinung das Schön-Gute offenbaren zu können. Wer das Göttliche in ihm erkennen wollte, musste ihn lieben lernen und dem großen Dämon «Eros» folgen, den Sokrates in seiner Person verkörperte. Deshalb inszenierte er sich als Erotiker und behauptete selbstbewusst von sich, dass er «nichts anderes verstehe als die Liebesdinge (erotika)»[9]. Dabei war ihm nicht nur bekannt, was allgemein als Liebe praktiziert und begriffen wurde. Dass er die Erotika «verstand», das hieß für ihn: Er selbst wusste sie verführerisch einzusetzen, um sein Ziel zu erreichen. Er wollte als der Mensch und Philosoph geliebt werden, der er wirklich war, verborgen hinter den Masken einer hässlichen Gestalt und einer verletzenden kommunikativen Kompetenz.
Der Einsatz von Liebesmitteln war für Sokrates eine konzeptionelle Kunstaktion, auf die sich zu verstehen er vorgab. Vielleicht erklärt das seine Weigerung, seine Lehre schriftlich mitzuteilen, sodass es von ihm keine einzige schriftliche Überlieferung gibt. Und es könnte auch die scheinbar uneinheitliche Komposition seines erotisch-philosophischen Gesprächs mit Phaidros verstehen lassen, das wegen seiner inhaltlichen und stilistischen Brüche die Leser und Kommentatoren irritiert hat. Denn während im Ersten Hauptteil des Phaidros um das Wesen der Liebe gestritten wurde, die Sokrates als oberste und edelste Form eines Wahnsinns pries, der auf das überirdische Ideenreich des Schönen hinweise, widmete sich der Zweite Hauptteil einer Kritik der Kommunikationsformen, wie die Liebe zur Sprache gebracht werden kann. Sokrates vertraute auf die Kraft der mündlichen Rede; denn nur sie sei wirklich lebendig und könne die Liebe als Lebensform zum Ausdruck bringen. Er wollte dabei sein, wenn man sich mit ihm auf den Eros des Philosophierens einließ. Dagegen richte sich eine stumme Rede, von ihrem Autor niedergeschrieben und allein gelassen, nicht an anwesende Gesprächspartner, um sie philosophisch verführen zu können, sondern «schweift gleichermaßen unter denen umher, die sie verstehen, und unter denen, für die sie nicht gehört, und versteht nicht, zu wem sie reden soll und zu wem nicht»[10]. Sokrates jedenfalls wollte als Mensch wahrgenommen, gehört und geliebt werden. Deshalb setzte er seine sprach-gedanklichen Praktiken als Erotika ein, die als tote Schriftzeichen ihre Wirkung verspielt hätten.
Hat Sokrates erreicht, was er begehrte? Wie stand es wirklich mit seinem Liebesleben? Sein philosophischer Anspruch muss unsere Aufmerksamkeit auf das lenken, was durch den sokratischen «eros philósophos» tatsächlich zum Fall wurde, auch wenn es schwer ist, den echten, historischen Sokrates[11] unter den vielen poetischen oder fiktionalen Geschichten freizulegen, die über ihn von Anfang an im Umlauf waren. Wir werden uns dabei vor allem auf seine Ehe, seine außerehelichen Beziehungen und seine Männerfreundschaften konzentrieren.
Xanthippe, die Frau des Sokrates
Schön war er jedenfalls nicht. Aber er verfügte über einen geistreichen Witz, womit er auch seinem hässlichen Aussehen eine schöne Seite abzugewinnen wusste. Er hat es in einer amüsanten Szene demonstriert, in der er sich auf einen Schönheitswettbewerb mit dem jungen Kritobulos einließ, dessen Aussehen bei allen Anwesenden eines Gastmahls und Trinkgelages (symposion), das Xenophon geschildert hat, eine begehrliche Sehnsucht provozierte. Mit seinem leichten Haarwuchs an den Wangen war Kritobulos noch in einem Alter, das den Griechen als körperlich besonders reizvoll galt. Auch ohne Worte konnte dieser Jüngling Menschen dazu verführen, ihn zu küssen und lieb zu haben. Was sollte der alte vollbärtige Silen Sokrates dagegensetzen? Nichts anderes als seine Gesprächstechnik, mit der er Kritobulos scherzhaft in die Falle lockte. Denn nachdem dieser auf seine Schönheit so stolze Junge die sokratische Frage, ob denn auch viele andere Tiere oder Dinge, wie Rinder, Pferde, Schilder oder Speere, schön sein können, insofern sie für ihre Aufgaben zweckvoll und kunstgerecht angefertigt worden seien, unvorsichtigerweise bejaht hatte, konnte Sokrates all das für sich ins Feld führen, was ihn physiognomisch auszeichnete.
«Weißt du», fragte Sokrates, «wozu wir die Augen brauchen?» – «Natürlich zum Sehen», antwortete Kritobulos. – «Dann wären bereits meine Augen schöner als deine.» – «Wieso?» – «Weil deine nur geradeaus, meine dagegen durch ihr Hervortreten auch seitwärts sehen.» – «Willst du behaupten», fragte Kritobulos, «daß der Krebs von allen Lebewesen die schönsten Augen hat?» – «Unbedingt!» sagte Sokrates. «Denn er hat Augen, die auch an Schärfe unübertrefflich sind.» – «Nun gut», meinte Kritobulos. «Aber die Nasen? Welche ist schöner, deine oder meine?» – «Ich glaube», antwortete Sokrates, «die meine – zumindest wenn uns die Götter die Nasen zum Riechen gemacht haben. Deine Nasenlöcher schauen nämlich zur Erde, während meine weit offen stehen, so daß sie die Düfte von allen Seiten aufnehmen können.» – «Wie sollte aber an einer Nase das Platte schöner sein als das Gerade?» – «Weil es», sagte Sokrates, «den Blicken nicht im Wege steht, sondern sie ungehindert sehen läßt, was sie wollen. Dagegen steht eine hohe Nase wie eine Mauer, als ständiges Ärgernis zwischen den Augen.» – «Was den Mund angeht», meinte Kritobulos, «gebe ich mich ohnehin geschlagen. Denn wenn er zum Abbeißen gemacht ist, beißt du wohl viel mehr ab als ich. Und glaubst du nicht, daß auch dein Kuß dank deiner dicken Lippen weicher ist?»[1]
Selbstverständlich dokumentiert diese kleine Szene aus Xenophons Gastmahl keine ernstzunehmende Argumentation, die Sokrates zum Sieger des Schönheitswettbewerbs werden ließ. Sie war eine kleine dialektische Übung, um den besonderen Witz zu charakterisieren, mit dem Sokrates die Menschen zum Lachen bringen und für sich gewinnen konnte. Und er zeigte damit auch einen Humor, mit dem er sich über seine eigenen Schwächen erheben konnte, um nicht unter ihnen schamvoll leiden zu müssen. Ironisch verdrehte er seine Schwächen zu Stärken, um sich als derjenige behaupten zu können, der er nun einmal war. Er verstand sich darauf, dass man ihn trotz seiner offenkundigen Hässlichkeit für einen geistreichen Menschen halten konnte, der über schönen Witz und erhabenen Humor verfügte.
Vielleicht war es ihm damit auch gelungen, im höheren Alter noch eine Frau zu finden, die ihm den Haushalt führte, drei Söhne zur Welt brachte und bis zu seinem Tode treu zu ihm hielt: Xanthippe, deren Namen sich kulturgeschichtlich von einem individuellen Eigennamen zur allgemeinen Charaktereigenschaft verschoben hat. Aus der einen Xanthippe, die mit Sokrates verheiratet war, wurde «Xanthippe» zum Inbegriff aller schwierigen, unerfreulichen, herrschsüchtigen Hausdrachen, von denen nichts Gutes und keine Liebe zu erwarten ist. Im Fremdwörterbuch findet sie sich umgangssprachlich als zanksüchtige Ehefrau eingetragen. Wie konnte es dazu kommen? Was weiß man von der echten Xanthippe und ihrem Verhältnis zu Sokrates? Stieß an ihr sein philosophischer Eros an unliebsame Grenzen, die lebenspraktisch nicht zu überwinden waren?
Es gibt drei literarische Quellen, aus denen sich die vielen Anekdoten über Sokrates und Xanthippe speisen, die seit der Antike bis in die Gegenwart in immer wieder neuen Variationen erzählt worden sind, wobei sich verächtliche Abwertungen mit wohlwollenden Ehrenrettungen abwechselten.[2] Zweimal taucht sie in den sokratischen Büchern des Xenophon auf, der sich als junger Mann in Athen an den alten Sokrates anschloss, bevor er im Jahre 401, gegen die ausdrückliche Warnung seines philosophischen Mentors, als griechischer Söldner in das Heer des Kyros eintrat, der gegen seinen Bruder, den persischen Großkönig, rebellierte; und eine besondere Rolle spielt Xanthippe in Platons Erzählung des Phaidon, der von den Gesprächen berichtet hat, die Sokrates 399 im Gefängnis mit seinen Freunden und philosophischen Lieblingen über den Tod und die Seele geführt hat, bevor er sich selbst tötete, wie es das Volksgericht mehrheitlich entschieden hatte.
Das Bild der unverträglichen, zänkischen Ehefrau geht auf einen kleinen Disput zurück, den Xenophon in seinem Gastmahl schilderte, in jenem Werk also, in dem er Sokrates als einen witzigen, humorvollen, ironischen Charakter zeichnete, der die unangenehmen, unerträglichen Seiten seines Lebens ins Positive umzuwenden wusste. War es im ästhetischen Wettstreit mit Kritobulos um sein Aussehen gegangen, so setzte sich Sokrates mit Antisthenes lebenspraktisch über den Nutzen und Nachteil seines Ehelebens auseinander. Dabei wurde literarisch das gleiche Muster verwendet. Es wurde auf etwas Hässliches oder Schlechtes hingewiesen, um Sokrates zu einer geistreichen Entgegnung herauszufordern.
Diesmal war es Xanthippe, die dazu herhalten musste. Anlass dazu bot die Geschicklichkeit einer jungen Tänzerin, die den Teilnehmern des Gastmahls ein kunstvolles Spiel mit Ringen vorgeführt hatte. Durch eine Flötenspielerin musikalisch begleitet, warf sie im Tanz zwölf Ringe wirbelnd in die Höhe, wobei sie genau auf die Höhe und Richtung des Wurfs achten musste, um sie im Takt wieder auffangen zu können. Dazu bemerkte Sokrates bewundernd: «Wie in vielen Dingen sonst, meine Herren, zeigt sich auch hier in der Leistung des Mädchens, daß die weibliche Natur im Grunde genommen keineswegs geringer ist als die des Mannes, daß ihr nur selbständige Einsicht und Kraft fehlt. Wer von euch eine Frau hat, soll ihr daher ruhig die Fähigkeiten beibringen, die er an ihr sehen möchte.» Diese Empfehlung provozierte Antisthenes zum Widerspruch. Jedoch opponierte er nicht mit rationalen Gründen, sondern argumentierte ad personam. Er sprach Sokrates als Ehemann an, der seine Xanthippe nicht zu bilden wusste. «Warum nur, Sokrates, erziehst dann nicht auch du in dieser Erkenntnis Xanthippe, sondern hast an ihr die unverträglichste Frau von allen, die es gibt – ja, ich glaube, sogar von allen, die es gegeben hat und geben wird?» – «Weil ich sehe», antwortete Sokrates, «daß Leute, die gute Reiter werden möchten, sich nicht die gutmütigsten Pferde, sondern die feurigsten nehmen. Sie glauben nämlich, wenn sie die zu meistern imstande sind, werden sie es mit den andern Pferden leicht haben. Und da ich mit Menschen leben und umgehen wollte, habe ich mir diese Frau genommen; denn ich wusste genau: wenn ich die ertragen kann, werde ich mit allen andern Menschen leicht auskommen.»[3] Und diese Worte, ergänzte Xenophon, scheinen auch wirklich ins Schwarze getroffen zu haben.
Im Gespräch mit Antisthenes verteidigte Sokrates seine Ehefrau nicht. Er wies den Vorwurf der Unverträglichkeit nicht offensiv zurück, sondern zog sich ironisch als Ehemann aus der Affäre. Er machte aus der Not des Ertragenmüssens eine Tugend des Lernenkönnens. In der zweiten Textstelle, in der Xanthippe als Mutter auftauchte, benutzte er eine ähnliche diskursive Taktik, wobei sein Sohn an seine Stelle rückte. Xenophon hat davon in seinen Erinnerungen an Sokrates berichtet, aus Anlass eines Gesprächs, in dem Sokrates als Vater seinen erstgeborenen Sohn Lamproklos darüber aufklärte, seine Mutter Xanthippe auch dann zu lieben und zu ehren, wenn sie zu wild oder verletzend mit ihm umgegangen war. Denn als er erfuhr, dass sein Sohn sich zornig über seine Mutter beklagte und «ihre ungestüme Art nicht ertragen»[4] wollte, wies er ihn auf all die Wohltaten hin, die er durch Xanthippe empfangen hatte. Als gute Mutter habe sie ihn gepflegt und aufgezogen, ihn zu einem moralischen Menschen gebildet und keine Mühe gescheut, um ihm das Leben angenehm zu gestalten. Dass sie sich dabei manchmal auch «ungestüm» verhalten habe, sei angesichts der schwierigen mütterlichen Aufgabe nicht zu vermeiden gewesen. Und wie in vielen anderen Gesprächen setzte Sokrates in dieser Ermahnung seines Sohnes auch seine Kunst der Umwendung wieder ein, indem er das scheinbar Schlechte als eigentlich Gutes vorstellte und gegen den Klagenden richtete. «Glaubst du tatsächlich, daß dir deine Mutter übelgesinnt ist?» Lamproklos: «Gewiß nicht. Das glaube ich freilich nicht.» Sokrates: «Du aber behauptest, daß sie unausstehlich sei, bei all ihrem Wohlwollen dir gegenüber und all ihrer Sorge um deine Gesundheit, wenn du krank bist, und bei ihrem Bemühen, daß dir nichts fehlt von dem, was du zum Leben brauchst. Zudem erfleht sie von den Göttern viel Gutes für dich, und sie erfüllt ihre Gelübde. Ich glaube, daß du das Gute nicht ertragen kannst, wenn du eine solche Mutter nicht erträgst.»[5]
Die dritte Quelle findet sich in Platons Bericht über den letzten Tag, den Sokrates vor seiner gerichtlich angeordneten Selbsttötung im Gefängnis verbrachte. Platon selbst war wegen Krankheit verhindert, beim Sterben seines Lehrers dabei zu sein. Deshalb ließ er den Augenzeugen Phaidon davon berichten, worüber Sokrates an seinem Todestag mit den vielen Freunden zum letzten Mal gesprochen hatte, die von ihm erfahren wollten, wie er philosophisch mit dem Tod umgehe und was er von der menschlichen Seele halte, wenn der Körper nicht mehr so existiere, wie er von der Seele belebt worden sei. Platons Werk, das inhaltlich und dramatisch mit der Apologie, Sokrates’ Verteidigungsrede vor Gericht, zusammenhängt, ist einer seiner künstlerisch schönsten Dialoge, der intellektuell um das umstrittene Problem der Unsterblichkeit der Seele kreist, für die Sokrates in mehreren Anläufen seine Argumente vortrug und gegen skeptische Einwände verteidigte. Doch wirklich berührend an diesen Gesprächen ist die furchtlose Haltung, mit der Sokrates sein Sterbenmüssen ertrug, wobei er zum letzten Mal auch seine Kunst der Umwendung demonstrieren konnte. Er sah den Tod als eine Befreiung. Denn endlich werde beim Sterben die Seele von allem getrennt und gelöst, was sie im Leben äußerlich bedrängt und gefesselt habe, von der staatlichen Herrschaft und den gesellschaftlichen Regeln bis zu den eigenen sinnlichen, körperlichen Erfahrungen von Lust und Unlust. Und mit dieser Drehung war es ihm auch möglich, das Verhältnis zu seinen Freunden zu verkehren. Aus dem zum Tode Verurteilten, den sie mit ihrer Anwesenheit trösten wollten, wurde der Tröster, der sie beruhigte und aufmunterte.
Allerdings musste Sokrates fürchten, dass seine Frau dabei nicht mitzumachen bereit war. Also musste Xanthippe die Gefängniszelle verlassen, um mit ihren ungestümen Gefühlen das Philosophengespräch nicht zu stören. Sie hatte die Nacht mit Sokrates verbracht, zusammen mit dem jüngsten Sohn. Phaidon hat die Szene geschildert, in der Xanthippe am frühen Morgen den Freunden ihres Mannes Platz machen musste. «Als wir nun hineintraten, fanden wir den Sokrates eben entfesselt, und Xanthippe, du kennst sie doch, sein Söhnchen auf dem Arm haltend, saß neben ihm. Als uns Xanthippe nun sah, wehklagte sie und redete allerlei dergleichen, wie die Frauen es pflegen, nämlich: O Sokrates, nun reden diese deine Freunde zum letzten Male mit dir, und du mit ihnen. Da wendete sich Sokrates zum Kriton und sprach: O Kriton, laß doch jemand diese nach Hause führen. Da führten einige von Kritons Leuten sie heulend und sich übel gebärdend fort.»[6] Am Abend, kurz vor Sonnenuntergang, kam Xanthippe mit ihren drei Söhnen und einigen Frauen aus der Verwandtschaft noch einmal zurück. Sokrates sprach mit ihnen und sagte, was sie nach seinem Tod tun sollten. Dann ließ er sie wieder weggehen, um völlig ruhig und entspannt den Giftbecher zu leeren. Und als all seine Freunde zu weinen begannen, um ihm ihr Mitgefühl zu zeigen, ermahnte er sie mit den Worten: «Was macht ihr doch, ihr wunderbaren Leute! Ich habe vorzüglich deswegen die Weiber weggeschickt, daß sie dergleichen nicht begehen möchten; denn ich habe immer gehört, man müsse stille sein, wenn einer stirbt.»[7]
Das also waren die drei Schlüsselstellen, die den Charakter Xanthippes erkennen lassen sollten. Ein eindeutiges Bild ergab sich dabei nicht. Sicher war sie keine ruhige, unterwürfige Hausfrau. Aber nichts sprach dafür, dass Sokrates sie als einen zänkischen, streitsüchtigen und widerspenstigen Quälgeist ertragen musste. Denn alle drei Erzählungen lassen doch viel eher erkennen, dass er sie vor ungerechtfertigten Vorwürfen in Schutz nahm und als gute Frau und Mutter schätzte. Im Gespräch mit Antisthenes verglich er sie mit einem «feurigen Pferd», mit dem zusammen ein guter Reiter viel mehr erreichen könne als mit einem lahmen Gaul; die Klage seines pubertierenden Sohnes, der sich durch Xanthippes «ungestüme» Art ungerecht behandelt fühlte, wies er mit dem Hinweis auf ihre fürsorgliche Güte und ihr Wohlwollen ab; und dass sie anlässlich seines Todesurteils weinte und wehklagte, wird er als Zeichen ihrer tiefen Zuneigung empfunden haben, auch wenn es ihn angesichts der geforderten Selbsttötung aus der Ruhe zu bringen drohte, die er brauchte, um ohne Furcht und Zittern aus dem Leben scheiden zu können. Jedenfalls gibt es im griechischen Originaltext keinen Hinweis darauf, dass Xanthippe «sich übel gebärdete», als sie aus dem Gefängnis hinausgeführt wurde. Denn mit dieser vorwurfsvollen Abwertung hat Friedrich Schleiermacher nur das überlieferte Vorurteil gegen Xanthippe stabilisiert, indem er ihr verzweifeltes «boosan kai koptomenen» (sich an die Brust schlagend) tendenziös und irreführend in eine üble, unpassende Handlung übersetzte.[8]
Populär wurde die Kennzeichnung einer «Xanthippe», die ihrem Mann das Leben schwermachte; und gegen sie konnte ein bunter Reigen von Anekdoten ihren Ehemann als schlagfertigen und gelassenen Philosophen profilieren. Nachdem sie ihn wieder einmal mit Schmähungen überhäuft und ihm dann auch noch einen Topf schmutzigen Wassers auf den Kopf geschüttet haben soll, wusste er stoisch zu witzeln: «Sagte ich nicht, daß Xanthippe, wenn sie donnert, dann auch Regen bringt?»[9] Er wusste alle familiären Übel geschickt umzuwenden. Friedrich Nietzsche hat es auf den Punkt gebracht: «Xanthippe. – Sokrates fand eine Frau, wie er sie brauchte – aber auch er hätte sie nicht gesucht, falls er sie gut genug gekannt hätte: so weit wäre auch der Heroismus dieses freien Geistes nicht gegangen. Tatsächlich trieb ihn Xanthippe in seinen eigentlichen Beruf immer mehr hinein, indem sie ihm Haus und Heim unhäuslich und unheimlich machte: sie lehrte ihn, auf den Gassen und überall dort zu leben, wo man schwätzen und müßig sein konnte, und bildete ihn damit zum größten athenischen Gassen-Dialektiker aus: der sich zuletzt selber mit einer zudringlichen Bremse vergleichen mußte, welche dem schönen Pferde Athen von einem Gotte auf den Nacken gesetzt sei, um es nicht zur Ruhe kommen zu lassen.»[10]
Nietzsches menschlich-allzumenschliche Notiz entsprach zwar dem sokratischen Selbstbild. Er wollte seinen Mitbürgern schmerzhafte Stiche versetzen und ihre festgefügten Meinungen verstören. Aber er tat es nicht als Haus- und Heimvertriebener. Historische Nachforschungen und Quellenstudien haben ein anderes Bild von der Lebens-, Wirtschafts- und Rechtsgemeinschaft (oikos) ergeben, die Sokrates erst im hohen Alter mit seiner Frau eingegangen ist. Denn dieser philosophierende Sonderling war, entgegen der gewöhnlichen athenischen Lebensform, so lange wie möglich Junggeselle geblieben, bis er endlich, bereits über fünfzig Jahre alt, um 413 die etwa zwanzig Jahre alte Xanthippe zur Frau nahm, mit der er die letzten dreizehn Jahre seines Lebens ehelich verbrachte und drei Söhne zeugte.
Dass es ihren Namen auch in männlicher Form als «Xanthippos» gab, der im athenischen Adel weit verbreitet war, und dass ihr erster Sohn Lamproklos nach ihrem Vater benannt wurde, spricht dafür, dass sie familiär höher gestellt war als Sokrates, der als Sohn eines Steinmetzen und einer Hebamme zur Mittelschicht der Zeugiten gehörte. Gemeinsam besaßen sie das athenische Vollbürgerrecht. Sie konnten ihre Freiheit und ihre Bürgerrechte, ebenso wie ihren Grund- und Hausbesitz, ihren Kindern vererben. In dieser Hinsicht war Zeugung (tokos) eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Sokrates hat sich ihr so lange wie möglich entzogen. Lieber wollte er sich ganz dem Philosophieren widmen, das er für den Sinn seines Lebens hielt, bevor er sich am Ende doch noch entschloss, zusammen mit Xanthippe seinen eigenen oikos zu gründen, um nicht nur seine Gedanken, sondern auch seine Bürgerrechte und seinen Besitz weitergeben zu können.
Zweifellos herrschte im klassischen Athen ein strenges Patriarchat. Der Mann war Herr in seinem Hauswesen, auch wenn seine Frau aus einer höheren Klasse stammte. Für sie sollten Schweigen und Bescheidenheit das Beste sein. Schicklicher war es für sie, im Haus zu bleiben, «als sich draußen herumzutreiben»[11]. Die Ehre eines oikos hing auch vom Verhalten der Frau ab, die sich den patriarchalen Machtbeziehungen anzupassen hatte. Alles, was man von Xanthippe weiß, spricht dafür, dass sie dazu nicht bereit war. Sie besaß ihren eigenen Kopf und verletzte die allgemein geltenden Gehorsamsregeln, wenn es ihr nötig zu sein schien. Sie war wie «ein feuriges Pferd», worauf bereits ihr Name anspielte. «Xanthe» verwies auf hell und glänzend, «hippe» benannte das weibliche Pferd. Nur als selbstbewusste Frau hat sie den alten Philosophen als ihren Mann heiraten können, den sie auch in seine Schranken zu weisen wusste. Und sie muss ihn geliebt haben, oder, anders formuliert, Sokrates muss es verstanden haben, mit seinen erotischen Mitteln die junge, freie, eigenwillige Xanthippe für sich zu gewinnen, trotz seines hohen Alters und unansehnlichen Äußeren, über das zu klagen sie oft genug Anlass hatte.
Von den Hetären lernen
Als Sokrates seinen ältesten Sohn Lamproklos über das familiäre Leben aufzuklären versuchte, in dem sich das göttliche Gute und Schöne verwirklichen sollte, trennte er zwischen sexueller Lust und funktionaler Zeugung. Dabei argumentierte er nicht, sondern appellierte an eine scheinbare Selbstverständlichkeit, die allgemein bekannt war. Er bestimmte den Geschlechtstrieb als eine Energie des Leibes, die zwar nötig sei, um Nachkommen zeugen zu können. Aber die familiäre Fortpflanzung als solche sollte sich nicht aus der Lust ergeben, die Mann und Frau im gemeinsamen Liebesakt körperlich genießen können. Sie folgte einem anderen, höheren Zweck. Sokrates gab sich keine Mühe, diese Trennung von Familienplanung und Sex näher zu begründen. Sein Sohn sollte schon wissen, woran er ihn nur erinnern musste: «Du nimmst indessen gewiß nicht an, daß die Menschen um der Liebeslust willen Kinder zeugen, da ja die Straßen und Lusthäuser genug Möglichkeiten bieten, diese zu erfüllen. Es ist bekannt, daß wir darauf sehen, von welchen Frauen wir wohl die besten Kinder bekommen können. Mit diesen vereinigen wir uns, und wir zeugen Kinder.»[1]
Das sollte nicht heißen, dass es in der Ehe keine sexuelle Lust geben konnte. Aber sie war weder darauf eingegrenzt noch funktionalistisch ausgerichtet. Eheliche Liebeslust war ein angenehmer und wünschenswerter Nebeneffekt der familienkonzentrierten Zeugung, die der Kontinuität der Familie und der Stabilität der Polisgemeinschaft diente. Für die Befriedigung der Lust in ihrer sinnlichen Eigenwilligkeit boten sich andere Möglichkeiten an, jedenfalls für den Mann, während die familiäre und bürgerliche Stellung der Frau sie zu einer streng ehelichen Sexualpraktik zwang. Auf den Straßen und in den staatlich kontrollierten Bordellen Athens konnte man die gewöhnlichen Dirnen, die «Käuflichen» (pornai) finden, oft Sklavinnen, die sich Geld für ihren Freikauf verdienen wollten; und für den gehobenen Geschmack gab es die freien Gefährtinnen (hetairai), die sich ihre Freier aussuchen und mit ihnen auch dauerhafte Beziehungen eingehen konnten. Erotik war ihr Beruf, wobei von besonders begehrten und kostspieligen Hetären auch musikalische und tänzerische Fähigkeiten erwartet wurden, ebenso wie die Kunst aufreizender Unterhaltung.
Auch Sokrates wird ihre Dienste gern in Anspruch genommen haben, bevor er sich im hohen Alter entschied, mit Xanthippe die bestmöglichen Kinder zu zeugen. Die «Erfüllung der Liebeslust» war ihm vertraut, und es lassen sich keine Hinweise finden, dass er sich für ein sexuell enthaltsames Junggesellenleben entschieden hatte. Namen von Liebhaberinnen sind allerdings nicht bekannt. Bemerkenswert sind jedoch seine Beziehungen zu zwei berühmten Hetären, die in erotischer Hinsicht für ihn interessant gewesen sind.
Aspasia. Das Bürgerrechtsgesetz für die Vollbürger Athens, das zur Zeit des Sokrates auch die legitimen Eheverhältnisse und ihre Folgen regelte, war vor allem Perikles zu verdanken, dem Ersten Strategen Athens, dem Sokrates schon als junger, etwa fünfundzwanzigjähriger Mann begegnet war. Er besuchte ihn oft in seinem Haus und wurde dabei nicht nur mit dem Philosophen Protagoras bekannt, der sich um die Erziehung der beiden Söhne des Perikles sorgte. Er lernte auch Aspasia kennen, eine äußerst schöne und kluge Hetäre, die Perikles um 450 für sich gewonnen hatte. Er hatte sich von seiner rechtmäßigen Frau getrennt und Aspasia, die aus dem kleinasiatischen Milet nach Athen gekommen war, als Geliebte in seinen oikos aufgenommen. Als Zugereiste besaß sie nur den minderrechtlichen Metöken-Status, war also eine freie Athener Mitwohnerin (metoike) ohne Bürgerrechte und auch nicht befähigt, mit Perikles ein rechtmäßiges Eheverhältnis einzugehen. Er hatte es durch seine eigene Gesetzgebung verhindert und lebte, wie seine Kritiker und politischen Gegner ihm vorwarfen, in einer unrechtmäßigen Liebesbeziehung, in der ein Sohn ohne Bürgerrecht gezeugt wurde. So wurde Aspasia zu einem beliebten Objekt des komödiantischen Spotts und der moralpolitischen Verachtung. Weil man ihren Einfluss auf den Ersten Strategen und andere hochrangige Bürger Athens fürchtete, wurde sie als Kupplerin und Bordellwirtin denunziert und wegen Gottlosigkeit angeklagt, vor allem, um ihrem Liebhaber Perikles zu schaden.
Dagegen sprach Sokrates immer mit Hochachtung von Aspasia. Denn nicht von philosophischen Lehrern oder in einem allgemein verordneten Schulunterricht, sondern ausgerechnet von dieser Hetäre habe er die beiden wichtigsten Liebesdinge gelernt, die er geschickt einzusetzen wusste. Sie betrafen zum einen seine erotische Kunst der Verführung als «Menschenjagd»; zum andern die Kunst der Rede, die man beherrschen muss, um Menschen zum Guten hinführen zu können.
Xenophon hat in seinen Erinnerungen an das Gespräch erinnert, das Sokrates mit Kritobulos führte, der ein guter Mensch werden wollte und auf der Suche nach einem guten Freund war. Sokrates war gern dazu bereit, diesem jungen Mann, mit dem er sich schon einmal in einem Schönheitswettbewerb gemessen hatte, als Mentor behilflich zu sein. Er wollte ihm die Liebesdinge vermitteln, von denen er selbst etwas zu verstehen glaubte. Was Kritobulos von Sokrates lernen wollte, wurde als Jagdszene nach dem Geliebten konzipiert. «Vielleicht mag ich dir ein wenig behilflich sein bei dieser Jagd, weil ich in der Kunst der Liebe erfahren bin. Denn mit aller Kraft und mit meiner ganzen Person bin ich darauf bedacht, daß meine Liebe und Sehnsucht von den mir begehrten Menschen erwidert wird, und daß sie Verlangen haben, mit mir zusammen zu sein, wie ich mit ihnen … Da ich mich ja darin übe, dem zu gefallen, der mir gefällt, glaube ich, von der Menschenjagd etwas zu verstehen.»[2]
Dabei müsse im Erjagen eines guten Freundes oder einer guten Lebensform eine Regel besonders beachtet werden. Die angestrebte Verbindung von Liebendem und Geliebtem darf nicht durch Täuschungen oder Lügen hergestellt werden, die allenfalls einen kurzfristigen Erfolg provozieren könnten, aber keine dauerhafte Liebesbeziehung herstellen ließen. Woher er das wisse? Von niemand anderem als von Aspasia, dieser Meisterin in der Liebeskunst, die auch Liebende und Geliebte erfolgreich zu «verkuppeln» wusste. «Sie sagte nämlich, daß die guten Kupplerinnen, soweit es der Wahrheit entspricht, die guten Seiten verkünden und auf diese Weise fähig sind, Menschen miteinander zu verheiraten, daß sie aber nicht loben wollen, wenn es nichts zu loben gibt. Die Getäuschten würden nämlich zugleich einander selbst hassen, wie auch die, welche sie zusammengeführt hat. Ich bin überzeugt, daß die Aspasia recht hat.»[3]
Von einem anderen Lernerfolg, für den sich Sokrates bei der Hetäre bedankte, berichtet Platon in seinem Dialog Menexenos. Dabei ging es nicht um das Verkuppeln von Liebenden, sondern um eine Leichenrede, durch die es einen Verstorbenen auch vor seinen Kritikern oder Feinden zu ehren galt. Die Kunst der guten Rede zeigte sich an der Überzeugung der Gegner. Sie wendete die Feindschaft um in Anerkennung. Und wieder war es Aspasia, die Sokrates in diesem Fall als seine Meisterin anpries. Denn wenn er selbst sich auf die rhetorische Kunst verstehe, dann nur, weil «ich eine gar nicht schlechte Lehrerin habe in der Redekunst, sondern eine, die auch viele andere treffliche Redner gebildet hat, einen aber, der es allen Hellenen zuvortut, den Perikles. – Menexenos: Wer ist die? Oder du meinst wohl gewiß die Aspasia. Sokrates: Die meine ich.»[4] Und dann referierte Sokrates die ganze Leichenrede, die er einen Tag zuvor von Aspasia gerade für den Fall gehört hatte, für den er als Redner einspringen musste. Er ahmte erfolgreich nach, was sie ihm vorgesprochen hatte. Bewunderung und Dank des Menexenos waren ihm sicher. «Beim Zeus, o Sokrates, glücklich ist Aspasia, wenn sie als eine Frau solche Reden imstande ist auszuarbeiten! – Sokrates: Wenn du es nicht glaubst, so komm mit mir, dann kannst du sie selbst vortragen hören. Menexenos: Ich bin schon oft mit der Aspasia zusammengewesen, o Sokrates, und weiß recht gut, was für eine Frau sie ist.»[5]
Aspasia war als erotische Gefährtin stadtbekannt, und ihre rhetorische Begabung wurde allgemein bewundert. Deshalb konnten sich auch die Leser von Platons Symposion schon bald sicher sein, dass es Aspasias Künste waren, die Sokrates der Priesterin aus Mantinea angedichtet hatte. Poetisch-fiktional schrieb er Diotima, «welche auch mich in Liebessachen unterrichtet hat»[6], die Rede über den Eros zu, die er tatsächlich Aspasia und ihren Erotika verdankte.
Theodote. Von ihr und Sokrates hat Xenophon in seinen Erinnerungen berichtet. Auch diese Hetäre, deren Namen wörtlich «Gottesgabe» bedeutete, war eine sehr schöne und geistreiche Frau, «die mit dem verkehrte, der sie zu gewinnen wusste»[7]. War es bei Aspasia der große Athener Stratege Perikles, so war es bei Theodote der politische Machtmensch, geniale Feldherr und sexuell ausschweifende Lebemann Alkibiades, ein Neffe des Perikles, den sie als Liebhaber bevorzugte. Schon zu seinen Lebzeiten wurde er als eine dämonische Gestalt bewundert oder verachtet, die im Guten wie im Bösen die Grenzen menschlichen Daseins zu sprengen versuchte. Bisexuell stürzte er sich in sinnliche Ausschweifungen, die ihm seine Ehefrau nicht bieten konnte, sondern nur die vielen Geliebten, denen er unermüdlich nachjagte. Theodote soll die attraktivste von ihnen gewesen sein, deren Schönheit über alle Beschreibung hinausging, weshalb vor allem Maler sie besuchten, um sie abzubilden. Alkibiades hatte sie mit Sokrates bekannt gemacht, der es nicht versäumen wollte, sie auch einmal seinen Schülern vorzustellen, um ihnen zu zeigen, was sich nicht sagen ließ. Also besuchten sie Theodote in ihrem Haus, wo sie gerade einem Maler Modell stand. Ihr Anblick erregte sie so sehr, dass Sokrates bald feststellen konnte: «Wir für unseren Teil begehren schon nach dem zu greifen, was wir betrachtet haben, und wir gehen weg mit gereizter Begierde, und zu Hause werden wir schmachten.»[8]
Doch bevor er zu seiner Xanthippe zurückkehrte, wollte er noch einiges von Theodote wissen. Womit verdiente sie ihren Lebensunterhalt? Durch Freunde, die sie für sich zu gewinnen wusste! Und welche Mittel setzte sie ein, um sie wie eine Spinne in ihrem Netz fangen oder wie ein Jäger die Hasen erlegen zu können? Darauf wusste die Hetäre so schnell keine passende Antwort, sodass Sokrates sie über sich selbst aufklären musste: «Ein Netz besitzt du auf alle Fälle, und zwar eins, das sehr gut zur Umgarnung ist, nämlich deinen Körper … Ich weiß auch ganz gut, daß du nicht nur sinnlich, sondern auch wohlwollend zu lieben verstehst, daß du nicht nur mit dem Wort, sondern auch mit der Tat davon überzeugst, daß dir deine Freunde angenehm sind.»[9] Nur mit diesen Erotika könne man seine Liebhaber wie «Tiere» einfangen oder erjagen.
Sokrates wäre nicht der erotische Dialektiker gewesen, wenn er während dieses Hetären-Gesprächs nicht die Verhältnisse hätte umdrehen können. Nicht er wollte Theodote begehren, sondern er versuchte, sie dazu zu verführen, ihn als ihren Geliebten gewinnen zu wollen. Und er kannte auch die Liebesmittel und beherrschte die erotischen Tricks, um sie in diese Falle zu locken. Mit versteckter Ironie machte er sich als ein Mann interessant, den die Frauen liebten und der viele Freundinnen besaß, «welche mich weder bei Tag noch bei Nacht aus ihrer Mitte weggehen lassen, indem sie von mir Liebesmittel und Zauberlieder lernen»[10]. Theodote fiel darauf herein. Am Ende des Besuchs war sie ganz begierig, das Zauberrad der Liebe «umzudrehen», um Sokrates libidinös einfangen zu können. Das war der Moment seines Erfolgs, den er mit einer letzten ironischen Geste übersteigerte: «Aber wahrlich, ich habe gar kein Verlangen, zu dir hingezogen zu werden, vielmehr möchte ich, daß du mich aufsuchst.» Theodote: «So will ich denn kommen, laß mich dann aber auch eintreten.» Sokrates: «Das will ich gerne tun, wenn nicht sonst schon eine Freundin drinnen ist, die mir lieber ist als du.»[11]
Alkibiades, der enttäuschte Liebhaber
Als Sokrates sein kurzes erotisches Gastspiel im Haus der Theodote gab, da wusste er, dass sie die Geliebte des Alkibiades war, mit dem er schon seit einigen Jahrzehnten eng vertraut war. Die Schlüsselszene ihrer sonderbaren Freundschaft fand bereits ein paar Jahre zuvor statt, als Alkibiades uneingeladen in jenes Gastmahl einbrach, mit dem Agathon im Winter 416 seinen Sieg im Tragödienwettbewerb feierte. Die großen Lobreden auf die Liebe waren bereits gehalten worden, gekrönt durch die Rede der Priesterin Diotima, die Sokrates «in Liebesdingen unterrichtet»[1] und in die Geheimnisse dieses großen Dämons Eros eingeweiht hatte, der das Leben für den Menschen lebenswert machen kann in der Schau des reinen Schönen selbst, zu dem er emporzusteigen vermag. Eigentlich hätte das Symposion damit zu Ende sein müssen. Die Abfolge der einzelnen Beiträge war geistig bis zur höchsten, göttlichen Stufe gesteigert worden. Ob sie auch im praktischen Leben erreicht werden kann, blieb allerdings ungewiss; und es wird diese Unsicherheit gewesen sein, die Platon dazu motivierte, nach all den schönen Beschreibungen, Erzählungen und Gedanken plötzlich Alkibiades auftreten zu lassen. Denn er stellte nun das geistig Verstandene oder Erkannte auf die praktische Probe. So hat es jedenfalls Friedrich Nietzsche gesehen, der in einer seiner frühen Jugendschriften den überraschenden Auftritt des Alkibiades interpretierte als den «Wendepunkt des kunstvollen Dramas und zugleich der Philosophie nach der Seite der Wirklichkeit hin»[2].
Dabei ging es nicht mehr um den «eros philósophos» in seiner allgemeinen, wesentlichen Bedeutung, sondern um das besondere Liebesverhältnis zwischen diesen beiden individuellen Charakteren, Sokrates und Alkibiades, deren unterschiedliche Persönlichkeiten Platon durch einen kühnen Kunstgriff verdeutlichte. Denn während Sokrates nüchtern, überlegt und klar strukturiert die höchste Idee des Eros entwickelt hatte, die ihm durch Diotima vermittelt worden war, stürmte Alkibiades sturzbetrunken, herumbrüllend und von seinen Zechkumpanen gestützt ins Haus des Agathon, wo er kein theoretisches Konzept der Liebe vortrug, sondern praktisch die Spannung veranschaulichte, die in seinem besonderen Fall zwischen dem Liebenden (erastes) und dem Geliebten (eromenos) bestand. Er ließ sich auf die Liege fallen, in die Mitte zwischen Phaidros und Sokrates, ohne ihn jedoch erkannt zu haben, betrunken, wie er war. Erschrocken musste er feststellen, neben wem er lag. Ausgerechnet Sokrates, mit dem ihn schon so viele Jahre lang eine verrückte Liebe verband, die sich bis zur Raserei steigern konnte! Doch diesmal versuchte er Ruhe zu bewahren und friedlich am Gelage teilzunehmen, und er erklärte sich schließlich sogar dazu bereit, den Wunsch der anderen Gäste zu erfüllen und sie über das Liebesverhältnis aufzuklären, das schon zwischen ihm und Sokrates bestanden hatte, bevor sie gemeinsam an mehreren Schlachten während des Peloponnesischen Krieges teilnahmen.
Denn bereits vor dem Kampf um Potidaia (432 bis 429), mit dem dieser lange, fast dreißigjährige Krieg begann, hatte sich zwischen ihnen etwas ereignet, das Alkibiades nun, vom Wein berauscht, zum ersten Mal zu erzählen bereit war. Es war geschehen, als er selbst etwa sechzehn Jahre alt gewesen war, in jenem schönen Alter also zwischen Kindheit und Männlichkeit, das ihn als jungen Geliebten älterer Männer besonders begehrenswert machte. Sokrates muss damals Mitte dreißig gewesen sein. Er hatte schon einige Schüler für sich gewonnen, die ihn als geistreichen Philosophen bewunderten, der ihnen etwas zu sagen hatte. Auch Alkibiades, der aus dem hohen Adel Athens stammte, hörte ihm gern zu und suchte seine Nähe. Er war wissbegierig und hoffte, an seiner Weisheit teilhaben zu können, «wenn ich mich dem Sokrates gefällig erwiese»[3]. Er wollte alles tun, was Sokrates von ihm wünschte. Also schickte er seinen Diener weg, um endlich einmal ganz allein mit ihm zu sein, «und ich meinte, er sollte mir nun gleich solche Dinge sagen wie ein Liebhaber seinem Liebling in der Einsamkeit sagen würde, und freute mich»[4].
Alkibiades setzte alle Erotika ein, die er beherrschte, um Sokrates zu verführen und als seinen Liebhaber (erastes) für sich zu gewinnen. Er forderte ihn zu Leibesübungen und Ringkämpfen heraus, ohne Beisein anderer Sportler, «um dadurch etwas zu erreichen». Er hatte nichts davon. Er lud ihn zu Mahlzeiten ein, «ordentlich wie ein Liebhaber seinem Liebling nachstellt»[5]. Auch das führte nicht zum Erfolg. Nach einem gemeinsamen abendlichen Essen nötigte er ihn schließlich mit dem Vorwand, dass es schon sehr spät sei, bei ihm zu bleiben. Als das Licht ausgelöscht war, wollte er den letzten Schritt wagen und Sokrates ohne Umschweife sagen, was er begehrte. «Ich stieß ihn also an und sagte: Sokrates, schläfst du? – Nicht recht, sagte er. – Weißt du wohl, was ich gesonnen bin? – Was doch? sprach er.»[6] Er wollte ihm als Geliebter alles gewähren. Sokrates wies das Angebot zurück. Er verwarf den leiblichen Genuss zugunsten einer geistigen Einsicht, für die er den schönen jungen Alkibiades noch nicht reif genug hielt. Er suchte ihm das Auge des Geistes zu öffnen und forderte ihn zu reiflichen Überlegungen auf, um für sie beide das Beste erreichen zu können. «Nach dieser Rede nun und nachdem ich meine Pfeile sozusagen abgeschossen, glaubte ich ihn doch getroffen zu haben», erzählte Alkibiades, «und ich stand auf, ohne daß ich ihn weiter zu Worte kommen ließ, warf dieses mein Kleid über, denn es war Winter, und legte mich unter seinen Mantel, indem ich mit beiden Armen diesen göttlichen und in Wahrheit ganz wunderbaren Mann umfaßte, und so lag ich die ganze Nacht … ohne etwas weiteres, als wenn ich bei einem Vater oder älteren Bruder gelegen hätte.»[7]