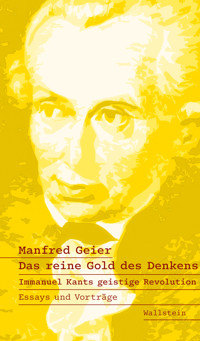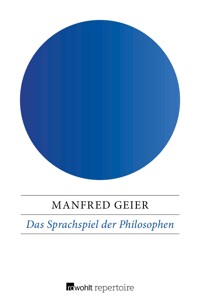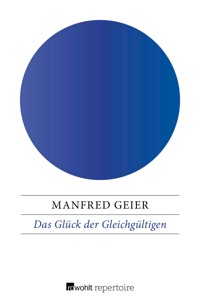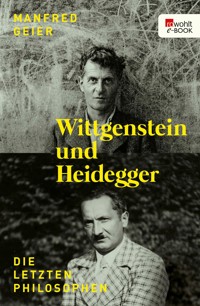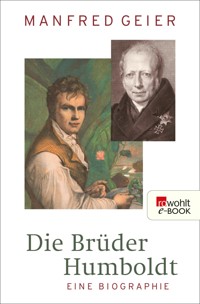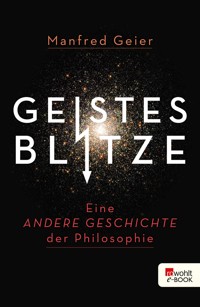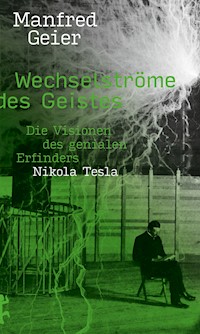
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Nikola Teslas unzählige Bewunderer, nicht zuletzt der Multimilliardär Elon Musk, halten ihn für den genialsten Erfinder aller Zeiten und umhüllen ihn mit einer gleißenden Aura, die ins Übermenschliche ausstrahlt. Dagegen steht das Bild eines Fantasten, der mit verschiedensten hochtrabenden und spekulativen, aber auch visionären Projekten grandios gescheitert ist. Bisweilen hat es den Anschein, als sei Teslas Leben und Werk aus einer anderen Welt zu uns gekommen. Sein »Welt-System«, das er theoretisch entwarf und experimentell erforschte, spiegelte sich in seinem eigensinnigen und einzigarten In-der-Welt-sein, das durch kosmische Kräfte angetrieben wurde und am Übermaß von strahlendem Licht und ätherischer Energie zu zerspringen drohte. Manfred Geier ist den widerstreitenden Spannungen gefolgt, um zu verstehen, wie Nikola Tesla, jener Mann, der sich selbst als eine durch kosmische Energien betriebene Mensch-Maschine verstand, funktionierte. Und so changiert Wechselströme des Geistes gleichermaßen genialisch zwischen Science und Fiction, zwischen sorgfältiger Recherche und erzählerischem Erfindergeist und bietet dadurch eine elektrisierende Annäherung an das obskure Individuum und sein futuristisches Werk.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MANFRED GEIER
WECHSELSTRÖME DES GEISTES
Die Visionen des genialen Erfinders Nikola Tesla
INHALT
Vorwort
1 Was Sie schon immer über Tesla wissen wollten
2 Wie der Lichtblitz eines Übermenschen
3 Bei lebendigem Leib geröstet
4 Das schicksalhafte Gewitter
5 Anamnese: Dementia spectralis
6 Der Mann, der die Tauben liebte
7 Todesstrahlen
8 Der Verstrahlte
Anhang
Strahlen-Dossier: von Nietzsche bis HAARP
Nachweise
Quellen und Literatur zum Tesla-Komplex
1. WAS SIE SCHON IMMER ÜBER TESLA WISSEN WOLLTEN
»Als erstes ist hier der herrliche Anblick außergewöhnlicher Blitzentladungen zu erwähnen.«
Nikola Tesla
Um Mitternacht, zwischen dem 9. und dem 10. Juli 1856, wurde Nikola Tesla geboren, sodass er also keinen richtigen Geburtstag hatte und später auch darauf verzichtete, einen solchen zu feiern. Sein Geburtshaus war ein altes Gebäude neben einer Kirche, dahinter ein Friedhof, in dem kleinen kroatisch-slawonischen Bergdorf Smiljan, das aus etwa vierzig weit voneinander getrennt liegenden Höfen bestand und damals zur österreichisch-ungarischen Provinz Lika gehörte. In den Bergen lebten noch Wölfe und Bären. Es war eine wilde Gegend, in der sich Teslas serbischer Vater Milutin als orthodoxer Priester um das Seelenheil seiner wenigen Schäfchen kümmerte. Ein gelehrter Mann, der sich für Naturphilosophie, Musik und Dichtung interessierte. Die Mutter Djuka dagegen konnte nicht lesen. Dafür besaß sie ein hervorragendes Gedächtnis und war äußerst geschickt und erfinderisch im praktischen Umgang mit den Dingen des täglichen Lebens.
In der dunkelschwarzen Nacht von Nikolas Geburt zog ein gewaltiges Unwetter über das einsam am Waldrand gelegene Pfarrhaus. Am mitternächtlichen Himmel schienen Blitze den Neugeborenen zu begrüßen, als ob sie ihn auf sich prägen wollten.
Ein frühkindliches Schlüsselerlebnis ereignete sich, als Nikola drei Jahre alt war. Es war ein äußerst kalter und trockener Winterabend, und die Dämmerung war bereits hereingebrochen, als der kleine Junge seinen geliebten Kater Macak streichelte. Sein Rücken sah wie eine leuchtende Fläche aus, und als seine Hand über das Fell fuhr, erzeugte sie einen Funkenschauer, dessen Knistern so laut war, dass es alle in der näheren Umgebung hören konnten. Sein Vater wusste dieses erstaunliche Phänomen zu erklären – »Das ist nichts anderes als Elektrizität, wie du sie auch bei Blitzen siehst« –, während die Mutter aus Angst vor einem drohenden Feuer darum bat, nicht mehr mit der Katze zu spielen. Der Dreijährige aber will schon gefragt haben: »Ist die Natur vielleicht eine riesige Katze? Und wenn das so ist, wer streichelt ihr dann den Rücken?« Sein Leben lang hat Tesla sich an diesen wundervollen Anblick seiner leuchtenden Katze erinnert, der seine kindliche Fantasie entzündete und ihn seine große Lebensfrage stellen ließ: Was ist Elektrizität?
Als Nikola sechs Jahre alt war, zog die Familie in die Stadt Gospic um, wo Tesla zunächst die Volksschule, dann das Gymnasium besuchte. 1871 wechselte er auf das höhere Gymnasium in Karlovac (Karlstadt). Zwei Jahre später erhielt er sein Reifezeugnis, über das er sich jedoch nicht freuen konnte. Denn seine Eltern wollten, dass er Priester wird, wie sein Vater, während er selbst sich lebhaft für Naturwissenschaften und Elektrotechnik interessierte. Mit Grauen sah er in die Zukunft bei der Vorstellung, den Wunsch seiner Eltern erfüllen zu müssen.
An diesem schicksalhaften Scheidepunkt seines Lebens erkrankte Tesla an Cholera, lag neun Monate kraftlos im Bett und war am Ende so erschöpft, dass die Ärzte ihn aufgaben und ein Sarg für ihn bestellt wurde. Doch er wollte leben, schließlich gab es noch so viel über die Natur zu erfahren! Sein Vater versuchte ihn aufzuheitern. »Du wirst wieder gesund werden.« – »Vielleicht«, antwortete der Sohn, um nach einer kurzen Pause fortzufahren, »wenn du mich Elektrotechnik studieren lässt.« – »Das werde ich ganz bestimmt«, versicherte der Vater. »Du wirst das beste Polytechnikum in Europa besuchen.« Alle waren erstaunt, dass sich der Todkranke erholte und wie Lazarus von den Toten wieder ins Leben zurückkehrte.
1875 begann Nikola Tesla das Studium der Elektrotechnik am Polytechnikum in Graz in der Steiermark, einige Jahre später wechselte er auf die Universität in Prag. Nach Abschluss seiner Studien fand er 1881 eine Anstellung als Technischer Leiter einer modernen Telefonzentrale in Budapest, begeistert über die Erfindung des Telefons, das in einer ersten Welle aus Amerika nach Europa gelangt war und in Ungarn als System installiert werden sollte. Doch sein überschwänglicher Enthusiasmus wurde bald durch eine neuerliche schwere Krankheit gedämpft. Tesla erlitt einen vollkommenen Nervenzusammenbruch, der ihn fremdartige und unglaubliche Dinge erleben ließ, die alle Vorstellungen übertrafen. Seine fünf Sinne waren extrem gesteigert. Eine Fliege, die sich auf dem Küchentisch niederließ, erschütterte sein Gehör. Ständig bebte der Boden unter seinen Füßen. »Periodisch unterbrochenes Sonnenlicht verursachte Schläge von solcher Wucht auf mein Gehirn, dass sie mich fast betäubten.« Seine Nerven waren aufs Äußerste gereizt, was er dem Einfluss von Strahlen zuschrieb. Wenn er unter einem Bauwerk hindurchging, verspürte er einen gewaltigen Druck auf seiner Wirbelsäule, und oft zitterten und bebten alle Fasern seines Körpers so sehr, dass er es kaum ertragen konnte. Tesla fühlte sich wie ein hoffnungslos verlorenes Wrack.
Wieder rettete ihn sein starker Lebenswille. Die Cholera hatte ihm letztlich das Studium der Elektrotechnik ermöglicht. Sein Nervenzusammenbruch mündete 1882 in einer genialen Erfindung. Im Februar dieses denkwürdigen Jahres kam ihm während eines Spaziergangs im Stadtpark von Budapest blitzartig der Gedanke an einen völlig neuen Motortyp. Als Tesla die Sonne untergehen sah, von der er wusste, dass sie am nächsten Morgen wiederkehren würde, stellte er sich einen Motor vor, der für seine Umdrehungen ein »rotierendes Magnetfeld« ausnutzt und durch einen phasenverschobenen Wechselstrom angetrieben wird. Das war die erste maschinelle Inspiration Nikola Teslas, die sich ihm wie in einer Offenbarung vor seinem geistigen Auge gezeigt hatte. Schon lange war Archimedes sein Vorbild. Doch erst jetzt wusste er, dass er selbst tatsächlich das war, was er sein wollte: ein Erfinder.
Als das Telefonunternehmen in Budapest aufgegeben wurde, bot man Tesla eine Stellung in Paris an, die er gern annahm. Er wurde Mitarbeiter bei der Continental Edison Company in der Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, deren Zauber einen unvergesslichen Eindruck auf seinen Geist ausübte. Anfang 1883 ging er dann für ein Jahr nach Straßburg, um an der Reparatur eines defekten Kraftwerks mitzuarbeiten. Nicht nur damit hatte er Erfolg. Er konnte auch seine Erfindung des mehrphasigen Wechselstrommotors praktisch umsetzen, der genau so funktionierte, wie er es ein Jahr zuvor konzipiert hatte.
Um für seine Arbeit als Erfinder das nötige Geld beschaffen zu können, ging Tesla im Sommer 1884 nach Amerika. Am 6. Juni kam er in New York an, mit nur vier Cent und einigen technischen Aufsätzen und mathematischen Berechnungen in der Tasche, dazu noch ein Empfehlungsschreiben des Leiters der Pariser Continental Edison Company an Thomas Alva Edison, in dem es hieß: »Ich kenne zwei bedeutende Männer. Einer davon bist du – der andere dieser junge Mann hier.«
Edison stellte Tesla in seiner New Yorker Maschinenfabrik ein, wo dieser aufgrund seiner außergewöhnlichen technischen Begabung schnell in der Hierarchie der Edison-Mitarbeiter aufstieg. Als Tesla Edison in Aussicht stellte, die Leistungskraft seiner Generatoren wesentlich verbessern zu können, war Edison begeistert und versprach: »Wenn Sie das wirklich schaffen, könnten dabei glatt 50.000 Dollar für Sie rausspringen.« Derart angespornt machte sich Tesla umgehend ans Werk – mit Erfolg: Die neuen Maschinen erfüllten alle Erwartungen. Doch als er um seinen versprochenen Lohn bat, entgegnete Edison nur lapidar: »Tesla, ich sehe schon, dass Sie unseren amerikanischen Humor noch nicht so recht verstehen.« Tesla fühlte sich betrogen und kündigte auf der Stelle.
Ab dem Frühjahr 1885 versuchte Tesla nun als selbstständiger Unternehmer seine Erfindungen zu Geld zu machen. Er gründete eigene Unternehmen unter seinem Namen und meldete mehrere Patente für sein neues Mehrphasen-Wechselstromsystem an. Schwung in die Sache kam, als er 1886 den Unternehmer George Westinghouse kennenlernte, dessen gewaltige Energie und Erfindungskraft ihn faszinierten. Das war ein Mann mit Visionen, ein Gigant, der in den großen industriellen Kämpfen nie seinen Mut verlor! Wenn andere verzweifelt aufgaben, triumphierte er. Westinghouse schuf neue Industriezweige, trieb den Maschinenbau und die Elektrotechnik voran und war offen für Erfindungen, die das moderne Leben erleichterten. Er erkannte schnell, wozu Tesla in der Lage war. Teslas Wechselstromsystem, so sah es Westinghouse, gehörte die Zukunft. Und so kam es in den folgenden Jahren zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen dem serbischen Erfinder und dem amerikanischen Großindustriellen, der in Pittsburgh die Westinghouse Electric Company leitete. Eine Million Dollar in bar und pro Pferdestärke einen Dollar Gewinnbeteiligung bot Westinghouse Tesla für seine Wechselstrompatente an. Tesla sagte zu und war auf einen Schlag ein reicher Mann.
Edison hingegen gefiel die Kooperation Westinghouse-Tesla überhaupt nicht. Denn seine Edison General Electric Company war auf die Verwendung von Gleichstrom niederer Spannung festgelegt, dessen Übertragung wesentlich mehr kostete und technisch aufwendiger war als die Verteilung von Wechselstrom hoher Spannung. Teslas Erfindungen bedrohten Edisons Unternehmen; und Teslas begeistert aufgenommener Vortrag, den dieser am 16. Mai 1888 in New York vor dem AIEE, dem Amerikanischen Institut der Elektroingenieure, über »Ein neues System von Wechselstrommotoren und Transformatoren« hielt, musste ihm als ungeheure Herausforderung erscheinen. Daher begann Edison den »AC/DC-Stromkrieg«, in dem er sein eigenes Gleichstromsystem (DC, Direct Current) gegen das Wechselstromsystem (AC, Alternating Current) seiner Gegner Westinghouse und Tesla zu behaupten versuchte. Propagandistisch warnte er vor der lebensgefährlichen Energie des Wechselstroms, und demonstrativ ließ er zahlreiche Hunde und Katzen mithilfe von Wechselstrom töten. Schließlich kam er sogar noch auf die perverse Idee, die electrocution, die Exekution mittels Elektrizität, als moderne technische Tötungsart zu empfehlen – was tatsächlich auf offene Ohren stieß. Am 6. August 1890 wurde William Kemmler das erste Opfer auf dem elektrischen Stuhl, hingerichtet mit Strom aus einer Westinghouse-Wechselstrommaschine, geröstet bei lebendigem Leib.
Doch alle Versuche Edisons, dem Wechselstrom ein negatives Image zu verpassen, scheiterten letztlich, der Erfolg des Wechselstromsystems war nicht mehr aufzuhalten. Zu Beginn der 1890er-Jahre gehörte Nikola Tesla zu den populärsten Helden seiner Zeit.
Tesla war nun auf dem Höhepunkt seines Ruhms: ein Prophet des künstlichen Lichts, das auf das Auge, Sinnesorgan für die Wahrnehmung der Schönheit dieser Welt, seinen zauberhaften Reiz ausübte. Nur finanziell sprang für ihn nicht allzu viel heraus. Denn im Wettbewerb mit seinem Konkurrenten Edison, dessen Elektrizitätsunternehmen sich mit der Thomson-Houston Company zur General Electric Company zusammengeschlossen hatte, war Westinghouse finanziell in die Bredouille geraten. Den Vertrag, der Tesla prozentual am Stromverkauf beteiligte, konnte er nicht erfüllen, ohne sein Unternehmen zu gefährden. Großzügig zerriss Tesla den Vertrag, um die Westinghouse Electric and Manufacturing Company zu retten, in der seine Erfindungen weiterentwickelt werden sollten. Er hätte zu einem der reichsten Männer Amerikas werden können!
Doch Geld scheint ihm nicht das Wichtigste gewesen zu sein. Was bedeutete es schon, wenn es um die Beantwortung der großen Fragen ging: Was ist Licht? Was ist Elektrizität? Zumal Tesla, seit dem 30. Juli 1891 US-amerikanischer Staatsbürger, reichlich Anerkennung fand und als größte Autorität auf diesem Gebiet bewundert wurde. Wie ein Magier trat er in zahlreichen Vorträgen vor sein staunendes Publikum, das ihn als Meister der Elektrizität verehrte. In New York berichtete er 1891 über seine »Versuche mit Wechselströmen sehr hoher Frequenz und deren Anwendung auf Methoden der künstlichen Beleuchtung«, bei deren praktischer Vorführung er faszinierende Lichtphänomene durch Hochspannungsentladungen erzeugte. 1892 ließ er in London seine »Tesla-Spule« wundervolle Lichterscheinungen vor den Augen seiner begeisterten Zuschauer und Zuhörer herstellen: dünne bläuliche Fäden, weiße flammende Bögen, Büschelentladungen und funkelnd-sprühenden Funkenregen. Sogar seinen eigenen Körper brachte er zum Leuchten, hüllte ihn in einen Flammenmantel ein, gespeist aus den Hochfrequenzwechselströmen seiner Transformatoren, die ihm augenscheinlich nichts anhaben konnten. 1893 wurden seine elektrischen Vorführungen in Paris, Philadelphia und St. Louis bejubelt.
Die größten Publikumserfolge konnte Nikola Tesla 1893 feiern, als die Westinghouse Company den Zuschlag erhielt, die gesamte Strom- und Lichtversorgung der Kolumbus-Weltausstellung in Chicago zu organisieren, diese Orgie des Lichts, in deren künstlich erleuchteten Palästen sich die erhabene Größe der Elektrizität strahlend zeigen und Teslas neue Maschinen effektvoll ausgestellt werden konnten; und 1894, als Teslas Mehrphasen-Wechselstromsystem beim hydroelektrischen Kraftwerk an den Niagarafällen zum Einsatz kam, das ganz Buffalo mit elektrischem Strom versorgen konnte.
Der Siegeszug der Elektrotechnik zur Nutzung von Energie schien vollendet. Tesla wurde anerkannt als Visionär einer Energiepolitik, deren weitreichende Perspektive er auf einer Gedenkfeier zur Einführung elektrischer Energie aus den Niagarafällen mit folgenden Worten umriss: »Wir müssen Mittel entwickeln, um Energie aus unerschöpflichen Quellen zu gewinnen, und Methoden finden, die nicht mit dem Verbrauch von irgendwelchen Materialien verbunden sind. Auf die großen Möglichkeiten, auf die großen Probleme, deren praktische Lösung so viel für die Menschheit bedeutet, habe ich seit Jahren meine Bemühungen gerichtet, und einige glückliche Einfälle, die ich hatte, haben mich dazu veranlasst, diese schwierige Aufgabe in Angriff zu nehmen, und sie haben mir Kraft und Mut gegeben.«
Kraft und Mut benötigte er auch weiterhin, denn die Phase des rauschhaften Erfolgs währte nur kurz. Das Unglück geschah am frühen Morgen des 13. März 1895. In seinem New Yorker Laboratorium, 35 South Fifth Avenue (heute: West Broadway) brach ein Feuer aus, als Tesla mit seinen Motoren und Transformatoren experimentierte. Das gesamte Haus wurde schwer beschädigt. Teslas Geräte, in die er den Großteil seines Vermögens investiert hatte, wurden vollkommen zerstört. Eine Versicherung hatte er nicht. Der Verlust war total, sein gesamtes bisheriges Lebenswerk, sämtliche Papiere, Aufzeichnungen und Arbeiten: vernichtet. Tesla jedoch gab sich nicht lange der Verzweiflung hin, sein ruheloser Forschergeist wandte sich alsbald neuen technischen Herausforderungen zu.
Die weltweite Nachrichtenübertragung auf kabellosem Wege war seine nächste selbstgestellte Aufgabe, wobei er auch gute Chancen sah für eine ebenfalls kabellose und völlig verlustfreie Übertragung elektrischer Energie. Schon im Juli 1897 gelang ihm die erste drahtlose Signalübertragung über eine größere Entfernung (40 Kilometer); und im September des gleichen Jahres reichte er seine diesbezüglichen grundlegenden Patente ein, die ihn, und nicht Guglielmo Marconi, zum Erfinder des Radios machten. Doch wie sollte er seine revolutionären Ideen verwirklichen, finanziell am Ende und ohne größere technische Apparaturen, die er für seine ehrgeizigen weltumspannenden Projekte benötigte? Er brauchte Geld und eine riesige Versuchsanlage, am besten auf dem offenen, menschenleeren Land, um den potenziellen Schaden durch Brandkatastrophen klein halten zu können.