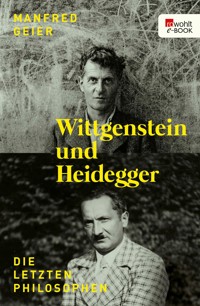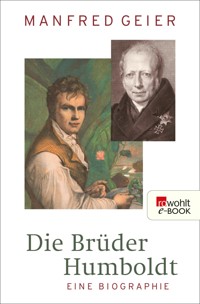14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
‹Gleichgültigkeit› gehört zu den fundamentalen Erfahrungen des Menschen. Jeder kennt diese Stimmung, die von einem partiellen Desinteresse bis zur vollkommenen Teilnahmslosigkeit an allem reichen kann. Diese enzyklopädisch ausgerichtete Untersuchung umspannt die Entwicklung vom stoischen Lob der Gleichgültigkeit bis zu ihren neuzeitlichen Abwehrstrategien. Sie folgt kulturgeschichtlich den Spuren, die Gleichgültigkeitserfahrungen in Mystik, Nihilismus und literarischer Moderne hinterlassen haben. Sie endet mit einer phänomenologischen Analyse der ‹postmodernen› Situation, in der Indifferenzen alle gesellschaftlichen Lebensbereiche zu beherrschen drohen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Manfred Geier
Das Glück der Gleichgültigen
Über Manfred Geier
Über dieses Buch
‹Gleichgültigkeit› gehört zu den fundamentalen Erfahrungen des Menschen. Jeder kennt diese Stimmung, die von einem partiellen Desinteresse bis zur vollkommenen Teilnahmslosigkeit an allem reichen kann.
Inhaltsübersicht
Für Monika
Am besten das Leben verbringen: Die Fähigkeit dazu liegt in der Seele, wenn sich jemand gegenüber den gleichgültigen Dingen gleichgültig verhält.
Marc Aurel
Was bleibt? Es sieht danach aus, als würden von der ganzen Bandbreite der Seelenregungen lediglich zwei übrigbleiben, die sich scheinbar widersprechen: Gleichgültigkeit und Ungeduld.
Jean Baudrillard
Vorwort
Gleichgültig, adj. – Von unvollkommener Empfänglichkeit für die Unterschiede zwischen den Dingen. «Schrecklicher Mann!» rief Indolentios Frau. «Du bist dem ganzen Leben gegenüber gleichgültig geworden!» «Gleichgültig?» gähnte er mit trägem Lächeln. «Das wäre ich ja gern, aber es lohnt sich nicht.»
Ambrose Bierce
In seinem Wörterbuch des Teufels hat Bierce den Vorwurf, gleichgültig zu sein, durch eine übersteigerte Trägheit ins Leere verpuffen lassen. Indolentio verteidigt sich nicht, sondern treibt seine Gleichgültigkeit müde lächelnd auf die Spitze.
Kein anderes Thema, über das ich bisher geschrieben habe, hat mich so sehr herausgefordert wie das Phänomen der Gleichgültigkeit. Persönliche Gründe haben dabei mitgespielt. Wiederholt mußte ich mir den Vorwurf gefallen lassen, nicht das Engagement zu zeigen, das man erwartete. Ich bildete mir ein, eher gelassen zu sein als gleichgültig, eher besonnen als träge oder teilnahmslos. Die folgenden Untersuchungen über den Wortgebrauch und die vielfältigen Erscheinungsweisen von Gleichgültigkeit sind auch ein Versuch der Selbstreflexion.
Je differenzierter man hinsieht, desto komplexer und unübersichtlicher werden die Phänomene. Die Klärungsversuche führten in ein verwirrendes Labyrinth. Es war nicht leicht, sich darin zurechtzufinden. Aber die Fülle der Entdeckungen entschädigte für die Mühe. Welche Rolle spielt die Gleichgültigkeit für die stoische Lebensform, die auf «Seelenruhe» intendiert? Was hat es mit der «Gelassenheit» auf sich, diesem Ideal eines unendlichen Friedens, das die Mystiker anstreben? Wie steht es um den Nihilismus, den Gottfried Benn als ein Glücksgefühl artistisch gefeiert hat? Was hat es mit der postmodernen «Indifferenz» auf sich, die unsere gegenwärtige Situation beherrscht? Wovor erschrecken diejenigen, die auf das Phänomen der Gleichgültigkeit der Welt hinweisen?
Gleichgültigkeit gilt allgemein als Charakterschwäche. Während bis ins späte 18. Jahrhundert «Gleichgültigkeit» in einem positiven Sinn verwendet wurde, um Dinge und Sachverhalte gleichen Werts zu bezeichnen, erhielt der Begriff mit der Aufbruchstimmung des «Sturm und Drang» seine subjektive Wendung. Er dient zur abwehrenden Charakterisierung eines inneren Zustands, der sich durch Teilnahmslosigkeit, Unempfindlichkeit, Uninteressiertheit und Trägheit auszeichnet. Wer gleichgültig ist, entzieht sich dem, was allgemein gewollt werden soll.
Gleichgültigkeit ist das Gegenteil von Fanatismus und so gesehen keine schlechte Eigenschaft. Sie hat auch mit Ruhe, Gelassenheit und Gleichmut zu tun. Es kommt mir nicht darauf an, die Gleichgültigkeit zu verteidigen. Statt dessen habe ich einen Streifzug durch die Geschichte unternommen, um den Bedeutungsreichtum der Gleichgültigkeit zu erhellen, und eine begriffliche Zerstreuung angestrebt, die jedem Leser sein eigenes Urteil ermöglicht. Vom Glück der Gleichgültigen zu sprechen klingt paradox. Es soll darauf verweisen, daß verschiedene Formen der Gleichgültigkeit sich verstehen lassen als Ausdruck des elementaren Menschenrechts, in einer aufgewühlten Welt, die den Menschen überfordert, souverän bleiben zu können. Der Titel des Buches könnte auch lauten: Vom Nutzen und Nachteil der Gleichgültigkeit für das Leben.
Hamburg, im November 1996
Über «Alles»
Ingeborg Bachmanns Porträt eines Gleichgültigen
Es war auch mir gewiß, daß wir in der Ordnung bleiben müssen, daß es den Austritt aus der Gesellschaft nicht gibt und wir uns aneinander prüfen müssen. Innerhalb der Grenzen aber haben wir den Blick gerichtet auf das Vollkommene, das Unmögliche, Unerreichbare, sei es der Liebe, der Freiheit oder jeder reinen Größe. Im Widerspiel des Unmöglichen mit dem Möglichen erweitern wir unsere Möglichkeiten.[1]
Ingeborg Bachmann
«Alles beginnt mit einer scharfsichtigen Gleichgültigkeit.»[2] In seinem Mythos von Sisyphos hat Albert Camus immer wieder eine Gleichgültigkeit beschworen, deren Provokation sich niemand entziehen kann, dem es um die Wahrheit der menschlichen Existenz geht. Alles – das meint nicht die Welt als Gesamtheit aller Tatsachen, die es wissenschaftlich festzustellen und zu erklären gilt. Intendiert wird statt dessen auf die dringlichste aller Fragen, der gegenüber sich alle wissenschaftlichen Problemlösungen als nichtig erweisen: Ist das Leben lebenswert? Ob die Erde sich um die Sonne dreht oder die Sonne um die Erde, was alles wie im mikrophysikalischen Teilchenzoo herumgeistert, wie kognitive Prozesse durch Computerprogramme simulierbar sind, all das mögen schwerwiegende Fragen sein, die es wissenschaftlich zu beantworten gilt. Aber wir fühlen doch auch, daß, selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Probleme gelöst sind, unsere Lebensrätsel noch gar nicht berührt sind, jene fundamentalen Fragen, welche die Entscheidung fordern, ob sich das Leben lohnt oder nicht. Alles, das zielt bei Camus auf das All des menschlichen Daseins, die verwirrenden Beunruhigungen der menschlichen Existenz, für die kein wissenschaftlicher Verstand eine Lösung anzubieten vermag.
Warum aber sollen wir, wenn es um die Grundfrage nach dem Sinn und Wert des Lebens geht, mit einer scharfsichtigen Gleichgültigkeit beginnen? Wir müssen es, weil wir nur so klar sehen können. Denn es handelt sich bei dieser geforderten Gleichgültigkeit um keine dumpfe Stimmung eines Mir-ist-alles-egal, um die Schwammigkeit eines blinden Gefühls, das der dringlichsten aller Fragen nur ausweicht, ohne sich ihr zu stellen. Scharfsichtigkeit (clairvoyance) ist eine Forderung moralischer Wahrhaftigkeit, die der Mensch zu wagen hat, auch wenn er daran zu zerbrechen droht. Sie will nicht beruhigend erklären, sondern enthüllen. Dazu aber ist es notwendig, mit einem ersten Schritt zu beginnen, der zunächst gleichgültig ist gegenüber allen Täuschungen und Unwahrhaftigkeiten, die dem Menschen nur scheinbare Sicherheiten und illusionäre Fiktionen vorspiegeln.
Wann und wo dieser anfängliche Schritt tatsächlich beginnt, ist dabei belanglos. Es kann ein verstörender Augenblick sein, in dem plötzlich die Kulissen des eingespielten Alltags einstürzen und sich Überdruß an einem mechanischen Leben breitmacht. Eines Tages steht das «Warum?» da, «und mit diesem Überdruß, in den sich Erstaunen mischt, fängt alles an. ‹Fängt an› – das ist wichtig. Der Überdruß ist das Ende eines mechanischen Lebens, gleichzeitig aber auch der Anfang einer Bewußtseinsregung.» (S. 16) Es kann ein grausamer Schockmoment sein, in dem sich dem Menschen die lächerliche Bedeutungslosigkeit und Vergänglichkeit aller weltlichen Dinge aufdrängt, oder das Ereignis einer heilsamen Enttäuschung, die sich durch keine propagierten Wahnideen und täuschenden Ideologien mehr bluffen lassen will und nicht mehr bereit ist, einem neuen Wahn zu folgen, nur weil ein alter verflogen ist. Und es kann ebenso die hochkultivierte Anstrengung eines geistigen Abenteuers sein, in dem ein radikaler Wahrhaftigkeitswille alle überkommenen höheren Werte in Frage stellt, von denen in Ethik, Metaphysik oder Theologie so oft nur geschwafelt worden ist. Immer kämpft die Moralität der Scharfsichtigen gegen die Blindheit derjenigen, die sich in den gewohnten Fassaden heimisch fühlen, seien sie gebaut aus alltäglicher Routine, gesellschaftlich konditionierten Werten oder transzendenter Gottgläubigkeit. Das Bedürfnis nach Klarheit fordert eine Haltung aktiver Indifferenz, die nicht notgedrungen zu der Einsicht führt, das Leben lohne sich nicht und der Selbstmord sei eine Lösung. Statt dessen erhalten alle Probleme ihre Schärfe wieder. Nichts ist entschieden. Aber alles ist jetzt verwandelt. Nicht ohne religiöses Pathos hat Camus diese Gleichgültigkeit beschworen mit dem Hinweis: «Der Mensch wird hier endlich den Wein des Absurden finden und das Brot der Gleichgültigkeit, mit der er seine Größe speist.» (S. 48)
Mag für diesen gleichgültigen Menschen das eingespielte profane Verhalten nur ein maßloses Possenspiel unter der Maske des Absurden sein, so braucht auch er seinen Ölberg, auf dem er nicht einschlafen darf. Denn die Gleichgültigkeit, die seine «Größe» speist, ist kein trübes Abstumpfen, sondern ein Erwachen. Sie weckt ein Bewußtsein, das schließlich alles affiziert. Wer von ihm ergriffen ist, will nichts als aufrichtig sein. Gefordert ist eine Haltung, welche die Mechanik des Alltags nicht akzeptieren will, sich auf wissenschaftliche Welterklärungen nicht verläßt und auch nicht mehr bereit ist, in die Transzendenz eines Glaubens zu springen. Doch wohin führt diese gleichgültige Klarsichtigkeit, die dem Sicherheitsbedürfnis des Menschen widerspricht, seinen Illusionen und Konstruktionen, in denen er sich zu Hause wähnt?
Halten wir zunächst fest, daß es hier nicht um Erklärungen geht, sondern um Lebenserfahrungen und -beschreibungen. Beschreiben ist der Ehrgeiz eines Menschen, der klar sehen möchte, was die menschliche Existenz betrifft. In jenen Situationen, in denen alles beginnt, haben vor allem Kunstwerke ihren Ursprung und ihre Legitimation. Es geschah nicht aus Nachlässigkeit, daß «Gleichgültigkeit» keine zentrale Kategorie des philosophischen Diskurses wurde. Denn so schwer es ist, diese Haltung dauernd auszuhalten, so sehr entzieht sie sich einer rein geistigen Reflexion, die ihre systematischen Gedankengebäude errichtet. Es sind vor allem literarische Werke, welche uns enthüllen, was es mit scharfsichtiger Gleichgültigkeit zu sehen gilt: wer wir selbst sind und wie wir uns zu anderen verhalten können. Das rechtfertigt die Stellung, die Romane und Erzählungen in dieser Untersuchung spielen. Dostojewski, Moravia, Sartre, Camus, Benn, Beckett, Pynchon, um nur einige von ihnen anzuführen, haben den philosophischen Drang zum Theoretisieren so gut verstanden, daß sie von ihm frei wurden und dort zu schreiben begannen, wo es eine neue Möglichkeit des Menschen zu entwerfen gilt. Immer ist es eine besondere Form von Gleichgültigkeit, die ihren Beschreibungen wie ein Sprengstoff den ersten Anstoß gab.
Alles ist eine Erzählung von Ingeborg Bachmann.[3] Auf engstem Raum sind hier alle Ambivalenzen verdichtet, die sich ergeben, wenn Gleichgültigkeit und Enthüllung die gewohnheitsmäßige Maskerade beenden wollen. Beschrieben wird die absurde Hoffnung eines Menschen, der klarsichtig die «reine Größe» einer Indifferenz zu erreichen versucht, die von allen gesellschaftlich und geschichtlich eingespielten Wertigkeiten befreit ist. Nichts bleibt dabei unberührt, alles wird infiziert durch den Impuls eines gleichgültigen Wollens, das in seinem Herzen rumort und sein ganzes Denken zunehmend beherrscht. Erzählt aber wird auch von seinem Scheitern, von einer Schuld und einem Tod, von einer inneren Kälte, die macht, daß das Nächste und Fernste gleich entrückt sind und alles nur noch im hellen Licht einer unerträglichen Indifferenz erscheint, die menschliches Zusammenleben der härtesten Probe aussetzt.
Wenn der Held dieser Geschichte wie ein Mann ohne Eigenschaften erscheint, so wird daran zugleich deutlich, daß es sich bei jener Gleichgültigkeit, die ihn immer stärker beherrscht, um keinen bloßen Affekt handelt, sind Affekte wie Liebe und Haß, Neid oder Mitleid doch stets noch auf bestimmte Personen oder Sachverhalte bezogen und motivieren eine bestimmte Handlungsweise. Affekte implizieren noch immer ein urteilsmäßiges, kognitives Moment, das eine Bewertung der Sachverhalte, auf die sie bezogen sind, hinsichtlich eines eigenen Wohls ausdrückt. Hier aber geht es um eine Stimmung, die zu keinen bestimmten Handlungen mehr motiviert, sondern nur eine unbestimmte Disposition ausdrückt, die sich auf «alles» bezieht. Woher diese Stimmung kommt, bleibt unbestimmt. Sie überfällt das Subjekt. Die Stimmung der Gleichgültigkeit kann einen beliebigen Menschen an einer beliebigen Straßenecke anspringen. Sie kommt weder von «Außen» noch von «Innen». Vor jeder Soziologie und Psychologie lenkt Ingeborg Bachmann die Aufmerksamkeit auf das fundamentale Phänomen einer existenzialen Grundbefindlichkeit, von der das Leben im ganzen betroffen ist, eingebunden zwischen Geburt und Tod, Zur-Welt-Kommen und Daseinsverlust.
Alles ist die Beschreibung eines Widerstreits, der vor allen Konflikten steht, die uns aus Romanen vertraut sind und uns in ihre dramatisierten Handlungsverläufe verstricken. Nicht zufällig scheinen dem Helden dieser Erzählung die Voraussetzungen zu fehlen, handeln zu können und einen geläufigen Romankonflikt auszutragen. Er haßt niemanden und liebt keinen. Entfesselt und freigesetzt von den Affekten und Werten, an denen sich die Gesellschaft orientiert, läßt er sich statt dessen auf ein geistiges und existenziales Abenteuer ein und gerät dabei auf das gefährliche Minenfeld einer geschärften Gleichgültigkeit, die unvorhersehbare Gedanken explodieren läßt und schließlich alles zu vernichten droht, was den Menschen in der Gesellschaft zu halten verspricht. Alles handelt von der Größe und der Schuld eines Mannes, der vom Brot der Gleichgültigkeit aß, ohne dadurch erlöst zu werden.
Die Erzählung beginnt mit einer nachträglichen Rekonstruktion. Sie ist das Postscriptum eines Namenlosen, dessen Kind gestorben ist und der nun neben seiner Frau dahinlebt, mit ihr, wie zwei Versteinte, verbunden allein durch einen Trauerbogen, «der von einem Ende der Welt zum anderen reicht, also von Hanna zu mir». (S. 49) Doch wie kam es zu dieser ungeheuerlichen Distanz und Fremdheit? Alles ist der mühsame Versuch einer nachträglichen Selbstreflexion, der die eigene Schuld zu begreifen versucht. Freigelegt wird das Schicksal eines Mannes, der mit seinem Kind experimentierte, gleichgültig gegen die herrschende Ordnung des gesellschaftlichen Lebens und seiner Sprache. Er wollte seinem Kind einen utopischen Raum freihalten, in dem eine kindliche Gleichgültigkeit sich zu ihrer reinen Größe entfalten sollte. – Im Schicksal dieses Ich-Erzählers sind bereits zahlreiche Motive versammelt, die es in den sechs Kapiteln dieser Untersuchung näher zu erhellen gilt.
1
Alles begann mit einer Heirat, weil Hanna ein Kind erwartete. Ein neues Leben war dabei, zur Welt zu kommen. «Ich war bewegt, weil sich etwas vorbereitete.» (S. 49) Doch es ist kein Gefühl der Freude oder des Stolzes, das ihn bewegt, eher eine Art von Neugier angesichts eines Neuen, durch das die Welt zuzunehmen schien. Sie geht einher mit einem ersten Riß in den Kulissen des gewohnheitsmäßigen Dahinlebens.
Es gab Augenblicke der Abwesenheit, die ich vorher nicht gekannt hatte. Selbst im Büro – obwohl ich mehr als genug zu tun hatte – oder während einer Konferenz entrückte ich plötzlich in diesen Zustand, in dem ich mich nur dem Kind zuwandte. (S. 49)
Abwesenheit und Entrückung sind die ersten Anzeichen einer Stimmung, die das mechanische Berufsleben nicht mehr so ernst nimmt, wie es allgemein gefordert wird. Sie bereiten die nächsten Schritte vor. – «Wir gingen kaum noch aus und vernachlässigten unsere Freunde.» (S. 49) Ein sozialer Rückzug findet statt, zunächst noch gesichert durch ein Wir, das sich gemeinsam auf die Geburt des Kindes vorbereitet. Doch das bevorstehende Ereignis beginnt bereits alles zu verändern und weckt ein neues Bewußtsein, das sich zunehmend in sich selbst zurückzieht.
Ich kam auf Gedanken, unvermutet, wie man auf Minen kommt, von solcher Sprengkraft, daß ich hätte zurückschrecken müssen, aber ich ging weiter, ohne Sinn für die Gefahr.
Hanna mißverstand mich. Weil ich nicht zu entscheiden wußte, ob der Kinderwagen große oder kleine Räder haben solle, schien ich gleichgültig. (Ich weiß wirklich nicht. Ganz wie du willst. Doch, ich höre.) Wenn ich mit ihr in Geschäften herumstand, wo sie Hauben, Jäckchen und Windeln aussuchte, zwischen Rosa und Blau, Kunstwolle und echter Wolle schwankte, warf sie mir vor, daß ich nicht bei der Sache sei. Aber ich war es nur zu sehr. (S. 49f)
Daß der Mann sich nicht zu entscheiden weiß, daß es ihm egal ist, welche Dinge aus dem differenzierten Angebot gewählt werden, heißt aber nicht, daß er «gleichgültig» ist im Sinne eines abgestumpften Es-geht-mich-alles-nichts-an. Gleichgültig ist er nur gleichgültigen Dingen gegenüber, den alltäglichen Anforderungen einer routinierten elterlichen Vorsorge, die sich in den Angeboten der Warenwelt zu entscheiden hat. Aber um so intensiver will er klar sehen, was hinter den Fassaden geschieht als Herausforderung menschlicher Existenz überhaupt, auch wenn ihm noch der Ausdruck fehlt, es mitzuteilen.
Zu sehr ist der werdende Vater bei «der Sache», die ihn zunehmend zu verwirren scheint, um sagen zu können, was in ihm vorgeht. Das einverständige Band zwischen den Eheleuten beginnt zu zerreißen. Das Ich rückt aus dem Wir. Mißverständnisse und Vorwürfe machen sich breit. Es ist ein erstes Bewußtsein von Absurdität, das ihn ergriffen hat und als Konflikt zwischen Innen und Außen, als Zwiespalt zwischen Ich und Welt bedrängt: denn so sehr er sich, von innen gesehen, sorgt um das Kind, dem er all seine Gedanken zuwendet, so sehr prallt sein Denken auf das Phänomen, daß die Welt, in die das Kind entbunden wird, von außen gesehen nur ein nichtiger Klecks des riesenhaften Weltalls ist, das in seiner unvorstellbaren Tiefe absolut gleichgültig ist gegenüber den kleinlichen Sorgen des Menschen. Es ist das Bewußtsein der objektiven Gleichgültigkeit der Welt, das dem Mann das Wort verschlägt. Was bedeutet schon die Geburt eines einzelnen Kindes, wenn Zur-Welt-Kommen immer auch heißt, in eine kosmische Welt zu fallen, die unermeßlich ist, stumm und gleichgültig gegen unsere Hoffnungen und Ängste?
Wie soll ich bloß ausdrücken, was in mir vorging? Es erging mir wie einem Wilden, der plötzlich aufgeklärt wird, daß die Welt, in der er sich bewegt, zwischen Feuerstätte und Lager, zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, zwischen Jagd und Mahlzeit, auch die Welt ist, die Jahrmillionen alt ist und vergehen wird, die einen nichtigen Platz unter vielen Sonnensystemen hat, die sich mit großer Geschwindigkeit um sich selbst und zugleich um die Sonne dreht. Ich sah mich mit einemmal in anderen Zusammenhängen, mich und das Kind. (S. 50)
Einen Schritt weiter – und das aufgeklärte Bewußtsein, dem die Erde nicht mehr als vertraute Stätte lebensweltlicher Geborgenheit erscheint, sondern als nichtiger Ort in einem gleichgültigen kosmischen Tiefenraum, stößt auf die Tiefenzeit, die unvorstellbar lange Kette der Wesen, in der das Kind nur einen bedeutungslosen Platz einnehmen wird, genauso wie alle vor und nach ihm.
Man muß es sich nur recht vorstellen. Diese ganze Abstammung! (…) Vielleicht ist es für manche beruhigend, diese Kette zu denken. (…) Ich probierte ein paarmal, diesen Prozeß durchzudenken, nicht nur nach vorn, sondern auch nach hinten, bis zu Adam und Eva, von denen wir wohl kaum abstammen, oder bis zu den Hominiden, von denen wir vielleicht herkommen, aber es gibt in jedem Fall ein Dunkel, in dem diese Kette sich verliert, und daher ist es auch belanglos, ob man sich an Adam und Eva oder an zwei andere Exemplare klammert. Nur wenn man sich nicht anklammern möchte und besser fragt, wozu jeder einmal an der Reihe war, weiß man mit der Kette nicht ein und aus und mit all dem Zeug nichts anzufangen, mit den ersten und letzten Leben nichts. Denn jeder kommt nur einmal an die Reihe für das Spiel, das er vorfindet und zu begreifen angehalten wird. (S. 50)
Die Stellung der Erde im Kosmos ist exzentrisch und bedeutungslos, an einem Ort, der in irgendeinem abgelegenen Winkel des mit ein wenig Materie angefüllten, leeren Kosmos dahintreibt; die Herkunft der menschlichen Existenz verliert sich in einem Dunkel, und der Zweck eines einzelnen Lebens wird ungewiß.
2
Was bleibt anderes, als sich mit diesem Spiel abzufinden, wenn man «mit all dem Zeug» nichts mehr anzufangen weiß? Auf das Phänomen der Gleichgültigkeit der Welt reagiert der Vater mit einem Akt fatalistischen Einverständnisses. «Da wir uns aber schon einmal so vertrauensvoll vermehren, muß man sich wohl abfinden. Das Spiel braucht die Spieler. (Oder brauchen die Spieler das Spiel?)» (S. 51)
Eine Art stoischer Gleichgültigkeit ergreift den Ich-Erzähler. Daß er hier von einem «Spiel» spricht, mit dem man sich «abfinden» muß, deutet zugleich jedoch an, daß ihm jenes Endziel verlorengegangen ist, auf das die stoische Lebensweisheit der Antike noch intendieren konnte in der Hoffnung, Ataraxia zu erringen: Unerschütterlichkeit, Seelenruhe und Unabhängigkeit vom Weltlauf. Denn die geistigen Übungen der Stoa, die immer wieder dazu aufforderten, sich den gleichgültigen Dingen gegenüber gleichgültig zu verhalten, vertrauten noch darauf, daß der Mensch seine Sichtweise mit derjenigen einer göttlichen Allnatur identifizieren konnte. Er war kein Fremder in einem sinnentleerten Universum und einer unbegreifbaren Gattungsgeschichte. Alles sollte nur darauf ankommen, den Dingen den falschen Wert zu entziehen, den die menschlichen Meinungen ihnen beimessen. Wer zu erkennen gelernt hat, daß Reichtum oder Armut, Gesundheit oder Krankheit, Mißerfolg oder Ruhm den Guten wie den Schlechten gleichermaßen zustoßen können, der weiß, daß auch die Allnatur zwischen diesen Phänomenen keinen Unterschied macht. Sie stoßen dem Menschen von außen zu, und es gilt, sie als gleichgültig anzuerkennen. Es qualifiziert den antiken Stoizismus, daß er dieses Wissen als innere Stärke und gleichmütige Gelassenheit begriffen hat. Die Weisheit des Stoikers beruht allein in ihm selbst, und die Welt kümmert ihn nicht. Nicht aus mangelndem Interesse an den Erscheinungen der Welt hält er gleichgültige Dinge für gleichgültig, sondern im Wissen darum, daß allein Tugend und Laster einen ethischen (guten bzw. schlechten) Wert besitzen. In dieser Hinsicht war stoische Vergleichgültigung, welche sich über alles erhebt, was in der Fachsprache der Stoa als «adiaphora» bezeichnet wurde (deren lateinische Übersetzung «indifferentia» war), von einem fundamentalen Ethos beherrscht, das alles als «gleichgültig» nivellierte, was sich nicht auf der Ebene des moralisch Guten oder Bösen befindet. Nur so war die unerschütterliche Größe einer befreiten Seele zu erringen und die gewünschte Fähigkeit, das Leben auf die beste Weise glücklich zu verbringen.
Von dieser stoischen Ethik finden sich in der scharfsichtigen Gleichgültigkeit des Ich-Erzählers nur noch verwischte Spuren. Durch Astronomie und Abstammungslehre aufgeklärt, daß der Mensch sich irgendwo in einem Weltall befindet, eingebunden in eine biologische Kette, mit der er nicht ein und aus weiß, findet er sich mit dem Spiel ab. Das ist weit entfernt von dem Einverständnis, das den Stoiker mit der Allnatur verband. Aber es hält, gegen alle gesellschaftlich konditionierten Wertigkeiten, noch am Ideal einer stoischen Ataraxia fest, die vor jeder formulierten Regelmoral eine neue Sittlichkeit zu entwickeln vermag. Deshalb opponiert der Vater zunehmend gegen die Meinungen einer Gesellschaft, in der er mitzumachen abgerichtet worden ist. Umstellt von den Mauern der allgemein favorisierten Wertigkeiten und Bedeutungen, fühlt er sich wie ein Kriegsgefangener der herrschenden Ordnung, der sprachlichen wie der materiellen.
Aber das Kind? Kann ihm nicht erspart bleiben, worin sich der Vater gefangen fühlt, ohne für sich einen begehbaren Ausweg zu finden? Kann es nicht wieder ein erster Stoiker sein, frei von den Einflüsterungen der gesellschaftlichen Außenwelt? Nachdem das Kind, dieses winzige nackte Geschöpf, das den Kosenamen Fipps erhielt, zur Welt gekommen war, steigerte sich die väterliche Beunruhigung. Es schien nicht mehr aufzuhalten, worauf es angekommen wäre: diesen sinnindifferenten Weltankömmling zu bewahren vor den sprachlichen Tätowierungen und gesellschaftlichen Wertschätzungen einer Welt, die nicht seine eigene war. Was tun? Der Vater weiß zwar keine Antwort. Aber in den Fragen, die nun auf ihn einstürzen, klingt eine Hoffnung an, in der ein Rest stoischer Adiaphorie nachklingt:
Hatte ich es, zum Beispiel, nicht in der Hand, ihm die Benennung der Dinge zu verschweigen, ihn den Gebrauch der Gegenstände nicht zu lehren? Er war der erste Mensch. Mit ihm fing alles an, und es war nicht gesagt, daß alles nicht auch ganz anders werden konnte durch ihn. Sollte ich ihm nicht die Welt überlassen, blank und ohne Sinn? Ich mußte ihn ja nicht einweihen in Zwecke und Ziele, nicht in Gut und Böse, in das, was wirklich ist und was nur so scheint. Warum sollte ich ihn zu mir herüberziehen, ihn wissen und glauben, freuen und leiden machen! (…) Wo er stand, war nichts entschieden. Noch nichts. Wie lange noch?
Und ich wußte plötzlich: alles ist eine Frage der Sprache. (…) Alles war eine Frage, ob ich das Kind bewahren konnte vor unserer Sprache, bis es eine neue begründet hatte und eine neue Zeit einleiten konnte.
Oft ging ich mit Fipps allein aus dem Haus, und wenn ich an ihm wiederfand, was Hanna an ihm begangen hatte, Zärtlichkeiten, Koketterien, Spielereien, entsetzte ich mich. Er geriet uns nach. Aber nicht nur Hanna und mir, nein, den Menschen überhaupt. Doch es gab Augenblicke, in denen er sich selbst verwaltete, und dann beobachtete ich ihn inständig. Alle Wege waren ihm gleich. Alle Wesen gleich. Hanna und ich standen ihm gewiß nur näher, weil wir uns andauernd in seiner Nähe zu schaffen machten. Es war ihm gleich. Wie lange noch? (S. 53)
3
Zur-Welt-Kommen heißt Zur-Sprache-Kommen. Das Kind, das sprechen lernt, wird sprachlichen Differenzen ausgesetzt, in denen ihm die gesellschaftliche Relevanz der Dinge und Erscheinungen für den Menschen begreifbar wird. Es lernt zu unterscheiden, entsprechend den Regeln symbolischer Ordnung und ihrer Werte. Nichts wird ihm mehr gleich sein. Das flüssige Weltplasma, in dem noch nicht geschieden und entschieden ist, in dem alles «gleich» ist, beginnt durch die benennende und feststellende Kraft der Sprache zu erstarren. Die Blankheit des Seienden wird durch Zeichen in Bedeutungsparzellen separiert; die Grammatik stellt Strukturraster möglicher Beziehungen zur Verfügung und läßt kognitive und affektive Urteile fällen; die Unmittelbarkeit des bloßen Daseins wird überführt in die Mitteilbarkeit intersubjektiver Abstraktionen; Diskurse ordnen die Felder des gesellschaftlich Bedeutsamen. Die Trennungen von Zweck und Zwecklosigkeit, Sinn und Unsinn, Wahrheit und Falschheit, Wirklichkeit und Schein, Erlaubtem und Verbotenem werden begründet in einer Sprache, die dem Ich die Welt als menschliche Welt aufschließt. Die ungeheure Ironie dieser Versprachlichung ist dem Vater nur zu bewußt: Seit die Sprache dominiert, seit die Dinge benannt sind und richtende Urteile gesprochen werden können, treten Ich und Welt auseinander. Das unschuldige Einverständnis eines sprachindifferenten Kindes mit allem, was ihm als gleich gilt, wird gebrochen durch sprachlich vermittelte Wertschätzungen. «Alles teilt sich in oben und unten, gut und böse, hell und dunkel, in Zahl und Güte, Freund und Feind.» (S. 56)
Auch wenn das Kind seinen Eltern nachgerät und ihre Sprache lernt, so gibt es doch noch Augenblicke, in denen ein paradiesischer Zustand vorscheint, ein Dasein vor dem Sündenfall, dieser Geburtsstunde der menschlichen Sprache und Erkenntnis. Kann nicht wenigstens sein Sohn wieder jener Adam sein, der «erste Mensch», der vor Zeichen, Urteil und Abstraktion in einer gottnahen Gleichgültigkeit lebte, die allem gleich nahe war, frei von Gut und Böse, Erkenntnis und Irrtum? Der Vater weiß zwar, daß er selbst aus dem Paradies vertrieben ist, und er glaubt auch die Schuldige zu kennen, von der bereits im alttestamentarischen Ersten Buch die Rede war. Verführt durch die teuflische Schlange, ist es das «Weib», das vom Baum der Erkenntnis zu essen verlockt, weil er klug machen soll. Auch Fipps wird sich der mütterlichen Verführung nicht entziehen können. Hanna war «eine wundervolle Versucherin. Sie stand unentwegt über den namenlosen Fluß gebeugt und wollte ihn herüberziehen.» (S. 54) Gegen ihre Macht kämpft der Vater mit dem utopischen Wunsch nach einer ganz anderen Sprache, einer reinen «adamitischen» Sprache, in der das sinnindifferente Sein aller Dinge unverstellt zum Ausdruck kommen kann. Er kennt zwar diese Sprache nicht. Aber er fühlt sich beseelt von der mystischen Intuition einer Paradiessprache vor jeder menschlichen Sprache.
Und wenn die Bäume Schatten warfen, meinte ich, eine Stimme zu hören: Lehr ihn die Schattensprache. Die Welt ist ein Versuch, und es ist genug, daß dieser Versuch immer in derselben Weise wiederholt worden ist mit demselben Ergebnis. Mach einen anderen Versuch! Laß ihn zu den Schatten gehn! Das Ergebnis war bisher: ein Leben in Schuld, Liebe und Verzweiflung. (Ich hatte begonnen, an alles im allgemeinen zu denken; mir fielen dann solche Worte ein.) Ich aber könnte ihm die Schuld ersparen, die Liebe und jedes Verhängnis und ihn für ein anderes Leben freimachen.
Ja, sonntags wanderte ich mit ihm durch den Wienerwald, und wenn wir an ein Wasser kamen, sagte es in mir: Lehr ihn die Wassersprache! Er ging über Steine. Über Wurzeln. Lehr ihn die Steinsprache! Wurzle ihn neu ein. Die Blätter fielen, denn es war wieder Herbst. Lehr ihn die Blättersprache!
Aber da ich kein Wort aus solchen Sprachen kannte oder fand, nur meine Sprache hatte und nicht über deren Grenze gelangen konnte, trug ich ihn stumm die Wege hinauf und hinunter und wieder heim, wo er lernte, Sätze zu bilden und in die Falle ging. (S. 54)
Als erzieherische Maßnahme mag das väterliche Sprachbegehren eine unmögliche Illusion sein. In der Welt, die der Fall ist und die Falle, ist es nicht zu verwirklichen. Der namenlose Fluß zwischen Paradies und versprachlichter Menschenwelt ist überschritten. Einen Weg zurück gibt es nicht. Doch die Erinnerung an einen glücklichen und freien Zustand bleibt bestehen: «Schattensprache», «Steinsprache», «Wassersprache» und «Blättersprache» sind Metaphern eines mystischen Ausdruckstraums, der die Dinge der Welt nicht benennt, der keine Urteile über Gut und Böse, Sein und Schein fällt und sich nicht durch die begrifflichen Abstraktionen der Menschensprache beherrschen läßt. In der großen Tradition der Mystik ist immer wieder zu dieser adamitischen Sprache zurückzukehren versucht worden, zu einer reinen Sprache vor jeder Sprache. Ihr Nicht-Ort ist die Utopie mystischer Gelassenheit vor jeder Differenzierung, sei sie kognitiver, sprachlicher oder ontologischer Art. Alles ist eins ist der fundamentale Glaubenssatz einer philosophischen Mystik, die in ihrer ungeheuren Verallgemeinerung einer Intuition entspringt, die indifferent ist gegenüber allen Geschiedenheiten, die unsere Erfahrungen dominieren und unser Bewußtsein in einem Raum gefangenhalten, der von den Gittern sprachlicher Differenzen umgeben ist.
Auch Fipps wird nicht entkommen können. Er kann weder Adam sein noch ein neuer Erlöser. «Ich hatte erwartet, daß dieses Kind, weil es ein Kind war – ja, ich hatte erwartet, daß es die Welt erlöse.» (S. 58) Statt dessen lernt es Wörter und Sätze zu bilden. Nichts wird ihm gleich bleiben, keine Wege, Wesen und Menschen.
Er äußerte schon Wünsche, sprach Bitten aus, befahl oder redete um des Reden willens. Auf späteren Sonntagsgängen riß er Grashalme aus, hob Würmer auf, fing Käfer ein. Jetzt waren sie ihm schon nicht mehr gleich, er untersuchte sie, tötete sie, wenn ich sie ihm nicht noch rechtzeitig aus der Hand nahm. (S. 55)
Alles wird seinen gewohnten Gang nehmen. Seit sein Kind nicht mehr wehrlos und stumm wie in den ersten Wochen war, seit sein riesenhafter dumpfer Kopf nicht mehr «wie ein Blitzableiter die Botschaften der Welt entschärfte» (S. 55), konnte die Gesellschaft sich auf diesen kleinen Mann verlassen. Er lernte, Bescheid zu wissen und den Ort zu finden, von dem aus die Gesellschaft sich vorwärts zu bewegen glaubte, «immer in dieselbe Richtung. Ich hatte gehofft, mein Kind werde die Richtung nicht finden.» (S. 56)
4
Denken wir diese gleichgültige Richtungslosigkeit, von der das väterliche Ich nur träumen kann, in ihrer radikalsten Form: das Dasein, wie es sein sollte, ohne Zweck und Ziel; die Erde nur ein nichtiger Platz unter vielen Sonnensystemen; die Gattungsgeschichte nur eine lange Kette, mit der man nichts mehr anzufangen weiß; eine Welt «blank und ohne Sinn». Es ist der Nihilismus, der in den unerfüllbaren Hoffnungen des Vaters am Werke ist und sein Denken beherrscht.
Denn dieses namenlose Ich, das über «Alles» in den allgemeinsten Worten reflektiert, ist vom «Nichts» als dem unheimlichsten aller Gäste heimgesucht worden. Es ist kein Stoiker mehr. Es mangelt ihm der Impuls der antiken Weisen, glücklich sein zu wollen in Übereinstimmung mit einer göttlichen Allnatur, der alles Äußerliche adiaphora war. Die Wege zum Glück, freigemacht von Zenon aus Kition bis Marc Aurel, von Chrysippos aus Soloi bis Seneca und Epiktet, sind ihm nicht mehr begehbar. Dieses eigenschaftslose und handlungsunfähige Ich sucht keine Seelenruhe in gewollter stoischer Gleichgültigkeit.
Es kann aber auch in keiner mystischen Tradition sich heimisch fühlen. Die «unio mystica», dieses höchste Ziel einer göttlichen Gleichgültigkeit, der alles eins ist, ist ihm verwehrt. Die Stummheit, mit der es das Kind die Wege hinauf und hinunter und wieder heim trägt, ist kein mystisches Schweigen, in dem eine reine Sprache ihren paradoxen Ausdruck finden kann, sondern nur noch Zeichen einer Unfähigkeit.
Es ist ein modernes Ich, großgeworden in der Epoche des europäischen Nihilismus, das in Alles zu uns spricht. Es ist durch die Schule von Friedrich Nietzsche und Martin Heidegger gegangen und hat seine Lektion gelernt. Seine scharfsichtige Moralität kennt nur noch eine letzte Gewißheit: «Alles ist leer, alles ist gleich, alles war.»[1] Der Glaube an hohe und hehre Ideale trägt nicht mehr in einer Welt, in der alle Werte als hohle und leere Götzen entlarvt worden sind. Gott ist tot, und das Ich taumelt als «toller Mensch»[2] richtungslos durch ein unendliches Nichts, rückwärts, seitwärts, vorwärts. Es bleibt ihm allein die kraftlose Geste eines Enttäuschten, der von der Menschenwelt, wie sie ist, nur urteilt, sie sollte nicht sein, und von der Welt, wie sie sein sollte, nur weiß, sie existiert nicht.
In dieser Situation bieten auch stoische oder mystische Gleichgültigkeit keine Hoffnung mehr. Der Vater ist infiziert von einem nihilistischen Virus, der in seiner grausamen Gleichgültigkeit alles befällt, was noch Halt versprach. Alles umsonst. Jetzt läßt er auch seinen Sohn fallen, der kein Adam und kein Christus sein konnte, kein neuer Mensch, der eine neue Welt zu begründen vermochte. «Darum ließ ich das Kind fallen. Ich ließ es aus meiner Liebe fallen. Dieses Kind war ja zu allem fähig, nur dazu nicht, auszutreten, den Teufelskreis zu durchbrechen.» (S. 56) Hatte der Vater anfänglich all seine Gedanken und Wünsche auf sein Kind gerichtet, so kann er es jetzt nur noch mit einem kalten und distanzierten Blick beobachten, wie ein Forscher einen «Fall», diesen hoffnungslosen Fall Mensch. Der Faden ist gerissen. An die Stelle einer ersehnten Gleichgültigkeit, die aktiv den eingespielten Werten widerstreitet, treten wunschlose Indifferenz, Verantwortungslosigkeit und Apathie. Je älter das Kind wird, desto gleichgültiger wird es dem Vater.
Wenn Fipps mit einer schlechten Note aus der Schule heimkam, sagte ich kein Wort, aber ich tröstete ihn auch nicht. (…) Es war mir gleichgültig, ob Fipps später aufs Gymnasium kommen würde oder nicht, ob aus ihm was Rechtes würde oder nicht. Ein Arbeiter möchte seinen Sohn als Arzt sehen, ein Arzt den seinen zumindest als Arzt. Ich verstehe das nicht. Ich wollte Fipps weder gescheiter noch besser als uns wissen. Ich wollte auch nicht von ihm geliebt sein; er brauchte mir nicht zu gehorchen, mir nie zu Willen sein. (…) Ich wünschte für Fipps nichts, ganz und gar nichts. (S. 55)
5
Gegen dieses Nichts opponiert die mütterliche Sorge Hannas, dieser wunderbaren Verführerin. «Sie erklärte mir einmal, als wir uns stritten, was alles sie für Fipps tun und haben wolle.» (S. 58) Alles: ein lichteres Zimmer, gesunde Ernährung, hübsche Kleidung, eine gute Schulbildung, Fremdsprachenkenntnisse und, mehr als alles andere, «mehr Liebe, die ganze Liebe» (S. 58). Der Nihilist kann darüber nur noch lachen. Auch wenn er weiß, daß unser Dasein eigentlich nicht zum Lachen ist, so ist ihm doch nichts lächerlicher als das Leben mit all seinen Vorsorgungen und Absicherungen.
Der nächste Schritt ist nicht mehr aufzuhalten: der Austritt aus dem Geschlecht. Auch die widerstreitende Differenz zwischen Mann und Frau muß noch vergleichgültigt werden. Nur so kann die nihilistische Indifferenz ihre ganze unheimliche Macht durchsetzen und behaupten. Die sexuelle Differenz der Geschlechter, die jeder vergleichenden Anthropologie als fundamentales Muster diente, weil sie von der Natur selbst ins Spiel gebracht worden zu sein scheint, gerät in den Sog einer nichtenden Indifferenz, die vor nichts mehr haltmacht. Jetzt spielen auch Lust und Unlust, Anziehung und Distanzierung auf dem verführerischen Feld der Geschlechter-Binarität keine Rolle mehr. Entfremdet von seiner Frau, bleibt dem Mann zunächst noch der Rückzug auf sich selbst, um zumindest seine eigene sexuelle Identität noch zu retten. Aber auch das muß ihm schließlich noch zuviel sein, wirkt dabei doch immer noch ein Rest von Verlangen nach dem anderen Geschlecht. Am Ende steht die leere Wüste des einzelnen, der nur noch in der «Impotenz» seine Ruhe finden kann. Sie wird gewollt als Symptom einer sexuellen Gleichgültigkeit, die selbst noch gegen homoerotisches Begehren und übergreifende Geschlechterauflösung ihr Veto einlegen würde. Sexuelle Differenz und Identität fallen ihr gleichermaßen zum Opfer.
Ich war auf der Suche nach Selbstbefriedigung, nach der lichtscheuen, verpönten Befreiung von der Frau und dem Geschlecht. Um nicht eingefangen zu werden, um unabhängig zu sein. (…) Ich fühlte mich wie ausgelöscht als Mann, impotent. Ich wünschte mir, es zu bleiben. Wenn das eine Rechnung war, würde sie aufgehen zu meinen Gunsten. Austreten aus dem Geschlecht, zu Ende kommen, ein Ende, dahin sollte es nur kommen! (S. 59f)
Und nun noch ein allerletzter Schritt. Das Nichts macht selbst vor dem Wunsch nicht halt, der sich auf das Leben selbst bezieht. Wenn nichts mehr gewünscht wird, verliert auch der Tod seinen Stachel. Die Gleichgültigkeit, die auf den Vater mit ihrer ganzen nihilistischen Gewalt eingestürzt ist, übersteigt am Ende selbst noch die fundamentale Angst, die angesichts des Todes nahestehender Menschen hervorquillt. Als Fipps während eines Schulausflugs auf einem Felsen ausrutscht, auf den darunterliegenden stürzt und einen raschen Tod findet, geht zwar alles zu Ende, was seit der Geburt seines Sohns die Gedanken des Vaters beherrscht hat. Aber es berührt ihn kaum. Was den Direktor der Schule stammeln läßt, weil er die schmerzvollen Worte nicht finden kann, um einem Vater mitzuteilen, daß sein Kind tot ist, interessiert ihn nicht. «Es sei nicht Schuld des Lehrers, sagte er. Ich nickte. Es war mir recht.» (S. 63) So sehr wünschte er für Fipps nichts, «ganz und gar nichts», daß er selbst seinem Sterben gegenüber gleichgültig ist. Niemand muß sich für diesen Tod verantwortlich fühlen, auch er nicht. Es gibt nur noch das Übliche zu tun, eine Todesanzeige aufzusetzen und an der Beerdigung teilzunehmen. Kein stoischer Heroismus, der auch den Tod in die Adiaphorie gleichgültiger Dinge einbezog, beseelt dieses erkaltete Ich, sondern eine gleichgültige Distanz, in der selbst der Tod noch seinen möglichen Sinn verliert als Quelle der intensiven Erfahrung lebendiger Gegenwärtigkeit des Menschen in seiner Welt.
Es war ein schöner Tag, ein leichter Wind ging, die Kranzschleifen hoben sich für ein Fest. Der Direktor sprach immerzu. (…) Es gibt eine Kälte innen, die macht, daß das Nächste und Fernste uns gleich entrückt sind. Das Grab entrückte mit den Umstehenden und den Kränzen. Den ganzen Zentralfriedhof sah ich weit draußen am Horizont nach Osten abtreiben, und noch als man mir die Hand drückte, spürte ich nur Druck auf Druck und sah die Gesichter dort draußen, genau wie aus der Nähe gesehen, aber sehr fern, erheblich fern. (S. 63)
Alles begann mit einer scharfsichtigen Gleichgültigkeit. Schritt für Schritt wurde sie radikalisiert. Gab es am Anfang nur kurze Momente der Abwesenheit, die in das alltägliche Büroleben einbrachen, so stand am Ende die eisige Kälte einer reinen nihilistischen Gleichgültigkeit, das Austreten aus der Geschlechterdifferenz und die Unfähigkeit zu trauern über den Tod des eigenen Kindes. Der Wunsch nach Befreiung vom Joch der symbolischen Ordnung, die alles ins Netz ihrer Differenzen einzufangen droht, steigerte sich in einen Rausch der Vergleichgültigung, der alles in seinen Sog riß und die Welt haltlos und fremd werden ließ. Gleichgültigkeit ist ein Minenfeld. Man muß lernen, wohin man tritt. Wer der gesellschaftlichen Dressur zu entkommen versucht und frei sein will von den soufflierten Wertigkeiten der herrschenden Ordnung und ihrer schlechten Sprache – von den erzieherischen Abrichtungen und zerstörerischen Erkenntniszwängen, von politischer Propaganda und religiösen Transzendenzangeboten, von den Lockungen des Geldes und der gesellschaftlichen Macht, von «diesem ganzen verfilzten, ausgeklügelten Wust, der sich Ordnung nennt» (S. 56) –, kann leicht zu weit gehen. Die reine Größe einer vollkommenen Indifferenz erreichen zu wollen, ist ein unmögliches Begehren. An seinem Horizont steht der Tod, der endgültige Gleichmacher. Auch in Ingeborg Bachmanns Erzählung, die uns als Anregung diente, das Thema «Gleichgültigkeit» in seiner verwirrenden Ambivalenz zu exemplifizieren, hat er nicht das letzte Wort.
Aber jetzt, da alles vorbei ist und Hanna auch nicht mehr stundenlang in seinem Zimmer sitzt, sondern mir erlaubt hat, die Tür abzuschließen, durch die er so oft gelaufen ist, rede ich manchmal mit ihm in der Sprache, die ich nicht für gut halten kann.
Mein Wildling, mein Herz.
Ich bin bereit, ihn auf dem Rücken zu tragen, und verspreche ihm einen blauen Ballon, eine Bootsfahrt auf der alten Donau und Briefmarken. Ich blase auf seine Knie, wenn er sich angeschlagen hat, und helfe ihm bei einer Schlußrechnung.
Wenn ich ihn damit auch nicht lebendig machen kann, so ist es doch nicht zu spät zu denken: Ich habe ihn angenommen, diesen Sohn. Ich konnte zu ihm nicht freundlich sein, weil ich zu weit ging mit ihm.
Geh nicht zu weit. Lern erst das Weitergehen. Lern du selbst. (S. 64)
Nur im Widerspiel des Unmöglichen mit dem Möglichen erweitern wir unsere Möglichkeiten. Die folgenden Untersuchungen sind ein Versuch, dieser Einsicht gerecht zu werden. Keine guten Ratschläge, aber eine Erkundung des Weges, wie weit man mit scharfsichtiger Gleichgültigkeit gehen kann, um von falschen Götzen frei zu sein, ohne aus der Welt und aus der Sprache zu fallen, in stumpfe Teilnahmslosigkeit und dumpfes Verstummen.
1 Alles, was der Fall ist
Die objektive Gleichgültigkeit der Welt
In der Welt ist alles wie es ist und geschieht alles wie es geschieht; es gibt in ihr keinen Wert – und wenn es ihn gäbe, so hätte er keinen Wert.[1]
Ludwig Wittgenstein
Wenn er diese Botschaft in ihrer vollen Bedeutung aufnimmt, dann muß der Mensch endlich aus seinem tausendjährigen Traum erwachen und seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Er weiß nun, daß er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen.[2]
Jacques Monod
Gleichgültigkeit gilt allgemein als Charakterschwäche. Gleichgültig zu sein ist ein Vorwurf. Der gleichgültige Mensch gilt als affektgelähmt und geistig träge. Seine Ansprüche, Pläne und Ideale sind zurückgeschraubt, seine Erfahrungsmöglichkeiten verflacht, sein Leben ist ohne Abenteuer. Er verzichtet auf Proteste und hat der Welt seine leidenschaftliche Aufmerksamkeit entzogen. Teilnahmslos und indolent lebt er vor sich hin und verzichtet darauf, sich zu engagieren. Immer wieder läßt er sich von der Gewißheit beherrschen, daß sich keine Tat rechtfertigt, die das Ziel hat, etwas zu ändern. Das Leben erscheint ihm als ein absurdes Schauspiel, in dem passionierte Hoffnungen keinen Platz haben. Denn alles könnte genausogut auch nicht sein, oder anders, es ist aber, wie es ist. «In der Gleichgültigkeit ohne Hoffnung liegt das Eingeständnis unserer Abdankung: wir geben das Sein sich selbst preis, enttäuschte, wenn auch besonnene Karnevalsprinzen, die die Masken ablegen und sich in ein Exil der vollkommenen Tatenlosigkeit zurückziehen.»[3]
In Wortgeschichte und Sprachgebrauch hat sich eine dominierende Bedeutung von «Gleichgültigkeit» durchgesetzt, die auf eine subjektive Gefühlslage zielt und sie zugleich kritisiert. Seit dem 18. Jahrhundert wird das Prädikat «gleichgültig» mit subjektiver Intention und negativer Konnotation gebraucht. Ungewohnt und sprachgeschichtlich überholt ist es, von einer objektiven Gleichgültigkeit zu sprechen und diese von negativen Wertungen freizuhalten. Darüber kann uns ein Blick ins Wörterbuch belehren.
Das Adjektiv «gleichgültig», zusammengesetzt aus dem Maßbegriff «gleich» (von der Gestaltähnlichkeit bis zur sachlichen Identität reichend) und dem Wertbegriff «gültig» (von «gelten» abgeleitet: geltend, anerkannt), wurde vom frühen 17. bis ins späte 18. Jahrhundert zunächst als positive Bezeichnung benutzt, um Dinge oder Handlungen von gleichem Wert, gleicher Geltung und Bedeutung zu kennzeichnen. Man tauscht gleich-gültige Sachen oder ist bestrebt, einem anderen Menschen gleich-geltend zu entsprechen. «Gleichgültigkeit» bezog sich auf objektiv feststellbare Wertigkeiten.
Bereits im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts deutete sich jedoch eine Bedeutungsverschiebung an. Der positive Gehalt wurde zurückgedrängt, und als «gleichgültig» wurden solche Dinge oder Handlungen verstanden, die «ohne Wert, ohne Bedeutung, ohne Belang»[4] sind. Bei ihnen ist es irrelevant, ob das eine oder das andere gewählt wird. Speziell im Gebrauch der Morallehre wurde, im Anschluß an das griechische «adiaphora» und lateinische «indifferentia», das Wort zur Bezeichnung solcher Handlungen gebraucht, die in der neutralen Mitte zwischen Gut und Böse liegen und in sittlicher Beziehung bedeutungs- und belanglos sind. Ob man arm ist oder im Geld schwimmt, hat für unser eigentliches Wohl nichts zu bedeuten.
Erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts, im Kontext einer bürgerlichen Kultur, fand eine «seltsame Vertauschung»[5] statt, durch die «gleichgültig» seinen objektiven Sachbezog verlor, auf das betrachtende und empfindende Subjekt hinüberwechselte und zugleich einen negativen Bedeutungsgehalt annahm. Gleichgültig ist, wer sich gegenüber bestimmten Phänomenen unbeteiligt, teilnahmslos, schläfrig und uninteressiert gibt oder dessen allgemeiner Charakter träge, indolent, gefühllos und stumpf ist. Das Spektrum reichte vom nicht-religiösen Indifferentismus über politische Uninteressiertheit bis zur erotischen Unempfindlichkeit. Auch das Substantiv «Gleichgültigkeit» hat überwiegend diese negative Konnotation übernommen, mit der eine subjektive Haltung oder Stimmung qualifiziert wurde, die den allgemein geforderten Wertigkeiten entschlüpfte. Der auf Sachliches bezogene Gebrauch ging gänzlich zurück, und das Subjekt, das gleichgültig ist, wurde als abgestumpft, affektgelähmt und desinteressiert be- und verurteilt.
Diese Wende zum Subjekt, das seit dem Vordringen einer bürgerlichen Lebensform stets etwas wollen soll, hat nun zwar den objektiven Bedeutungsbezug von «Gleichgültigkeit» zurückgedrängt. Aber sie hat zugleich eine erstaunliche Rückprojektion ermöglicht. Die subjektive Wendung konnte zurückgebogen werden auf die Objektivität der Welt, die sich in ihrer bloßen Existenz nicht für den Menschen interessiert, seinen Hoffnungen und Ansprüchen teilnahmslos gegenübersteht und auf seine Sinnfragen indifferent schweigt. In diesem Sinn hat etwa Jean Baudrillard von der Gleichgültigkeit der Objekte gesprochen, die auf die leidenschaftlichen Sinngebungen des Menschen mit provozierendem Schweigen antworten. «Die Welt selbst wird gleichgültig, und je gleichgültiger sie wird, desto mehr scheint sie sich einem übermenschlichen Ereignis anzunähern, einem alles übersteigenden Ende, dessen Widerspiegelung sich in unserer gesteigerten Ungeduld findet.»[6] – Siegfried Lenz hat Gleichgültigkeit als eine «natürliche Angelegenheit» charakterisiert, die in der Teilnahmslosigkeit und Indolenz des Menschen ihre subjektive Resonanz findet: «Sie ist das Schweigen des Raums, das Vergessen, das Unglück, das nie bedauert wird. Sie ist das Achselzucken der Zeit, mit dem sie unsere Versuche quittiert, unsere Opfer entwertet, unsere Auflehnung zweifelhaft macht.»[7] – Leszek Kolakowski hat das «Phänomen der Gleichgültigkeit der Welt» als eine fundamentale Erfahrung des Menschen freigelegt, die sich vor allem im körperlichen Schmerz und antizipierten Tod offenbart. Denn im Schmerz zeigt sich der Körper, der ich bin, mir gegenüber gleichgültig und enthüllt sich mir in seiner physiologischen Fremdheit und Indifferenz; und auch die Vorwegnahme des eigenen Todes deckt vor mir nichts anderes auf als «die Ansicht einer Welt, der ich gleichgültig geworden bin, die also organisch unfähig geworden ist, meine Präsenz zu bemerken.»[8] – Und nicht zuletzt kreist das Lebenswerk Hans Blumenbergs um dieses erschreckende Phänomen. Sei es nun die Arbeit am Mythos oder die Lesbarkeit der Welt, das Auseinanderfallen von Lebenszeit und Weltzeit oder der Prozeß der theoretischen Neugierde: Hinter all diesen Anstrengungen, das geschichtliche und kulturelle Schicksal des Menschen zu entziffern, steht die ängstigende Erfahrung einer gleichgültigen Welt, gegen die wir uns zur Wehr setzen wollen, ohne es doch wirklich zu können. Denn bereits das bloße In-der-Welt-Sein konfrontiert uns mit der härtesten Bedürftigkeit, die den Menschen zum «trostbedürftigen Wesen»[9] macht: dem Tod. Er läßt uns wissen, daß alles übrige ohne Rücksicht auf das Faktum des eigenen Ausscheidens aus der Welt unbetroffen und ungerührt fortbestehen wird. Freigesetzt aus der Sicherheit lebensweltlicher Bindungen und eingeordnet in eine unermeßliche kosmische Weltzeit sehen wir uns in einer Welt, die sich gegenüber jedermann gleichgültig und rücksichtslos verhält. «Daß die Welt dieselbe wäre, wenn es uns selbst nie gegeben hätte, und alsbald dieselbe sein wird, als ob es uns niemals gegeben hätte»[10], ist Blumenberg zufolge die bitterste aller Entdeckungen, die empörendste Zumutung der Welt an das Leben.
Es soll in diesem Kapitel nicht darum gehen, den Strategien zu folgen, die vorgeschlagen wurden, um diese Gleichgültigkeit der Welt zu überwinden. Baudrillard sah sie in einem spielerischen Stoizismus, der die Welt durch eine Gleichgültigkeit besiegt und verführt, die der ihren zumindest ebenbürtig ist[11]; Lenz in einem paradoxen Protest, zu dem wir gerade dann angehalten sind, wenn er uns aussichtslos vorkommt; Kolakowski beschwor die Gegenwärtigkeit des Mythos[12], der allein die Kraft besitzen soll, die Gleichgültigkeit der Welt aufzuheben, im Gegensatz zu all den vergeblichen Maßnahmen der technischen Weltbeherrschung, der erotisch-sexuellen Begegnung, der Besitzleidenschaft und des Machthungers; Blumenberg schließlich favorisierte den Aufbau partikularer Sinnwelten, die sich gegen die Gleichgültigkeit der Welt abgrenzen, ohne sie in ihrer Absolutheit zu dementieren oder zu diskreditieren.