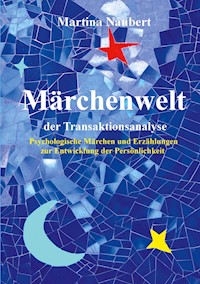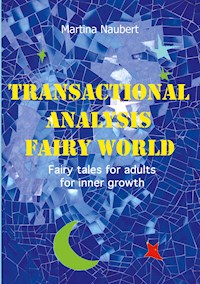Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Endlich darf die deutsche Lisa nach dreimonatiger Trennung ihren italienischen Traummann wieder in die Arme schließen. Doch das verliebte Paar kann seine Frühlingsgefühle in Bologna kaum genießen. Eine Überraschung nach der anderen stürmt auf die beiden von deutscher und italienischer Seite ein. Sogar der geheimnisvolle Kater und Hausgeist Massimiliano kann dem Treiben nicht entkommen, obwohl er selbst gehörigen Anteil an manchem Durcheinander hat. Die frische Liebe wird ernsthaft auf die Probe gestellt. Eine humorvolle Beziehungskomödie in Italien mit spritzigen Dialogen, in der ein eleganter Hausgeist als Kater in Designeranzug herumspukt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Illustrierte Ausgabe
Endlich darf die deutsche Lisa nach dreimonatiger Trennung ihren italienischen Traummann wieder in die Arme schließen. Doch das verliebte Paar kann seine Frühlingsgefühle in Bologna kaum genießen. Eine Überraschung nach der anderen stürmt auf die beiden von deutscher und italienischer Seite ein. Sogar der geheimnisvolle Kater und Hausgeist Massimiliano kann dem Treiben nicht entkommen, obwohl er selbst gehörigen Anteil an manchem Durcheinander hat. Die frische Liebe wird ernsthaft auf die Probe gestellt.
Eine humorvolle Beziehungskomödie in Italien mit spritzigen Dialogen, in der ein eleganter Hausgeist als Kater in Designeranzug herumspukt.
Über die Autorin
Martina Naubert hat sich in dem Land niedergelassen, welches der Deutschen liebstes Reiseziel ist: Italien. Sie wurde 1960 in Kanada geboren, wuchs in Neumarkt i.d. Opf. auf, ist viel gereist und siedelte schließlich im Jahre 2007 nach Bologna über. Ihre Ausbildung in Transaktionsanalyse beeinflusst ihre Arbeit maßgeblich. Fantasie und Spielerisches sind dabei Kernthemen ihrer Bücher, in denen trotz tieferem Sinn Unterhaltung nie zu kurz kommt. Sie arbeitet heute als Beraterin für Personalentwicklung und Autorin. Sie veröffentlicht ferner Märchen zur Entwicklung der Persönlichkeit auf Basis der Transaktionsanalyse.
Inhaltsverzeichnis
MYSTERIÖSE BOTSCHAFTEN
MARCONI
GEBURTSTAG
EINSICHTEN
ES STINKT ZUM HIMMEL
COSA!?
EINLADUNGEN
GEHEIME ZUTATEN
ÜBERRASCHUNG KOMMT SELTEN ALLEIN
AUS DER TAUFE GEHOBEN
KLARE ANSAGEN
TÜREN UND PFORTEN
BUMERANG
MERKMALE
LIEBESBANDE
GESTÄNDNISSE
ZWEI
Dank meinen Testleserinnen Claudia, Ursula, Ingrid, Nikola, Tanja, Sieglinde, Renate und Uschi
„Anstrengung ist für den edlen Geist eine Stärkung.“
Seneca (Römischer Philosoph, 4 v. Chr. – 65 n. Chr.)
„Katzen halten keinen für eloquent, der nicht miauen kann.“
Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach (Österreichische Erzählerin, 1830-1916)
„Du musst die Gunst der Stunde nutzen, bevor sie Dir schlägt!“
Massimiliano (Römischer Hausgeist und Kater)
„Die Menschheit hat in den zweitausend Jahren, die ich persönlich erinnere, manches wertvolle Wissen verloren. Und immer hat sie felsenfest behauptet, dass die Zeit des Irrglaubens vorbei sei!“
Massimiliano (Römischer Hausgeist und Kater)
1. Mysteriöse Botschaften
„Seltsame Dinge gehen in meiner Wohnung vor sich!“
Mein Freund Norio San steht vor mir und sieht mich höflich besorgt an.
Ich halte ihm die Tür zu meinem Ein-Zimmer-Studio im ersten Stock auf. Seit kurzem sind wir Nachbarn in diesem alten Wohnhaus in Bologna.
Er tritt sich mit einem gemurmelten „permesso1“ auf dem Abstreifer sorgfältig die Schuhe ab, bevor er schließlich einen Schritt in meine Richtung macht.
„Ich habe nicht viel Zeit“, informiere ich ihn, schließe aber gleichzeitig schnell die Tür hinter ihm. Wie ich ihn kenne, könnte dieser Hinweis sonst Anlass genug sein, ihn auf dem Absatz kehrtmachen zu lassen. Er könnte wieder, sich entschuldigend, über die Treppen nach unten verschwinden, bevor ich erfahren haben werde, was so Ungewöhnliches in seinen vier Wänden vor sich geht.
„Ich muss zum Flughafen. Marco kommt doch heute zurück!“, strahle ich ihn an.
Seit drei Monaten fiebere ich dem Moment entgegen, meinen italienischen Carabiniere2 gesund und heil wieder in die Arme schließen zu können. „Aber ein paar Minuten habe ich noch. Was gibt es denn so Merkwürdiges?“
Norio San schiebt die Hände in die Hosentaschen und zieht seinen Kopf zwischen die Schultern, als wolle er sich zwischen seinen eigenen Schlüsselbeinen verstecken.
„Du wirst mich für verrückt halten“, fängt er zögerlich an, „im besten Fall für vergesslich“, fährt er dann fort, „und mit meinen knapp sechzig Jahren wäre das ja auch nicht so ungewöhnlich, dass die Konzentration ein wenig nachlässt, nicht wahr? So dachte auch ich zunächst, dass ich einfach ein bisschen zerstreut werde. Aber dann ...“
Ein ungewöhnlich verunsicherter Blick sucht Halt in meiner Reaktion.
Die vorbauenden Worte meines ehemaligen Italienisch-Kommilitonen der altehrwürdigen Universität Bolognas sind jedoch völlig überflüssig. Anstatt Gefahr zu laufen, seine Befürchtungen zu teilen, habe ich sofort ein ahnendes Déjà-vu vor Augen. Zu häufig habe ich selbst derartige Gedanken an mir selbst beobachtet: der schleichende Zweifel am eigenen Verstand, weil man sich ereignende Vorfälle des Alltags mit gesundem Menschenverstand nicht mehr erklären kann.
Ich befürchte, dass es dafür nur eine Deutung gibt: Massimiliano!
Norio Sans Besorgnis hört sich, ohne Zweifel, nach meinem zweitausend Jahre alten römischen Hausgeist an! Seit ich vor einem Jahr für meinen deutschen Arbeitgeber eine Stelle in der Vertriebsniederlassung Italien angetreten und im Zuge dessen diese wunderschöne, renovierte Altbauwohnung im Zentrum bezogen habe, spukt er mit dergleichen Geschichten durch mein Leben und bringt mich immer wieder in Verlegenheit.
Dementsprechend muntere ich meinen neuen Nachbarn aus dem Hinterhaus selbstbewusst auf, einfach zu erzählen.
„Als Schriftsteller habe ich freilich tausend Zettel und Notizen überall in meiner Wohnung verteilt“, berichtet er schließlich. „Schreiben ist ein kreativer Prozess: Wo mir etwas einfällt, halte ich das fest, damit ich es nicht vergesse. Und es kommt auch durchaus vor, dass ich eine bestimmte Anmerkung lange suchen muss, weil ich sie vielleicht irgendwo anders aufbewahrt habe, als ich dachte. Aber, seit ich vor drei Monaten in diese Wohnung dort unten gezogen bin, verschwinden manche Aufzeichnungen völlig! Weg. Sie lösen sich einfach in Luft auf. Unauffindbar. Ich habe sogar schon die Mülltonne – und ich meine den Restmüll! – deswegen durchwühlt.“
Norio San nimmt die Hände aus den Taschen und legt ihre Flächen vor seinem Brustkorb wie zu einem begrüßenden Namaste3 aneinander. Seine Handgeste zaudert zwischen fernöstlicher Grußhaltung und italienischer Dramatikgebärde4.
„Du bist vielleicht einfach nur überarbeitet“, versuche ich ihn mit stoischer Zuversicht in der Stimme zu beruhigen.
Gleichzeitig schweift mein Blick hinüber zum Sofa, wo der Kater Massimiliano samt Jackett in den warmen Strahlen der Frühlingssonne, die durch das offene Fenster fluten, ausgestreckt schnarcht. Er hat die Pfoten hinter dem Kopf verschränkt, als denke er nach. Mit seiner Sonnenbrille auf der Nase kann ich nicht erkennen, ob er diese Konversation mithört und nur vorgibt, tief zu schlafen.
„Du solltest täglich einen Spaziergang machen“, plaudere ich indes selbstsicher weiter auf meinen japanischen Freund ein. „Du arbeitest in letzter Zeit zu viel wegen diesem Abgabetermin. Bestimmt hast du manche Notiz gedankenverloren weggeworfen. Das passiert schnell, wenn man übermüdet ist.“
„Già,5 das dachte ich zuerst auch“, meint Norio San bedächtig. „Das wäre eine mögliche Erklärung. Aber wie kann es angehen, dass nicht nur Aufzeichnungen verloren gehen, sondern sogar welche auftauchen, die ich nie verfasst habe?!“
Er unterstreicht seine Worte mit heftigem Nicken.
„Es tauchen Notizen auf?“, wiederhole ich scheinbar skeptisch, jedoch mit betont lauter Stimme, obwohl ich genau verstanden habe. Ich nehme ihm jede seiner ihm so fragwürdig erscheinenden Aussagen hundertprozentig ab.
Mit zusammengepressten Lippen brumme ich kurz in Richtung meines Sofas, wo der Kater - trotz meiner kräftigen Laute - weiterhin vorgibt, selig zu schnarchen.
„Ja“, bestätigt der Japaner. Er zieht einen gefalteten kleinen Notizzettel aus der Hosentasche. „Es sind - zugegeben - durchaus bemerkenswerte Punkte, die sich - wie aus dem Nichts – wie ein fehlendes Puzzleteil in meine Arbeit fügen. Sieh her!“
Er hält mir ein gelbes Papierchen vor das Gesicht.
Ich entziffere etwas über römischen Straßenbau, die Via Emilia von Ariminium nach Plancentia6 und die Via Francigena von Genua nach Rom.
Ich winke betont lässig ab: „Das hast du irgendwann spät nachts notiert und es bis zum nächsten Morgen vergessen. Das ist mir auch schon passiert. Mach dir keine Gedanken deswegen! Schlafmangel kann unser Gedächtnis schwer beeinträchtigen. Was du brauchst, ist: ein paar Tage den Kopf frei machen und Ruhe!“
Etwas nervös schiele ich auf die Uhr. Ich will nicht zu knapp losfahren und dann rasen müssen.
Aber meine Versuche Norio San zu überzeugen, fallen nicht auf fruchtbaren Boden.
Er schüttelt vehement den Kopf und zieht eine ganze Handvoll gelber Papierschnitzel aus der anderen Hosentasche. Er schiebt die duftende Blaubeercrostata7, die ich zu Marcos Begrüßung gebacken habe, beiseite und breitet die Notizen der Reihe nach auf meinem Küchentisch vor uns aus. Er liest jede einzeln laut vor.
„Handel mit blondem Haar der Germanen ... im Norden des Reiches Verkauf von Öl, Wein, garum8 der Iberischen Halbinsel ... Gallien: Wein, garum, Oliven ... Milch, Käse, garum, Schmuck ... gefärbtes Tuch ... Sesterzen einheitliche Währung in ganz Europa ... Eisen, Blei, Holz ... und hier, das ...“, Norio schiebt mir eines der Blättchen hin, „Umweltverschmutzung durch Herstellung Eisen wie zu Zeiten der industriellen Revolution?“
Er sieht mich eindringlich an.
Ich schweige ebenso eindringlich zurück.
Allmählich werde ich zappelig, aber er tut mir in seiner Verwirrung auch leid. Deshalb zügle ich meine Ungeduld.
„Das ist ein interessanter Gedanke, denn die damalige Technik war nicht sehr effizient, gemessen an heutigen Prozessen. Aber woher kommt dieser Hinweis? Das soll ich selbst notiert haben? Mich überrascht der Inhalt mehr als der Zettel selbst!?“
Der arme Norio San!
„Das ist in der Tat ein äußerst interessanter Aspekt! Den solltest du weiterverfolgen“, lenke ich ihn gezielt durch ungestüme Begeisterung ab. „Bemerkenswert, wie uns das Unterbewusstsein manchmal Geschenke macht, meinst du nicht?“
Er schaut mich zweifelnd an. Aber mit einem Schimmer Hoffnung in den dunklen, mandelförmigen Augen. Er guckt wie ein Pokémon der älteren Generation, der durch seinen klaren Blick das Herz erweicht.
„Du meinst also hundertprozentig, dass das nur Übermüdung ist?“, überlegt er mit wiegendem Kopf. „Ich habe wahrhaftig wenig geschlafen in letzter Zeit, das muss ich zugeben.“
„Ganz bestimmt!“, versichere ich ihm. „Mach dir einen heißen Tee und verwöhne dich ein wenig! Schlaf dich tüchtig aus!“
Und mit besonders hörbarer Stimme in Richtung Couch füge ich hinzu: „Du wirst sehen, dass das mit den geheimnisvollen Botschaften aufhört!“
Norio San sammelt seine Vermerke so fleißig wieder ein, wie er sie aufgereiht hatte.
„Merkwürdig ist doch, dass ich nicht in japanischen Schriftzeichen notiert habe“, bringt er noch einen letzten Zweifel leise an und schiebt die Notizen wieder in die Hosentasche.
Ich übergehe den Einwand, weil ich darauf keine andere Antwort parat habe, als die, dass Massimiliano der japanischen Schrift natürlich nicht mächtig ist.
„Vielleicht hast du recht?“, erwägt mein Nachbar dann laut weiter und schreitet langsam zur Tür. „Ich werde mich drei Tage nicht mehr an mein Manuskript setzen. Ich werde mich ausruhen, schlafen, spazieren gehen, gezielt andere Dinge tun und vor allem: an etwas anderes denken!“
Ich folge ihm mit einem heimlichen Blick auf meine Armbanduhr an die Tür. Marcos Maschine aus Libyen ist bereits in Rom gelandet. Inzwischen sollte er im Flugzeug von Rom nach Bologna sitzen.
„Genau das!“, bestätige ich ihm. „Du wirst sehen: Es wird aufhören!“
„Danke, Lisa. Jetzt halte ich dich aber nicht länger auf. Du musst zum Flughafen. Grüße Marco von mir!“
Kaum verschwindet Norio San am Ende der Treppe über den kleinen Garten in seine Wohnung, wende ich mich mit einem tadelnden „Massimiliano!“ meinem Penaten-Hausgeist9 zu.
„Das kannst du doch nicht machen!“
Der Kater schiebt seine Sonnenbrille hoch und positioniert sie munter auf seinem Kopf im dunkelgrauen Fell.
„A contrario!10“, postuliert er sofort. „Was ich nicht tun kann, ist ihn Dummheiten schreiben zu lassen! Die habe ich unwiderruflich vernichtet. Dafür habe ich ihm ein paar Korrekturen zugespielt. Und du hast selbst gesagt, dass diese letzte Information ein durchaus zu verfolgender Aspekt sei. Es ist nämlich den Römern geschuldet, dass Italien heute streckenweise kaum noch nennenswerte Wälder besitzt.“
„Zugespielt kann man das nicht gerade nennen“, kritisiere ich, ohne auf das durchaus gewichtige Umweltthema einzugehen. „Das würde nämlich implizieren, dass er deine Botschaften unauffällig erhalten würde, ohne an seinem gesunden Menschenverstand zu zweifeln. Der arme Norio San! Für ihn bist du ein ganz normaler Kater, der keinen Anzug trägt und nicht sprechen kann. Vergiss das nicht! Du kannst ihm also nicht einfach schriftliche Nachrichten verpassen.“
Der Kater schwingt sich mit Elan in die Senkrechte und verzieht dabei verächtlich den Mund.
„Es hat in der Vergangenheit noch niemandem geschadet, dem ich in diesen zweitausend Jahren ein wenig auf die Sprünge geholfen habe. Und es waren Einige, glaub mir! So ein bisschen Verwirrung gibt sich schnell, wenn er einmal verstehen wird, wie nützlich die Informationen für seinen Erfolg sein werden.“
„Versprich mir, die mysteriösen Botschaften einzustellen!“
Ich sehe ihm intensiv in seine blauen Augen.
Er blinzelt.
„Und auch keine anderweitigen Nachrichten irgendwelcher Art! Nichts! Keine Mails, keine Briefe, keine Telefonanrufe, keine Rauchzeichen, nichts!“
Aus Erfahrung weiß ich, dass ich sämtliche Möglichkeiten in Betracht ziehen muss.
„Auch nicht, was ich in meiner Aufzählung jetzt nicht explizit genannt haben sollte“, füge ich deshalb noch hinzu.
„Nicht einmal ein kleines Bisschen?“
„Nichts. Lass ihn seine eigenen Recherchen machen! Er ist ein angesehener Schriftsteller in Japan. Du wirst sehen, dass er fundierte Tatsachen zusammentragen wird.“
„Ha!“, macht mein Hausgeist, wirft die Pfoten bühnengerecht in die Luft und wendet sich theatralisch von mir ab.
„Da muss es aber erlaubt sein, dass ich zweifle!“
Er schreitet auf das geöffnete Fenster zu, das hinunter in den kleinen Garten des Hinterhofes weist, wo sich Norio Sans Wohnung befindet, und bleibt davorstehen. Wie einst Napoleon von einem Hügel das Schlachtfeld, betrachtet er, mit hinter dem Rücken verschränkten Pfoten und durchgedrücktem Rückgrat, das kleine Idyll.
„Ich möchte nur erwähnen, dass die Menschheit in den Jahrhunderten, die ich persönlich erinnere – von vorher will ich gar nicht sprechen – manches wertvolle Wissen verloren hat! Ganz zu schweigen von jahrelangem Irrglauben und Unfug, an dem hartnäckig festgehalten wurde! Über Jahrhunderte!“
Er rollt das R in seinem Satz betont streng.
„Die Zeiten sind vorbei!“, beharre ich umso nüchterner.
„Das haben die Menschen zu jeder Epoche behauptet!“
„Mag sein“, lenke ich ein wenig ein, da ich weder Zeit noch Muse für diese Diskussion habe. „Aber lass die Menschen ihre Erfahrungen selbst machen!“
Ich trete neben ihn und zeige in Richtung der Eingangstür zu Norio Sans Wohnung hinter dem großen Baum. „Besonders diesen einen da unten!“
Aber der Kater gibt noch nicht auf.
Er schiebt die Hände in seine Hosentaschen, wie es zuvor der Japaner getan hat, nur in absolut selbstbewusster Haltung.
„So ganz ohne Hilfe hat die Menschheit sich nicht immer alleine entwickelt! Ich habe gar manchen Samen gesät, der zu großen Erfindungen geführt hat.“
Er wirft den Kopf stolz in den Nacken: „Ich sage nur: Marconi11! Was meinst du, warum er und nicht Edison12 das Rennen in der drahtlosen Telegraphie gemacht hat? Edison hat zwar die Grundlagen zu dieser Erfindung gelegt, aber sie nicht mit nötigem Belang weiterverfolgt. Und ich habe dafür gesorgt, dass Marconi es aufgegriffen und weiter daran gearbeitet hat. Er hat sich zuerst auch ein wenig gewundert, woher manche Information kam, die plötzlich auf seinem Schreibtisch lag. Aber das hat er im Zuge seiner Arbeit dann schnell wieder vergessen.“
„Ach! Du hast bei Marconi gewohnt?“
Mittlerweile reagiere ich nicht mehr ganz so überrascht, wenn mein Hausgeist mir wieder einmal seine Bekanntschaft mit einer historischen Persönlichkeit offenbart.
„Nein. Ich kann schließlich nicht überall sein! Er hat im Sommer 1892 einmal einige Vorlesungen an der hiesigen Universität besucht. Ich weiß es deshalb noch so genau, weil es ein ganz bezaubernder Sommer war! Ein Gartenfest jagte das andere! Es waren sehr bewegte Zeiten. Damals hat er jedenfalls in dem Haus verkehrt, in dem ich gelebt habe. Die Nachfahren der Prinzessin haben versucht, die Tradition des vormaligen VIP-Salons Bolognas, wieder auferstehen zu lassen. Nebenbei gesagt: mit mäßigem Erfolg. Sie konnten nicht an die einstigen Erfolge der Prinzessin anknüpfen. Es war einfach ihre Persönlichkeit, die ihre Abende so berühmt gemacht haben! Aber immerhin, Marconi verkehrte auf diesen Gesellschaftsanlässen. Er stammte schließlich zur Hälfte aus einem englischen Landadel.“
„Welche Prinzessin?“
Während ich ihn frage, ergreife ich meine Handtasche und werfe mein Mobiltelefon hinein.
„Prinzessin Maria Hercolani13.“
Er setzt einen verklärten Blick auf, seufzt tief und träumt in Richtung meiner Küchenzeile durch mich hindurch: „Ach ja, das waren gute Zeiten.“
„Nie gehört“, murmle ich.
Währenddessen wühle ich mit mäßiger Geduld in den Tiefen meiner Handtasche nach dem Schlüssel meiner kürzlich erstandenen Vespa, mit der ich meinen Freund am Flughafen überraschen will.
„Wir residierten in einem der luxuriösesten Gebäude Bolognas in der Via Zamboni! Heute ist es kein Wohnhaus mehr. Dort ist jetzt die Fakultät der Politikwissenschaften untergebracht. Aber das hätte ihr vielleicht sogar gefallen? Sie war ja politisch sehr engagiert.“
Massimiliano verzieht kurz das Gesicht und kehrt mit seiner Aufmerksamkeit zurück in meine wenig fürstliche Ein-Zimmer-Wohnung, die er seit einem Jahr mit mir teilt.
Ich kippe den Inhalt meiner Tasche auf den Küchentisch, um den sich hartnäckig versteckenden Schlüssel zum Symbol meines italienischen Lebensgefühls endlich aus dem Haufen zu ziehen. Mittlerweile bin ich wirklich unter Zeitdruck und entsprechend fahrig.
Ein Exemplar von Norio Sans gelben Zettelchen hat sich zwischen der Tischkante und einem Küchenstuhl versteckt. Ich ziehe es kurzerhand ab und winke meinem Hausgeist damit nochmals zur Erinnerung.
„Ich fahre jetzt zum Flughafen, Marco abholen. Keine Nachrichten mehr, versprochen?“
Der Kater schlendert betont gelassen herbei und greift nach der Notiz in meiner Hand.
„Versprochen?“, wiederhole ich und locke wie eine Mutter mit einer Belohnung nochmals das Papier aus seiner Reichweite in die Höhe.
„Va bene!“
Er zieht die Antwort beinahe so lange wie seinen Mund schief, erhascht die Notiz und murmelt mit ernster Miene auf die notierten Worte: „Ich hoffe, er hat die Bedeutung des garum verstanden.“
Im kleinen Handspiegel ziehe ich mir nochmals meine Lippen nach und zupfe ein paar blonde Strähnen aus meiner Stirn.
Ich bin nervös wie ein Teenager vor dem ersten Kuss. Drei Monate Sehnsucht und Sorge haben mich mürbe gemacht.
„Was ist das eigentlich: garum?“, frage ich geistesabwesend und stopfe den Rest der Sachen zurück in meine Handtasche.
„Garum - auch liquamen genannt - war das Standardgewürz in der antiken römischen Küche!“, legt der Kater sofort mit übertriebenem Pathos los.
Ich hätte es besser wissen müssen: Es war nicht der Augenblick, eine solche Frage zu stellen! Ich habe gar nicht die Zeit, dem nun zu erwartenden Monolog zu folgen.
Er kommt natürlich trotzdem.
„Ah, garum ...“
Er zieht tief Luft ein und hält seine Nase schmatzend in die Luft, als könne er den Geschmack aus der Erinnerung herbeirufen:
„Diese köstliche Würzsoße für salzige und süße Speisen! Man hat es damals etwa in der Häufigkeit verwendet, wie heutzutage Sojasauce in der asiatischen Küche, sai14. Man konnte sehr feines, edles garum kaufen und das billigere, das eher für die Massen bestimmt war. So, wie heute Balsamico, verstehst du?“
Wiederholt wirft er mir einen prüfenden Blick zu, ob ich seinen Ausführungen auch mit dem nötigen Respekt folge. Er läuft um mich herum, positioniert sich vor mir und spricht mir direkt ins Gesicht.
„Wie Balsamico! Da gibt es auch den richtigen, cremig alten und den billigen, der es gar nicht Wert ist, dass man ihn so nennt. Industrieller Lug und Trug, sage ich da nur! Man sollte das Zeug boykottieren! Però15: Italien hängt vom Export seiner besonderen Lebensmittel zu sehr ab! Moderne Zeiten, ich sag es immer wieder ...“
Er umkreist mich nachdenklich: „... wo war ich stehen geblieben? .... Ach ja, es gab ganze Manufakturen, die sich nur der Herstellung dieses edlen Gewürzes widmeten. Ein sehr wertvolles Handelsgut. Dein Freund Norio sollte das auf keinen Fall in seinem Buch unterbewerten, nur weil man es heute nicht mehr kennt. Es durfte in keiner Küche fehlen, jeder Koch, der etwas auf sich hielt ...“
„Es tut mir leid“, falle ich ihm ins Wort. „Ich muss los! Erzähl mir das bitte ein anderes Mal. Es interessiert mich wirklich. Das klingt köstlich.“
Er brummt unwirsch.
Ich weiß, dass er es hasst, wenn man seine historischen Verbal-Ausflüge in die Antike so abrupt unterbricht.
„Und noch etwas: Kannst du heute Nacht ausnahmsweise bei Maurizio übernachten?“, frage ich vorsichtig. „Marco hat doch noch keine eigene Wohnung und wird erst mal hierbleiben und wir haben uns doch so lange nicht gesehen.“
„Erst darf ich dem Schriftsteller nicht mehr helfen und nun werde ich schon aus dem eigenen Besitz vertrieben!“
Er mault so übertrieben, dass ich das leichte Schmunzeln in seinem Schnurrhaar sogar trotz meiner Aufregung wahrnehme. Ich weiß, dass ihm meine Beziehung am Herzen liegt und er seinen kleinen Beitrag zur Harmonie in derselben leisten wird.
„Danke!“
Ich tätschle leicht seine Pfote.
„Außerdem würde sich Maurizio freuen, wenn du dich mal wieder sehen lässt. Früher hast du doch auch immer auf seiner Couch geschlafen. “
„Bei Jupiter! Das Leben an deiner Seite ist wahrlich nicht immer einfach“, ruft er mir hinterher, als ich schon mit geschulterter Handtasche durch die Tür enteile. Und im Ton einer ständig meckernden, jedoch liebenden Mutter ruft er mir hinterher: „Aber verschwinde schon! Lass ihn nicht warten!“
Viel leiser höre ich ihn gerade noch eine angefügte, letzte Bemerkung murmeln: „Ich werde mir etwas einfallen lassen.“
Dieser letzte Satz sollte mich aufgrund meiner Erfahrung mit meinem Hausgeist sofort umkehren lassen und der Sache auf den Grund gehen. Aber nun habe ich wirklich keine Zeit mehr. Außerdem fegt meine Freude über das nahende Wiedersehen mit meinem Carabiniere keimende Bedenken einfach hinweg.
Ich fliege förmlich über die Stufen der alten, ausgetretenen Steintreppe hinunter, stülpe mir meinen visierlosen Helm über mein zuvor sorgfältig drapiertes Haar und schwinge mich auf die Vespa.
Nie habe ich mich der italienischen Kultur so nahe gefühlt!
1 Wörtlich: ich erlaube mir; wird bei Eintreten in eine Wohnung, selbst nach Aufforderung erwidert
2 dem Außenministerium untergeordnete Polizeitruppe in Italien
3 in Indien sowie einigen weiteren asiatischen Ländern eine unter Hindus verbreitete Grußformel und Grußgeste
4 aneinandergelegte Handflächen vor dem Brustkorb hin- und hergeschaukelt bedeutet in Italien sinngemäß: kann man es fassen!?
5 schon (wird häufig als Füllwort verwendet)
6 Wichtige römische Handelsstraße von heute Rimini nach Piacenza. Die Straßen existieren heute noch: Die Via Emilia zieht sich durch Bologna und ist heute eine moderne Bundesstraße; die Via Francigena ist ein Pilgerweg, teilweise noch im Urzustand des römischen Pflasters zu begehen.
7 Flache Mürbteig Torte
8 Wird später durch Massimiliano erklärt
9 Antike römische Religion: Private Schutzgötter eines römischen Haushalts. Zusammen mit anderen Göttern schützen sie die Familie. Sie sind für den Herd und die Vorratskammer zuständig, sorgen dafür, dass nachts die Ratten nicht an die Speisevorräte gehen und dass ein Koch angeregt wird, etwas Schmackhaftes zu kochen. Penaten waren nach der römischen Religion die Seelen verstorbener Vorfahren und somit an ihre Familie gebunden, sogar bei Umzug. Sie treten in der Regel zu zweit oder zu dritt auf, teilten ihre Zuständigkeit zwischen Herd, Essen und den Getränken. Der Herd ist ihr Altar.
10 Im Gegenteil
11 Guglielmo Marconi (1874 Bologna – 1937 Rom), italienischer Radiopionier, 1909 Nobelpreis für Physik für Funktelegrafie gemeinsam mit Ferdinand Braun.
12 Thomas Alva Edison (1847 - 1931) US Erfinder Elektrizität, Elektrotechnik, elektrisches Licht, Telekommunikation, Medien für Ton und Bild.
13 Ehe (1780) mit Prinz Astorre Hercolani, alte italienische Adelsfamilie
14 weißt du
15 jedoch, aber
2. Marconi
Bolognas Flughafen präsentiert sich in gewohnter Dauerbaustelle, gehüllt in enge Passagen, Bauzäune und transportable Betonklötze als Fahrbahnbegrenzung. Wer glaubt, sich an diesem Ort jemals Orientierung verschafft zu haben, der irrt. Der Airport ist nicht groß, aber erfindungsreich. Er macht seinem Namen ‚Marconi’ in diesem Punkt alle Ehre. Besser gesagt: Unehre, denn er hat immer eine Überraschung parat und man tut gut daran, die Zeit dafür einzukalkulieren.
Doch das Unvorhergesehene ist diesmal nicht zeit- sondern nervenraubend und hätte, bei näherer Betrachtung meiner Erfahrungen in dieser Stadt, auch vorhersehbar sein können.
Nachdem ich mein Äußeres auf der Damentoilette in Eile wieder in einen halbwegs annehmbaren Zustand versetzt habe – meine blonden Haare standen mit Abnehmen des Helms elektrifiziert in die Luft, wie bei einer vom Blitz getroffenen Wetterhexe (Edison hätte seine wahre Freude daran gehabt) – stehe ich nun seit über vierzig Minuten zwischen wartenden Menschen. Einige davon halten abgebrüht wie lebende Litfaßsäulen Schilder vor der Brust. Sie machen routiniert gelangweilte Gesichter, während ich mit jeder verstreichenden Sekunde zusehends zu einem Nervenbündel mutiere.
Meine innere Vorfreude auf dieses Wiedersehen wandelt sich in diesen unbeweglichen Minuten von flatternden Insekten in der Bauchgegend zu surrenden Stromstößen, die durch meine Venen zu jagen scheinen.
Jedes Mal, wenn sich die milchige Schiebetür wie durch Geisterhand auseinanderschiebt und ein neuer Fluggast durch sie hindurch auf die Front der Wartenden zutritt, setzt mein Herzschlag einen Moment aus. Seit dem Abschied von meinem Carabiniere, vor genau drei Monaten, hat dieses Herz schließlich täglich gebangt, er möge gesund aus dem Krisengebiet zurückkehren. Gleichwohl Marco mir in unseren Video-Gesprächen immer wieder versichert hatte, dass er in völliger Abgeschiedenheit eine äußerst langweilige Verwaltungstätigkeit ausüben musste, hielt mich die Angst vor einem Anschlag neunzig lange Tage gefangen.
Endlich scheinen die Koffer der Maschine aus Rom auf dem Gepäckband zu laufen, denn nun strömen immer mehr Passagiere durch den engen Durchgang, den die Wartenden bilden.
Links und rechts zu meinen Seiten fallen sich Familien um den Hals, jaulen Kinder vor Freude über ein Mitbringsel und aufgeregte Flugreisende übertönen mit penetranten Urlaubseindrücken die Lautsprecherdurchsagen über unseren Köpfen. Vereinzelt schlängeln sich mit kleinem Gepäck behaftete Geschäftsleute schweigend durch diese Anhäufung. Ich stehe wie ein Fels im Strom. Jeden Augenblick erwarte ich, das geliebte Gesicht unter den Ankommenden zu entdecken.
Doch es taucht nicht auf.
Nach weiteren zehn Minuten verringert sich die Dichte der Eintreffenden und es tröpfeln nur noch vereinzelte Personen aus dem Korridor der Gepäckhalle.
Ich prüfe mein Mobiltelefon auf Nachrichten, aber es hüllt sich in Schweigen wie ein Mönch während des Gebets. Die beinahe elektrische Ladung in meinem Inneren verwirbelt zu einem Knoten im Hals.
Der Tumult um mich herum löst sich schon nach und nach auf. Wenn bloß nichts in letzter Minute passiert ist!
Ich bin hin- und hergerissen zwischen dem Bedürfnis, am Informationsschalter Auskunft über den Verbleib meines kostbaren Passagiers zu erfragen und der Notwendigkeit, noch die Stellung für den Fall zu halten, dass diese vermaledeite Schiebetür ihn doch noch herausgibt.
Es siegt der Drang nach Gewissheit.
„Die Maschine ist pünktlich gelandet“, bestätigt mir die herausgeputzte Hostess hinter dem Tresen und wendet sich mit dieser Antwort sofort wieder ihren Kolleginnen zu. Dieses Gespräch hat für sie unmissverständlich Vorrang.
„Das weiß ich“, unterbreche ich ihr Unterfangen ungeduldig.
Ich schiebe ihr einen Zettel mit Marcos vollständigem Namen und Flugnummer hin: „Können Sie bitte nachsehen, ob dieser Passagier eingecheckt hat?“
„Da müssen Sie am Schalter der Fluggesellschaft fragen!“, wirft sie mir trocken wie Vogelfutter hin. Mit einem abschließenden Wink des Kopfes schickt sie mich auf die andere Seite der Halle, an eine Stelle in meinem Rücken.
Ich fühle mich mit meinem Anliegen alles andere als ernst genommen und dadurch zu einer Art Verteidigung animiert.
Ganz neu sind mir unhöfliche Antworten dieser Art allerdings nicht. Die Einstellung zu Dienstleistung in der roten Stadt16, wie Bologna genannt wird, ist sprichwörtlich: Man scheint stets bemüht, dem Kunden unumwunden beinahe körperlich spüren zu lassen, welche bedingungslos zu hofierende ‚Leistung’ alleine hinter dem Wort ‚Dienst’ steckt.
Trotzdem drehe ich mich auf der Suche nach dem angewiesenen Schalter noch kommentarlos um.
Dann wende ich mich wieder der Hostess zu: „Der Platz ist nicht besetzt.“
Diese dritte Unterbrechung ihres Privatgespräches bringt sie sichtbar an die Grenzen ihrer Geduld. Sie war gerade dabei ihrer Kollegin die Adresse einer Kosmetikerin aufzuschreiben.
Sie zieht hörbar Luft durch die Nase ein und presst zwischen schmalen Lippen den Hinweis hervor, dass ich in die Abflughalle gehen muss. Dies sei die Ankunftshalle. Da man hier aus- und nicht einchecke, ergäbe es wenig Sinn, hier einen Schalter zu besetzen.
Da ich weder Lust habe mit ihr zu streiten, noch ans andere Ende des Flughafens zu laufen - denn dort würde ich Marco auf jeden Fall verpassen - stehe ich einen Moment ratlos da.
Grund genug für sie, mir ein „cos’altro?17“ hinzuspucken.
„Oouh!“, hebe ich zynisch abwehrend die Hand.
Das habe ich von Marco gelernt. Der langgezogene, betonte Buchstabe kann in Italien sehr vielseitig - und vor allen Dingen - relativ unverbindlich eingesetzt werden. Er erspart in vielen Situationen die „Jetzt ist aber gut! Mal langsam! Es reicht aber! Vorsicht! Ein bisschen mehr Respekt!“-etcetera-etcetera-Antwort.
Der Gesichtsausdruck der erbarmungslosen Auskunftsdame auf meine italienische Ein-Buchstaben-Reaktion hin ist jedoch überraschend freundlich. Sie wechselt plötzlich die Tonart wie ein Chamäleon die Farbe: „Desidera18?“
Diese überaus freundliche Frage zielt aber auf den nächsten Kunden hinter mir, das eindeutige Signal des Endes dieser lästigen Konversation mit mir.
„Amore!“
Die Stimme lässt mich erschaudern.
Ich wirble herum und blicke auf meinen adretten Carabiniere, der groß und braungebrannt mit weit ausgebreiteten Armen lächelnd hinter mir steht.
„Marco!“
Ich falle ihm in die Arme und bedecke sein Gesicht mit einem Meteoritenhagel an Küssen.
Nicht nur steht er nach dieser Zeit des Bangens gesund und munter vor mir, er sieht auch noch so blendend aus, als käme er gerade von einem Wellnessaufenthalt zurück!
Er schlingt seine Arme um mich und wirbelt mich einmal um seine Achse. Es folgt ein endloser Supernovakuss der Ekstase.
Dann sehen wir uns lange, schweigend und lächelnd in die Augen.
„Come stai19?“
Wir flüstern es beide gleichzeitig.
Die zickige Hostess, die uns ungeniert beobachtet, kommentiert die Szene flüsternd zu ihren Kolleginnen.
„Stai bene?”, wiederholt Marco seine Frage in anderer Form, als sei ich diejenige, die unversehens über Weihnachten für zwölf Wochen in ein Krisengebiet abkommandiert worden war.
Er streicht mir sanft übers Haar und haucht einen Kuss hinein. Seine blauen Augen leuchten aus seinem sonnengegerbten Gesicht wie ein klarer Gebirgssee im Morgengrauen.
„Du hast mir so gefehlt!“, wispert er mit einem tiefen Seufzer, der mich mit aller Wucht ins Herz trifft. Ich kann es spüren, als hätte er die aufgestauten Emotionen aus dem Land von der anderen Seite des Mittelmeers mir direkt übertragen.
Ich beiße mir auf die Unterlippe und nicke ihn nur schweigend an. Meine eigenen Ängste um ihn, aus der sicheren Zivilisation heraus, erscheinen mir plötzlich eine so viel geringere Bürde als das, was er in der Wüste alleine vermutlich ertragen musste.
Tränen der Erleichterung füllen meine Augen.
Völlig überwältigt von den intensiven Gefühlen, die sich in diesem Moment der Zusammenkunft kristallisieren, bin ich unfähig etwas zu sagen.
Er küsst mich auf beide Augen und wischt mir die Nässe auf meinen Wangen liebevoll mit der Hand trocken. An seinem Hals funkelt das goldene Medaillon aus der Antike, das Massimiliano ihm zum Schutz mitgegeben hat.
‚Er wird gesund wiederkommen! Er trägt das Medaillon!’, hatte mir der Kater in der Silvesternacht mit felsenfester Sicherheit versprochen.
„Ich habe es immer getragen“, versichert mir Marco, der meinem Blick auf das Objekt folgt. Dann schmunzelt er verschmitzt: „Es hat wirklich hervorragend geholfen: Ich habe mich in meinem Leben noch nie so gelangweilt!“
„Meno male!20“, lächele nun auch ich wieder. „Lieber Langeweile als Geschützhagel!“
„Ja“, erwidert er nur.
„Lass uns gehen!“, versuche ich dann mit einem tiefen Atemzug, mich wieder einzufangen. „Ich hatte schon befürchtet, dass irgendetwas passiert ist, weil du so lange nicht herausgekommen bist!“
„Du weißt doch, wie das mit dem Gepäck hier am Flughafen ist!“, legt Marco lachend den Arm um mich, schultert seinen schwarzen Seesack und zieht mich mit sich. „Con calma!21 Mein Sack war das letzte Gepäckstück auf dem Band. Ich konnte dir leider keine Nachricht schicken. Der Akku meines Telefons ist leer.“
Das hätte ich mir freilich auch denken können.
„Du hast dir eine Vespa zugelegt?! Che bello!“, kommentiert mein Freund kurz darauf den Anblick meines geparkten Fahrzeuges.
„Zu einem italienischen Sommer gehört das einfach!“, behaupte ich freudestrahlend. Ich reiche ihm seinen Motorradhelm: „Willst du fahren?“
Und so kurven wir mit dem Seesack auf dem Trittbrett vor uns, eng aneinandergeschmiegt, wie das Sinnbild der italienischen Nation, überglücklich durch die sonnige Frühlingsluft. Unter einem rosig erscheinenden Geigenhimmel kreisen wir entlang der mittelalterlichen Stadtmauer durch schattige Baumalleen, tauchen an einer der porta22 durch die engen Straßen in den orangeroten Altstadtkern und schließlich entlang endloser Rundbogenarkaden links und rechts der Fahrt unserem kleinen Liebesnest entgegen.
Hand in Hand stürmen wir, zwei Stufen auf einmal nehmend, meiner Wohnung entgegen.
Die Leidenschaft wird an der Stätte unserer Sehnsüchte jedoch jäh gebremst. Angewidert bleiben wir auf den Stufen zu meinen vier Wänden stehen.
„Was ist denn das für ein fieser Geruch?!“, entsetze ich mich.
„Nicht einmal in den Slums von Tripolis hat es so gestunken!“, bestätigt Marco meinen Ekel.
„Du warst in Slums?“
Für den Moment eines Wimpernschlags zuckt ein Schatten über seine Augen.
„Auch. Einmal“, bestätigt er dann nur, wischt mit einer Handbewegung die Frage beiseite und rümpft wieder heftig die Nase.
Ein fauliger Geruch undefinierbarer Herkunft sitzt wie eine modrige Wolke im Treppenhaus.
„Ich kann mir das nicht erklären?“, sage ich zu Marco, ziehe ihn langsam weiter nach oben zu meiner Haustür, in meiner Tasche nach dem Schlüssel kramend. „Wo kommt denn das auf einmal her?“
Beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen, warum die Steuerberaterin im Stock über mir derart schlechte Luft verbreiten sollte. Aber außer uns residiert sonst niemand in diesem renovierten Altbau?
Die Irritation hält uns aber nicht lange auf.
Kaum springen der Eingang zu meinem kleinen Studio auf und wir in die saubere Luft meiner vier Wände, haben wir den Vorfall auch schon vergessen.
Mit einem Schubs kicken wir die Tür ins Schloss, die Schuhe von den Füssen, bilden einen Pfad aus verlorenen Kleidungsstücken zum Bett und lassen uns in die Kissen fallen, ohne auch nur einmal unsere ungestüme Umarmung unterbrochen zu haben.
Ewigkeiten später betrachten wir selig schweigend die Schatten an der Zimmerdecke, die das schwache Mondlicht dort hinmalt. Es ist bereits weit nach Mitternacht.
Eine entzückende Müdigkeit lullt mich ein.
Morgen ist mein sechsunddreißigster Geburtstag. Ein schöneres Geschenk als dieses Wiedersehen könnte ich mir nicht vorstellen!
Ein Lächeln breitet sich unversehens über mein Gesicht, wie ich mir diese wundervollen kommenden Stunden mit ihm erträume.
Ein ganzer Tag Freiheit: In sonniger Frühlingsluft, verliebt durch die altehrwürdige Stadt bummeln, in meiner Lieblingseisdiele biologisches Eis aus reiner, dunkler Bitterschokolade schlecken, unter den Schirmen des berühmten Kultcafés aus den Siebzigern an der Piazza Galvani einen zweiten Cappuccino genießen, dann nach einem ausgiebigen pranzo23 in einem der zahlreichen typischen Bologneser Restaurants, die 3,7 kilometerlange Treppenreihe zum Wahrzeichen der Stadt San Luca24 langsam hinaufzusteigen. Von dort werden wir über die grünen Hügel hinter der Stadt, Arm in Arm in die Apenninen und unsere gemeinsame Zukunft träumen.
Mit der Vorfreude eines Kleinkindes auf das Christkind kuschle mich in seinen Arm und schließe mit einem geflüsterten „Buona notte!“ die Augen.
Er brummt etwas Ähnliches kaum noch vernehmbar zurück.
Der schrille Klingelton seines Telefons reißt uns in voller Lautstärke aus dem Dahindämmern.
Blind tastet er nach dem Gerät und knurrt missmutig nicht einmal ein „pronto“, sondern nur ein genervtes „si“ in den Apparat.
Dann fährt er ruckartig im Bett auf und ich gleite unsanft aus seinem Arm:
„Cosa?! Ma come?! Adesso?!“25
16 Bologna wird aus zwei Gründen „Die rote Stadt“ genannt: Einmal, weil erdfarbene und rote Töne das Stadtbild prägen, doch auch, weil sie das Zentrum der einst kommunistischen Partei war. Noch heute gilt die Stadt als die am weitesten politisch links orientierte Metropole Italiens.
17 In diesem Fall: Was denn noch?
18 Sie wünschen?
19 wie geht es dir?
20 Umso besser
21 Mit der Ruhe! In aller Ruhe!
22 Alte Stadttore, die entlang des heutigen Straßenrings Kreuzungen schmücken, die die Altstadt mit neueren Vierteln außerhalb der Mauer verbinden.
23 Mittagessen
24 Die nachts beleuchtete Rundkuppel der Basilika ist von Weitem als Wahrzeichen Bolognas sichtbar, wenn man sich der Stadt von Norden und Osten nähert.
25 Was? Aber wie das denn? Jetzt?
3. Geburtstag
Marco jagt meine Vespa durch die nächtlichen Straßen Bolognas, als wäre der Teufel hinter uns her.
Ich klammere mich verzweifelt an ihn, um nicht von meinem Soziositz zu kippen, wenn wir wieder einmal eine scharfe Kurve nehmen.
Ich kann sein verkehrswidriges Fahrverhalten nicht fassen! Auf unserem Weg entlang der, wie leergefegten Verkehrsadern der Stadt, überfahren wir zwei rote Ampeln, tauchen in entgegengesetzter Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße und überqueren knatternd eine für sämtliche Fahrzeuge gesperrte piazza. Allein an einer Stelle drosselt er spürbar das Tempo. Jedoch gerade so lange, bis wir an dem fest installieren autovelox fisso, das gut sichtbar, mit einem Blinklicht versehen, als oranger Kasten am Straßenrand steht, vorüber sind. Gott sei Dank ist es in Italien Gesetz, die fest installierten Blitzer so deutlich zu kennzeichnen, dass sie auch Nicht-Ortskundige sofort als solche erkennen. Sonst würde mir die wilde Fahrt vermutlich eine ausstellungsreife Sammlung an Strafzetteln ins Haus flattern lassen.
Als Marco wieder mit Vollgas beschleunigt, macht meine Vespa einen Satz und der Motor hustet ein paar Meter vor sich hin.
„Che due palle!26“, höre ich gedämpft durch meinen Helm von vorne. Er geht etwas vom Gas und versucht es nochmals sachter. Das scheint meinen geschundenen Hobel zu überzeugen. Er trägt uns den restlichen Weg zuverlässig ans Ziel.
Vor dem Krankenhaus Sant’Orsola stürmt Marco in Richtung des Eingangs und ruft mir nur noch ein kurzes „Parke du und komm nach!“ zu. Dann verschwindet er in einer Tür.
Ich schiebe die Vespa in eine Ecke der Einfahrt, wo sie nicht im Weg ist, wuchte sie auf den Ständer und sichere sie mit einer kiloschweren Eisenkette, die ich stets im rückwärtigen Koffer dabeihabe. Der Einbruch in meine Wohnung kurz nach meiner Ankunft in dieser Stadt hat mich vorsichtig gemacht.
Als ich schließlich ebenfalls in den durch gleißendes Neonlicht illuminierten Gang trete, sehe ich gerade, wie eine Krankenschwester Marco eine grüne Schürze überzieht, ihm eine Schutzbedeckung über den Kopf stülpt und ihn mit sich fortziehen will.
Eilig trete ich hinzu, um auch meine Anwesenheit bemerkbar zu machen.
„Gehören Sie dazu?“, fragt sie mich verwundert.
„Si“, behaupte ich und nicke überzeugend.
„Sind Sie die Schwester?“
„Äh, no. Ich bin ...“
„... mia fidanzata!“,27 fällt mir Marco ins Wort.
Die Frau sieht ihn einen Moment verwirrt an, kraust kurz die Stirn, zuckt dann die Achseln, zieht ihn mit sich fort und wirft mir zu: „Tut mir leid. Sie müssen hier warten!“
Wieder verschwindet Marco hinter einer Tür.
Ein schriller Schmerzensschrei dringt aus dem Saal dahinter.
Ich stehe da, wie bestellt und nicht abgeholt.
Unbeholfen sehe ich um mich.
Obwohl es draußen erst zu dämmern beginnt, herrscht bereits erhebliches Kommen und Gehen.
Ich trete zur Seite. Ein Pfleger schiebt eine Metallliege mit einem Patienten an mir vorüber in einen geschützten Bereich und zieht den Vorhang hinter diesem zu.
Der digitale Zeitanzeiger über meinem Kopf verrät die frühe Stunde. Sie fühlt sich nächtlicher an, als sie ist: Es ist beinahe sechs Uhr.
Vielleicht hat die Caffetteria des Krankenhauses schon geöffnet?
Sie hat.
Eine Schlange anderer übermüdeter Krankenhausangestellter und Besucher - vermutlich wie ich als nicht familienzugehörig verbannt – steht an der Kasse an. Einer nach dem anderen versucht zu bestellen und zu bezahlen. Währenddessen langweilen sich drei Serviermädchen hinter der Theke, weil irgendeine Bankkarte nicht funktioniert, der Kunde kein Bargeld hat und niemand vorrücken kann.
Kurz entschlossen versuche ich direkt bei einer der gelangweilten Kellnerinnen mit einer Bestellung für einen Cappuccino und ein Hörnchen, den vorgegebenen Ablauf pragmatisch umzukehren.
„Sie müssen zuerst bezahlen!“, weisen sie mich sofort dreistimmig in perfektem Einklang an, als hätten sie es einstudiert. Unter dem Druck dieser Überzahl geselle ich mich wieder an das Ende der Schlange, die sich inzwischen um ein weiteres Glied verlängert hat.
Es dauert geschlagene zwanzig Minuten, bis ich endlich in mein brioche beißen kann, das zu allem Überfluss auch noch dick mit Schokolade befüllt, überzuckert und aus Weißmehl hergestellt ist. Das letzte, einfache Vollkornhörnchen schnappte sich die Dame vor mir, die während meines Versuches, das System zu umgehen, meinen Platz eingenommen hatte.
Ich seufze.
So habe ich mir meinen Geburtstagmorgen nicht vorgestellt!
Zwar habe ich in den letzten Monaten immer die Grundbefürchtung gehegt, dass die Situation mit meinem Traummann als werdender Vater alles andere als einfach werden würde, aber dass das Kind ausgerechnet an diesem Tag zur Welt kommen sollte, das habe ich mir selbst in meinen apokalyptischsten Vorstellungen nicht träumen lassen!
Das fängt ja gut an: Kaum eine rauschende Liebesnacht und schon wird mir der Mann wieder entrissen! Ich seufze noch heftiger und löffle nachdenklich den Milchschaum meines Kaffees.
Freilich bin ich bereit, alles zu tun, um Marco in seiner delikaten Rolle in dieser merkwürdigen Konstellation zu unterstützen. Alles andere wäre schlichtweg dumm von mir und würde unsere Beziehung von Beginn an unmöglich machen. Schließlich hat er sich vor seiner Abreise vor drei Monaten deutlich zu mir bekannt.
Aber er hat auch die Verantwortung für das erwartete Baby übernommen. Deshalb habe ich ihn auch mit meiner Vespa ins Krankenhaus begleitet, als er mir in Panik eröffnete, dass das bambino unterwegs sei. Da seine ehemalige Freundin sonst niemand in der Stadt kennt und auch keine Familie mehr hat, wollte er seinem Kind als Vater zumindest beistehen, damit es nicht völlig alleine auf diese Welt kommt.
Die Frage, was ich hier nun allerdings soll, wird mir mit diesem Gedanken erst richtig bewusst. Ich verdränge das scheußliche Gefühl, überflüssig zu sein.
Es wird das Beste sein, wenn ich nach Hause fahre.
In einem Zug kippe ich den Rest des Kaffees hinunter und stelle Tasse und Teller zurück auf den Tresen der Bar.
„So früh schon auf den Beinen?“, begrüßt mich eine Stimme hinter mir und nimmt über meinen Kopf hinweg ein in Papier gewickeltes Hörnchen entgegen.
Max, mein blonder Freund, Nachbar, Arzt und Landsmann lacht mich unerträglich gut gelaunt an.
„Es ist so weit“, antworte ich nur.
Mein Gegenüber nickt verständnisvoll: „Ah, das Kind.“
Er nimmt noch eine Espressotasse entgegen und geht damit an einen Stehtisch.
Ich folge ihm.
Drei Monate lang habe ich meine Freunde mit dem Thema genervt. Immer wieder haben wir sämtliche Wenn-und-Aber in dieser herausfordernden Situation beleuchtet. Wirklich geholfen hat es mir wenig. Außer ständige Anregungen zur Selbstreflexion und Ermahnungen zu Geduld, haben mir diese Gespräche wenig Erleichterung gebracht.
„Und du? Wieso bist du hier?“, frage ich deshalb, um davon abzulenken.
„Ich habe in einer Stunde auch eine Entbindung“, meint Max und kippt seinen Espresso hinunter.
„Du bist doch gar kein Frauenarzt?“
„Eine Patientin von mir will mich unbedingt als Vertrauensarzt dabeihaben“, erklärt er und packt sein Hörnchen raschelnd aus der Tüte. Er wirft einen Blick auf die Papiertüte und zerknüllt sie dann: „Wieso packen sie bloß ein Hörnchen für den kurzen Weg von der Theke zu diesem Tischchen in eine Tüte? Verschwendung.“
Er zielt auf den Abfalleimer an der Wand und wirft den Papierball wie den alles entscheidenden Korb in einem Basketballspiel direkt hinein.
„Und das weißt du jetzt schon? Die Geburt kann man so genau planen?“, wundere ich mich, seine sportliche Leistung mit einem Nicken anerkennend.
„Einen Kaiserschnitt schon“, erklärt er. „Dafür entscheiden sich heute viele Frauen, weil sie sich und ihrem Kind das Geburtstrauma ersparen wollen. Die Meinungen darüber sind geteilt: Manche sagen, die natürliche Geburt mache Kinder resistenter.“
Er unterbricht seine Erläuterung. Vermutlich deshalb, weil ihn mein Gesichtsausdruck daran erinnert, dass dies für mich in dieser Lage alles andere als einfach zu verdauende Kost ist.
„Fahr nach Hause, Lisa. Du kannst hier jetzt sowieso nichts dazu beitragen. Wenn das eine natürliche Geburt ist, kann es noch Stunden dauern.“
„Genau das werde ich auch tun!“, bekräftige ich meine Absicht und verabschiede mich von meinem Freund.
Doch meine entschlossene Haltung scheitert am Widerwillen meiner Vespa. Sie weigert sich, überhaupt noch ein Lebenszeichen von sich zu geben.
Nach mehreren vergeblichen Versuchen, den Motor selbst durch Anschieben zu starten, rufe ich den Händler an, der mir das Fahrzeug verkauft hat. Ich erreiche nur die Werkstatt, die früher mit der Arbeit beginnt, als die Verkäufer. Der Mann verspricht in zehn Minuten mit einem Schlepper an Ort und Stelle zu sein.
Fünfzig Minuten später biegt tatsächlich ein blinkender Abschleppwagen um die Ecke und versperrt die Einfahrt zur Notaufnahme. Der Mechaniker wischt meinen Hinweis auf diese Tatsache mit einem „solo due minuti“28
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: