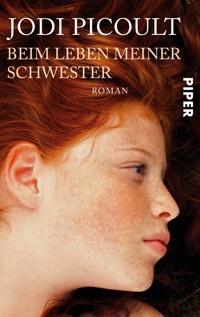4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Baumhaus
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Märchenhaft. Romantisch. Emotional. Eine Young-Adult-Geschichte von Bestseller-Autori
- Sprache: Deutsch
"Hilf mir" - Delilah kann es kaum fassen, als sie diese Nachricht in ihrem Lieblingsbuch findet. Offensichtlich hat Oliver, der umwerfend gut aussehende Prinz der Geschichte, die Bitte speziell für sie hinterlassen. Und tatsächlich: Schnell stellen die beiden fest, dass sie über die Grenzen der Buchseiten hinweg miteinander sprechen können. Doch das reicht ihnen schon bald nicht mehr aus. Oliver ist schon lange genervt von seinem Märchen, das er immer wieder durchspielen muss, sobald ein Leser das Buch aufschlägt. Und er findet Gefallen an Delilah, die so anders ist als die langweilige Prinzessin Seraphima, die er sonst immer küssen muss. Da ist es doch klar, dass er endlich zu ihr will! Und Delilah: Die hat sich längst Hals über Kopf in ihren Märchenprinzen verliebt. Und ist begeistert von der Idee, Oliver aus dem Buch herauszuholen. Doch wie können die beiden es schaffen, die Grenzen zwischen ihren so unterschiedlichen Welten zu überwinden?
Zusammen mit ihrer Tochter Samantha hat die bekannte Bestseller-Autorin Jodi Picoult einen wunderschönen Liebesroman geschrieben - mitreißend, märchenhaft, unwiderstehlich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhalt
Titel
Impressum
Widmung
Eine Anmerkung von Jodi Picoult
Wie alles begann
Oliver
Delilah
Seite 11
Oliver
Delilah
Seite 27
Oliver
Delilah
Seite 31
Oliver
Delilah
Seite 32
Oliver
Delilah
Seite 37
Oliver
Delilah
Seite 40
Oliver
Delilah
Seite 44
Oliver
Delilah
Seite 52
Oliver
Delilah
Seite 58
Oliver
Delilah
Seite 60
Oliver
Danksagung
Jodi Picoult Samantha van Leer
Mein Herz zwischen den Zeilen
Aus dem amerikanischen Englisch von Christa Prummer-Lehmair und Katharina Förs
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Die englischsprachige Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel
»Between the lines« bei Simon Pulse/Emily Bestler Books/Atria Books
im Verlag Simon & Schuster, Inc., New York.
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2012 by Jodi Picoult and Samantha van Leer
Vierfarbige Innenillustrationen: © 2012 by Yvonne Gilbert
Schwarz-weiß Innenillustrationen: © 2012 by Scott M. Fischer
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2013 by Boje Verlag in der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, Köln
Textredaktion: Susanne Klein, Hamburg
Umschlaggestaltung: Sandra Taufer, München
Umschlagmotiv: © murielbuzz /shutterstock; Oleg Gekman /shutterstock; tetyana radchenko /shutterstock
Innenillustrationen: Yvonne Gilbert und Scott M. Fischer
E-Book-Produktion: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-838-74595-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Ema,
die immer die Heldin
meiner Geschichte sein wird.
In Liebe,
Sammy
Für Tim,
weil Märchen manchmal
wirklich wahr werden.
In Liebe,
Jodi
Eine Anmerkung von Jodi Picoult
Ich war gerade auf Lesereise in Los Angeles, als mein Telefon klingelte. »Mom«, sagte meine Tochter Sammy, »ich glaube, ich habe eine ziemlich gute Idee für ein Buch.«
Das war nicht ungewöhnlich. Von meinen drei Kindern hatte Sammy schon immer die lebhafteste Fantasie. Während andere Kinder einfach nur mit ihren Stofftieren spielten, verteilte Sammy ihre im ganzen Haus und inszenierte ausgefeilte Szenarien – der Teddy steckt verletzt auf dem Mount Everest fest, und ein Rettungshund muss hinaufklettern, um ihn zu retten. In der zweiten Klasse bat mich ihr Lehrer, Sammys Kurzgeschichte abzutippen. Sie war vierzig Seiten lang. Als meine Tochter damit nach Hause kam, erwartete ich eine weitschweifige Ansammlung von Wörtern, doch ich bekam eine stimmige Geschichte über eine Ente und einen Fisch, die sich in einem Teich kennenlernen und beste Freunde werden. Die Ente lädt den Fisch zum Abendessen ein und der Fisch nimmt die Einladung gerne an. Aber dann kommen ihm Zweifel: Und wenn ich nun das Abendessen bin?
Das, verehrte Leser, nennt man in der Literaturwissenschaft »einen Konflikt erschaffen«, und es ist das Einzige, das einem niemand beibringen kann. Entweder liegt einem das Geschichtenerzählen im Blut oder eben nicht, und meine Tochter schien bereits im Alter von sieben Jahren ein angeborenes Gespür dafür zu haben, wie man literarische Spannung aufbaut. Sammys Kreativität trug immer reichere Blüten, je älter sie wurde. Ihre Albträume sind so lebhaft, dass sie es mit Storys von Stephen King aufnehmen könnten. Schon jetzt als Teenager schreibt sie Gedichte, die mich dazu gebracht haben, meine eigenen Poesiehefte aus der Jugend hervorzukramen, nur um festzustellen, dass sie sehr viel weiter ist als ich im selben Alter.
Und darum habe ich gleich aufgehorcht, als Sammy mir erzählte, sie habe eine interessante Idee für ein Jugendbuch.
Und wissen Sie, was? Sie hatte recht.
Was wäre eigentlich, wenn die Charaktere in einem Buch ein Eigenleben hätten, nachdem der Buchdeckel zugeklappt wurde? Wenn der Akt des Lesens nur bedeuten würde, dass die Figuren immer wieder das gleiche Stück aufführen … und diese Schauspieler aber Träume, Hoffnungen, Wünsche und Sehnsüchte jenseits der Rollen haben, die sie tagtäglich für den Leser spielen? Und wenn gar einer der Charaktere das Buch unbedingt verlassen wollte?
Besser noch, wenn sich eine Leserin in ihn verlieben und beschließen würde, ihm zu helfen?
»Mom«, sagte Sammy, während ich mich durch den Verkehr von Los Angeles quälte. »Wie wäre es, wenn wir das Buch gemeinsam schreiben würden?«
»Okay«, sagte ich zu ihr, »aber das heißt, wir schreiben es. Nicht ich.«
Darauf folgten zwei Jahre, in denen wir abends, an den Wochenenden und in den Schulferien Seite an Seite an meinem Computer saßen und eifrig an der Geschichte bastelten. Ich glaube, Sammy war überrascht, was für ein hartes Stück Arbeit es bedeutet, stundenlang dazusitzen und seine Fantasie anzustrengen; ich wiederum habe gelernt, dass man die eigene Tochter bei strahlendem Sonnenschein leichter dazu bringt, ihr Zimmer aufzuräumen, als ein Kapitel abzuschließen. Wir haben uns beim Tippen abgewechselt und buchstäblich jeden Satz laut gelesen. Eine Zeile sagte ich, dann kam Sammy mit der nächsten. Am schönsten war es, wenn wir einander ins Wort fielen und feststellten, dass wir das Gleiche dachten – es war, als hätten wir denselben Traum und würden uns beim Schreiben telepathisch verständigen.
Manchmal, wenn ich ein tolles Buch lese, denke ich: »Wow, ich wünschte, ich hätte diese Handlung erfunden.« Ich fühlte mich richtig geehrt, dasselbe bei der Geschichte zu empfinden, die sich meine Tochter ausgedacht hat. Als Sammy mir das erste Mal von ihrer Idee erzählte, fand ich sie großartig. Ich hoffe, Ihnen geht es genauso, wenn Sie Mein Herz zwischen den Zeilen lesen.
Wie alles begann
Es war einmal in einem fernen Land, da lebten ein tapferer König und eine wunderschöne Königin, die liebten einander so sehr, dass die Menschen – wohin sie auch kamen – alles stehen und liegen ließen, nur um sie vorbeischreiten zu sehen. Bauersfrauen, die mit ihren Männern stritten, vergaßen auf einmal den Grund für den Streit; kleine Jungen, die im Begriff waren, kleinen Mädchen Spinnen in die Zöpfe zu setzen, versuchten stattdessen, einen Kuss von ihnen zu erhaschen; Maler brachen in Tränen aus, weil nichts von dem, was sie auf der Leinwand schufen, auch nur annähernd der reinen Liebe zwischen König Maurice und Königin Maureen ebenbürtig war. Es heißt, an jenem Tag, als der König und die Königin erfuhren, dass die Königin guter Hoffnung war, spannte sich ein Regenbogen über das Königreich, größer und schöner, als man je einen gesehen hatte. Es war, als wollte sogar noch der Himmel ein Jubelbanner schwenken.
Doch nicht alle freuten sich für den König und die Königin. In einer Höhle am äußersten Ende des Königreichs lebte ein Mann, der der Liebe abgeschworen hatte. Ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Vorzeiten hatte auch Rapscullio einmal gehofft, für ihn könnte ein Märchen wahr werden und es würde sich alles zu seinem Glück fügen – und zwar mit einem Mädchen, das über sein Narbengesicht und seine krummen Gliedmaßen hinweggesehen hatte und ihm mit Güte begegnet war, als er von aller Welt verachtet wurde. Immer wieder durchlebte er im Geiste den Tag, an dem er von seinen Schulkameraden grob in den Schmutz gestoßen worden war und sich ihm eine schlanke, weiße Hand entgegengestreckt hatte, um ihm aufzuhelfen. Wie hatte er sich an sie geklammert, an diesen Engel, seinen Rettungsanker! Tage hatte er damit zugebracht, ihr zu Ehren Gedichte zu ersinnen und Porträts von ihr zu malen, von denen keines ihrer Schönheit gerecht wurde. Und er hatte nur auf den richtigen Augenblick gewartet, um ihr seine Liebe zu gestehen. Doch dann fand er sie in den Armen eines Mannes, wie er nie einer sein konnte: eines hochgewachsenen, starken Mannes, zu Großem berufen. Rapscullio war daraufhin in noch tiefere Düsterkeit verfallen und hatte sich mehr denn je in seinem Hass vergraben. Das Bild seiner Geliebten war ausgeklügelten Racheplänen gegen jenen Mann gewichen, der sein Leben zerstört hatte: König Maurice.
Eines Nachts hob draußen vor den Toren des Königreichs ein Gebrüll an, wie man es noch nie vernommen hatte. Die Erde erbebte und ein Feuerstrahl schoss aus dem Himmel und setzte die Strohdächer des Dorfes in Brand. Als König Maurice und Königin Maureen vor das Schloss rannten, erblickten sie ein riesiges schwarzes Ungeheuer mit rotglühenden Augen und geschuppten Flügeln, groß wie Segel. Es raste über den Nachthimmel, stieß seinen Schwefelatem aus und spie Feuer. Rapscullio hatte einen Drachen auf eine magische Leinwand gemalt, und der Dämon war lebendig geworden. Der König blickte von den entsetzten Gesichtern seiner Untertanen zu seiner Frau, doch diese war, gekrümmt vor Schmerzen, auf die Knie gesunken. »Das Kind«, flüsterte sie, »das Kind kommt.«
Hin und her gerissen zwischen Liebe und Pflicht, wusste der König doch, was er zu tun hatte. Er küsste seine geliebte Frau, ließ sie in der Obhut ihrer Zofen zurück und versprach ihr, rechtzeitig zurück zu sein, wenn sein Sohn das Licht der Welt erblickte. Dann schwang er sein Schwert hoch in die Luft und ritt voller Wagemut und Zorn mit hundert Rittern in glänzender Rüstung über die Zugbrücke des Schlosses.
Aber einen Drachen zu besiegen ist kein einfaches Unterfangen. Als er mit ansehen musste, wie seine treuen Krieger von ihren Reittieren geschleudert und von dem feuerspeienden Ungeheuer in den Tod gerissen wurden, wusste König Maurice, dass er die Sache selbst in die Hand nehmen musste. Das Schwert eines gefallenen Ritters mit der linken Hand ergreifend und sein eigenes Schwert in der rechten, trat er an, den Drachen herauszufordern.
Während die Nacht immer dunkler wurde und draußen vor den Schlossmauern die Schlacht tobte, gebar die Königin unter Qualen ihren Sohn. Wie es bei einem Königsspross Sitte war, versammelten sich die Feen des Königreichs, um das Neugeborene mit ihren Gaben zu beschenken. In strahlendes Licht getaucht, schwebten sie über dem Bett der Königin, die vor Schmerz und Sorge um ihren Mann wie von Sinnen war.
Die erste Fee versprühte einen leuchtenden Nebel über dem Bett, so gleißend, dass die Königin die Augen abwenden musste. »Ich schenke diesem Kind Weisheit«, sagte die Fee.
Die zweite Fee sandte einen Hitzestrahl aus, der die Königin auf ihrem Lager umhüllte. »Ich schenke diesem Kind Treue«, sagte sie.
Die dritte Fee hatte den Kleinen eigentlich mit Mut beschenken wollen, denn jedes Königskind braucht eine ordentliche Portion Tapferkeit. Aber noch ehe sie ihre Gabe verleihen konnte, setzte sich Königin Maureen plötzlich im Bett auf, die Augen weit aufgerissen, denn sie sah ihren Mann auf dem Schlachtfeld, in den wütenden Klauen des Drachen. »Bitte«, rief sie. »Rettet ihn!«
Die Feen blickten einander bestürzt an. Das Kind lag still auf dem Kissen und regte sich nicht. Bereits bei vielen Geburten, bei denen sie zugegen gewesen waren, hatten sie vergeblich auf den ersten Atemzug des Kindes gewartet. Die dritte Fee verzichtete darauf, dem Neugeborenen wie vorgesehen Mut zu verleihen. »Ich schenke ihm Leben«, sagte sie, und das Wort ergoss sich als gelber Wirbel von ihren Lippen auf ihre Handfläche. Mit einem Kuss blies sie es in den Mund des Säuglings.
Im Königreich geht die Legende, dass Prinz Oliver in eben jenem Augenblick, als König Maurice im Todeskampf aufschrie, seinen ersten Schrei tat.
Es ist nicht leicht, ohne Vater aufzuwachsen. Bis zum Alter von sechzehn Jahren hatte Prinz Oliver nie wirklich Kind sein dürfen. Anstatt Fangen zu spielen, hatte er siebzehn Sprachen lernen müssen. Anstatt Gutenachtgeschichten zu lesen, hatte er die Gesetzbücher des Königreichs auswendig lernen müssen. Oliver liebte seine Mutter, aber so sehr er sich auch anstrengte, er würde nie so werden, wie sie ihn gern gehabt hätte. Manchmal hörte er, wie sie in ihrer Kammer mit jemandem sprach, aber wenn er eintrat, war sie allein. Wann immer sie sein schwarzes Haar und seine blauen Augen betrachtete und bemerkte, wie groß er geworden war und wie sehr er seinem Vater ähnelte, war sie den Tränen nahe. Soweit er es beurteilen konnte, gab es jedoch einen entscheidenden Unterschied zwischen ihm und seinem heldenhaften verstorbenen Vater: Mut. Oliver war klug und treu, aber was die Tapferkeit betraf, eine einzige Enttäuschung. Um seine Mutter glücklich zu machen, versuchte Oliver seine ganze Jugendzeit hindurch, sich bei allem anderen besonders hervorzutun. Jeden Montag hielt er Gericht, damit die Bauern ihre Zwistigkeiten vorbringen konnten. Durch ein von ihm erdachtes Fruchtfolgesystem waren die Vorratskammern im Königreich stets prall gefüllt, sogar in den härtesten Wintern. Zusammen mit Orville, dem Zauberer des Königreichs, entwickelte er eine hitzebeständige Rüstung für den Fall, dass es wieder zu einem Drachenangriff kommen sollte (auch wenn er vor Angst fast in Ohnmacht fiel, als er zu Testzwecken mit der Rüstung durch ein Lagerfeuer laufen musste). Mit sechzehn Jahren war er im besten Alter, den Thron zu besteigen, doch weder seiner Mutter noch seinen Untertanen war es eilig damit. Und wie konnte er es ihnen verübeln? Ein König beschützte sein Reich. Doch Oliver war überhaupt nicht erpicht darauf, in die Schlacht zu ziehen.
Er kannte natürlich den Grund dafür. Sein eigener Vater war mit dem Schwert in der Hand gestorben; Oliver zog es vor, am Leben zu bleiben, und bei diesem Vorhaben waren Schwerter eher hinderlich. Es wäre alles anders gewesen, wenn sein Vater da gewesen wäre und ihm das Fechten beigebracht hätte. Aber seine Mutter ließ ihn nicht einmal ein Küchenmesser anfassen. Olivers einzige Erinnerung an so etwas wie körperliche Gewalt war, als er im Alter von zehn Jahren mit seinem Freund Figgins, dem Sohn des Hofbäckers, auf dem Schlosshof gespielt hatte, sie würden gegen Drachen und Piraten kämpfen. Aber dann war Figgins auf einmal fort gewesen. (Insgeheim vermutete Oliver, dass seine Mutter das eingefädelt hatte, damit er nicht einmal mehr so tun konnte, als würde er kämpfen.) Danach hatte Oliver eigentlich nur noch einen Freund gehabt, einen streunenden Hund, der am selben Nachmittag auftauchte, als Figgins verschwand. Frump, so hieß der Hund, war zwar ein prima Gefährte, aber Fechten konnte Oliver mit ihm nicht üben. Und so wuchs Oliver mit einem großen Geheimnis auf: Im Grunde war er sogar froh darüber, dass er nie in die Schlacht geritten war oder sich in einem Turnier gemessen oder auch nur jemanden bei einem Streit geschlagen hatte …, weil er sich nämlich tief im Innern schrecklich davor fürchtete.
Dieses Geheimnis ließ sich jedoch nur bewahren, solange Frieden herrschte. Die Tatsache, dass der Drache, der seinen Vater getötet hatte, sich hinter die Berge zurückgezogen und seit sechzehn Jahren nicht gerührt hatte, hieß nicht, dass er nicht zurückkehren würde. Und wenn das passierte, halfen weder die auswendig gelernten Gesetze noch die Sprachen, die Oliver beherrschte, sofern er ihnen nicht mit scharfer Klinge Nachdruck verleihen konnte.
Eines Tages, als sich der Gerichtstag dem Ende zuneigte, begann Frump zu bellen. Oliver erspähte am anderen Ende der Großen Halle eine einsame Gestalt, von Kopf bis Fuß in einen schwarzen Umhang gehüllt. Der Mann fiel vor Olivers Thron auf die Knie. »Euer Hoheit«, bat er, »rettet sie.«
»Wen soll ich retten?«, wollte Oliver wissen. Frump, der immer schon ein guter Menschenkenner gewesen war, bleckte die Zähne und knurrte. »Platz, mein Junge«, murmelte Oliver und streckte dem Mann die Hand entgegen, um ihm aufzuhelfen. Einen Augenblick zögerte der Mann, dann klammerte er sich wie ein Ertrinkender daran. »Welcher Gram bedrückt Euch, guter Mann?«, fragte Oliver.
»Meine Tochter und ich leben in einem Königreich weit entfernt von hier. Sie ist entführt worden«, flüsterte er. »Ich brauche jemanden, der sie retten kann.«
Mit einem derartigen Anliegen war noch nie jemand zu Oliver gekommen. Normalerweise ging es darum, dass ein Nachbar dem anderen ein Huhn gestohlen hatte oder dass das Gemüse im Süden des Landes schlechter gedieh als im Norden. Oliver blitzte eine Vision durch den Kopf – wie er mit Rüstung und Pferd auszog, um ein edles Fräulein zu retten –, und sofort meinte er sich übergeben zu müssen. Der arme Mann konnte nicht wissen, dass er sich von allen Prinzen der Welt ausgerechnet den größten Feigling ausgesucht hatte. »Es gibt bestimmt einen anderen Prinzen, der besser dafür geeignet ist«, meinte Oliver. »Denn ich bin eigentlich noch ganz unerfahren.«
»Der erste Prinz, den ich gefragt habe, hatte keine Zeit, weil in seinem Land Bürgerkrieg herrschte. Der zweite brach gerade zu einer Reise auf, um seine Braut abzuholen. Ihr seid der Einzige, der auch nur bereit war, mich anzuhören.«
Olivers Gedanken überschlugen sich. Schlimm genug, dass er selbst um seine Ängstlichkeit wusste, aber was, wenn sich die Kunde von seiner Feigheit bis über die Grenzen des Königreichs hinaus verbreitete? Was, wenn dieser Mann in seiner Heimat jedem erzählte, dass Prinz Oliver kaum gegen eine Erkältung ankam … geschweige denn gegen einen Feind?
Der Mann missdeutete Olivers Schweigen als Zögern und zog ein kleines, ovales Porträt aus seinem Umhang. »Das ist Seraphima«, sagte er.
Oliver hatte noch nie ein so liebreizendes Mädchen gesehen. Ihr helles Haar glänzte wie Silber; ihre Augen hatten das Violett königlicher Roben. Ihre Haut schimmerte wie das Mondlicht, mit einem Hauch von Rot auf Wangen und Lippen.
Oliver und Seraphima. Seraphima und Oliver. Das klang irgendwie gut.
»Ich werde sie finden«, versprach Oliver.
Frump sah ihn an und winselte.
»Sorgen kann ich mir später machen«, flüsterte Oliver ihm zu.
Der Mann fiel vor Dankbarkeit hintenüber, und dabei öffnete sich für den Bruchteil einer Sekunde sein Umhang so weit, dass Oliver ein verzerrtes, narbiges Gesicht sah und Frump erneut zu bellen begann. Während der Vater des Mädchens sich untertänig zurückzog, sank Oliver auf seinem Thron zusammen, stützte den Kopf in die Hände und fragte sich, was um alles in der Welt er sich da gerade aufgehalst hatte.
»Kommt nicht in Frage«, verkündete Königin Maureen. »Oliver, die Welt da draußen ist gefährlich.«
»Die Welt hier drinnen auch«, erklärte Oliver. »Ich könnte die Treppe hinunterfallen. Ich könnte mich am Abendessen vergiften.«
Die Augen der Königin füllten sich mit Tränen. »Das ist nicht witzig, Oliver. Du könntest sterben.«
»Ich bin nicht Vater.«
Kaum war es heraus, bereute er es bereits. Seine Mutter ließ den Kopf hängen und trocknete sich die Augen. »Ich habe alles getan, um dich zu beschützen«, jammerte sie. »Und das willst du aufs Spiel setzen für ein Mädchen, das du nicht einmal kennst?«
»Und wenn nun vorgesehen ist, dass ich sie kennenlernen soll?«, fragte Oliver. »Wenn ich mich in sie verliebe wie du in meinen Vater? Ist es die Liebe nicht wert, dass man ein Risiko für sie eingeht?«
Die Königin hob den Kopf und sah ihren Sohn an. »Es gibt etwas, das ich dir erzählen muss«, sagte sie.
Die folgende Stunde saß Oliver wie gelähmt da und hörte zu, wie seine Mutter ihm von einem Jungen namens Rapscullio erzählte und von dem bösen Mann, zu dem er geworden war; von einem Drachen und drei Feen; von den Gaben, die ihm bei seiner Geburt verliehen worden waren, und von der einen, die er nicht bekommen hatte. »Seit Jahren mache ich mir Sorgen, dass Rapscullio eines Tages zurückkehren könnte«, gestand sie. »Dass er mir den letzten Beweis der Liebe deines Vaters wegnehmen wird.«
»Beweis?«
»Ja, Beweis, Oliver«, erklärte die Königin. »Dich.«
Oliver schüttelte den Kopf. »Das hier hat nichts mit Rapscullio zu tun. Es geht um ein Mädchen namens Seraphima.«
Königin Maureen nahm die Hand ihres Sohnes. »Versprich mir, dass du nicht kämpfen wirst. Gegen nichts und niemanden.«
»Selbst wenn ich es wollte, ich wüsste wahrscheinlich gar nicht, wie das geht.« Schmunzelnd schüttelte Oliver den Kopf. »Ich habe mir eigentlich noch gar keinen Schlachtplan zurechtgelegt.«
»Oliver, du bist mit vielen anderen Talenten gesegnet. Wenn es jemand schaffen kann, dann du.« Seine Mutter stand auf und griff nach dem Lederband, das sie um den Hals trug. »Aber für alle Fälle solltest du das hier mitnehmen.«
Aus dem Mieder ihres Kleides zog sie eine winzige runde Scheibe heraus, die als Anhänger an dem Halsband hing, und reichte sie Oliver.
»Das ist ein Kompass«, sagte er.
Königin Maureen nickte. »Er hat deinem Vater gehört«, erklärte sie. »Und er hat ihn von mir bekommen. Der Kompass wurde in meiner Familie von Generation zu Generation weitervererbt.« Sie sah ihren Sohn an. »Er weist nicht nach Norden, sondern den Weg nach Hause. Dein Vater hat ihn seinen Glücksbringer genannt.«
Oliver dachte an seinen tapferen, kühnen Vater, der mit diesem Band um den Hals losgeritten war, um gegen einen Drachen zu kämpfen. Ja, der Kompass hatte ihn nach Hause gebracht, aber nicht lebendig. Er schluckte und fragte sich, wie um alles in der Welt er dieses Mädchen retten sollte, wenn er nicht einmal ein Schwert hatte. »Vater hatte bestimmt nie Angst«, sagte er ganz leise.
»Angst zu haben heißt nur, dass man etwas hat, weshalb es sich lohnt zurückzukehren, das war einer der Sprüche deines Vaters«, erklärte ihm seine Mutter. »Und mir hat er immer gesagt, er habe ununterbrochen Angst.«
Oliver küsste sie auf die Wange und streifte sich das Band mit dem Kompass über den Kopf. Als er durch die Tür der Großen Halle schritt, fand er sich mit dem Gedanken ab, dass sein Leben bald sehr, sehr kompliziert sein würde.
Oliver
Also, nur damit ihr es wisst, wenn es heißt »Es war einmal …«, dann ist das eine Lüge.
Es war nämlich nicht einmal. Und auch nicht zweimal. Es war hunderte Male, immer wieder, jedes Mal, wenn jemand dieses staubige alte Buch aufschlägt.
»Oliver«, sagt mein bester Freund. »Schach.«
Ich blicke auf das Schachbrett, das eigentlich gar kein echtes Schachbrett ist. Es sind nur in den Sand des Ewigkeitsstrands geritzte Quadrate und dazu einige Feen, die so nett sind, Bauern, Läufer und Damen zu spielen. Weil in diesem Märchen kein Schachbrett vorkommt, müssen wir uns damit behelfen, und natürlich müssen wir anschließend sämtliche Spuren verwischen, sonst könnte jemand auf den Gedanken kommen, es stecke mehr hinter der Geschichte als das, was er gelesen hat.
Ich weiß nicht mehr, wann mir zum ersten Mal aufgefallen ist, dass das Leben, wie ich es kenne, nicht real ist. Dass die Rolle, die ich wieder und wieder spiele, eben nur eine Rolle ist. Und dass für dieses Schauspiel noch eine weitere Partei nötig ist – diese großen, runden Gesichter, die jedes Mal zu Beginn der Geschichte unseren Himmel eintrüben. Was auf den Seiten dieses Buches steht, entspricht nicht immer den tatsächlichen Verhältnissen. Wenn wir nicht gerade unsere Rollen spielen, können wir nämlich tun und lassen, was wir wollen. Es ist wirklich ziemlich kompliziert. Ich bin Prinz Oliver, aber zugleich bin ich auch nicht Prinz Oliver. Wenn dieses Buch zugeschlagen wird, kann ich aufhören so zu tun, als würde ich mich für Seraphima interessieren oder gegen einen Drachen kämpfen, und stattdessen mit Frump herumhängen oder einen der Tränke kosten, die Königin Maureen so gerne in ihrer Küche zusammenbraut. Oder ich kann mit den Piraten, die eigentlich ganz nette Kerle sind, mal kurz ins Meer springen. Mit anderen Worten, jenseits des Lebens, das wir spielen, wenn ein Leser das Buch aufschlägt, hat jeder von uns noch ein zweites Leben. Allen anderen hier reicht es, das zu wissen. Es macht ihnen nichts aus, die Geschichte immer wieder aufs Neue zu spielen und auch nachdem die Leser fort sind, in der Kulisse gefangen zu sein. Aber ich habe mir schon immer Gedanken gemacht. Es leuchtet doch ein: Wenn ich ein Leben außerhalb dieser Geschichte habe, muss es bei den Lesern, deren Gesichter über uns schweben, ebenso sein. Und sie sind nicht zwischen den Buchdeckeln gefangen. Also wo genau sind sie? Und was treiben sie in der Zeit, wenn das Buch geschlossen ist?
Einmal hat ein Leser – ein sehr junger – das Buch hingeworfen, es klappte auf und blieb auf einer Seite offen liegen, auf der nur ich vorkomme. So konnte ich der Anderswelt eine ganze Stunde lang zusehen. Diese Riesen stapelten Bausteine aus Holz mit Buchstaben darauf aufeinander und bauten daraus monströse Gebäude. Sie vergruben ihre Hände in einem tiefen Kasten mit genau dem gleichen Sand, wie wir ihn am Ewigkeitsstrand haben. Sie standen vor einer Staffelei, wie Rapscullio sie benutzt, aber diese Künstler hatten einen ganz eigenen Stil – sie tauchten ihre Hände in die Farbe und schmierten farbige Schnörkel auf das Papier. Schließlich neigte sich eines der Andersweltgeschöpfe, das so alt wie Königin Maureen aussah, stirnrunzelnd über das Buch, sagte: »Kinder! So geht man nicht mit Büchern um«, und schloss mich dann aus.
Als ich den anderen erzählte, was ich gesehen hatte, zuckten sie nur die Schultern. Königin Maureen schlug vor, ich sollte wegen meiner seltsamen Träume Orville konsultieren und ihn um einen Schlaftrunk bitten. Frump, innerhalb und außerhalb des Märchens mein bester Freund, glaubte mir. »Und was macht das für einen Unterschied, Oliver?«, fragte er. »Warum Zeit und Energie damit verschwenden, über einen unerreichbaren Ort oder eine Person, die man nie sein wird, nachzudenken?« Sofort bereute ich, dass ich es zur Sprache gebracht hatte. Frump ist nicht immer ein Hund gewesen – in der Geschichte wird er als Figgins von Rapscullio in einen gewöhnlichen Hund verwandelt. Da dies nur in einer Rückblende erwähnt wird, taucht er im Text ausschließlich als Hund auf, und deshalb bleibt er das auch, wenn wir die Bühne verlassen.
Frump schlägt meine Dame. »Schach und Matt!«, triumphiert er.
»Warum gewinnst du eigentlich immer?«, seufze ich.
»Warum lässt du mich immer gewinnen?«, sagt Frump und kratzt sich hinter dem Ohr. »Blöde Flöhe.«
Wenn wir arbeiten, spricht Frump nicht – dann bellt er nur. Er trabt hinter mir her wie ein, na ja, treues Hündchen. Sieht man ihn auf der Bühne, würde man nie vermuten, dass er uns im wirklichen Leben alle herumkommandiert.
»Ich glaube, oben auf Seite 47 habe ich eine Träne gesehen«, bemerke ich so beiläufig wie möglich, obwohl ich, seit ich sie entdeckt habe, darauf brenne, dorthin zurückzukehren und mehr darüber zu erfahren. »Willst du mitkommen und nachsehen?«
»Ehrlich, Oliver. Nicht schon wieder.« Frump verdreht die Augen. »Du bist wie ein Zirkuspferd, das nur ein einziges Kunststück kann.«
»Hat mich jemand gerufen?« Socks trottet herbei. Er ist mein treues Ross und außerdem ein weiteres glänzendes Beispiel dafür, dass der äußere Anschein zuweilen trügt. Auf den Seiten unserer Welt schnaubt und stampft er wie ein stolzer Hengst, doch wenn das Buch zugeschlagen wird, ist er ein Nervenbündel mit dem Selbstvertrauen einer Stechmücke.
Ich lächle ihn an, denn sonst würde er denken, dass ich ärgerlich auf ihn bin. Er ist nämlich sehr sensibel. »Nein, niemand …«
»Ich habe aber ganz deutlich das Wort Pferd gehört …«
»Das war doch nur eine Redensart«, bemerkt Frump.
»Aber da ich schon mal hier bin, seid ehrlich«, bittet uns Socks und dreht sich halb herum. »Mit diesem Sattel sieht mein Hintern total fett aus, oder?«
»Nein«, beeile ich mich ihm zu versichern, während Frump heftig den Kopf schüttelt.
»Du bestehst nur aus Muskeln«, sagt Frump. »Ich wollte dich gerade fragen, ob du trainiert hast.«
»Das sagt ihr nur, damit ich mich besser fühle«, schnieft Socks. »Ich hab doch gewusst, ich hätte beim Frühstück auf die letzte Karotte verzichten sollen.«
»Du siehst toll aus, Socks«, beharre ich. »Ehrlich.« Doch er schüttelt seine Mähne und trottet beleidigt zum anderen Ende des Strandes zurück.
Frump rollt sich auf den Rücken. »Wenn ich mir das Gejammer dieses dämlichen Gauls noch einmal anhören muss …«
»Genau davon rede ich«, falle ich ihm ins Wort. »Was, wenn du das nicht müsstest? Was, wenn du überall, wenn du alles sein könntest, was du willst?«
Ich habe da so einen Traum. Es ist irgendwie verrückt, aber in dem Traum laufe ich eine Straße entlang, die ich noch nie gesehen habe, in einem Dorf, das mir fremd ist. Ein Mädchen rennt gehetzt auf mich zu, die dunklen Haare wehen wie eine Fahne hinter ihr her, und vor lauter Eile rempelt sie mich an. Als ich die Hand nach ihr ausstrecke, um ihr aufzuhelfen, spüre ich, wie es zwischen uns funkt. Ihre Augen haben die Farbe von Honig und ich kann den Blick nicht von ihnen abwenden. Endlich, sage ich, und als ich sie küsse, schmeckt sie nach Minze und Winter und überhaupt nicht wie Seraphima.
»Ja, schon recht«, unterbricht Frump mich. »Wie sieht es mit den Berufsaussichten eines Bassets aus?«
»Du bist nur ein Hund, weil es so im Buch steht«, entgegne ich. »Und wenn du es nun ändern könntest?«
Er lacht. »Ändern. Die Geschichte ändern. Ganz klar, der war gut, Ollie. Wo du schon mal dabei bist, warum verwandelst du das Meer nicht in Traubensaft und machst, dass die Meerjungfrauen fliegen können?«
Vielleicht hat er recht und es liegt wirklich nur an mir. Alle anderen in diesem Buch scheinen nicht das geringste Problem damit zu haben, dass sie Teil eines Märchens sind; dass sie dazu verdammt sind, immer und immer wieder das Gleiche zu tun und zu sagen, wie in einem Theaterstück, das bis in alle Ewigkeit auf dem Spielplan steht. Wahrscheinlich glauben sie, dass die Menschen in der Anderswelt die gleiche Art Leben haben wie wir. Ich kann mir dagegen nur schwer vorstellen, dass die Leser jeden Morgen zur selben Zeit aufstehen, das gleiche Frühstück essen, stundenlang im selben Stuhl sitzen und dieselben Gespräche mit ihren Eltern führen, ins Bett gehen und wieder aufstehen, nur damit dann alles wieder von vorne anfängt. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass sie ein unglaublich tolles Leben führen – und mit unglaublich toll meine ich, dass sie selbst darüber bestimmen. Ich frage mich die ganze Zeit, wie sich das anfühlen würde: Wenn man das Buch aufschlagen und ich nicht die Königin anbetteln würde, mich ziehen zu lassen. Wenn ich nicht von Feen in die Falle gelockt werden würde und mich nicht mit einem Bösewicht herumschlagen müsste. Wenn ich mich in ein Mädchen verliebte, dessen Augen die Farbe von Honig haben. Wenn ich jemanden träfe, den ich nicht kenne und dessen Namen ich nicht weiß. Ich bin wirklich nicht wählerisch. Es würde mir nichts ausmachen, anstatt Prinz ein Metzger zu sein. Oder den Ozean zu durchschwimmen, um als legendärer Athlet bejubelt zu werden. Oder mit irgendjemandem, der meinen Weg kreuzt, Streit anzufangen. Ich würde alles lieber machen als das, was ich schon seit ewigen Zeiten tue. Wahrscheinlich muss ich einfach glauben, dass es auf der Welt mehr gibt als das, was sich auf den Seiten dieses Buches abspielt. Oder vielleicht will ich es auch nur unbedingt glauben.
Ich werfe den anderen einen Blick zu. Wenn das Buch geschlossen ist, treten die wahren Charaktere zutage. Einer der Trolle übt eine Melodie auf seiner Flöte, die er aus einem Stück Bambus geschnitzt hat. Die Feen lösen Kreuzworträtsel, die Kapitän Crabbe sich für sie ausdenkt, aber sie schummeln die ganze Zeit und ziehen die Kristallkugel des Zauberers zurate. Und Seraphima …
Sie wirft mir eine Kusshand zu, und ich zwinge mich zu lächeln.
Sie ist hübsch, denke ich, mit ihren silbernen Haaren und ihren Augen, die so blau sind wie die Veilchen, die auf der Wiese vor dem Schloss wachsen. Aber ihr IQ lässt zu wünschen übrig. Zum Beispiel glaubt sie tatsächlich, dass ich ernsthafte Gefühle für sie hege, nur weil ich sie immer wieder rette. Dabei tue ich nur meinen Job.
Ich will ehrlich sein, ein hübsches Mädchen zu küssen ist keine harte Arbeit. Aber nach einer Weile wird es einfach Routine. Ich liebe Seraphima definitiv nicht, doch dieses kleine Detail scheint ihr entgangen zu sein. Deshalb habe ich auch immer Gewissensbisse, wenn ich sie küsse – weil ich weiß, dass sie mehr von mir will, als ich ihr zu geben bereit bin, wenn die Buchdeckel zugeklappt werden.
Frump neben mir stößt ein langes, klägliches Jaulen aus. Das ist der zweite Grund, warum ich mich so schuldig fühle, wenn ich Seraphima küsse. Er schwärmt für sie, solange ich denken kann, und das macht es noch schlimmer. Wie muss das für ihn sein, mir Tag für Tag dabei zuzusehen, wie ich so tue, als würde ich mich in das Mädchen verlieben, auf das er steht?
»Tut mir leid, Kumpel«, sage ich zu ihm. »Ich wünschte, sie wüsste, dass es nur Show ist.«
»Nicht deine Schuld«, gibt er knapp zurück. »Du tust nur deine Pflicht.«
Als hätte er es heraufbeschworen, bricht plötzlich gleißendes Licht herein und unser Himmel reißt einen Spalt auf. »Achtung!«, brüllt Frump hektisch. »Alles auf die Plätze!« Dann saust er davon, um den Trollen beim Zerlegen der Brücke zu helfen, damit sie sie anschließend wieder aufbauen können.
Ich schnappe mir Umhang und Dolch. Die Feen, die unsere Schachfiguren waren, stieben wie Funken auf und schreiben die Worte BIS SPÄTER in die Luft, bevor sie einen Lichtschweif hinter sich herziehend im Wald verschwinden.
»Ja, und danke noch mal«, sage ich höflich und mache mich rasch zum Schloss auf, wo meine erste Szene spielt.
Was würde passieren, frage ich mich, wenn ich mich verspäten würde? Wenn ich trödeln oder am Schlosstor stehen bleiben würde, um am Fliederbusch zu schnuppern, sodass ich beim Öffnen des Buches nicht auf meinem Posten wäre? Bliebe es dann unaufgeschlagen? Oder würde die Geschichte ohne mich anfangen?
Versuchsweise gehe ich langsamer, lasse mir Zeit. Doch auf einmal werde ich vorne am Wams wie von einem Magneten durch das Buch gezogen. Die Seiten rascheln, als ich von einer zur nächsten springe, und bei einem verwunderten Blick nach unten stelle ich fest, dass sich meine Beine wie im Zeitraffer bewegen. Ich höre Socks in seiner Box in den königlichen Stallungen wiehern, und das Platschen der Meerjungfrauen, die wieder ins Meer tauchen, und plötzlich stehe ich auf meinem vorbestimmten Platz, vor dem Königsthron in der Großen Halle. »Wurde auch Zeit«, grummelt Frump. Einen Augenblick später wird es über uns leuchtend hell, und anstatt wie üblich wegzusehen, richte ich dieses Mal den Blick nach oben.
Ich kann das Gesicht der Leserin sehen – an den Rändern ein bisschen unscharf, so ähnlich wie die Sonne vom Meeresboden aus. Und genau wie beim Anblick der Sonne bin ich wie hypnotisiert.
»Oliver«, zischt Frump. »Konzentration!«
Also wende ich mich von diesen Augen ab, die exakt die Farbe von Honig haben; von diesem Mund, dessen Lippen ein ganz klein wenig geöffnet sind, als würde sie gleich meinen Namen aussprechen. Ich drehe mich weg, räuspere mich und spreche zum hundertmillionsten Mal die ersten Zeilen meines Textes.
»Wen soll ich retten?«
Ich habe die Zeilen, die ich spreche, nicht selbst geschrieben, sondern sie irgendwann einmal bekommen, wann, weiß ich schon lange nicht mehr. Mein Mund formt die Wörter, ihr Klang jedoch entsteht im Kopf des Lesers, nicht in meiner Kehle. In ähnlicher Weise spielen sich sämtliche Bewegungen, die wir wie in einem Theaterstück vollführen, irgendwie in der Fantasie einer anderen Person ab. Es ist, als würden die Handlungen und Geräusche auf unserer winzigen Bühne von weit weg in die Gedanken der Leser übertragen. Das habe ich, glaube ich, nicht irgendwann einmal herausgefunden, sondern schon immer gewusst, genauso wie ich weiß, dass die Farbe, die das Gras hat, grün ist.
Ich lasse mir von Rapscullio vormachen, er sei ein Edelmann aus einem fernen Land, dessen geliebte Tochter entführt worden ist. Weil ich seinen Monolog schon so oft gehört habe, murmle ich ihn manchmal leise mit. Natürlich hat er in der Geschichte eigentlich gar keine Tochter. Er stellt mir nur eine Falle. Aber das darf ich jetzt noch gar nicht wissen, auch wenn ich diese Szene schon unzählige Male gespielt habe. Während er mir also dieselbe alte Leier von den anderen Prinzen erzählt, die Seraphima nicht retten wollen, schweifen meine Gedanken zu dem Mädchen, das unsere Geschichte liest.
Ich habe sie schon einmal gesehen. Sie ist anders als unsere üblichen Leser, die entweder ältere Damen sind wie Königin Maureen oder Kinder, die man mit Geschichten über Prinzessinnen in Gefahr noch begeistern kann. Aber diese Leserin sieht aus, als wäre sie tatsächlich etwa in meinem Alter. Das kann eigentlich nicht sein. Sie weiß doch sicher – so wie ich –, dass Märchen nur erfundene Geschichten sind. Dass es in Wirklichkeit kein Happy End gibt.
Frump trippelt über den schwarz-weißen Marmorboden, und als er schlitternd neben mir stehen bleibt, wedelt er heftig mit dem Schwanz.
Plötzlich höre ich eine Stimme – entfernt, wie durch einen Tunnel, aber trotzdem klar und deutlich: »Delilah, ich sage es dir jetzt schon zum dritten Mal … wir werden zu spät kommen!«
Von Zeit zu Zeit passiert es, dass ich Leser reden höre. Normalerweise lesen sie nicht laut, aber manchmal unterhalten sie sich, während das Buch aufgeschlagen ist. Weil ich ein guter Zuhörer bin, habe ich eine Menge daraus gelernt. »Ab in die Flohkiste« ist offenbar ein gängiger Ausdruck dafür, um gute Nacht zu sagen, und zwar auch in Räumen, in denen weit und breit kein Floh zu sehen ist. Und ich kenne inzwischen Dinge aus der Anderswelt, die es bei uns nicht gibt: Fernsehen (das mögen Eltern nicht so gern wie Bücher); Happy Meals (offenbar machen nicht alle Mahlzeiten glücklich, nur diejenigen aus einer Papiertüte mit einem kleinen Spielzeug); und duschen (das macht man vor dem Zubettgehen und man wird ganz nass davon).
»Lass mich noch zu Ende lesen«, sagt das Mädchen.
»Du hast dieses Buch doch schon tausend Mal gelesen und weißt, wie es ausgeht. Mit jetzt meine ich jetzt!«
Ich habe bereits mehrmals mitbekommen, wie sich diese Leserin mit der älteren Frau unterhalten hat. Ihren Gesprächen nach zu schließen, muss es ihre Mutter sein. Sie ermahnt Delilah ständig, das Buch wegzulegen und nach draußen zu gehen. Einen Spaziergang zu machen und frische Luft zu schnappen. Eine Freundin anzurufen (keine Ahnung, was sie damit meint) und ins Kino zu gehen (was immer das ist). Jedes Mal warte ich darauf, dass sie die Anordnung ihrer Mutter befolgt, meistens jedoch findet sie eine Ausrede. Und manchmal geht sie zwar nach draußen, liest jedoch dort weiter. Ich kann euch nicht sagen, wie frustrierend das für mich ist. Ich versauere hier in diesem Buch und wünschte nichts sehnlicher, als zu entkommen, und sie kann sich nicht von der Geschichte losreißen.
Wenn ich mit dieser Delilah sprechen könnte, würde ich sie fragen, warum sie auch nur eine Sekunde ihrer Welt gegen die Welt eintauscht, in der ich festsitze.
Aber ich habe bereits probiert, laut mit anderen Lesern zu sprechen. Glaubt mir, das war das Erste, was ich versucht habe, seit mich diese Träume vom Leben in der Anderswelt verfolgen. Wenn ich die Menschen, die das Buch in der Hand halten, nur dazu bringen könnte, mich wahrzunehmen, dann hätte ich vielleicht eine Chance zu entkommen. Diese Menschen sehen mich jedoch nur, wenn sich die Handlung abspielt, und dann muss ich mich ja an den Text halten. Selbst wenn ich beispielsweise sagen will: »Bitte, hör mir zu!«, kommt stattdessen aus meinem Mund: »Ich bin ausgezogen, eine Prinzessin zu retten!«, wie bei einer Marionette. Ich würde alles dafür tun, damit mich ein Leser als der sehen könnte, der ich bin, und nicht als der, dessen Rolle ich spiele. Ich würde mir die Seele aus dem Leib schreien. Ich würde im Kreis herum laufen. Mich in eine lebende Fackel verwandeln. Alles, nur damit man mich sieht. Könnt ihr euch vorstellen, wie es wäre, wenn ihr wüsstet, dass euer Leben nur eine endlose Abfolge von Tagen ist, einer wie der andere, dass ihr in einer Zeitschleife gefangen seid? Als Prinz Oliver wurde mir vielleicht das Geschenk des Lebens verliehen … aber ich habe nie eine Chance bekommen, es wirklich zu leben.
»Ich komme«, sagt Delilah über die Schulter, und ich stoße seufzend den Atem aus. Mir war gar nicht aufgefallen, dass ich ihn angehalten hatte. Der Gedanke, nicht schon wieder dieselben Szenen durchexerzieren zu müssen, ist eine wahre Wohltat.
Als das Buch sich zu schließen beginnt, erfasst uns ein Taumel, daran haben wir uns schon gewöhnt. Wir klammern uns an irgendetwas – Kronleuchter, Tischbeine, zur Not sogar an die herabhängenden Schleifen von Buchstaben wie g oder y –, bis die Seiten ganz geschlossen sind.
»Tja«, sage ich und lasse die Gardine los, an der ich mich festgehalten habe. »Wir sind wohl noch mal davongekommen.«
Kaum habe ich den Satz beendet, überschlage ich mich schon wieder und purzle durch die Seiten, denn das Buch wird weiter durchgeblättert. Kurz vor Schluss der Geschichte öffnet sich unsere Welt wieder. Wie durch Zauberhand befinde ich mich plötzlich am Ewigkeitsstrand, und neben mir steht Seraphima, funkelnd und glitzernd in ihrem schimmernden Kleid. Frump trägt ein silbernes Band um den Hals, an dem ein Ehering befestigt ist. Die Trolle halten den Hochzeitsbaldachin; die Kobolde haben Seidenbänder gesponnen, die sich um sie wickeln und in der Meeresbrise flattern. Die Meerjungfrauen versammeln sich im seichten Wasser und sehen verbittert zu, wie wir vermählt werden.
Ich blicke zu Boden und Panik ergreift mich.
Das Schachbrett. Es ist immer noch da. Die Feen-Schachfiguren natürlich nicht, aber die Quadrate, die ich mit einem Stock in den Sand gezeichnet habe – der Beweis dafür, dass das Buch ein Eigenleben hat, wenn niemand es liest – sind immer noch am Strand zu sehen.
Ich habe keine Ahnung, warum das Buch sich nicht zurückgesetzt hat. Es macht sonst nie solche Fehler; bei jedem Umblättern sind wir an Ort und Stelle, fertig kostümiert und im Kreis der jeweiligen Mitspieler. Was weiß ich, vielleicht ist das ja schon einmal passiert und ich habe es nicht bemerkt. Aber wenn ich es sehe, dann könnte es auch noch jemand anderer sehen, das ist doch wohl klar.
Zum Beispiel ein Leser.
Delilah.
Tief Luft holen, Oliver, beruhige ich mich. »Frump«, zische ich.
Er knurrt, aber ich verstehe ihn deutlich: Nicht jetzt.
Na schön, Oliver, sage ich mir. Das ist keine Katastrophe. Was die Menschen an einem Märchen interessiert, ist das Happy End, sie suchen nicht nach einem kaum sichtbaren Schachbrett, das auf der letzten Seite in den Sand geritzt ist. Trotzdem versuche ich Seraphima näher an mich zu ziehen, um das Schachbrett unter dem bauschigen Rock ihres Kleides zu verstecken. Seraphima missversteht meine Geste jedoch und denkt, dass ich ihr näher sein möchte. Sie hebt das Kinn und schließt die Augen, weil sie darauf wartet, dass ich sie küsse.
Alle warten. Die Trolle, die Feen, die Meerjungfrauen. Die Piraten, die ihre Ankerleinen fest um den Drachen Pyro gewickelt haben, um ihn in Schach zu halten.
Auch die Leserin wartet. Und wenn ich ihr gebe, was sie will, wird sie das Buch zuschlagen, und das war’s dann.
Na schön.
Ich beuge mich vor und gebe Seraphima einen Kuss, vergrabe meine Finger in ihrem Haar und ziehe ihren Körper an mich. Sie schmilzt unter meiner Berührung dahin und ich schließe sie fest in die Arme. Auch wenn sie nicht mein Typ ist, gibt es schließlich keinen Grund, warum ich bei der Arbeit keinen Spaß haben sollte.
»Delilah!«
Als sich das Mädchen tiefer über uns beugt, verdunkelt sich der Himmel. »Wie merkwürdig«, murmelt sie.
Ihr Finger senkt sich auf uns herab, drückt auf die Umgrenzung unserer Welt, verbiegt die Kulisse, in der wir stehen. Ich halte die Luft an, weil ich denke, dass sie mich fangen will. Stattdessen berührt sie die Stelle, wo das Schachbrett in den Sand geritzt ist.
»Das«, sagt sie, »war hier noch nie.«
Delilah
Ich bin sonderbar.
Das sagen alle. Wahrscheinlich kommt das daher, weil ich es mir lieber mit einem Buch gemütlich mache, anstatt mich wie andere Fünfzehnjährige über das tollste Lipgloss und den heißesten Filmstar zu unterhalten. Ganz im Ernst – seid ihr in letzter Zeit mal in einer Highschool gewesen? Warum sollte sich jemand, der seine fünf Sinne beisammenhat, mit Hockeyspielern abgeben, die sich wie Neandertaler benehmen? Oder vor den boshaften Mädchen, die vor den Spinden herumlungern wie die Modepolizei und Kommentare zu meinen ausgebleichten Chucks und Secondhand-Pullis loslassen, Spießruten laufen? Nein, danke; da tue ich doch viel lieber so, als wäre ich woanders, und genau das geschieht jedes Mal, wenn ich ein Buch aufschlage.
Meine Mom macht sich Sorgen um mich, weil ich eine Einzelgängerin bin. Aber das stimmt nicht ganz. Meine beste Freundin Jules versteht mich total. Meine Mom ist selbst schuld, wenn sie über die Sicherheitsnadeln in Jules’ Ohrläppchen und ihren pinkfarbenen Irokesenschnitt nicht hinwegsehen kann. Das Coole daran ist doch, dass ich neben Jules überhaupt nicht auffalle.
Jules versteht meine Versessenheit auf Bücher. Ihre Schwäche sind trashige Horrorfilme. Sie kennt jede einzelne Dialogzeile aus Der Blob. Die beliebten Mädchen an unserer Schule nennt sie nur die »Körperfresser«.
Jules und ich gehören nicht zu den Beliebten. Ich jedenfalls bin meilenweit davon entfernt, beliebt zu sein oder mich auch nur im Dunstkreis der Beliebten aufhalten zu können. Letztes Jahr, als wir in der Turnhalle Softball spielten, habe ich Allie McAndrew nämlich mit dem Schläger die linke Kniescheibe zertrümmert. Allie ist Chef-Cheerleaderin und konnte sechs Wochen lang nicht auf die Spitze der Pyramide, außerdem musste sie die Krone, mit der sie beim Abschlussball zur Ballkönigin gekrönt wurde, auf Krücken entgegennehmen.