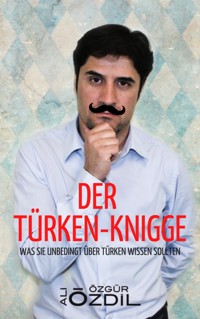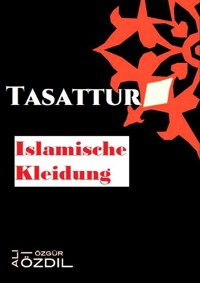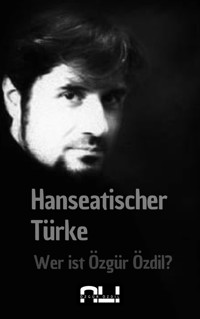5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"Wie nennt man im Islam jemanden, der die Pilgerfahrt gemacht hat?"
So lautete einmal die 500.000-Euro-Frage bei "Wer wird Millionär".
Ob für einen Vortrag, für ein Referat oder einfach nur das Allgemeinwissen: hier ist das komprimierte Wissen zum Islam von Abraham bis Zakat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mein Islam Handbuch
Von Abraham bis Zakat
Denen, die nach Wissen durstenBookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenMein Islam Handbuch
Von Abraham bis Zakat
Ali Özgür Özdil
www.alioezdil.de
Hamburg 2020
INHALTSVERZEICHNIS
AbrahamAbû BakrAbû HanîfaAdam und EvaAischaAhmad ibn HanbalAl-AqsâAl-Azharal-FâtihaAl-GhazzâlîAli ibn Abi TâlibAlkoholAllâhArabischArchitekturAr-RûmîAsch-Schâfi‘îAuferstehungAyatAzânBarmherzigkeitBasmalaBeschneidungBild und BilderverbotBrüderlichkeitBukhârîChristenDeutsche Wörter arabischer HerkunftDialogDjafar as-SâdiqDjihâdDjinnDynastienEhe und FamilieEngelErbrechtErziehungFarbenFastenFâtimaFâtima al-FihrîFatwâFeste/FestkalenderFirdûsîFrau und Mann im IslamFreitagFriedensgrußFünf Säulen des IslamGebetGebetshaltungenGebetsketteGebetsteppichGeboteGelehrteGerechtigkeitGlaube und GlaubensehreGlaubenszeugnisGottesdiensteGötzen und GötzendienstHadithHadschHalâlHandelHarâmHeilige StättenHidjraHölleIbn KhaldûnIbn RuschdIbn SînaIdjtihâdImâmIslamJenseitsJerusalemJesus im KoranJudenJüngstes GerichtKaabaKalenderKalifKalifatKalligraphieKhutbaKleidungKoranKoranexegeseKunstKutub as-SittaLichtversLiteraturgeschichteMâlik ibn AnasMedinaMekkaMenschenbildMenschenrechte im IslamMethoden der RechtsschulenMihrâbMinarettMinbarMinderheiten im IslamMissionMondsichelMonotheismusMoscheeMosesMuezzinMuhammadMusik im IslamMuslimMutterMystikNafisaNamen99 Namen GottesOffenbarungOpferfestParadiesPflichten, religiösePhilosophie, islamischePolitischer IslamPolygamieProphetenQalamQiblaQuellen des IslamRamadânRauschmittelRecht, islamischesRechtsschulenReinheitReligionSahâbaSalaf as-SâlihSalafismusSchächtungSchariaScheidungSchicksalSchiitenSchiitische ImameSchweinefleischSeeleSexualitätSufisSultanSunnaSunnitenSureSure al-IhlâsSymboleTafsîrTeufelTheologische RichtungenTodUmar ibn Al-KhattâbUmmaUthmân ibn ‘AffânWeisheitWelt des IslamWissenZeittafelZakâtQuellenSuchhilfen
In der Regel wurden die im Deutschen gebräuchlichen Schreibweisen berücksichtigt (also Koran statt Qur´ân). Bei unterschiedlichen Schreibweisen wurde sich für eine bestimmte Schreibweise entschieden (also Muhammad statt Mohammed). Bei Fachbegriffen wurde die Originalbezeichnung (z.B. Idjtihâd oder Djihâd) und nicht die Übersetzung gewählt.
Hier einige Suchhilfen:
Auswanderung (siehe Hidjra)
Averroes (siehe Ibn Ruschd) oder Avicenna (siehe Ibn Sina)
Freitagspredigt (siehe Khutba)
Gebetsnische (siehe Mihrab)
Gebetsrichtung (siehe Qibla)
Gebetsrufer (siehe Muezzin)
Gott (siehe Allah)
Harâm und Helâl (für Verbotenes und Erlaubtes)
Osman (siehe Uthman) oder Ömer (siehe Umar)
Polytheismus (siehe Götzen und Götzendienst)
Satan (siehe Teufel)
Sufismus (siehe Mystik)
Überlieferung (siehe Hadith)
Vers (Koranvers, siehe Ayat)
Vorbeter (siehe Imâm)
Anmerkung:
Zu allen mit einem Pfeil (→) versehenen Begriffen existiert ebenfalls eine Erklärung im Buch.
Die Zahlen in Klammern (z.B. 5:3) bedeuten, dass dieses Zitat aus dem Koran, in der Sure 5, Vers 3 enthalten ist.
Abraham (arab. Ibrâhîm)
Die Chaldäer, unter denen Abraham lebte, besaßen eine gründliche Kenntnis der Himmelskörper. Sonne und Mond zählten zu ihren Hauptgottheiten. Abraham wehrte sich aber gegen den →Götzendienst seines Volkes, woraufhin Gott ihn rechtleitete und durch die physische Welt hindurch blicken ließ und ihm die geistige Welt dahinter zeigte. In den Koranversen 6:74-83 wird die Suche Abrahams nach Gott geschildert. Danach muss Abraham eine schwere Zeit durchstehen: Verfolgung in Mesopotamien, Auseinandersetzung mit den →Polytheisten (21:51-69, 37:97) und Streit mit dem Pharao Nimrud (2:258-260), bis ihm die Gesandten Gottes (zwei Engel in Menschengestalt) erscheinen (11:69-76) und er die Botschaft erhält, dass er zum Ahnherr einer langen Reihe prophetischer Persönlichkeiten erwählt worden ist. Seine Reise führt ihn schließlich an jene Ortschaft, wo er seine Frau Hadjar (Hagar) mit ihrem Sohn Ismael zurücklässt und wo sie eine Wasserquelle findet, die zur Gründung der Stadt Mekka führt. Abraham errichtet mit seinem Sohn Ismael „die Grundmauern des Hauses“, d.h. der →Kaaba in →Mekka (2:124 ff.): „Wahrlich, das erste Gotteshaus, das für die Menschen gegründet wurde, ist das in Bakka (Mekka) – ein gesegnetes und eine Leitung für die Welten. In ihm sind deutliche Zeichen – die Stätte Abrahams. Und wer es betritt, ist sicher...“ (3:95 ff.). Abraham war zur Zeit des Propheten →Muhammad ﷺ (570-632) eine unter den Arabern bekannte Persönlichkeit (26:69), denn fast alle Araber betrachteten ihn als ihren Leiter und ihr Vorbild. Besonders die Quraisch (Familie des Propheten Muhammad ﷺ) waren stolz darauf, von ihm abzustammen und Hüter der →Kaaba zu sein, die er erbaut hatte. Darüber hinaus wird Abraham im Koran als „Imâm für die Menschen.“ (2:124) bezeichnet (→Imâm) und als „Freund Gottes“ (Khalîlullâh): „Und wer hätte einen schöneren Glauben, als wer sich Allah hingibt und das Gute tut und die Religion Abrahams, des Lauteren im Glauben, befolgt; denn Allah nahm sich Abraham zum Freund.“ (4:125 und 54). Die →Religion (Islam), zu der durch den Propheten Muhammad ﷺ eingeladen wird, ist demnach keine neue, sondern die Religion Abrahams: „...So folgt der Religion Abrahams, des Lauteren im Glauben, der neben Gott keine Götter setzte.“ (3:95) „Und wer hat eine schönere Religion als jener, der sich Gott ergibt und dabei Güte übt und dem Glauben Abrahams folgt, des Aufrechten?“ (4:125). „Und eifert in Gottes Sache, wie dafür geeifert werden soll. Er hat euch erwählt und hat euch nichts auferlegt was euch in der Religion bedrücken könnte, der Religion eures Vaters Abraham. Er ist es, der euch schon Muslime nannte und (nun auch) in diesem...“ (22:78).
Abû Bakr r.a.
Nach Khadidja, der Frau des Propheten →Muhammad ﷺ und nach dessen Vetter →Ali, war der mekkanische Kaufmann Abû Bakr der erste Mann, der der Botschaft des Propheten Glauben schenkte. Er war in etwa gleichem Alter wie der Prophet und erhielt von ihm den Beinamen „as-Siddîq“ (der Wahrhaftige, der Glaubensstarke). Denn als die anderen Mekkaner über den Propheten spotteten, er sei in einer Nacht von Mekka nach Jerusalem und von dort aus durch die sieben Himmel gereist (→Mirâdj), sagte Abu Bakr: „Wenn Muhammad es sagt, dann ist es wahr. Denn ich habe bereits an etwas größeres (d.h. an Gott) als dies geglaubt!“ Als Abu Bakr zur Unterstützung der Muslime, dem Propheten all sein Hab und Gut übergab, fragte der Prophet ihn, was er denn seiner Familie hinterlassen habe. Dieser antwortete: „Gott und Seinen Gesandten!“ Er war es auch, der den Propheten bei der Auswanderung aus →Mekka begleitete, nach dem die anderen Muslime die Stadt schon verlassen hatten (→Hidjra). Des Weiteren besteht eine enge Bindung zwischen ihm und dem Propheten, weil der Prophet Aischa, (türk. Ayşe) die Tochter Abû Bakrs geheiratet hat. Der Prophet sagte über Abû Bakr: „Niemand ist mir ein besserer Gefährte gewesen, als Abû Bakr“. Es wird berichtet, dass der Prophet ihm mitgeteilt hat, dass ihm das Paradies versprochen wurde und das er der Erste aus der →Umma des Propheten sein werde, der ins Paradies eintritt. Nach dem Tode des Propheten wurde Abu Bakr in →Medina 632 zum ersten →Kalifen gewählt. Als Kalif war er vor allem damit beschäftigt, die vom Islam abgefallenen arabischen Stämme wieder zu gewinnen, da diese sich nach dem Tode des Propheten nicht mehr an die Verträge halten wollten. Abu Bakr r.a. starb im Jahre 634 in Medina.
Abû Hanîfa
Der Rechtsgelehrte Abû Hanîfa (699-767) lebte in Kufa/Irak, dass vom vierten →Kalifen ‘Ali ibn Abi Tâlib zur Hauptstadt gemacht wurde. Er erlebte die Umbruchszeit von den Umayyaden zu den Abbasiden (siehe →Dynastien) mit. Direkte Schriften von ihm gibt es nicht, doch vieles über ihn, ist von seinen Schülern vermittelt worden. Die berühmtesten Werke, die ihm zugesprochen werden, sind "al-Fiqh al-Akbar" und "al-Fiqh al-Akthar". Er war in seiner Quellenbewertung sehr vorsichtig und hat von ca. 700.000 Überlieferungen, die im Umlauf waren, nur 80 für die Glaubensgrundsätze (‘aqîda) als relevant akzeptiert. Er hat viel eigenständige Meinung (ra`y) betrieben und soll dem Analogieschluss (Qiyâs) sehr viel Gewicht beigemessen haben. Es gibt viele Legenden um Abû Hanîfa, so dass auch die Ursache seines Todes unklar ist. Der Kalif al-Mansûr soll versucht haben, ihn für sich zu gewinnen, indem er ihm ein Richteramt anbot. Doch als Abû Hanîfa ablehnte, kam er ins Gefängnis, wo er an den Folgen der Folter 767 gestorben sein soll. Seiner →Rechtsschule gehören die meisten Muslime an (vor allem in Pakistan, Indien, Bangladesch, der Türkei und auf dem Balkan).
Adam und Eva (Hawwa)
Im →Koran ist der Mensch, dessen Prototyp Adam ist, das Geschöpf, das Gott vor allen anderen ausgezeichnet hat (17:70). Himmel und Erde wurden in seinen Dienst gestellt (7:54; 55:1-10; 6:97; 20:53-55). Als der Mensch erschaffen wird, fordert Gott die Engel auf, vor ihm niederzufallen. Alle, bis auf den Satan (Iblîs, siehe →„Teufel“), folgen dem Befehl. Denn der Satan meint: „Ich bin besser als er; Du erschufst mich aus Feuer, doch ihn erschufst Du aus Lehm.“ (38:77) So beginnt eine Urfeindschaft zwischen Satan und dem Menschen und Satan schwört den Menschen zu verführen: „Jedoch Satan flüsterte ihm Böses ein; er sagte: "O Adam, soll ich dich zum Baum der Ewigkeit führen und zu einem Königreich, das nimmer vergeht?" Da aßen sie beide davon, sodass ihnen ihre Blöße ersichtlich wurde, und sie begannen die Blätter des Gartens über sich zusammenzustecken. Und Adam befolgte das Gebot seines Herrn nicht und ging in die Irre.“ (20:120-121) Der Koran macht sowohl Adam als auch Eva für den Fehltritt bzw. diese Ursünde, verantwortlich und verurteilt den Satan als Verführer und Feind. Als Adam und Eva ihren Fehler erkennen, sagen sie: "Unser Herr, wir haben gegen uns selbst gesündigt; und wenn Du uns nicht verzeihst und Dich unser erbarmst, dann werden wir gewiss unter den Verlierern sein. (7:23). Anstatt dem Paar Vorwürfe zu machen, akzeptiert Gott ihre Reue und vergibt ihnen. Adam wurde als erster Mensch, als höchstes Geschöpf Gottes aus Lehm geformt und ins Leben gerufen und gegen die Bedenken der Engel als „Statthalter Gottes“ (→„Kalif“) auf Erden eingesetzt (2:30). Die Tatsache, dass Gott ihm von Seinem Geiste einhaucht, macht den Menschen zum Träger göttlicher Eigenschaften.
Ahmad ibn Hanbal
Der Rechtsgelehrte Ahmad ibn Hanbal (780-855) wurde in Bagdad geboren und war von 810-813 Schüler von →Asch-Schafi‘î. Er ist einer der bedeutendsten Traditionarier (Hadith-Sammler) des Islam und sein bedeutendstes Werk ist der "Musnad" (nach Gewährsleuten sortiert), das von seinem Sohn in sechs Bänden mit 38.000 Texten herausgebracht wurde. Sein Leben ist geprägt durch die Auseinandersetzung mit der theologischen Schule der Mu‘tazila zur Zeit des Kalifen Ma`mûn (813-33), deren Hauptlehre sich auf die Vernunft stützte. Ihre Lehre, z.B., dass der Koran geschaffen sei, war von den Abbasiden (siehe →Dynastien) vereinnahmt und zum Staatsdogma erhoben worden, was auch zur ersten so genannten mihna, d.h. der Unterdrückung entgegen gesetzter Meinungen, in der muslimischen Geschichte führte. Als ibn Hanbal sich dagegen währte, kam er ins Gefängnis. Doch durch sein Beharren auf die Unerschaffenheit des Korans, wurde unter dem Kalifen al-Mutawakkil die alte These wieder aufgenommen. Besonders bei ibn Hanbal ist auch, dass er alles ablehnte was bid‘a ("unerlaubte Neuerung") war und an →Koran und →Sunna, als die einzigen Quellen, festhielt.
Aischa
Aischa (gest. 678) war eine der Ehefrauen des Propheten Muhammad ﷺ und somit eine der Mütter der Gläubigen. Ihr Vater ist →Abu Bakr. Zu Aischas Heirat mit dem Propheten Muhammad ﷺ gibt es kontroversen unter Muslimen, insbesondere über ihr Alter. Aischa wird indirekt an mehreren Stellen im Koran erwähnt (siehe unter anderem Sure 24, Vers 11ff.). Auf Aischa werden in mehreren Werken zusammen über 2000 Überlieferungen zurückgeführt. In der Zeit des 4. Kalifen →‘Ali r.a. war sie in die so genannte „Kamelschlacht“ gegen ihn verwickelt. Aischa selbst hatte keine Kinder, nahm jedoch, als ihr Bruder ‘Abdurrahmân starb, seine beiden Kinder unter ihre Obhut. Aischa starb in der Nacht zum Dienstag, dem 17. Ramadan 678. Sie wurde neben den anderen Frauen des Propheten beigesetzt. Ihr Totengebet wurde von Abu Huraira geleitet.
Al-Aqsâ
Al-Masdjîd al-Aqsâ (wörtlich: „die Entfernteste Moschee“) befindet sich in →Jerusalem (arab. al-Quds, d.h. „die Heilige“). Hier befand sich der Tempel des Propheten Salomon (genannt „Bait al-Maqdis“). Der Felsen im Felsendom gilt als Stätte des →Abraham-Opfers. Von hier aus stieg der Prophet →Muhammad ﷺ laut Überlieferung bei seiner nächtlichen Reise (arab. Mirâdj) zu den sieben Himmeln, traf die anderen →Propheten, die vor ihm entsandt wurden, sah →Hölle und →Paradies und brachte das muslimische →Gebet mit, das ihm der Engel Gabriel beibrachte. Im Koran lesen wir dazu: „Preis Ihm (d.h. Gott), der bei Nacht Seinen Diener (Muhammad) hinwegführte von der Heiligen Moschee (in →Mekka) zur Entferntesten Moschee (in Jerusalem), deren Umgebung Wir gesegnet haben, auf dass Wir ihm einige unserer Zeichen zeigen...“ (17:1). Die Stadt Jerusalem war die erste Gebetsrichtung (siehe →Qibla) der Muslime und hat aus den genannten Gründen nach Mekka und Medina eine zentrale Rolle im islamischen Glauben.
Al-Azhar
Al-Azhar („die Leuchtende“) ist der Name einer Moschee und Universität in Kairo, die im Jahre 972 von den →schiitischen Fâtimiden gegründet wurde. Sie hat sich im Laufe der Jahrhunderte zu der angesehensten Hochschule des →sunnitischen Islam entwickelt, zu der neben der theologischen, juristischen und philosophischen Fakultät, auch naturwissenschaftliche und technische Fakultäten hinzugekommen sind. Wer an Al-Azhar studiert, lernt in der Regel neben Koran- und Hadithwissenschaften und deren Exegese auch Rechtswissenschaften, Geschichte, Philosophie und Mystik. Heute ist Al-Azhar vor allem für ihre Rechtsgutachten (→Fatwâ) bekannt und hat auch Einfluss auf die Gründung neuerer islamischer Universitäten bzw. theologischer Einrichtungen auch in anderen Ländern der Welt. Ihre Absolventen arbeiten nicht nur in den eigenen Einrichtungen der Hochschule, sondern auch als Arabisch- oder Ethiklehrer, als →Imâm oder als Wissenschaftler für Theologie, Philosophie oder Recht. Die Absolventen betreiben auch in anderen islamischen Ländern die Aufklärung der Muslime über den Islam und haben auch unter den meisten Muslimen aufgrund ihres Azhar-Abschlusses ein sehr hohes Ansehen.
Al-Fâtiha (1. Sure des Koran)
Die erste Sure des Korans ist die “al-Fâtiha“. Das heißt aber nicht, dass sie die erste Offenbarung an den Propheten Muhammad war, sondern vom Propheten (beim Vortragen des Koran) als erste vorgetragen wurde. Al-Fâtiha bedeutet “die Eröffnende”, d.h. die →Sure, die den Koran eröffnet. Sie ist die Sure, die von den Muslimen am häufigsten gelesen wird, denn während der fünf →Gebete am Tag, wird diese Sure immer vorgetragen. In Sure 15:87 gibt es einen zusätzlichen Hinweis auf die al-Fâtiha („...die sieben oft zitierten Verse...“), die der Prophet →Muhammad ﷺ laut Überlieferungen bei den Traditionssammlern Bukhârî und at-Tirmidhî, als „die größte aller Suren“ bezeichnet haben soll.
Bismillâhi-r-Rahmâni-r-Rahîm
al-Hamdu lillâhi rabbîl ‘âlamîn
ar-Rahmânirrahîm
Mâliki yaumid-Dîn
iyyâka na‘budu wa iyyâka nasta‘în
ihdinâs-Sirât al-Mustaqîm
Sirât al-lazîna an‘amta ‘alaihim, gayril magdûbi ‘alaihim wa lâd-dâllîn
Übersetzung:
Mit dem Namen Gottes, des Barmherzigen, des Gnädigen
Lob sei Allah, dem Weltenherrn
Dem Erbarmer, dem Barmherzigen
Dem Herrscher am Tage des Gerichts
Dir dienen wir und zu Dir rufen wir um Hilfe
Leite uns den rechten Pfad
Den Pfad derer, denen Du gnädig bist, nicht derer, denen Du zürnst, und nicht der Irrenden.
Al-Ghazzâlî (lat. Algazel)
Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazzâlî (1058-1111), geboren in Tûs, gilt als einer der größten muslimischen Gelehrten. Seine Schwerpunkte lagen auf Theologie, →Philosophie, →Mystik und Recht, zu denen er mehrere Werke verfasst hat. Sein Hauptwerk ist das Berühmte „Ihyâ Ûlûm ad-Dîn“ (Die Wiederbelebung der religiösen Wissenschaften), dessen einfachere Form als „Das Elixier der Glückseligkeit“ auch in deutscher Sprache vorliegt. Hellmut Ritter hat in der Einleitung eine hervorragende Biographie von al-Ghazzâlî verfasst. Al-Ghazzâlî war bekannt für seine kritische Haltung gegen Autoritäten und für sein Streben nach Freiheit des Denkens. Seine Suche nach der Wahrheit, führte ihn zum Studium von vier Gruppen: 1. Die scholastischen Dogmatiker (al-mutakallimûn), 2. die Verehrer eines verborgenen Imâms als alleiniger Lehrautorität („Bâtiniyya), 3. die Philosophen, 4. die Sufis. So beschreibt er in seiner Selbstbiographie, dass der Weg der →Sufis der sei, der zu Gott führt. Die Weisheit der Gelehrten, die Doktrin der Philosophen, vermochten nicht die Seelen zu verbessern und zu befreien, das konnte allein die praktische Befolgung der sufischen Lehre, das man das Herz von allem außer Gott frei machen müsse. So schloss sich ihn eine neue Quelle der Erkenntnis auf. Das innere Fenster nach der übersinnlichen Welt eröffnete sich ihm und er gewann das Verständnis für das Wesen des Prophetentums. Sein Hauptanliegen richtete sich auf das Herz. So berichtet er über Liebe, Brüderlichkeit und Freundschaft in ihrer vollkommensten Art. In seinen letzten Jahren zog er sich nach Tûs zurück, wo er teilweise in einer →Madrasa und teilweise im Sufikonvent Schüler unterrichtete.
Ali (ibn Abi Tâlib)
Ali r.a. ist der Vetter des Propheten →Muhammad ﷺ und nahm noch als Kind den Islam an. Er hat den Propheten bis zu dessen Tod treu begleitet und war später mit dessen Tochter →Fâtima verheiratet. Durch seine Verwandtschaft und die enge Beziehung zum Propheten, haben einige Muslime ihn als rechtmäßigen Kalifen (“Nachfolger”) gesehen und stimmten nach dem Tode des Propheten im Jahre 632 für ihn als →Kalifen. Seine Anhänger werden als “Schiat Ali” (→Schiiten) bezeichnet. Die Mehrheit der Muslime jedoch wählte →Abû Bakr r.a., und nach dessen Tod, →Umar zum Kalifen. Ali war in den darauffolgenden Jahren mit der Belehrung der Muslime beschäftigt und ist berühmt für seine weisen Sprüche. Als im Jahre 657 der dritte Kalif Uthman ibn ‘Affân r.a. ermordet wird, kommt Ali per Akklamation an die Macht. Er veranlasst, dass die Hauptstadt von →Medina nach Kufa verlegt wird. Doch ihm wird vorgeworfen, die Mörder Uthmans nicht verfolgen lassen zu haben bzw. selbst hinter dessen Ermordung zu stehen, um selbst an die Macht zu kommen. Als dann Mu‘âwiya, der Statthalter von Damaskus und ein Verwandter des Kalifen ‘Uthmân war, mit einem Heer gegen Ali zieht, findet in Siffîn (heute Abu Huraira, Syrien) die erste Schlacht unter Muslimen statt. Diese wird durch ein Schiedsgericht beigelegt. Das Schiedsgericht entscheidet die Absetzung ‘Alî´s. Als Ali diese Entscheidung zur Beilegung des Kampfes akzeptiert, wenden sich einige seiner früheren Anhänger, die als “Khâridjiten” bezeichnet werden, von ihm ab und ermorden ihn während des Morgengebets. Für jene, die ihm treu bleiben, gilt er als der erste →Imâm (d.h. geistige wie politische Führer) und sein Sohn Hassan als der zweite und Hussain als der dritte Imâm.