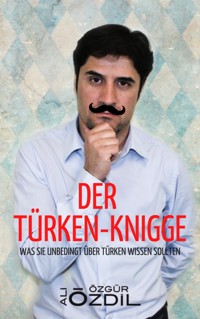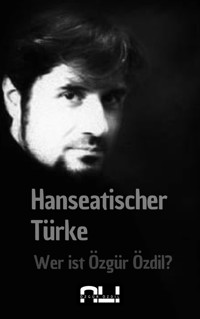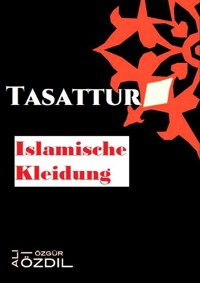
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Wie der Prophet Muhammad verstehe ich mich als Frauenrechtler. In mehr als 1000 Veranstaltungen musste ich die Frage nach dem Kopftuch beantworten. Dabei gehe ich auf sehr unterschiedliche anthropologische, religiöse, kulturelle, historische, soziale und individuelle Aspekte ein. Wie definiert man nun "islamische Kleidung" oder wann ist eine Kleidung "islamisch"? Eines der Top-Themen zum Islam in Deutschland ist das Kopftuch, und zwar nicht irgendein Kopftuch, sondern das Kopftuch der muslimischen Frau. Wieso ist dieses Thema in unserem gesellschaftlichen Kontext so wichtig? Oder wird es wichtiger gemacht, als es in Wirklichkeit ist? Im Islam als Religion kommt das Thema vielleicht an Platz 248, da es so viele andere Themen gibt, die wichtiger sind, aber in Deutschland gilt das Kopftuch als ein "Symbol", und zwar ein negatives Symbol. Ist das Kopftuch aber tatsächlich ein Symbol? Wer fragt überhaupt die Betroffenen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Tasattur
Islamische Kleidung
Den Mutigen!BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenTasattur - Islamische Kleidung
Ali Özgür Özdil
www.alioezdil.de
Hamburg 2014
Inhaltsverzeichnis Seite
1. Einleitende Worte
2. Anthropologische Aspekte
3. Kulturelle Aspekte
4. Gesellschaftliche Aspekte
5. Historische Aspekte
6. Wirtschaftliche Aspekte
7. Individuelle Aspekte
8. Die Außensicht
9. Fazit
10. Anhang: Sollte das Kopftuch an öffentlichen Schulen verboten werden?
10.1 Die erste empirische Kopftuch-Studie
11. Quellenverzeichnis
1. Einleitende Worte:
Aus den beiden Hauptquellen des Islam, Koran und Sunna, lassen sich gewisse Vorschriften für ein islamgemäßes Kleiden ableiten. Dabei geht es um Vorschriften – bezüglich beider Geschlechter – sich „sittsam“ zu kleiden, wie wir weiter unten sehen werden.
Was jedoch ist mit sittsam gemeint?
Damit ist gemeint, wie dies auch in islamischen Rechtsquellen zu lesen ist, keine durchsichtige, keine zu weit geschnittene oder enge Kleidung zu tragen, welche die Körperkonturen zeigen (außer, dass eine enge Kleidung die Körperkonturen hervorhebt und so zum Reiz beiträgt, hemmt es auch eine optimale Durchblutung des Körpers). Im Allgemeinen ist damit gemeint, keine allzu auffällige (reizende oder prunkvolle) Kleidung zu tragen. Außerdem wird empfohlen, saubere Kleidung zu tragen. Die „Übergewänder“ (arab. „Djâlabib“), wie sie in Sure 33:59 erwähnt werden, erläutert der Prophetengefährte Ibn Abbâs folgendermaßen: „Der Djilbâb ist ein Überwurf, der den Körper von oben bis unten verhüllt.“ Die Erläuterung der Quellen wird weiter unten erfolgen.
Des Weiteren sei auf folgenden Sachverhalt hinzuweisen: Der hierzulande verwendete Begriff „Kopftuch“ begrenzt und beschränkt das Thema einmal nur auf das Stofftuch, dass sich auf dem Kopf befindet und andererseits nur auf die Frau. Das Thema müsste eigentlich lauten „Kleidung“ bzw. im islamischen Kontext „islamische Kleidung“. Das Arabische „sitâr“ (abgeleitet aus dem Verb „satara“ für bedecken, verhüllen, verstecken, schützen) bedeutet „Schleier“, aber auch „Vorhang“ und bezeichnet die Bedeckung des Körpers im Allgemeinen, also nicht nur des Kopfes. Der koranische Begriff „khimâr“, wie wir ihm in Sure 24, Vers 31 begegnen, bezeichnet wiederum im Speziellen den „Kopfschleier“ (vgl. Wehr, Hans: Arabisches Wörterbuch. Wiesbaden 1977, S. 235).
Was eine islamische Kleiderordnung anbetrifft, spielen viele Aspekte eine Rolle, die berücksichtigt werden müssen. Hier seien zumindest folgende genannt:
anthropologisch;
kulturell;
gesellschaftspolitisch;
historisch;
wirtschaftlich/sozial;
individuell/psychologisch;
Oftmals sind diese sechs Aspekte schwer voneinander zu trennen.
Die LeserInnen werden sich vielleicht fragen, warum der „religiöse Aspekt“, bzw. der „politische Aspekt“ fehlt, mit dem hierzulande Kopftuchgegner häufig argumentieren. Die sichtliche Zunahme der Religiosität unter Muslimen und das Tragen des Kopftuches, besonders auch in Westeuropa, wird durch Medien nicht selten als „politisches Symbol“ gedeutet und gewertet. Diese Annahme ist durch soziologische Untersuchungen widerlegt worden (vgl. z.B.: „EuroPhantasien: Die islamische Frau aus westlicher Sicht“ von Irmgard Pinn und Marlies Wehner. Duisburg 1995). Für die türkische Soziologieprofessorin Nilüfer Göle (Istanbul/Berlin) ist das Kopftuch ein Zeichen des Selbstbewusstseins, welche gleichzeitig die Botschaft vermittele: „Wir lassen uns nicht assimilieren!“ Außerdem sei das Kopftuch kein Symbol einer politischen Bewegung, sondern Zeichen einer Kulturbewegung (Vgl. Focus 32/1997, S. 47-48).