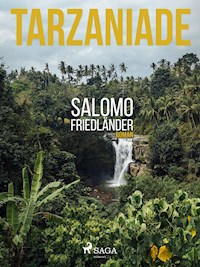Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Die Sammlung enthält außer der Titelgeschichte die Grotesken "Der Nachtkübel als Lebensretter", "Die Kunst, sich selber einzubalsamieren", "Die Jungfrau als Zahnpulver", "Beschreibung meiner Braut", "Der Greis in der Versammlung", "Warum ich immer so traurig bin", "Deine Unterhosen sind schön", "Der Sonnenmissionar", "Der verliebte Leichnam", "Greis und Mädchen", "Das Unglück im Winkel". Mynonas Grotesken verbinden das Heitere und Ernste, das Komische und das Grausige, das Tiefsinninge und Banale in paradoxem, humoristisch-ironischem Spiel. Schrankenlose Fantasie verbindet sich mit scharfer, spöttischer Zeitkritik.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 77
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Salomo Friedländer
Mein Papa und die Jungfrau von Orléans
Nebst anderen Grotesken
Saga
Das Kreuz muß präzis lotrecht errichtet werden, damit das Opfer den Sättigungagrad der Qual erreiche.
(Mynona, Bank der Spötter.)
Der Nachtkübel als Lebensretter.
Rosen hauchte die Nachtampel über die Schläferin, deren zarter, junger Mädchenkopf auf weißseidenen Spitzenkissen anmutig gebettet war. Und doch schlief der dazu gehörige sehr schöne Rumpf genau so wie der Kopf den Schlaf des Ungerechten. Das Gewissen dieser ... Jungfrau schien aber ein nicht minder sanftes Kissen zu sein als das seidene, worauf ihr Kopf ruhte. Sie schlief äußerst solide, trotzdem sie ein weiblicher Don Juan niederträchtigster Sorte war. Ihr allerletztes Opfer war der berühmte Schrupp, einer der größten Stahlfabrikanten. Sie hatte ihn dermaßen ausgesaugt, daß er hausieren gehen mußte. Dafür aber besaß sie jetzt einen geradezu kaiserlichen Diamantschmuck.
Ihr derzeitiger Verehrer und Lebensbegleiter war ein entsetzlich magrer alter Graf Racker von Deibel. Selbstverständlich betrog sie ihn tüchtig mit etwa sechs jungen Herren. Unter diesen befand sich der äußerst eifersüchtige Schauspieler Ayßler. Ayßler nun fand nicht den geringsten Geschmack am Grafen Racker von Deibel, welchen Dégoût dieser übrigens von ganzem Herzen erwidert haben würde, wenn er von den Beziehungen Ayßlers zu seiner Geliebten etwas gewußt hätte. Als aber eines Abends Ayßler ausgerechnet den Othello spielte, also seine Muskeln mit glühender Eifersucht geradezu innervierte, bemerkte er in der Fremdenloge dicht über der Bühne den Grafen mit der blonden Wanda. Die Folgen waren verhängnisvoll. Zunächst stürzte Ayßler in der Zwischenpause nach der Loge; fand diese aber bereits leer. Weder in den Wandelgängen noch im Vestibül noch am Büfett entdeckte der doppelte Othello den Grafen und dessen Liebchen. Aber als er racheschnaubend, in vollem Kostüm, vor das Theatergebäude lief, zum Ergötzen der Nachbarschaft, erblickte er vor der Einfahrt den Grafen, wie dieser Wanda in ein Auto hob und ratternd mit ihr davonfauchte. Ayßler spielte die letzten Akte des Othello übernatürlich gut. Der Kritiker Klempner nannte ihn anderen Tages den überlegenen Konkurrenten der Wirklichkeit.
Andern Tages! Ja, das sagt man so leichthin! Allein andern Tages waren die Abendblätter bereits voll von einem der sonderbarsten und zugleich lächerlichsten Attentate, welche jemals stattgefunden haben. Ayßler brütete Rache. Nach der Vorstellung setzte er sich zu diesem Zwecke in einen Bouillonkeller, in dem die Verbrecherwelt verkehrte. Mord und Totschlag! Mord und Totschlag! so tickte es in ihm wie eine Uhr. Der Diamantenmarder Julius Potter schaute sich die ausdrucksvolle Miene Ayßlers mit wissenschaftlicher Neugierde forschend an. „Na?“ fragte er, „soll wo eingeknackt werden, Mensch? Was simulierste?“ Ayßler fuhr heftig auf; er wollte den Kerl barsch abfertigen, besann sich aber. Denn erstlich hätte man im Lokal allseitig Partei gegen ihn ergriffen; es hätte übel für ihn ablaufen können. Zweitens durchzuckte ihn der Gedanke eines Racheplans, den er vielleicht mit Potters Hilfe ausführen könnte. So bezwang er seinen Widerwillen, stellte sich freundlich, ließ Bier kommen, und beide Herren verhandelten gemütlich. „Also heraus mit der Sprache. Was soll’s gelten?“ „Hören Sie mal, Sie können doch Häuser- und Wohnungstüren öffnen?“ „Na allemal! Es fragt sich nur, ob was dabei raus kommt: ich sammle Diamanten.“ Ayßler fuhr es durch den Kopf, wie herzlich der Wanda der Verlust ihres Schmuckes zu gönnen wäre. Selbstverständlich überließer diesen Teil des Geschäftes Herrn Potter. „Diamanten“, sagte er deshalb, „sind Ihre Sache. Sie finden dort welche in Menge. Machen Sie meinethalben damit, was Sie wollen; mich lassen Sie damit aus!“ „Desto besser!“ strahlte Potter, „aber was wollen Sie denn eigentlich?“ „Ein Weibsbild will ich,“ zischte Ayßler, „das mich betrogen hat, verdenkzetteln.“ „Ach, das wird ja ein quietschvergnügter Abend,“ lachte Potter, „wolln wir los?“ Beide machten sich auf den Weg.
Eine herrliche Vollmondherbstnacht kontrastierte stimmungsvoll mit den Seelen des entmenschten Paars. Potter erschloß Wandas Haustüre mit graziösester Gewandtheit. Die Wohnungstür drehte sich bereits geräuschlos in der Angel, als Ayßler, der dem Treppenschnelläufer Potter kaum nachkommen konnte, oben angelangt war. Sie tappten sich durch den Korridor, Ayßler kannte ja den Weg. Im übrigen kümmerte er sich nicht mehr um Potter; er hatte Wichtigeres zu bedenken: Mord und Totschlag! — Rosen hauchte die Ampel über die Schläferin. Potter guckte nur flüchtig hin: „Wo sind die Diamanten?“ fragte er energisch. „Such’ sie dir selbst,“ schrie Ayßler so grob, daß Wanda im Schlafe zusammenschrak. Potter war ein raffiniert spürsinniger Diamantenfinder, er roch die Dinger förmlich, steckte sie zu sich und ließ Othello mit Desdemonen allein. (Er ist heute bereits in Australien.) Ayßler aber rüttelte Wanda an ihrer lieblichen Schulter auf. Sie erwachte und starrte ihn entsetzt an. Als sie ihn aber einen Revolver entsichern und hochheben sah, griff sie mit blitzschneller Bewegung unters Bett und erhob — tausendmal Verzeihung! — ihren auffallend blanken Zuber. Potter stutzte unwillkürlich, brach aber sofort in ein gräßliches Othellogelächter aus. „Stirb! infame Verräterin! Hure! Mörderin meines Herzens.“ Darauf drückte er den Revolver fünfmal auf Wanda ab; es gab jedes Mal einen helleren Klang. Als die Patronen verschossen waren, schwang sich Wanda lebendig, den Zuber mit der Linken wie einen Schild vor sich haltend, aus dem Bett, legte ihren rechten Arm auf Ayßlers Schulter und lächelte ihn so liebreizend an, daß er laut aufweinte, eine solche Geliebte nicht für sich fesseln zu können. Die sentimentale Reaktion trat bei ihm ein. Erlöste Wandas Hand von seiner Schulter und verließ, das Taschentuch vorm Auge, das Lokal.
Noch am selben Tage ließ ihn Wanda verhaften: nicht nur wegen Mordversuches, sondern — o Sensation! — wegen Diamantenraubes. Er konnte sich nicht rechtfertigen. Racker von Deibel bezahlte Wanda den geschicktesten Rechtsanwalt. Der machte sich über Pottern lustig, nannte ihn den allzu bekannten „großen Unbekannten“ und spottete sogar des Namens. Psychoanalytisch deute Potter auf Pott, lächelte er arglistig. Die ganze Residenz lachte über das Panzerplattennachtgeschirr, welches Wanda einer Champagnerlaune Schrupps verdankte. Den Diamantenschmuck hat Wanda nicht wiederbekommen. Racker von Deibel verkaufte drei Rittergüter, um ihr einen neuen zu geben. Sie aber — Wunder der Weibsnatur! — verpfändete ihn für Ayßlern, den sie als unzurechnungsfähig erklären und in ein Sanatorium bringen ließ, dessen Leiter ihr jede gewünschte Besuchszeit gern gewährte. — Seit diesem Vorfall kommen sich elegante Kokotten ohne stählernen Nachtkübel so unvollständig vor. —
Die Kunst, sich selber einzubalsamieren.
Mein Haus war abgebrannt und nicht versichert gewesen. Als ich nach meiner Bank ging, hatte dort schon jemand statt meiner mein ganzes Guthaben für sich abgehoben. Auf der Post nahm ich drei Telegramme in Empfang. Im ersten stand der Tod meines besten Freundes, im zweiten enterbte mich mein Großonkel, weil er wieder heiratete; nebenbei gesagt, meine letzte Möglichkeit, jemanden zu beerben, war damit höchstwahrscheinlich verschwunden. Aus dem dritten Telegramm erfuhr ich den plötzlichen Tod meiner Braut.
Ich stand nun, da Eltern und Geschwister mir längst gestorben waren, mein Freund soeben mich verlassen hatte, desgleichen meine liebe Braut, und ich meinem Großonkel von Herzen fluchte, mutterseelenallein auf der Welt. Das passiert ja so manchem. Aber mir war es doch allzu gut ergangen: ich hatte mich an das gemütlichste, behaglichste Leben gewohnt. Und nun? Mein ganzer Besitz bestand in dem, was ich auf dem Leibe trug; in meinen Taschen steckten etwa fünf Mark und ein paar Pfennige. Schulden bedrohten mich überdies, und zum Kampfe ums Dasein fühlte ich mich nicht im mindesten fähig. Dabei war ich ein dicker, schöner, blonder Mann mit Bonvivantmiene, und mein angeborenes Stilgefühl verbot mir den mimischen Ausdruck der Verzweiflung, welche sich meiner bemächtigte. Trotzdem muß etwas davon sichtbar geworden sein, denn mir begegnete folgendes: Ich beschloß, eine Art Henkersmahlzeit einzunehmen, und wählte, um mit meinem letzten Gelde auszulangen, ein mittleres Speisehaus. Ich hatte nicht sobald einen Teller Suppe vor mir, als ich mich mit einer sonderbaren Teilnahme fixiert sah. Ich aß außergewöhnlich langsam; zwischen Löffel und Löffel machte ich lange Pausen voller Nachdenklichkeit. Vielleicht war das dem dürren langen Herrn mit Magistergesicht am Nebentische aufgefallen. Jedenfalls begegnete ich seinem merkwürdigen, sich tief in meine Augen einbohrenden und sie gleichsam zwangsweise festhaltenden Blicke. Während der nächsten Gänge gerieten wir öfter und öfter in dieses eigentümliche Duell. Bis ich — was hatte ich zu verlieren? — es müde wurde und einfach fragte: „Was wollen Sie?“ Er meckerte und hüstelte ein entschuldigendes Lachen: „Es ist nicht so ganz einfach, das zu erklären. Würden Sie mir gestatten, mich zu Ihnen zu setzen? Oder darf ich Sie bitten, an meinem Tische Platz zu nehmen?“ Mir war dieser Zwischenfall eigentlich willkommen; er lenkte mich wohltuend von meiner fruchtlosen Grübelei ab. Ich bat den Alten, da nicht ich von ihm, sondern er von mir etwas zu verlangen schien, an meinen Tisch. Er kam, in einer etwas zitterigen Hand ein Glas Wein haltend, auf mich zu, setzte sich mir gegenüber, nippte am Getränk, machte aber noch keine Miene, sich auszusprechen. Wir beschäftigten uns ein paar Minuten schweigsam mit unserm Mundvorrat. Endlich fragte ich: „Fällt es Ihnen denn so schwer, mir anzuvertrauen, weswegen ich Sie interessiere? Lassen Sie doch hören!“