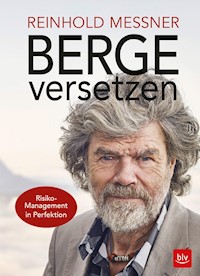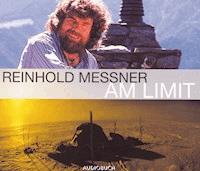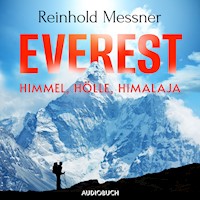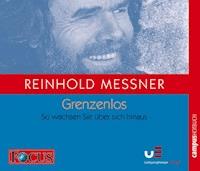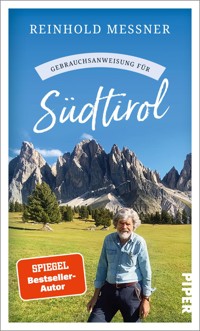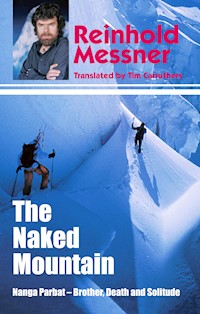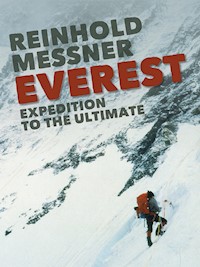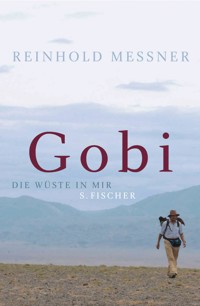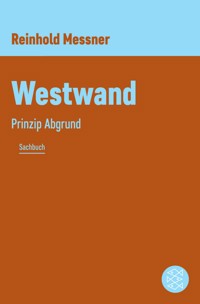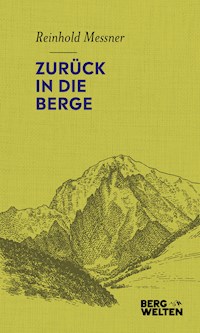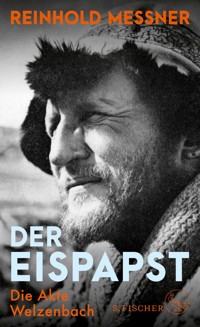12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er ist der berühmteste Bergsteiger der Welt, seine Erfolge sind legendär, seine Auftritte spektakulär. Reinhold Messner steht immer schon im Fokus der Medien, die das wahre Wesen des Extrembergsteigers, Biobauern, Wüstenwanderers, Europapolitikers und Museumsgründers zu fassen versuchen. Die Zusammenschau der aussagekräftigsten Interviews und persönlicher Texte von Messner selbst – Expeditionsberichte, Reportagen, Essays – macht den Grenzgänger greifbarer denn je: Sie zeigt einen kompromisslosen Werdegang, offenbart dessen Brüche, verrät Messners tiefste Gedanken und den Weg zu sich selbst. Das Kaleidoskop eines Lebens, authentisch und aufregend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.malik.de
Herausgegeben von Ralf-Peter Märtin Mit 38 farbigen Abbildungen und 62 Schwarz-Weiß-Fotos
ISBN 978-3-492-97172-0 April 2017 © Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2006 Herausgeberschaft und Redaktion: Dr. Ralf-Peter Märtin, Frankfurt am Main Covergestaltung: Dorkenwald Grafik-Design, München Coverabbildungen und Innenteilfotos: Archiv Reinhold Messner Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
He noblest lives and noblest dies who makes and keeps his self-made laws.
RICHARD FRANCIS BURTON
Einleitung
Grenzgang als Zustand und Philosophie
Das Ziel der Grenzgänger vergangener Zeiten – zu Beginn des 20. Jahrhunderts nannte man sie noch Abenteurer – war es, die letzten weißen Flecken auf den Landkarten zum Verschwinden zu bringen. Ihnen ging es um die Pole: Nordpol, Südpol und um den Mount Everest, der damals als dritter Pol oder Ostpol bezeichnet wurde. Viele der Zeitgenossen haben sich mit ihren mutigen Landsleuten identifiziert, die stellvertretend für ihre Nation sich in die wüsten, lebensfeindlichen Landschaften hinausbegeben haben, um als Erste die Fahne ihres Landes dahin zu tragen, wo noch keiner gewesen war.
Damit hat meine Form des Grenzgangs nichts zu tun. Ich habe nie irgendwelche Fahnen mitgenommen, und 1978, gerade vom Mount Everest zurück, habe ich in Südtirol das Sakrileg begangen, in einer feierlichen Dankesrede zu erklären, dass höchstens ein Taschentuch meine Fahne sei. Denn wenn ich auf einem großen Berg stehe, bin ich zu klein für heroische Gebärden. Das hat mir viel Häme eingebracht, aber nach wie vor stehe ich zu dieser antinationalistischen Haltung des Grenzgängers. Gerade in der heutigen Zeit, denn wir haben nicht das Recht, ferne Orte in Besitz zu nehmen. Wir haben die Berge nicht als Kolonialreiche unter unseren Füßen, sondern betreten sie nur kurz, als Gäste. In Südtirol, wo es allerorten kreuzelt, wo die Berge mit Gipfelkreuzen verschandelt sind, gilt eine solche Haltung als ketzerisch. Aber gerade deswegen habe ich mich bemüht, den Wüsten, den Meeren, den Eiswüsten und den großen Höhen mit Demut und Respekt zu begegnen. Also habe ich angefangen, mit Beinen und Händen zu philosophieren, mit fliegenden Lungen zu denken und mit der »Geschwindigkeit des Fußgängers« – mein Freund Christoph Ransmayr soll zitiert sein – die Welt zu erfahren. Wir Menschen sind nicht dafür geboren, im Fliegen oder aus dem Auto heraus die Welt zu sehen, zu ertasten und zu hören. Alles geht dabei zu schnell. Unsere Sinne sind die Sinne von Fußgängern. In der Geschwindigkeit des Zu-Fuß-Unterwegsseins, des Hinaufsteigens, des Hinausgehens erkennen wir etwas über uns und die Welt.
Ich weiß, dass die Globalisierung alles Ferne und Fremde verschluckt. Wir erhalten durch die virtuellen Welten des Internets, durch Fernsehen und Kino den Eindruck, dass wir die ganze Welt kennen und im Nu auch erreichen können. Die Welt ist zum Zoo geworden oder zum Disneyland. Die Auseinandersetzung Mensch – Natur, die Begegnung Mensch – Berg findet leider kaum noch statt. Heute sind Nord-, Süd- und Ostpol-Reisen möglich. Der Everest wird im Reisekatalog angeboten, er ist zur Handelsware geworden. Die kommerziellen Expeditionen, die Big E, so der höchste Gipfel der Welt im Englischen, zum Highway-Trip, zu einer Art Angebot von der Stange gemacht haben, suggerieren größtmögliche Sicherheit. Dabei leisten beim Aufstieg Sherpas die Hauptarbeit. Zum Südpol kann man fliegen, und amerikanische Wissenschaftler haben dort seit 50 Jahren eine Station. Täglich fliegen Maschinen ein, um sie zu versorgen. Fast scheint es, als ob dort Heimat wäre. Auch der Nordpol ist per Flugzeug oder Hubschrauber erreichbar, oder die Reisenden benutzen komfortable atombetriebene Eisbrecher. Jedes Jahr sind es Tausende, die dem Kitzel frönen, die krachenden, hämmernden, sägenden Eisschollen zu hören, während das sichere Schiff das zwei Meter dicke Eis im Polarmeer Richtung Nordpol durchbricht.
Wir alle umrunden heutzutage die Welt als Touristen. Wir tun es schon seit etwa 40 bis 50 Jahren. Lange bevor die globalen Geldströme die Welt umkreisten, hat der Tourismus die Welt erobert. Die Revolution der Kommunikation tut ein Übriges. Von jedem Punkt der Erde können wir uns mit einem Satellitentelefon mit jedem anderen Punkt der Erde in Verbindung setzen. Die Abenteuer, die früher notwendig waren, um zum Nordpol, zum Südpol, in den Dschungel oder auf die großen Berge zu kommen, die notwendig waren, um Ozeane zu überqueren, sind heute keine Abenteuer mehr. Seit Neckermann Abenteuerreisen anbietet, habe ich das Wort Abenteuer aus meinem Wortschatz gestrichen. Die allermeisten Abenteuer, die heute im Fernsehen oder auch im Vortrag angeboten werden, sind Inszenierungen, die produziert werden wie Events in einem Freizeitpark. Gemacht für eine abenteuerhungrige Menschheit, die sich Abenteuer vorführen lässt, weil ihr selbst der Mut fehlt, in die Wildnis hinauszugehen. Aber die meisten »Abenteurer« gehen der Wildnis ebenso aus dem Weg wie jene Touristen, die Flugzeug und Reisebüro benutzen, um an die Orte zu kommen, wo sie ihre Träume vermuten. Früher ein Ausdruck für das Schwierige, Harte, Selbstverantwortete, ist der Begriff Abenteuer zum Schlagwort verkommen, um sich vom »normalen« Touristen abzusetzen.
Für mich persönlich ziehe ich den Begriff Grenzgänger vor. Der ist vor allem dadurch definiert, dass er mehr Künstler ist als alles andere. Ich weiß, das klingt etwas überheblich, aber ich werde versuchen klar zu machen, warum ich mich Künstlern mehr verwandt fühle, als meinen Abenteurergenossen. In einer Risikovermeidungsgesellschaft ist es nicht möglich, Abenteuer zu erleben. Die weißen Flecken auf der Landkarte sind alle erschlossen. Eine Welt, die vom Satelliten aus bis ins kleinste Detail vermess- und fotografierbar ist, bietet keine Dimension Wildnis im ursprünglichen Sinne mehr. Wir dürfen heute auf dieser Erde kaum noch von Wildnis sprechen. Aber es gibt sie noch, die weißen Flecken: Sie sind in uns selbst. Und für diese weißen Flecken lohnt es sich, hinauszugehen in jenen Bereich, der für den Menschen nicht gemacht ist.
Der Mensch ist ein Mängelwesen, und wenn er diese Tatsache akzeptiert und sich trotzdem in Gefahr begibt und diese nicht portionieren, also in Stücke schneiden will, indem er Seilbahnen baut, Flugzeuge benutzt, überall seine Sicherheitsnetze auslegt, dann bietet diese Wildnis nach wie vor die Chance, zu den eigenen inneren Wüsten zu finden. So sind für mich die Berge und die arktische Nacht als Wüsten nur Entsprechungen dessen, was auch in mir wüst, dunkel oder nicht greifbar ist. Wenn ich hinausgehe in die Wüsten, dann fehlt das Wasser. Wenn ich ins arktische Polarmeer gehe, fehlt in der Winterzeit das Licht. Wenn ich in die Antarktis gehe, fehlt die Wärme. Wenn ich in den Dschungel gehe, dann fehlt die Orientierungsmöglichkeit. Wenn ich eine steile Felswand hinaufklettere, fehlt mir der Boden unter den Füßen. Wenn ich auf den Everest hinaufsteige ohne Maske, dann wird der Sauerstoff knapp. Es fehlen also jene Elemente, die wir zwingend zum Leben, zum Überleben brauchen. Entziehen wir unserem Habitat, unserer Welt nur eines dieser Elemente, haben wir einen Mangel, und wir werden mit unseren Begrenztheiten, mit unseren Zweifeln und Ängsten und relativ schnell auch mit Hoffnungslosigkeit konfrontiert. Allein darum geht es beim Grenzgang.
Grenzgänger zu sein bedeutet nicht, Grenzen zu verschieben, bedeutet nicht, neue Grenzen zu erreichen. Es bedeutet in erster Linie, seinen eigenen Grenzbereich auszuloten und zu erkennen, dass es jenseits ein Mehr von Möglichkeiten gibt, die uns nicht zugänglich sind, die sich uns entziehen. Wir sind die Eroberer des Nutzlosen – ich nehme das für mich in Anspruch. Es ist nicht notwendig, auf den Everest hinaufzusteigen. Es bringt der Menschheit gar nichts, wenn wir die Antarktis oder Grönland der Länge nach durchqueren. Es ist nicht notwendig – es ist nur möglich. Zu entdecken gibt es dabei eigentlich nichts, zumindest im geographischen Sinne nicht, und zu erobern schon gar nichts, aber zu erleben gibt es etwas. Wir können uns an den Bildern satt sehen, an der Stille satt hören. Wir können unseren Hunger spüren, und wir erleben, welche Ängste, Zweifel, Hoffnungen über uns kommen, wenn wir draußen sind.
Ich habe schon als 20-jähriger Bursche erkannt, dass das Klettern im Fels und später in der großen Höhe nur dann sinnvoll ist, wenn ich es neu erfinde. Wäre ich nicht fähig, in jede meiner Touren, in jede meiner Besteigungen Sinnhaftigkeit hineinzulegen, dann würde ich nicht weit kommen. Ähnlich einem Künstler, der einer Vision folgt, erfinde ich im Zeitpunkt meines Aufbruchs zur Tat ihren Sinn. Dieser Sinn entsteht in mir selber, er fällt nicht vom Himmel, und er erlaubt mir, die Tour zu machen im Bewusstsein, dass sie zu dieser Zeit sinnvoller ist als alles andere. Nachher kann ich aus der Distanz darüber lächeln, sie relativieren, sie als Erfahrung analysieren.
Als Grenzgänger habe ich den Verzicht entdeckt, weil die Technik schon seit 50 Jahren alles zugänglich gemacht hat. Bis zum Rand der Erde, dort, wo wir nicht hingehören. Mit Bohrhaken können Sie jede Felswand der Erde erklettern. Mit dem Sauerstoffgerät können Sie jeden Berg der Welt besteigen. Mit Flugzeug oder Motorschlitten ist es keine große Kunst, Touristen bis zum Südpol zu bringen oder mit dem Eisbrecher zum Nordpol. Alles kein Problem. Es wird aber ein Problem, wenn wir freiwillig diese Hilfen und die moderne Technik nicht nutzen. Deswegen habe ich den Verzicht angestrebt, und mir selbst Regeln auferlegt, beispielsweise immer dorthin zu gehen, wo die anderen gerade nicht sind, ohne Infrastrukturen auszukommen und keine Spuren zu hinterlassen. Aus diesen Gründen ist für mich der Everest kein wünschenswertes Ziel mehr, nachdem er Jahr für Jahr von Tausenden von Sonntagsbergsteigern berannt wird. Ich will nicht Natur umbauen, um sie kurzfristig als mein Spielfeld zu benutzen und vorgegebene Wege sind keine Wege, um Erfahrungen zu machen.
Der Weg über Eis, Fels und Gletscherspalten ist immer auch ein Eindringen in die eigene Befindlichkeit.
Auf meinen Wegen, die im Gehen entstehen, entstehen auch Linien, Linien in meinem Kopf. Das sind die Kunstwerke, die ich hinterlasse. Sie sind weder sichtbar noch hörbar, noch greifbar. Es ist die Erschaffung des Nichts. Die Linie, die ich bei meinem Marsch zusammen mit Arved Fuchs gelegt habe, von der südamerikanischen Seite der Antarktis über den Südpol bis an die neuseeländische Seite ans Rossmeer, 2800 Kilometer über Eis, durch Gletscherbrüche, über Berge, über Pässe – wo ist sie? Nichts ist geblieben. Die Spur, die damals ein paar Wochen im Schnee zurückgeblieben war, die Spur unserer Skier, die Spur unserer Schlitten, ist lange verweht. Auch in den Bergen gibt es keine Linien, die man sehen könnte, denn ich habe sie nicht mit Farben markiert. Das haben die Alpenvereine im letzten Jahrhundert getan: Routen, Steige markiert. Ich habe mir das immer erspart, weil ich der Meinung bin, dass die Linien im Kopf wichtiger sind. Die Wildnis, die Berge und Wüsten sollen Räume für unsere Fantasie bleiben und dürfen eben nicht Heimat werden. Meine Spur ist also kein konkreter Ort, keine bleibende Linie, sie ist nur eine Linie in meiner Vorstellung, in meiner Erinnerung.
Jede Erstbegehung, die ich geklettert bin, ist für mich im Kopf eine Linie geblieben, und ich kann sie an die Stirnseite, in mein Bewusstsein projizieren. Nur für mich, für alle anderen bleibt sie unsichtbar. Die Höhenmeter bedeuten gar nichts. Die Schwierigkeitsbewertungen sind nur eine menschliche Norm. Die Koordinaten der Pole sind Hilfskonstrukte, damit wir uns nicht ganz verlieren. Die Achttausender, mit denen ich in Mitteleuropa berühmt geworden bin, sind eine reine Erfindung. Hätte Napoleon, als er den Meter festlegte, das Maß ein bisschen länger gemacht, gäbe es nur drei bis vier Achttausender, und ich hätte es leichter gehabt. Hätte er ihn aber ein bisschen kürzer gemacht, ein paar Zentimeter hätten gereicht, dann gäbe es viel mehr Achttausender, und ich hätte sie vermutlich nicht geschafft. Ich muss also Napoleon dankbar sein, dass nicht mehr als vierzehn Achttausender entstanden.
In den Bergregionen, in den Eis- und Felswüsten oder in einer Dolomitenwand, die vielleicht nur tausend Meter hoch ist, in der wir aber das Ausgesetztsein besonders stark empfinden, weil der Abgrund gähnt, sind wir in einer Arena der Einsamkeit. Ohne störenden Filter, ohne Technik gewinnen wir in dieser Begegnung Mensch – Natur ein neues Raum-Zeit-Verhältnis. Als ich die Antarktis durchquerte, hatte ich die Empfindung, dass ich nicht Monate, sondern Jahre, im Grunde genommen ein Leben lang unterwegs war. Und heute, im Rückblick, ist meine Zeit dort wie ein eigenes Leben, ein Aufenthalt wie auf einem anderen Stern.
Je älter ich werde und je öfter ich aufbreche, desto größer wird mein Respekt vor diesen menschenfeindlichen Welten. Beim Felsklettern, der ersten Phase meines Lebens als Grenzgänger, stieg ich in der Senkrechten, und mir wurde klar: Je höher und schwieriger ich klettere, umso tiefer kann ich in mich hineinschauen und in meine Ängste. Je höher ich am Berg kam, umso größer wurde mein Überblick, nicht nur über das eigene Leben, sondern auch über die Welt. Bei diesem Hinaufsteigen versuche ich, mein Maß zu finden. Der Schlüssel liegt für mich im Zurückkommen in die Niederungen. Ich brauche nach einer bestimmten Zeit des Daheimseins, des Eingebettetseins in Kreativität und Arbeit wieder den Abschied und das Hinausgehen in verlassene Habitate.
Vor Jahren habe ich eine Erfahrung gemacht, die mir eine mögliche Zukunft des Grenzganges zeigte. Ich war in der Mongolei. Aus der Mongolei haben sich die Sowjetrussen in den 90er-Jahren zurückgezogen. Sie hatten dort überall Schulen, kleine Fabriken und Krankenhäuser gebaut. Diese künstliche, hoch subventionierte Infrastruktur war vollständig zusammengebrochen. Die Schulen hatten keine Fenster mehr, die kleinen Kliniken waren aufgelöst, die Fabriken Ruinen. Und ich habe es sehr sonderbar empfunden, zu sehen, wie die Städte wüst fielen. Ich marschierte durch menschenleere Häuserschluchten und begann mir Häusermeere vorzustellen, die nie mehr bewohnt sein werden. Städte wie in der Mongolei, aus der sich die Techniker und Investoren zurückgezogen haben. Vielleicht wird das Abenteuer, der Grenzgang der Zukunft genau an solchen Plätzen stattfinden. In der sibirischen Einöde oder in Kanada, in den aufgegebenen verseuchten und verschmutzten Zonen der Öl- und Bergwerksindustrie oder in den durch chinesische Atomwaffenversuche verstrahlten Gebieten der Takla Makan. Dort werden Gefahren ganz anderer Art auftauchen, und man wird anderes zu lernen haben als im arktischen Ozean oder im Dschungel, meine Erfahrungen aber werden die gleichen sein, die ich erlebe, wenn ich dorthin gehe, wo ich nicht hingehöre, um zu erkennen, dass die größten Wüsten in uns selbst liegen.
Quelle: Eröffnungsrede zur Ausstellung im Leipziger Museum für bildende Künste »Desert & Transit« am 15. 11. 2000.
Berg in mir
Berge: Landschaften meiner Seele
Zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen gehören jene warmen, trockenen Frühlingstage, als meine Geschwister und ich an den steilen Waldhängen herumtollten, in jenen dichten Bergwäldern, die mein Heimatdorf im Südtiroler Villnößtal umsäumen. Wir haben Häuschen gebaut, sind auf alle möglichen Bäume gekraxelt und haben Eichhörnchen gejagt. Lange bevor wir zu meinem Vater in die Schule kamen – er war Leiter der Dorfschule –, mussten wir hinaus und Brennholz nach Hause bringen. Wir haben Kleinholz und Fichtenzapfen in Säcken gesammelt und diese bis ins Dorf geschleift, weil wir sie noch nicht tragen konnten. Gewohnt haben wir im unteren Teil von St.Peter, einem langgestreckten Straßendorf, zu dem damals nicht mehr als fünfzehn Häuser – in der Mehrzahl Bauernhöfe – gehörten. Daneben gab es nur noch die Schule, ein Gasthaus, eine Metzgerei, einen Kolonialwarenladen und natürlich auf einer Anhöhe eine Kirche. Die Bauern nannten uns »Dorfräuber«, weil wir bei unseren Streifzügen weder ihre Wiesen und Wälder noch ihre Heustadel schonten. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in dieser Zeit Angst gehabt hätte, es könnte uns draußen etwas zustoßen, wir könnten nicht mehr nach Hause finden. Nur einmal habe ich mich gefürchtet, als meine Eltern mit meinem älteren Bruder und mir ziemlich hoch zu einem Waldstück, das der Mutter gehörte, hinaufgestiegen sind. Als wir Kinder nicht mehr laufen konnten, haben uns die Eltern an einem geschützten Platz zurückgelassen. Zuerst waren wir beide ganz still, doch dann haben wir gebrüllt und geschrien, bis die Eltern wieder zurückkamen.
St.Magdalena in Villnöß mit den Geislerspitzen. Unter ihnen der düstere Waldhügel von Gschmagenhart.
Zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen gehören die Sommermonate, die ich zusammen mit meiner Familie über viele Jahre hindurch auf der Gschmagenhartalm verbrachte, einer Hütte oberhalb des Villnößtals, auf einer riesigen Wiese gelegen, direkt zu Füßen der Geislerspitzen, jener langen Gipfelreihe mächtiger, zerklüfteter Berge, die wie riesige Kirchtürme in den Himmel ragen. Hier war meine Welt, die Welt meiner Berge. Bis heute ist dieses Fleckchen Erde mein Lieblingsplatz in den Dolomiten geblieben.
Im Sommer, bevor ich in die Schule kam, ich war damals fünf, hat mich der Vater auf den höchsten Gipfel der Geislerspitzen, den Saß Rigais (3027Meter), mitgenommen. Der Vater hat uns erklärt, dass über uns andere Bergsteiger Steinlawinen auslösen könnten und wir uns deswegen immer unter Überhängen verstecken müssten, sobald wir das Poltern hören würden. Oben, beim richtigen Klettern, sollten wir selbst vorsichtig sein, weil das schmelzende Eis das Gestein gelockert hätte. Das Überqueren des Geröllfeldes bis zum Fuß der Steilwand war mühsam. Immer wieder habe ich die Eltern gefragt: »Wie weit ist es noch?« Als wir die Felswand erreicht hatten, begann die richtige Kletterei. Der Vater hat das Seil aus dem Rucksack geholt, und wir sind in eine steil aufragende Rinne eingestiegen. Kurz vor dem Gipfelkreuz mussten wir über einen schmalen Grat: Rechts fiel die Wand steil ins Tal ab, und links gähnte ein schwarzes Loch. Da wurde mir doch angst und bange, und ich war froh, dass mich ein Bergsteiger, der talwärts ging, an der Hand genommen und über die schwierigsten Stellen geführt hat. Wie war ich müde, als wir endlich auf dem Gipfel rasten konnten, aber doch sehr stolz, dass wir es geschafft hatten! Dann habe ich runtergeschaut: Ganz weit unten waren die Almwiesen, ringsum die anderen Gipfel. Ich hatte das Gefühl, das ist die Welt, viel größer ist die nicht. Damals wusste ich nichts von der Eiger-Nordwand, vom Nanga Parbat, vom Mount Everest.
Mit der Mutter und dem älteren Bruder Helmut auf der Brogles-Alm.
In den Jahren danach haben wir Kinder mit dem Vater fast alle Geislerspitzen kennen gelernt. Schon bald hatte ich das Gefühl, die Routen, die der Vater aussucht, schaffe ich allemal. Im Alter von zehn bis fünfzehn Jahren haben dann vor allem mein Bruder Günther und ich uns selbstständig gemacht. Wir haben uns einfach einen Gipfel vorgenommen, den wir noch nicht kannten, oder wir haben einen neuen Weg, eine neue Variante ausfindig gemacht. Oft haben wir uns überschätzt, mussten aufgeben, weil wir nicht mehr weiterkamen, vielfach haben wir uns in der Zeit vertan und haben gemerkt, wir schaffen es nicht mehr, wir müssen zurück. Aber in der nächsten Woche haben wir es wieder versucht. Mit jeder neuen Tour wurden wir sicherer, unser Erfahrungsschatz größer. Unser Instinkt, die Gefahren in Fels und Eis zu erkennen, wuchs. Wir bekamen ein Gefühl für Wetterumstürze, und wir wussten bald ganz genau, ob wir eine Eisrinne überqueren durften oder nicht. Bald konnte der Vater nicht mehr mithalten. Wir haben ihm nicht mehr geglaubt, wenn er uns erzählte, diese oder jene Wand sei unbezwingbar, weil er in seiner Jugend mit Kameraden es zwar versucht habe, sie aber nicht durchgekommen seien. Er hat uns Jungen erzählt, die Furchetta-Nordwand sei ohne Route, da käme niemand hoch. Da habe ich dann Tag und Nacht davon geträumt, alle diese Wände zu schaffen. Im Schlaf habe ich sie alle vor mir gesehen, und ich bin gestiegen und gestiegen. Es waren keine Angstträume, niemals bin ich abgestürzt. Mit 16 habe ich dann alle diese Wände gemacht, die der Vater nicht geschafft hatte, mit 19 sogar die Furchetta-Nordwand!
In diesen Jahren gab es für mich und meinen Bruder Günther nichts anderes als die Berge. Wir haben zu jeder Felswand, die wir erkletterten, eine ganz innige Beziehung bekommen. Im wahrsten Sinne habe ich damals in der Senkrechten gelebt, sie war für mich das Ein und Alles. Wenn mich damals jemand zu einer Expedition in den Himalaja eingeladen hätte, hätte ich abgelehnt und geantwortet: »Die klettern ja gar nicht, die stapfen doch nur durch den Schnee!« Damals interessierte mich das überhaupt nicht. Das Einzige, was mich interessierte, waren die überhängenden oder senkrechten Wände, die höchsten Schwierigkeitsgrade. Umso freier die Kletterei, desto befreiender das Gefühl, desto stärker die Lust, nur durch eigene Kraft und Fähigkeit und ohne größere Absicherung hinaufzukommen: Das war es!
Mit dem Vater beim Skifahren.
Der Vater hat uns gewähren lassen, weil wir ihn mit unserer Geschicklichkeit, mit unserem Schneid beeindruckten, vielleicht, weil er spürte, dass wir ihm nicht mehr gehorchen, dass wir immer wieder ausbrechen würden. Er hatte uns eine Menge beigebracht: Schultersicherung, am Standplatz einen festen Punkt zu bauen, Drei-Punkt-Regel, Kaminsteigen; er hat uns gezeigt, was eine Verschneidung, was ein Riss ist; wir haben gelernt, wie man Schneerinnen ohne Pickel und Steigeisen quert; er hat uns von der Schwierigkeitsskala erzählt; er wusste, was der erste, zweite und dritte Grad bedeutet, so weit reichten seine Erfahrungen, darüber hinaus war er als verantwortlicher Seilführer nicht mehr gekommen. Wir waren über ihn hinausgewachsen, nun ging er mit uns mit, er hat sich unserer Führung anvertraut.
In dieser Zeit fingen wir an, über die Geislerspitzen hinauszublicken. Oft haben wir uns zu viert getroffen, zwei Bauernburschen aus Villnöß – der Heindl Messner, ein entfernter Verwandter, und der Paul Kantioler, ein mutiger und starker Kerl –, mein Bruder Günther und ich, und wir haben von den großen Dolomitenwänden geschwärmt. Da haben wir schon ganz im sportlichen Sinne gedacht: Wir haben im Detail Pläne für Zweit- und Erstbegehungen gemacht, wir haben von den großen klassischen Wänden gesprochen, von dem damals höchsten, dem sechsten Schwierigkeitsgrad geträumt.
Mit jugendlichem Elan begann ich alles zu verschlingen, was ich von der alpinen Literatur in die Finger bekam. Ich kannte den »Alpinismus«, die damals führende Fachzeitschrift, und ich las »Das Bergsteigerblatt«, die Wochenbeilage unserer Südtiroler Tageszeitung. Vom Vater hatte ich den Dolomitenführer geschenkt bekommen, in dem sämtliche Informationen enthalten sind, wer welche Wand wann gemacht hat und in der die Routen anhand von Bildern beschrieben sind. Diese Bilder vor Augen, habe ich mir selbst neue Linien ausgedacht, neue Routen, die ich selbst verwirklichen wollte. Es waren möglichst schwierige Routen, die ich mit möglichst wenigen Haken meistern wollte, weil es mein Ehrgeiz war, schneller und eleganter als die anderen zu sein.
Mit meinem Bruder Günther habe ich immer wieder darüber gesprochen: Wir müssten eine Wand machen, die für unüberwindbar gilt. Wir wollten über den sechsten Grad hinaus. Tagelang haben wir mit dem Fernglas Routen erspäht, den Weg festgehalten. Und immer mehr haben wir uns vorgenommen: Wir müssen die ganze Route frei klettern. Dementsprechend mussten wir die Erstbegehung planen. Ich wollte nicht einfach bei jeder glatten Wand ein Loch bohren, einen Haken reinschlagen. Das fand ich unsportlich, weil man dann alles machen kann. Natürlich konnte ich mir nicht einfach jede Wand vornehmen, weil ich mit meinen Mitteln dann stecken geblieben wäre, aber mit ein paar Quergängen links oder rechts habe ich meine Routen geplant und später viele sehr schwere durchführen können.
Der Anfang im Fels
Wenn du an deine Entwicklungsjahre, an deine Schulzeit zurückdenkst, gab es da eigentlich etwas anderes für dich als Bergsteigen?
Sicher, ich habe die Schule anfangs ernst genommen. Ich hatte ja eine Verantwortung dem Vater gegenüber, der mich nach der Volksschule in Villnöß auf die Mittelschule in Dorf Tirol und danach in Bozen auf die Technische Oberschule geschickt hatte. Ich hatte schon das Bestreben, ich muss etwas lernen, ich muss ja etwas werden. So war ich ein recht fleißiger, eher einer von den besseren Schülern. Mit manchen Klassenkameraden hatte ich ein recht gutes Verhältnis, auch mit denen, die sich für etwas anderes als die Bergsteigerei interessierten. Erst in den letzten Klassen vor dem Abitur habe ich die Schule etwas vernachlässigt, und auch die Schulkameraden standen nicht mehr so im Vordergrund meiner menschlichen Beziehungen. Die anderen, die Kletterkameraden, mit denen ich im Sommer zusammen war, waren viel wichtiger geworden. Mit denen habe ich mich auch lieber getroffen, wenn ich in der Stadt war. Mit denen habe ich viel länger geredet. Ich war nicht bereit, in der Nacht aufzubleiben, um etwas zu lernen, aber ich war bereit, in der Nacht aufzubleiben, um mich mit einem Kletterkameraden zu treffen und mit ihm Touren durchzusprechen, die wir im Sommer machen wollten. Immer noch habe ich mich aber mit dem Gedanken getragen, ich werde früher oder später Hoch- und Tiefbau studieren oder Geometer werden. Ich werde einen bürgerlichen Beruf ausüben und eben dann in der Freizeit viel klettern, am Wochenende, im Urlaub. Ich wäre nie in der Stadt geblieben, um einen Film anzuschauen. Ich hätte auch nie die Schule geschwänzt, um die Zeit mit einem Mädchen zu verbringen. Ich bin aber von der Schule eine Woche lang weggeblieben, um die Matterhorn-Nordwand im Winter zu versuchen. Das war für mich selbstverständlich, und das habe ich auch so gemacht. Es gab auch kaum einen Samstag und Sonntag, an dem ich nicht mit Gleichgesinnten zu einem stadtnahen Felsbrocken gegangen wäre, um dort zu klettern. Als ich dann selbst – etwa mit achtzehn, neunzehn Jahren – mit dem Roller fahren durfte, bin ich auch während der Schulzeit einfach in die Dolomiten gefahren. In dieser Zeit habe ich auch angefangen zu schreiben. Mit 20 habe ich relativ viel geschrieben, ich habe das erzählt, was ich erlebt habe, ich habe mich geistig mit dem auseinandergesetzt, was ich getan habe. Sicherlich bin ich von der damaligen Alpinliteratur beeinflusst worden. Ich wollte meine Erlebnisse ausdrücken, meine Ideen der Welt bekannt geben, um zu sagen, man darf nur so klettern und nicht anders. Da steckte schon sehr viel Engagement dahinter.
In meiner Volksschulklasse (rechts außen Reinhold Messner).
Hat dich auch nichtalpine Literatur interessiert?
Natürlich war ich von der Schule her beeinflusst, und so kannte ich die Klassiker recht gut. Ich bin ein großer Goethe-Verehrer. Ich mag seine Lebenseinstellung. Goethe war für mich der Egoist schlechthin. Er hat so gelebt, wie er wollte.
Wie waren damals deine Beziehungen zu den Mädchen?
Ich hatte keine Probleme oder Vorstellungen. Tag und Nacht einem Mädchen nachzulaufen hätte ich lächerlich gefunden. Mir waren die Wände viel wichtiger, viel wichtiger. Die paar Freundschaften, das waren mehr so Mädchen, die auch geklettert sind, die mir imponiert haben. Bewundert habe ich hauptsächlich reifere Frauen, beispielsweise Helga Lindner, eine damals für mich unerreichbare Kletterin, die fast die gleichen schwierigen Touren wie wir gemacht hat. Das war so ein Traummädchen, nicht weil sie irgendwie besonders schön war oder reizvoll, sondern weil sie so gut geklettert ist.
Hattest du sexuelle Beziehungen?
Nein, das Sexuelle war völlig sekundär; das spielte damals keine entscheidende Rolle.
Du hast also keine pubertären Schwierigkeiten gehabt?
Vermutlich habe ich sie schon gehabt, aber ich habe sie selbst nicht als Schwierigkeiten empfunden. Ich habe meine Pubertät in den Wänden ausgelebt.
Also gab es nur Kameradschaft und Freundschaft?
Ja, das kann man so sagen. Es gab die enge Beziehung zu meinem Bruder Günther, und dann war da auch noch der Sepp Mayerl, der war mein Lehrmeister. Von dem habe ich am meisten im Umgang mit Seil und Haken gelernt, nicht, wie man eine Route findet, das wusste ich schon lange, das habe ich bereits als Kind gelernt, auch nicht wie man einen Überhang klettert, das ist etwas ganz Selbstverständliches. Er hat mir aber beigebracht, wie man beispielsweise einen Riss klettert, einen ganz speziellen Riss, oder wie man einen Haken noch besser schlägt, wie man einen Standplatz baut, wie man schneller klettert.
Freundschaft gab es in einer Clique von fünf bis sechs Leuten, die immer wieder gemeinsam Touren unternahmen. Ich habe nie gesagt: »Das ist mein Freund«, sondern wir sind schlicht und einfach miteinander zum Klettern gegangen. Im Übrigen haben wir uns nicht mit diesem Kitschgeschwätz, das vielfach noch heute in Bergsteigerzeitschriften zu finden ist, abgegeben. Es war eine starke Beziehung da, weil wir einfach gern miteinander bergsteigen gingen. Jeder konnte dem anderen hundertprozentig vertrauen. Wenn einer stürzte, so hat der andere nicht gesagt: »Warum hast du nicht trainiert?«, wir haben dem anderen keinen Vorwurf daraus gemacht. Wir hatten einfach das Gefühl: »Wir sind ein kleiner Haufen, wir gehen durch die Welt. Wir sind unschlagbar!« Wir waren wie eine kleine Räuberbande, die den anderen die Wände wegstiehlt. Vielfach haben wir oft jahrelang bestimmte Routen geplant, und wenn wir dann hörten, da gibt es welche, die wollen diese Wand auch machen, da haben wir uns gegenseitig angerufen, sind hingefahren und haben die Wand gemacht.
Mit Bruder Helmut und einem Cousin beim Rasten nach einer Bergtour.
Habt ihr manchmal Angst vor der eigenen Courage gehabt, gab es Gedanken an den Tod?
Angst kannten wir kaum, wir sprachen nicht darüber, und der Tod kam bei uns nicht vor. Keiner von uns hätte jemals im Traum daran gedacht, dass einer tödlich abstürzen könnte – das gab es nicht.
Ab welchem Zeitpunkt hast du dich von der Clique abgeseilt und hast Alleingänge unternommen?
Ende der sechziger Jahre habe ich damit angefangen, mehr allein zu gehen. Das hatte jedoch keinen persönlichen, sondern ausschließlich praktische Gründe. Die anderen aus der Clique hatten weniger Zeit als ich. Der eine war Bauer, der andere, Sepp Mayerl, war Kirchturmdecker und musste sein Geld verdienen, und mein Bruder war in einer Bank beschäftigt. Nur ich hatte sehr viel Zeit, weil ich Student war und in jeder freien Minute geklettert bin: sechzig bis siebzig Touren im Jahr. Wenn also die anderen keine Zeit hatten, habe ich oft Alleinbegehungen gemacht, weil ich keinen Partner auf der Straße anreden wollte. Ich war ziemlich schüchtern.
Wo hast du studiert?
Ich habe in Padua studiert. Ich hatte ein Stipendium, davon habe ich gelebt, und im Sommer habe ich mir nebenbei etwas Geld verdient. Ich ging als Bergführer, machte dann ein oder zwei Alleintouren, ging wieder als Bergführer und machte dann erneut einige Touren. So war mein Rhythmus. In dieser Zeit habe ich ganz schwere Alleintouren unternommen. In dieser Zeit begannen alle, bis auf Heindl Messner, mich böse zu kritisieren. Sie sagten: »Wenn du das machst, fliegst du herunter. Du bist ja verrückt! Das machst du höchstens noch eine Woche.« Ich hatte das Gefühl, die stänkern nur deswegen, weil sie arbeiten müssen und ich nicht. Ich glaubte, die anderen wären auf mich neidisch, weil ich ein so freies Leben führen konnte. Ich bin dann auch deswegen mehr und mehr allein gegangen, weil ich wusste, allein geht es schneller, und weil ich merkte, dass ich besser trainiert war als die anderen.
Steckte dahinter das Gefühl, über die Gruppe hinauswachsen zu müssen?
Nein, das war einzig und allein mein sportlicher Ehrgeiz. Es war für mich ein neuer Anreiz, zu sagen, diese Wände, die bisher alle von zwei Leuten gemacht worden sind, die als kriminelle Routen galten, machst du allein.
Quelle: Playboy Interview 1, Moewig Taschenbuch 6402.
Sehnsucht Steilwand
Als ich Mitte der Sechzigerjahre mit dem extremen Klettern in den Dolomiten begann, war die Direttissima der Dernier Cri des Bergsteigens. Wir jüngeren Bergsteiger waren hellauf begeistert und ließen uns blenden von den Möglichkeiten des konsequenten technischen Kletterns. Der Bohrhaken war damals selbstverständlich, die Strickleiter Griff- und Kletterersatz. Deutsche und Italiener versteiften sich darauf, absurde Superdirettissimas am Monte Popena oder an der Punta Emma zu suchen. Eine neue Welt des technologischen Steigens setzte ein. Wer von uns hörte noch auf jene, die gerade das Gegenteil forderten, nämlich auf Bohrer, »Nabelschnur« und Steighaken völlig zu verzichten? Es gäbe eben extrem schwere Touren, bei denen die Verwendung einer »Nabelschnur« unverzichtbar wäre, trichterte man uns ein. Fortschrittsgläubig, wie wir waren, pflichteten wir den Ideologen der Direttissima bei.
Auch ich fühlte mich anfangs angezogen von den Verlockungen des Hakenkletterns. Erst nach und nach setzte bei mir der Prozess des Umdenkens ein, als ich begriffen hatte, dass die Direttissima-Idee eine Fortentwicklung im Freiklettern unmöglich gemacht hatte. Ich schaffte den Absprung zwar nicht von heute auf morgen, wusste aber, dass wir Bergsteiger uns mit der »Schlosserei« direttissima in die Sackgasse begeben würden, wenn es nicht zu einer »Umwertung der Werte« käme. War nicht mit der Superdirettissima ein Ideal ausgeschöpft worden? Der »siebte Grad«, eine Schwierigkeitsstufe jenseits der damals angenommenen Leistungsgrenze, war im Ansatz zwar da, in der Diskussion aber weginterpretiert worden.
Schon damals empfand ich jeden Fortbewegungshaken als Kompromiss. Von einem Mal zum anderen wuchs jedoch mein Ehrgeiz, jede Route völlig frei zu klettern. Ich wurde verwegener und verwegener, ich wollte den »siebten Grad« herausfordern, ja ich wollte ihn sogar erzwingen. Mit der Erkenntnis, dass ich nur noch im Freiklettern eine Steigerung bis jenseits des sechsten Grades erreichen konnte, knüpfte ich an die Ideen von Paul Preuß an, der schon am Anfang unseres Jahrhunderts jedes künstliche Hilfsmittel beim Erklimmen eines Berges abgelehnt hatte. Gemeinsam mit Kameraden, die so dachten wie ich, wollte ich durch mehr Training und durch mehr Konzentration erreichen, auf Haken – wo möglich – verzichten zu können. Wir peilten in den Wänden keine starre Linie an, sondern wir strebten nach verfeinerter Kletterkunst. Und wir hatten unsere Vorbilder: Max Niedermann, der in den Fünfzigerjahren schwierigste Felsanstiege eröffnet hatte, Erich Abram aus Bozen, Hias Rebitsch oder Hans Vinatzer aus dem Grödner Tal.
Ich war also zum Feind des konsequenten technischen Kletterns geworden und begann ganz im Geiste von Paul Preuß gegen diese Art des Steigens zu »kämpfen«. So schrieb ich 1965 in der Südtiroler Tageszeitung »Dolomiten« unter der Überschrift »Mord am Unmöglichen« nicht ohne Polemik: »Es gilt, die Schwierigkeiten zu überwinden und nicht zu umgehen, sagt Paul Claudel. Dasselbe sagen die Männer der Direttissima, die allerdings am Einstieg bereits wissen, dass sie kein Hindernis aufhalten kann. Sie wissen auch von vorneherein, dass es eine harte Arbeit sein wird, aber sie haben die Gewähr, dass sie den Gipfel erreichen. Sie haben sich ein Problem gestellt, das es im Grunde gar nicht gibt. Ob es irgendeine Stelle gibt, die sie aufhalten könnte, habe ich einmal gefragt. Sie lachten. Diese Zeiten sind seit langem vorbei.
Bestimmte Kletterer wollen heute von vorneherein sicher sein, dass sie durchkommen. Wenn sie zufällig einen schlechten Tag haben und über eine schwierige Stelle nicht hinwegkommen, schlagen sie bedenkenlos ein Loch und in dieses einen Bohrhaken, auch wenn die Stelle bis dahin immer frei erklettert worden war.
Meine Kletterkameraden: Sepp Mayerl und Heindl Messner.
Beobachten wir einen dieser Direttissima-Männer: Angst kennt er nicht, obwohl sich die Wand gelb und überhängend über ihm aufbaut. Er sitzt auf seinem Sitzbrett, das am letzten Haken hängt, bohrt ein Loch in die glatte Wand, treibt einen Haken ein, hängt seine Leitern um, steigt in die letzte oder vorletzte Sprosse, hängt sich wieder an und bohrt darüber das nächste Loch. Nach einigen Tagen ist er vielleicht müde, aber er gibt nicht auf. Noch hat er fünf Tage Urlaub und genügend Haken. Haken über Haken, so zwingt er der Wand seine Route auf, weiter nichts.
Der Bohrhaken ist zu einer normalen Angelegenheit geworden, wenigstens für einen Teil der heutigen Bergsteiger. Ich habe schon gesagt, dass man mit den herkömmlichen Mitteln nicht auskommt. Wer nicht bereit ist umzukehren, trägt den Mut heute in Form von Eisen mit. Die Wände werden mit diesem System nicht mehr erklettert, sondern Seillänge für Seillänge erschlossert. Was heute nicht geht, macht man morgen.
Wer denkt schon daran, dass Stellen, die heute mit Hilfe von Bohrhaken erschlossen werden, von der nächsten Generation frei bewältigt werden könnten?
Wenn man auch nur einige der Möglichkeiten, Neutouren zu eröffnen, erhält, werden sich zukünftige Kletterer so lange an ihnen versuchen, bis sie dort durchkommen, wo man heute ohne den Bohrhaken zur Umkehr gezwungen wäre.
Um sich aber ins Recht zu setzen, behaupten bestimmte Leute, die im Übrigen stolz darauf sind, große Erstbegehungen oder Wiederholungen auf ihrer Tourenliste zu führen, einfach, dass viele Freiklettertouren gefährlich sind, zu gefährlich, und dass man rein aus Vorsicht mehr Haken bzw. den Bohrhaken dabeihaben müsse. Nicht mehr Können und Mut sind die bestimmenden Faktoren, sondern die Technik.
Die Besteigungen dauern oft viele Tage, und die Haken zählt man heute in Hunderten. Umkehren gilt vielfach als schimpflich, weil inzwischen alle schon wissen, dass mit den modernsten Hilfsmitteln alles möglich ist, auch eine durchgehend überhängende Direttissima.
Früher einmal, zur Zeit der großen Freiklettertouren, haben die Bergsteiger ihre Begeisterung an die Wände geschrieben, wenn ich mich symbolisch ausdrücken darf, heute schreiben sie mit Haken und Bohrhaken ihren blinden Ehrgeiz an die Wand. Die mechanische Sicherung ist vielfach an die Stelle der inneren Sicherheit getreten, die nur eine Folge von Erfahrung und Können sein kann. Nicht selten wird die Leistung einer Seilschaft nach der Zahl der Biwaks und ihr Mut nach der Anzahl der geschlagenen Haken bemessen. Das Können eines Freikletterers wird glattweg als Unverantwortlichkeit abgetan.
Mein Vater in der Südwand der Großen Fermeda.
Ich frage mich, wer die ethischen Werte des modernen Alpinismus getrübt hat.
Seit das Unmögliche ausgelöscht ist, hat der Alpinismus seinen ursprünglichen Wert verloren und ist vielfach zu einer traurigen Mittelmäßigkeit herabgesunken.
Vielleicht wollten die Ersten, die sich der Bohrhaken, der Verbindungsschnüre und Fixseile in den Alpen bedienten, nur noch weiter an die Grenze des Möglichen herankommen, als es bis dahin der Fall gewesen ist. Heute aber ist jede Grenze verschoben, und nur wer sich eigene Regeln schafft, kann die ursprünglichen Werte wiederfinden.
Drei Bergsteigergenerationen: mit Ricardo Cassin, dem führenden Alpinisten der 30er-Jahre, und Lothar Brandler, dem Klettergenie der 50er.
Zehn Jahre haben gereicht, um den Begriff ›Unmöglich‹ im Bergsteigen auszulöschen.
Bei oberflächlicher Betrachtung könnte diese Tatsache als Fortschritt erscheinen. In Wirklichkeit aber ist der technologische Alpinismus ein Abweg. Man nagelt heute zu viel und klettert zu wenig.
Das Unmögliche, der Drache, ist tot, und Siegfried ist arbeitslos geworden. Dieses Beispiel aus der deutschen Sagenwelt zitierte ich nicht, weil ich der Meinung bin, dass die Bergsteiger Helden sein müssten, sondern weil der Mut im Menschen instinktiv nach dem nahezu Unmöglichen sucht, um sich daran versuchen zu können.
Wenn aber das Unmögliche selbst ausgelöscht ist, gibt es auch das nahezu Unmögliche nicht mehr, und das extreme Bergsteigen wäre zum Untergang verurteilt. Nur wer den Mut hat, eine sehr schwierige Wand mit einfachen technischen Hilfsmitteln anzugehen, findet das Abenteuer, das das Bergsteigen wertvoll macht.
Ohne viele Gedanken hat die Generation der Direttissima das Unmögliche gemordet, gemordet deshalb, weil es nicht überwunden wurde, sondern mit unfairen Mitteln ausgelöscht. Wer sich nicht gegen dieses System einsetzt, ist mit verantwortlich für die Sackgasse, in der das extreme Bergsteigen steckt. Wenn die Bergsteiger einst die Augen aufmachen werden, ist es vielleicht schon zu spät. Das Unmögliche kann nicht so leicht zurückgeholt werden.
Die Generation vor uns hat sich in die wildesten Wände hineingenagelt, unsere Aufgabe muss es sein, uns aus all diesen Wirrnissen zu befreien. Man hat uns gelehrt, mit Haken und Strickleitern umzugehen, in der Linie des fallenden Tropfens zu klettern; wir müssen versuchen, der nächsten Generation andere Wege zu zeigen.
Wir müssen eine Grenze finden, eine Grenze, der wir uns nähern könnten. Und auch wenn wir diese Grenze nie erreichen sollten, müssen wir uns hüten, sie mit Tricks zu überspringen.
Damals wie heute bin ich davon überzeugt, dass man nur im freien Klettern ein Höchstmaß an Erlebnismöglichkeit erfahren kann. Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass es ohne das Unmögliche kein letztes Geheimnis geben kann; ohne Geheimnis sind aber neue Erfahrungen nicht möglich. Ich wusste, dass mein Weg der des Verzichts sein musste, des Verzichts auf die letzten Tricks der Technik; nur so konnte es gelingen, die Kletterschwierigkeit zu steigern. Unter der Devise »Kampf dem Bohrerkrampf« machte ich meine berüchtigtsten Freiklettertouren und Erstbegehungen in den Dolomiten. Ich wollte sie alle machen, diese extremen Wände, all meine Sehnsucht galt ihnen, meinen ganzen Ehrgeiz setzte ich ein, um mein Klettervermögen und meine Kondition zu steigern. 1969 erreichte ich schließlich die Höchstform. Entscheidend trug dazu bei, dass ich in diesem Jahr an einer Anden-Expedition des Österreichischen Alpenvereins in Peru teilnahm. Zusammen mit Peter Habeler bestieg ich die Nordostwand des Yerupaja Grande bis knapp unter den Gipfel (6634Meter) sowie die Südwestwand des Yerupaja Chico (6121Meter). Die Anstrengungen in sauerstoffarmer Luft wirkten sich auf meinen Körper positiver aus als jedes gezielte Training. Ich verlor zwar zehn Kilo Gewicht, fühlte mich jedoch agiler denn je. Die Erweiterung des Horizonts stärkte mein Selbstbewusstsein, und die Erlebnisse auf dieser für mich ersten Expedition brachten mich dermaßen in Schwung, dass ich eine unbändige Lust am Klettern verspürte. Von Südamerika zurückgekehrt, gelangen mir Wände, von denen ich Jahre zuvor nicht einmal zu träumen gewagt hatte. Routen, die ich zuvor selbst für aberwitzig gehalten hatte, konnte ich mir zuschreiben: Alleinbegehungen der Droites-Nordwand, der Punta-Tissi-Nordwestwand über die Philipp-Flamm-Führe, der Direkten Südwand an der Marmolata di Rocca, der Soldà-Führe an der Langkofel-Nordwand, der Furchetta-Nordwand und meiner Route am Zweiten Sella-Turm; Begehungen des Frêney-Pfeilers am Montblanc, des Berland-Pfeilers an der Droites, der Domino-Nordwand, der Coronelle-Nordwestwand, der Maestri-Führe an der Rotwand und der Direkten Nordwand am Langkofel.
Die drei Zinnen von Norden. Hier verlaufen die berühmtesten Direttissimas.
Es war meine Sturm-und-Drang-Periode, in der ich der ganzen Welt beweisen wollte, was sie von mir zu halten hatte. Mit der gesamten naiven Begeisterung dieser Zeit, mit dieser damals ungebrochenen Selbstverständlichkeit fuhr ich mit Vehemenz fort, gegen die herkömmlichen Wertvorstellungen zu rebellieren. Je kühner meine Kletterei, desto provokativer meine Äußerungen: »Als man mich fragte, was ich gegen den Bohrhaken hätte, konnte ich nur Positives anführen: Er kann überall eingesetzt werden. Er sieht aus wie die anderen Haken, fällt nicht auf. Sehr klein und leicht ist er und doch sehr sicher. Er wird fabrikmäßig hergestellt. Er ist nicht teuer. Er kann auch von Leuten gebraucht werden, die noch nie geklettert sind. Er hilft überall weiter. Er dient auch zum Aufhängen von Bildern an einer Betonwand. Er tut etwas für den Alpinismus: Er trägt mit zum Untergang bei.«
Von meinen Gegnern wurde die von mir propagierte Art des Bergsteigens als »Ideologie des Wahnsinns« verketzert. Man muss sich einige der kritischen Äußerungen, die mir damals entgegengeschleudert wurden, vergegenwärtigen, um zu begreifen, wie schwer es war, das Freiklettern zu verteidigen. Alle gebrauchten zwar den Begriff »fair«, aber was nützt der kategorische Imperativ des »reinen sportlichen Ideals«, wenn der Bohrhaken als Steighilfe nicht in Frage gestellt wurde? Der damalige Hauptideologe, Dietrich Hasse, der sich mit der Zinnen-Direttissima ein Denkmal gesetzt hatte, redete dem technologischen Alpinismus weiterhin das Wort: »Wenn in der alpinistischen Entwicklung je eine Entscheidung richtungsweisendes Gewicht hatte, so war es die, die vor gut einem halben Jahrzehnt zum künstlichen Klettern führte. Sie brachte eine gänzlich neue Qualität ins breite Bergsteigen.« Vom gleichen Mann stammt der Kommentar zu meinen Alleinbegehungen im Sommer 1969: »Bei aller Bewunderung über so viel Kühnheit, Vorbild darf das nicht werden! Mir gefällt ein derart auf die Spitze getriebener Alpinismus nicht. Unausdenkbar, wenn nur noch das als Spitzenleistung Gültigkeit besitzen sollte, was irgendeiner jenseits vom Normalmenschlichen mit dermaßen letztem Risiko erzwingt. So betrieben wird Bergsteigen wie jeder andere Sport zum Auswuchs, zur Verantwortungslosigkeit.«
Was scherte mich das Geschrei! Ich war davon überzeugt, dass sich der Freikletterstil durchsetzen, ja dass er die Bergsteigerszene verändern würde. Und ich sollte Recht behalten! Einer der Mitsteiger Dietrich Hasses bei der Zinnen-Direttissima, Jörg Lehne, bekannte zu meiner Verwunderung: »Ich war lange Jahre der Meinung, mit der ersten Durchsteigung der Direkten Nordwand der Großen Zinne (1958) sei eine neue Epoche in der Bezwingung schwierigster Routen eingeleitet worden. Heute, zehn Jahre danach, bin ich der Meinung, dass diese Route als Schluss und zugleich Krönung jener Erschließungsepoche zwischen den Zwanziger- und Fünfzigerjahren anzusehen ist. Die Ungewissheit durchzukommen, das Unmögliche, beides wird vom Bohrhaken theoretisch aufgehoben.« Nichts anderes hatte ich als Zwanzigjähriger gesagt. Plötzlich war man der Ansicht, dass die Freikletterei wieder in den Vordergrund gestellt werden sollte. »Nur die freie Kletterei fordert maximales Können, nur die freie Kletterei bietet maximalen Erlebnisgehalt.« Viele der Nachbeter meiner Überzeugung waren Jahre zuvor meine Kritiker gewesen.
Erst der Berg, dann die Frauen
Haben Sie zu den Bergen so etwas wie eine erotische Beziehung?
Meine geschiedene Frau (Uschi Demeter-Messner) hat gesagt, früher hätte ich meine Gefühle und Interessen stets in irgendwelche Wände gesteckt. Ich hätte diese Wände geliebt. Damit hatte sie nicht so Unrecht. Ab und zu tue ich das heute noch.
Sie lieben nackte Felswände?
Ich habe kein erotisches Verhältnis zu einer Wand, aber es ist eine Liebesbeziehung.
Stimmt es, dass Sie manchmal von Felswänden als Gemälden träumen, die nur Sie sehen können?
Ich habe gesagt, dass Bergbesteigungen etwas mit Kunst zu tun haben können. Das ist ein schöpferischer Vorgang. Eine Wand, die ich hinaufwill, sehe ich auf einer Art Zeichentafel vor mir. Mit meiner Erfahrung und mit meinem Empfinden für Linien kann ich eine Route auf diese Wand legen. Eine gedachte Linie also, die sehr schön sein kann. Wenn ich diese gedachte Linie klettere, dann lebe ich sie, liebe sie. Sie ist in mir drin, nur für mich greifbar.
Nennen Sie doch bitte so eine Liebes-Wand.
Die Rupal-Wand am Nanga Parbat. Sie ist die höchste der Welt, 4500Meter hoch. Über den rechten Eckpfeiler könnte ich hinauf. Mit der Linie dieser Wand spiele ich seit Jahren. Es ist meine Linie, ich habe sie gemacht, ich steige auf ihr hoch. Niemand außer mir kann sie sehen.
Wie hoch ist die Scheidungsrate unter den Bergsteigern?
Ziemlich niedrig. Bergsteiger lassen sich im allgemeinen nicht scheiden. Bergsteiger sind eher konservativ. Als ich über meine Scheidung schrieb, habe ich nur mal klarstellen wollen, dass auch ein Bergsteiger Eheprobleme hat.
Was ist passiert?
Meine Frau war ganz und gar nicht gegen das Bergsteigen. Sie hat auch mit mir zu klettern angefangen. Weshalb sie weggegangen ist, wissen wir wahrscheinlich beide nicht. Die Berge haben nur am Rande damit zu tun, darüber sind wir uns mittlerweile einig. Sie hatte bei mir wohl keine Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen. Ich habe ihr keinen Platz gelassen, eine eigene Persönlichkeit zu sein.
Sind Sie ein total ichbezogener Mensch?
Ich glaube schon, dass ich auf andere eingehen und Rücksichten nehmen könnte. Aber dieser andere muss wenigstens ebenso stark sein wie ich. Wäre das so, dann würde ich mich sogar unterordnen. Merke ich aber, dass der andere nicht so engagiert oder besessen ist, dann fresse ich ihn automatisch auf.
Quelle: Playboy Interview 1, Moewig Taschenbuch 6402.
Träume leben
Einige Monate nach der Anden-Expedition, Ende 1969, veränderte sich meine Einstellung zum Klettern. Der magische Reiz, den bisher jede Steilwand auf mich ausgeübt hatte, verflachte. Es fehlte das Gefühl von Winzigkeit, das ehrfurchtsvolle Schaudern. Ich fühlte mich übertrainiert, weil ich jeden Dolomiten-Gipfel in wenigen Stunden erreichen konnte. Was mir abging, das war eine neue Dimension, ein neues Spielfeld für meine Fantasien.
Just in dieser Phase voller Unlust und Zweifel erhielt ich eine Einladung zur Teilnahme an der »Sigi-Löw-Gedächtnis-Expedition« und sagte sofort zu, weil ein solches Unternehmen die Erfüllung meiner Träume bedeutete. Wir wollten zur 4500Meter hohen Südwand des Nanga Parbat, der höchsten Fels- und Eiswand der Erde. Nach einigen gescheiterten Versuchen war die Rupal-Flanke zum größten Wandproblem überhaupt geworden. Ich brannte darauf, diese Schwierigkeiten selbst kennen zu lernen. Um mir vorstellen zu können, was mich da erwarten würde, stellte ich Vergleiche an: Die Rupal-Wand ist ungefähr zweieinhalbmal so hoch wie die Eiger-Nordwand, viermal so hoch wie die Civetta-Nordwand, achtmal so hoch wie die Nordwand der Großen Zinne. Doch dazu musste ich die gewaltige Meereshöhe mit einkalkulieren, ein wichtiger Faktor, der in allen Berichten vorangegangener Versuche eine große Rolle spielte. Nach meinen Erfahrungen, die ich bei der Anden-Expedition gesammelt hatte, ahnte ich, welche Gefahren in der Todeszone auf einen lauern konnten. Ich begann mich dementsprechend vorzubereiten:
Da ich eine größere Summe aufbringen musste, um an der Expedition teilnehmen zu können, unterbrach ich mein Studium in Padua und unterrichtete an der Mittelschule von Eppan Mathematik, Naturlehre und Leibeserziehung. Vormittags widmete ich mich meinen Schülern, doch die Nachmittage gehörten mir, und diese wiederum hatte ich fast ausschließlich für mein Konditionstraining reserviert. Das Training lief nach einem genauen Plan ab. Von der Grundüberlegung ausgehend, dass jedes Kilogramm Körpergewicht beim Steigen entsprechend Kalorien und damit Sauerstoff benötigt, der ab einer Meereshöhe von 7000Metern nur in sehr geringem Maße vorhanden ist, stellte ich meine Übungen zusammen. Weil ich also einerseits auf jedes unnötige Gramm Gewicht verzichten musste, andererseits wusste, dass die Beine die Hauptarbeit würden verrichten müssen, versuchte ich solche Übungen, bei denen sich die Oberkörpermuskulatur zugunsten der Waden und Schenkel zurückbildet. Anstatt der üblichen Kletterarbeit lief ich längere Strecken bergauf. Beinahe jeden Tag legte ich meine Trainingsstrecke von Bozen nach Jenesien folgendermaßen zurück: Ich lief diese 1000 Höhenmeter auf Zehenspitzen ohne anzuhalten; dazu benötigte ich weniger als 40Minuten. Gleichzeitig übte ich mich im richtigen Atmen, aß und trank oft nur in großen Zeitabständen.
Obwohl ich bei Trainingsbeginn eine Notsituation nicht ins Auge gefasst hatte, so hatte ich mir doch vorgestellt, dass der Aufstieg eine überdurchschnittliche Anstrengung bedeuten würde. Deshalb richtete ich mich schon beim Training entsprechend darauf ein. Ich wusste, dass es weniger die klettertechnischen Schwierigkeiten sind, die oftmals einen Bergsteiger im Himalaja-Gebirge vor schier unlösbare Probleme stellen, sondern dass es die extreme Höhe ist, die vom Einzelnen das Äußerste abverlangt. Um sich gründlich auf solche Vorgegebenheiten einzustellen, musste man sich über mehrere Monate hinweg vorbereiten. Ohne ein spezielles Training darf man sich keiner Himalaja-Expedition anschließen. Gewiss, man kann sich auch noch beim Anmarsch zum Berg akklimatisieren, aber die konditionellen Voraussetzungen für eine Achttausender-Besteigung müssen schon lange vor dem Start geschaffen werden.
Die Civetta-Nordwestwand, wo mir eine »logische« direkte Route gelang.
Ich achtete also unbedingt auf mein Höchstformgewicht, das bei 64Kilogramm liegt. Mit meiner Ernährung habe ich noch nie Probleme gehabt. Sie ist über all die Jahre eigentlich unverändert geblieben. Ich esse relativ wenig Fleisch, dafür viele Kohlehydrate und reichlich Obst. Damals legte ich einmal in der Woche einen Obsttag ein, um meinen Körper zu entschlacken. Außerdem trank ich viel Milch. Weil ich irgendwo gelesen hatte, durch häufigen Knoblauchgenuss würde die Elastizität der Gefäßwände vergrößert, achtete ich außerdem auf eine ausreichende Zufuhr dieses Gewürzes. Auch meine Schlafgewohnheiten musste ich nicht verändern. Ich schlafe fast immer sechs bis sieben Stunden. Bei meinen körperlichen Übungen übertrieb ich jedoch keineswegs. Ich trainierte pro Tag nicht mehr als vier Stunden. Damit erreichte ich ein körperliches Wohlbefinden wie nach einem langen, erholsamen Urlaub.
Bereits nach einigen Monaten wollte ich das alltägliche Training nicht mehr missen. Musste ich es einmal aus irgendeinem Grund ausfallen lassen, fühlte ich mich gereizt und unwohl. Für gewöhnlich lief ich längere Strecken, nachdem ich mir am Morgen eine kalte Dusche verabreicht hatte. Diese Prozedur ist für mich übrigens bis heute eine lieb gewordene Gewohnheit geblieben, auf die ich nicht verzichten könnte. Durch autogenes Training versuchte ich, meinen Herzschlag zu verlangsamen und die Durchblutung der Hände und Füße zu verbessern. Ferner versuchte ich mich gezielt auf den Bewegungsablauf in der Todeszone vorzubereiten. Meine Oberkörpermuskulatur bildete sich dank des speziellen Lauftrainings zugunsten der Beine zurück, der Puls sank auf 42Schläge in der Minute. Vier Monate vor der Abreise konnte ich mit meinen Trainingserfolgen zufrieden sein. Obwohl ich mit dem Klettern völlig aufgehört hatte, fühlte ich mich bestens vorbereitet.
Die Rupal-Wand am Nanga Parbat, links unsere Route von 1970.
Daneben beschäftigte ich mich auch theoretisch mit den Problemen des Nanga Parbat. Ich studierte die geplante Route anhand von Bildern, vertiefte mich in die Literatur über den Nanga Parbat und interviewte Personen, die dieses Gebiet bereits aus eigener Klettererfahrung kannten. Die Informationen, die ich erhielt, bestärkten mich in meiner Überzeugung, dass es eigentlich unmöglich war, über die Rupal-Wand zum Gipfel des Nanga Parbat zu gelangen. Bei der Abreise gingen die Meinungen über Gelingen oder Misserfolg auseinander. Doch meine persönliche Begeisterung war trotz aller Bedenken ungebrochen, obwohl ich mir gegenüber diesem Giganten Berg unheimlich klein und nichtig vorkam.
Ein halbes Jahr später hatte ich gemeinsam mit meinem Bruder Günther den Gipfel des Nanga Parbat erklommen. Durch unvorhergesehene widrige Umstände mussten wir über die zwar leichtere, dafür aber uns völlig unbekannte Westseite absteigen, was uns auch beinahe geglückt wäre. Doch unmittelbar vor dem Wandfuß begrub eine Lawine meinen Bruder. Meine verzweifelten Bemühungen, ihn zu suchen und ihm zu helfen, trugen nichts ein. Mit erfrorenen Zehen schleppte ich mich tagelang durch das Diamir-Tal abwärts. Ungeplant und unvorbereitet hatten wir den »nackten Berg«, wie Nanga Parbat auf Sanskrit heißt, überschreiten müssen. Doch was nützte diese in Bergsteigerkreisen als sensationell geltende Tat, wenn doch mein Bruder, der Rettung so nahe, hatte sterben müssen! Drei Tage hatte ich nichts zu trinken, fünf Tage nichts zu essen. Drei Tage hatte ich ohne Schutz im Eis verbringen müssen. Am Ende kroch ich nur noch talwärts, weil ich mich nicht mehr auf den Beinen halten konnte.
»Das Jahr 1970 brachte die entscheidende Wende in meinem Leben. Nach der tragischen Nanga-Parbat-Expedition wurden mir mehrere Zehen amputiert. Drei Monate lang lag ich in der Klinik. Auch 1971, nach einem lang anhaltenden moralischen Tief, konnte ich die Hochform von 1969 nicht mehr erreichen. Ich hatte beim extremen Klettern nicht mehr jenes feine Gleichgewichtsgefühl und Schmerzen, wenn ich nicht Schuhe mit steifen Sohlen trug. Trotzdem gelangen mir einige Erstbegehungen in den Dolomiten, wie zum Beispiel die Direkte Nordwestwand der Kleinen Rodelheilspitze am Grödner Joch, die die Schwierigkeiten klassischer Sechsertouren übertreffen. Das Klettern machte mir trotz allem viel Spaß, sodass ich weitermachte. In dieser Zeit fiel aber der Entschluss, mein bürgerliches Leben aufzugeben und es als Abenteurer zu versuchen. Mit zunehmendem Alter faszinierten mich die »großen« Berge mehr und mehr, der reine Kletterwunsch der Sturm-und-Drang Zeit – je steiler und freier, umso herausfordernder – wich dem Bedürfnis, monatelang in der Wildnis zu leben. So klettere ich heute noch: einmal extrem und einmal in 8000Meter Höhe am Ende der Welt.« (Reinhold Messner, Siebter Grad, 1985)
Die Freiheit auszubrechen, wann ich es will
Sie nehmen sich das Recht und die Freiheit, auszubrechen, wann es Ihnen passt?
Ja. Ich bin ein Privilegierter, weil ich meine Spinnereien ausleben kann. Die meisten Menschen können das nicht. Sie verlieren sich in den Alltäglichkeiten und tun nicht das, was sie gerne möchten. Ich wäre so unglücklich wie sie, wenn ich auf meine Wünsche verzichten müsste.
Sie sind also glücklicher als andere?
Ich habe den Mut, meine Träume auszuleben. Deswegen muss ich nicht glücklicher sein als andere. Zwei, drei Jahre habe ich Kompromisse gemacht, brav studiert und furchtbar gelitten. Ich steuerte eine Laufbahn als Architekt an, und mir grauste davor. Alle möglichen Zahlen liefen mir durch das Hirn. Ich habe nachts Albträume gehabt und schlecht geschlafen. Dann habe ich diese bürgerlichen Lebensvorstellungen über Bord geworfen. Meine Frau, die ich damals kennen lernte, hat mir sehr dabei geholfen. Sie war die Erste, die mich beeinflusst hat, so zu werden, wie ich heute bin. Weil sie sich selbst verwirklichen wollte – wie ich. Sie hat das an meiner Seite leider nicht erreicht.
Gibt es für Sie noch Grenzen – oder haben Sie alle durchbrochen?
Ende der Leseprobe
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: