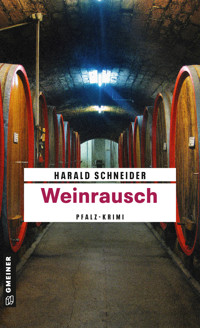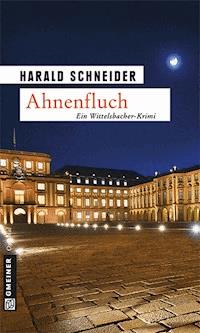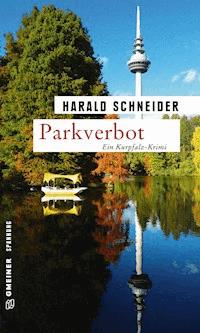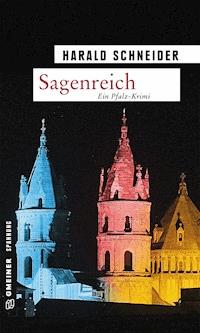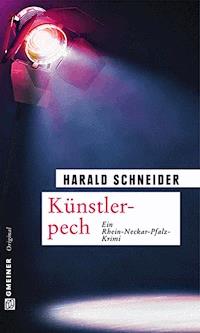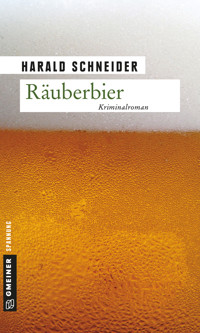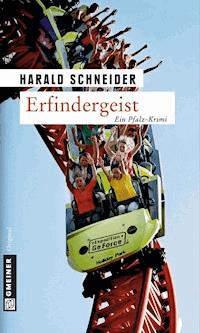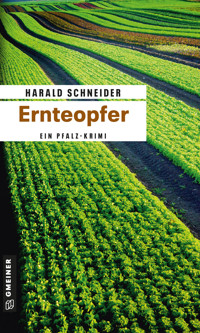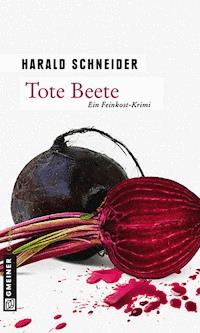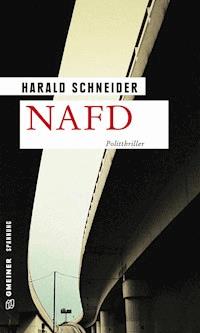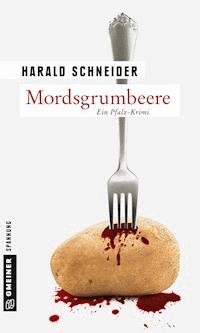
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hauptkommissar Palzki
- Sprache: Deutsch
Woher kommt die unbekannte Tote auf dem Biobauernhof »Kartoffel-Käfer« in Iggelheim? Kommissar Reiner Palzki steht vor einem Rätsel, als er im Büro der Vorarbeiterin eine Leiche findet, die niemand identifizieren kann. Er beginnt mit verdeckten Ermittlungen, als kurz darauf weitere Leichen gefunden werden. Dabei trifft er auf die Lehrerin Avril Walters, die aus England gekommen ist, um als selbsternannte Miss Marple in einer längst vergangenen Sache zu ermitteln. Gemeinsam kommen die beiden einem lang gehegten Geheimnis auf die Spur, das zu einem Schatz führen könnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Harald Schneider
Mordsgrumbeere
Palzkis 13. Fall
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2016 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2016
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © leungchopan / Fotolia.com, © goir / Fotolia.com, © gradt / Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-5106-5
Inhalt
Impressum
Gedicht
Prolog
Kapitel 1 – Ein paar Vermisstenfälle
Kapitel 2 – Kartoffel-Käfer
Kapitel 3 – Die Sache mit dem Oldtimer
Kapitel 4 – Melanies 13. Geburtstag
Kapitel 5 – Die Indoor-Hanf-Plantage
Kapitel 6 – Das Geheimnis einer Neustadter Stadträtin
Kapitel 7 – Alles geht zu Bruch
Kapitel 8 – Diskussionsrunde bei Getränke-Bruch
Kapitel 9 – Pilates für Anfänger
Kapitel 10 – Auf dem Grumbeerenacker
Kapitel 11 – Dr. Metzgers neue Geschäftsidee
Kapitel 12 – Mords-Grumbeere
Kapitel 13 – Ein Vorstand mischt sich ein
Kapitel 14 – Das übliche Störfeuer durch KPD
Kapitel 15 – Viele Nachbarn in Rheingönheim
Kapitel 16 – Die Schatzkarte
Kapitel 17 – Lüge oder Wahrheit?
Kapitel 18 – Besuch bei Kartoffel-Kuhn
Kapitel 19 – Es klärt sich auf
Kapitel 20 – Gruppenführung
Epilog
Danksagung
Personenglossar
Bonus 1: KPD im Capitol
Bonus 2: Ratekrimi – Palzki und der Meisterdetektiv
Lesen Sie weiter …
Gedicht
Jetzt schlägt deine schlimmste Stunde,
Du Ungleichrunde,
Du Ausgekochte, du Zeitgeschälte,
Du Vielgequälte,
Du Gipfel meines Entzückens.
Jetzt kommt der Moment des Zerdrückens
Mit der Gabel! – Sei stark!
Ich will auch Butter und Salz und Quark
Oder Kümmel, auch Leberwurst in dich stampfen.
Musst nicht so ängstlich dampfen.
Ich möchte dich doch noch einmal erfreun.
Soll ich Schnittlauch über dich streun?
Oder ist dir nach Hering zumut?
Du bist so ein rührend junges Blut.
Deshalb schmeckst du besonders gut.
Wenn das auch egoistisch klingt,
So tröste dich damit, du wundervolle
Pellka, dass du eine Edelknolle
Warst, und dass dich ein Kenner verschlingt.
Abschiedsworte an Pellka von Joachim Ringelnatz
Prolog
»Eines Tages bring ich sie um!«
Bauer Ewald fluchte mit krebsrotem Gesicht, während er in der Scheune wütend eine Kanne mit Pfefferminztee an seinen Lanz Bulldog Baujahr 1937 schleuderte. Mit einem Scheppern zerbarst diese an der hinteren Stahlfelge.
»Lange spiele ich da nicht mehr mit.« Er verpasste den Resten der Kanne einen Tritt, der sie in Richtung Holzlager fliegen ließ. Zitternd setzte sich Ewald auf einen Holzklotz, den er zum Holzspalten benutzte, und vergrub sein schweißnasses Gesicht in den schwieligen Händen.
Ewald Butzenhauer hatte ein Problem: Es hieß Dorothea und war seit mehr als 20 Jahren seine Frau. Wenige Tage vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hatten sie geheiratet. Damals konnte er sein Glück nicht fassen. Er, der schon immer etwas grobschlächtige Typ, war hässlich. Alle anderen Beschreibungen wären nur Beschönigungen, wie er sich bereits im Jugendalter eingestehen musste. Dass ausgerechnet die damals bildhübsche Dorothea seinem Charme erlegen war, konnte in dem kleinen Dorf Rheingönheim, das ein Jahr vor der Hochzeit in Ludwigshafen eingemeindet wurde, niemand verstehen, selbst Ewald nicht. Er hütete sich davor, das Motiv seiner Frau zu hinterfragen, damit sie nicht im letzten Moment absprang.
Mit der Heirat kam Ewald nicht nur seiner Traumfrau Dorothea näher, sondern auch einem Bauernhof in der Rheingönheimer Hauptstraße nebst vielen Hektar Äckern westlich und nördlich von Rheingönheim. Ewald selbst brachte nur das in die Ehe ein, was er auf dem Leib trug. Als Tagelöhner, der in einem winzigen Hinterzimmer über dem Braustübel der Rheingönheimer Weizenbierbrauerei mehr hauste als wohnte, war es ihm in den fünf Jahren seines bisherigen Arbeitslebens nicht gelungen, Ersparnisse zu bilden, woran auch die Kneipe unter seinem Zimmer beitrug.
Das eine oder andere Mal hatte er als Tagelöhner seinem zukünftigen Schwiegervater bei der Ernte geholfen. Er vermutete, dass er dem alten Herrn mit seiner Arbeit dermaßen imponiert hatte, dass er seine Tochter mit ihm verkuppelte. Ob dies freiwillig oder unfreiwillig geschah, war Ewald egal. Dorothea ließ sich jedenfalls nichts anmerken.
Sogar eine kleine Hochzeitsreise in den Schwarzwald war geplant. Der Kriegsbeginn machte dem jungen Paar einen Strich durch die Rechnung. Ewald, der mit Hitler und den Nazis nichts am Hut hatte, rechnete täglich mit seiner Einberufung. Wenige Wochen nach der Hochzeit kam ihm der Zufall zu Hilfe: Sein Schwiegervater, mit dem er sich sehr gut verstand, erlitt während eines abendlichen Zechgelages einen Schlaganfall. Halbseitig gelähmt wurde er zum Pflegefall. Ewalds Schwiegermutter, die ihn noch nie leiden konnte, gab ihm die Schuld an dem Schlaganfall, da beide an dem Abend gemeinsam in der Weezebeez, wie das Braustübel genannt wurde, gezecht hatten.
Während Dorothea das Schicksal gefasst aufnahm und mithalf, den Vater zu pflegen, war Ewald von einem Tag auf den anderen auf sich alleine gestellt: Der landwirtschaftliche Betrieb musste weiterlaufen. Vorarbeiter gab es keine, alles hatte sein Schwiegervater mithilfe von Tagelöhnern und einer knappen Handvoll festangestellten Arbeitern selbst organisiert.
Anfangs klappte dies überraschend gut. Das Federvieh behielt er, während die Schweinezucht aufgegeben wurde. Die Feldarbeit war für dieses Jahr im Großen und Ganzen erledigt. Nun konnte er sich zum ersten Mal näher mit der Immobilie, die, wie er zu diesem Zeitpunkt dachte, früher oder später seiner Frau und ihm gehören würde, beschäftigen. Das Anwesen nebst Scheune war heruntergewirtschaftet und stellenweise baufällig. Je näher sich Ewald mit dem Gebäudekomplex befasste, desto deprimierter wurde er. Selbst die Gerätschaften und der überschaubare Fuhrpark hatten schon bessere Zeiten erlebt, manches stammte aus dem 19. Jahrhundert. Nur der neue 37er Lanz Bulldog stach aus diesem halbverrotteten Ensemble heraus.
Gleich im nächsten Frühjahr, wenn der Krieg vorbei sein würde, länger als ein halbes Jahr würde er bestimmt nicht dauern, müsste er mit dem Erneuern und dem Renovieren des Anwesens beginnen. Er wusste nur noch nicht, wie er seine Schwiegermutter, den alten Besen, davon überzeugen konnte, dafür die Ersparnisse zu opfern.
Das Frühjahr 1940 kam, und ein Ende des Krieges war nicht abzusehen. Während auf den Äckern immer mehr Personal benötigt wurde, wurde dieses reihenweise eingezogen. Die Knappheit an Arbeitern machte Ewald zu schaffen, zumal er immer noch mit seiner eigenen Einberufung rechnete.
Eines Tages, wieder hatten sich drei Arbeiter auszahlen lassen, da sie an der Westfront benötigt wurden, stritt er sich wie fast täglich mit seiner Schwiegermutter. Diese hatte gerade ihren Mann gefüttert, der im Obergeschoss vor sich hinvegetierte. Das bereits öfters vorgebrachte Argument, in den Bauernhof zu investieren, quittierte sie mit einer saftigen Ohrfeige. Wutentbrannt schubste Ewald sie zurück. Daraufhin verlor sie das Gleichgewicht und stürzte mit einem mörderischen Radau rücklings die steile Stiege hinab.
Da Dorothea zu diesem Zeitpunkt bei den Nachbarn weilte, gab es keine weiteren Zeugen. Der hinzugerufene Arzt war an diesem Sturz völlig desinteressiert und füllte bei einem Gläschen Himbeergeist sogleich den Totenschein aus.
Fortan musste sich Dorothea alleine um ihren Vater kümmern. Ewald wurde vom Kriegsdienst freigestellt, um die Versorgung der Bevölkerung mit Grumbeeren, wie man die Kartoffeln nannte, sicherzustellen. Die Arbeit war mühsam, da er als Gehilfen nur ein paar Kriegsversehrte akquirieren konnte.
Im Herbst 1941, die Ernte war eingefahren, entledigte er sich nach einem Zechgelage seines Schwiegervaters. In Ewalds Augen band seine Versorgung die Arbeitskraft seiner Frau, die dringend benötigt wurde. Nachdem Dorothea ihrem Vater den Abendbrei verabreicht hatte, der ohne ihr Wissen mit einem Gemisch aus grünen Knollenblätterpilzen angereichert war, achtete Ewald genau darauf, die Reste des Mahles zu entsorgen.
Der am nächsten Morgen einsetzende Brechdurchfall war für den halbseitig Gelähmten äußerst schmerzhaft, aber erst der Anfang des Endes. Nach zwei Tagen ging es ihm kurzzeitig sogar wieder besser, doch nach neun Tagen versagte seine Leber endgültig. Der Nachweis einer Vergiftung war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu erbringen, zumal der Arzt, es war der gleiche wie beim Tod seiner Schwiegermutter, ohne richtig hinzusehen, eine natürliche Todesursache bescheinigte.
Während seine Frau trauerte, freute sich Ewald über das Erbe. Allerdings stellte sich bald heraus, dass die Verstorbenen bereits vor der Hochzeit das Anwesen auf Dorothea übertragen hatten. Dorothea war Alleinerbin, damit musste sich Ewald wohl oder übel arrangieren.
Das Leben auf dem Hof ging trotz widriger Umstände seinen Weg. 1943 wurde der Lanz Bulldog eingezogen. Im Gegenzug erhielt Ewald ein Kontingent polnischer Fremdarbeiter, wie die Kriegsgefangenen hießen, zugewiesen.
Einem glücklichen Umstand hatte Ewald es zu verdanken, dass er 1949 seinen Traktor fast unbeschädigt zurückerhielt. Kurz nach der Beschlagnahmung des Bulldogs wurde er in einer Scheune im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof zwischengelagert. Wenige Nächte später wurde die Scheune und die umliegenden Gebäude ein Opfer der Bombardierung. Erst bei der Schuttbeseitigung sechs Jahre später entdeckte man den verdreckten, aber fahrbereiten Traktor wieder.
Die Nachkriegszeit gestaltete sich ebenso hart wie die Jahre zuvor. Arbeitskräfte waren nach wie vor Mangelware, und zu allem Überdruss wurden im Zuge der technischen Modernisierung, wie man es Anfang der 50er Jahre nannte, zahlreiche Äcker neu verteilt, um dem stark zunehmenden Autoverkehr die benötigten Überlandstraßen zu bauen. Bereits vorher besaß Ewald kleinere Parzellen, die sich auf mehrere Gemeinden des Landkreises Ludwigshafen verteilten. Fortan war es für ihn noch zeitaufwendiger, die weiter entfernten Felder zu bestellen.
Dorothea hatte sich längst mit ihrem Schicksal abgefunden. Trotz aller Mühsal des täglichen Lebens gelang es ihr als eine der ersten in der Vorderpfalz, einen kleinen Hofverkauf mit eigenen Produkten zu etablieren. Eine genossenschaftliche Angliederung hatte ihr Mann stets abgelehnt.
1960 sahen die beiden das erste Mal Licht im Tunnel. Die Ernte übertraf bei Weitem die Erwartungen, und es gelang ihnen, eine kleine Lebensmittelkette in Südhessen zu überzeugen, fast das komplette Erntegut zu einem guten Preis abzunehmen. Leider war aufgrund diverser Qualitätsmängel das Geschäft bereits ein Jahr später wieder Vergangenheit.
In der Euphorie des Vorjahres war Dorothea schwanger geworden. Lange vor der Geburt eskalierten die ehelichen Beziehungen, was nicht nur daran lag, dass Ewald mit Geld nicht umgehen konnte und den einen Teil des Gewinnes in die Wirtschaft getragen und die andere Hälfte in die Anzahlung eines Mittelklassewagens gesteckt hatte. Der weit wichtigere Grund lag in dem unbestimmten Geschlecht des Nachwuchses. Während Dorothea von einem Mädchen träumte, war Ewald auf einen Stammhalter dermaßen fixiert, dass er mehr als einmal wüste Beschimpfungen gegenüber seiner hochschwangeren Frau aussprach.
Größere Gewalttätigkeiten hatte Ewald sich seiner Frau gegenüber bisher nicht zu Schulden kommen lassen, die vielen kleinen Nadelstiche verschärften den Ehezwist langsam, aber sicher.
Genau zu dieser Zeit passierte es: Bauer Ewald fuhr mit seinem Traktor auf einer der kleineren Parzellen weit ab von Rheingönheim, als plötzlich das linke Vorderrad einbrach. Wütend brachte er die Maschine zum Stehen. Zu Beginn dachte er an einen überdimensionierten Kaninchenbau, wie es sie im direkt benachbarten kleinen Kieferwäldchen massenhaft gab. Während er sich die Situation betrachtete und überlegte, wie er seinen Traktor ohne fremde Hilfe aus dem Loch herausbekommen könnte, stutzte er. Mit wenigen Handgriffen löste er einen metallenen Gegenstand aus der Ackerkrume. Für eine Hinterlassenschaft des Weltkrieges war er zu alt. Nachdem Ewald den Gegenstand notdürftig gesäubert hatte, erkannte er die Schneide eines Beils. Die Form hatte allerdings nur wenige Ähnlichkeiten mit den Werkzeugen, die Ewald kannte. Auch wenn es für ihn eine intellektuelle Herausforderung war: Er deutete seinen Fund korrekt. Das Beil musste aus Bronze sein, was auf eine keltische Herkunft schließen ließ.
Statt seinen Fund zu melden, ging Ewald mit dem wenigen Werkzeug, das er zur Verfügung hatte, an die Arbeit und untersuchte die Grube. Woher der Hohlraum auf einmal kam, konnte Ewald nicht wissen. Er war viel zu aufgeregt, als er zwei weitere bronzene Beilschneiden fand. Schließlich stieß er mit seinem Spaten auf eine tönerne Platte, die bei dem Versuch der Bergung in kleinste Teile zerbröselte. Dass er unter der Tonschicht nur einen winzig kleinen schwarzen Metallkegel entdeckte, enttäuschte ihn zunächst. Erst als es ihm nicht gelang, den Kegel aus dem Boden zu ziehen, wurde er stutzig. Mit seinen Händen befreite er das Umfeld des Kegels von dem Sand. Immer größer wurde der seltsame Gegenstand. Nach einer Weile musste er sogar die Grube mit seinem Spaten vergrößern und dabei aufpassen, dass der Traktor nicht tiefer rutschte. Nach gut zwei Stunden stieß er auf Widerstand. Der Kegel breitete sich an dieser Stelle horizontal aus. Ewald wusste mit dem schmutzigen Gebilde nichts anzufangen, dennoch glaubte er, etwas Seltenes und Wertvolles aus dem Boden zu holen. Geduldig arbeitete er weiter, bis er den 70 Zentimeter großen Kegel aus dem Loch herausziehen konnte. Zuerst war er ziemlich schwer, doch als er ihn hochhob, fiel das Innere des Kegels einfach zurück in das Loch. Sand, dachte sich Ewald und betrachtete den nun leichten Kegel mit der abschließenden Krempe. Die Erkenntnis traf ihn fast wie ein Schlag. Vorsichtig streifte er den hartnäckigen Schmutz ab und legte damit viele kleine Ornamente frei. Ewald hatte einen Goldenen Hut gefunden. Er wusste, dass vor über 100 Jahren nur ein paar Kilometer von seinem jetzigen Standpunkt entfernt ein weiterer Hut gefunden wurde, der aus purem Gold bestand. Bisher hatte er nur Fotos des wertvollen Hutes gesehen. Der Fund, den er in der Hand hielt, erschien ihm größer und vollständig erhalten. Mit Bedacht, um ja nicht die dünne Wand des Hutes einzudrücken, stellte er ihn auf den Fahrersitz seines Traktors.
Ewald überlegte, was er mit seinem Fund anstellen könnte. Ihn einfach melden? Würde er den Hut abgeben müssen, vielleicht lediglich gegen einen kleinen Finderlohn, wenn überhaupt? Oder sollte er ihn einem Kunsthändler zum Kauf anbieten? Während er die Möglichkeiten durchging, fiel ihm seine Frau ein. Gestern hatte sie wieder von Scheidung gesprochen. Nein, Ewald war nicht gewillt, seiner Frau die Hälfte des Gewinns abzugeben. Den Hut hatte er gefunden, er ganz allein.
Gewillt, möglichst viel Geld aus dem Fund herauszuschlagen, wickelte er den Hut vorsichtig in eine Decke ein und versteckte ihn in der Großwerkzeugkiste, deren Inhalt er einfach auf das Feld warf. Bevor er zurückfahren konnte, wartete eine weitere schweißtreibende Arbeit auf ihn: Er musste die Grube wieder befüllen, um mit seinem Traktor nicht tiefer einzubrechen.
Erst spät am Abend kam er erschöpft im Hof an und motzte als Erstes mit seiner Frau, weil das Essen nicht auf dem Tisch stand.
Nach dem Abendessen verschwand er in der Scheune, wo eine ältere und unbenutzte Metallkiste lagerte. Zusammen mit zwei oder drei Decken packte er den Hut und die Beilschneiden ein und polsterte den Rest des Volumens mit Stroh aus.
Gleich am nächsten Morgen fuhr er zum zweiten Mal auf die abgelegene Parzelle und öffnete erneut die Grube. Sorgfältig stellte er die Metallkiste hinein und deckte sie grinsend mit dem Ackerboden ab. Jetzt kann die Scheidung kommen, dachte er. Gleich danach werde ich den Goldenen Hut zum zweiten Mal finden.
Da Ewald wusste, wie schnell man sich bei Entfernungen auf dem freien Feld verschätzen konnte, fertigte er eine Karte an. Dazu schritt er die Strecken zu zwei markanten Punkten der Umgebung ab und notierte sie. In seinem Haus versteckte er seine private Schatzkarte auf dem Speicher bei den Habseligkeiten, die er mit in die Ehe gebracht hatte und vor allem aus stark abgenutzter Kleidung und einem vergilbten Bild seiner Mutter bestand.
Das Schicksal nahm seinen Lauf. Ein abendlicher Streit der beiden kam einer Scheidung zuvor. Ewald, nach dem übermäßigen Genuss von Alkohol nicht mehr geistiger Herr über sich selbst, pöbelte seine Frau an, die, hochschwanger wie sie war, den Holzboden im Obergeschoss reinigte. Ein Wort gab das andere, die erhobene Hand Ewalds konterte Dorothea mit dem Stiel des Schrubbers, und schon stürzte Ewald wie seinerzeit seine Schwiegermutter final die enge Stiege hinunter. Das Ausstellen des Totenscheins war nur eine Formsache.
Kapitel 1 – Ein paar Vermisstenfälle
Es hätte so ein schöner Tag werden können.
»Grumbeere?« Ich glaubte, nicht richtig gehört zu haben. Der Montagmorgen hatte so vielversprechend begonnen. Nach einem stressigen Wochenende, an dem ich wie üblich durch meine Familie zu 100 Prozent fremdbestimmt war, fuhr ich heute früh gut gelaunt zur knapp einen Kilometer entfernten Dienststelle im Schifferstadter Waldspitzweg. Dass der Montag das heimliche Wochenende familiengeplagter Väter war, dürfte jedem Beamten, aber auch den meisten Arbeitnehmern bekannt sein. Als Polizeibeamter der Kriminalinspektion Schifferstadt hatte ich einen zusätzlichen Bonus zum Wochenstart: Unser Dienststellenleiter KPD, mit richtigem Namen Klaus P. Diefenbach, nutzte den Wocheneinstieg immer zur Selbstbeweihräucherung in eigener Sache. Ein endloser Monolog, noch nie hatte es ein Zuhörer geschafft, seinen Ausführungen in Gänze zu folgen, was vor allem daran lag, dass es niemand versuchte. Die Kunst während der Lagebesprechung bestand darin, möglichst natürlich nach vorne gebeugt zu sitzen, sodass KPD, der im Stehen referierte, die geschlossenen Augen nicht bemerken konnte. Ein geöffneter Schreibblock nebst Kugelschreiber vervollständigte die Tarnung. Selbst ein leichtes Schnarchen störte unseren Chef nicht, da er während seines Monologes nicht auf einzelne Untergebene, wie er uns bezeichnete, achtete.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!