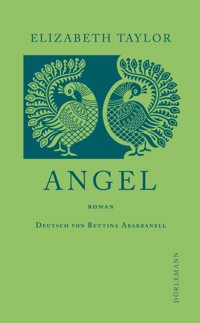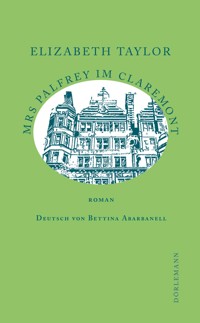
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
An einem verregneten Sonntag im Januar trifft die kürzlich verwitwete Mrs Palfrey im Claremont ein, wo sie den Rest ihres Lebens verbringen soll. Ihre Mitbewohner – herrlich exzentrisch und unendlich neugierig – leben von Krümeln der Zuneigung und Schnipseln von Klatsch und Tratsch. Gemeinsam wehren sie, dank der berühmten britisch steifen Oberlippe, ihre größten Feinde ab: die Langeweile und den Tod.Eines Tages schließt Mrs Palfrey unerwartet Freundschaft mit dem mittellosen jungen Schriftsteller Ludo, der sie als Vorbild für seinen Roman verwendet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Elizabeth Taylor
Mrs Palfreyim Claremont
Roman
Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell
Mit einem Nachwort von Rainer Moritz
DÖRLEMANN
Die englische Originalausgabe »Mrs Palfrey at the Claremont« erschien 1971 bei Chatto & Windus, London. Die Übersetzung wurde mit Mitteln des Deutschen Übersetzerfonds gefördert. Die Übersetzerin bedankt sich hierfür. Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten Copyright © 1971 The Estate of Elizabeth Taylor © 2021 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf unter Verwendung eines Fotos von Tupungato | Dreamstime.com Porträt: © Elizabeth Taylor, National Portrait Gallery Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN: 978-3-03820-984-3www.doerlemann.com
Inhalt
Elizabeth Taylor
Kapitel Eins
Mrs Palfrey zog an einem Sonntagnachmittag im Januar ins Claremont Hotel. Über London hatte es sich eingeregnet, und ihr Taxi schipperte auf der so gut wie verlassenen Cromwell Road an einem höhlenartigen, von Säulen getragenen Vordach nach dem anderen vorbei. Der Chauffeur fuhr langsam und streckte den Kopf zum Fenster hinaus, denn das Hotel war ihm unbekannt. Das hatte Mrs Palfrey etwas verstört, denn sie kannte es auch nicht und begann sich zu fragen, was sie erwartete. Sie versuchte, den Schrecken aus ihrem Herzen zu verbannen. Ihre drohende Bedrückung setzte ihr zu.
Wenn es dort nicht schön ist, brauche ich ja nicht zu bleiben, versprach sie sich, leicht die Lippen bewegend, während sie sich im Taxi vorbeugte, um auf der breiten, beängstigenden Straße von einer Seite zur anderen zu schauen, und beinahe fürchtete, den Namen Claremont über einem der Vordächer zu lesen. Es gab so viele Hotels an dieser Straße, eins neben dem anderen, und alle sahen im Grunde gleich aus.
Sie war ganz zufällig auf eine Anzeige in der Sonntagszeitung gestoßen, als sie bei ihrer Tochter Elizabeth in Schottland zu Besuch gewesen war. Herabgesetzte Winterpreise. Hervorragendes Essen. Das dürfte wohl mit Vorsicht zu genießen sein, hatte sie gedacht.
Schließlich bremste das Taxi ab. »Claremont Hotel« las sie, denkbar deutlich, in großen Buchstaben quer über eine Häuserfront hinweg, die aus zwei – vielleicht sogar drei – großen, zu einem einzigen vereinten Gebäuden zu bestehen schien. Sie atmete auf. Die Säulen des Vordachs waren unlängst gestrichen worden; in den Blumenkästen wuchsen Japanische Aukuben; saubere Gardinen – eine Fassade ausdrücklicher Anständigkeit.
Sie wuchtete sich aus dem Taxi und ging, auf ihren mit Gummikappe versehenen Spazierstock gestützt, über den Bürgersteig und ein paar Stufen hinauf. Ihre Krampfadern machten ihr heute zu schaffen.
Sie war eine hochgewachsene Frau mit großen Knochen und einem feinen Gesicht, dunklen Augenbrauen und säuberlich gefaltetem Doppelkinn. Sie hätte einen vornehmen Mann abgegeben, und manchmal, in Abendgarderobe, sah sie aus wie irgendein berühmter General in Frauenkleidern.
Gefolgt von dem Chauffeur und ihrem Gepäck (denn aus dem Hotel kam kein Lebenszeichen), kämpfte sie mit der Schwingtür und taumelte fast in das stille Foyer hinein. Die Dame an der Rezeption war von kühler Freundlichkeit, so als sei dies ein Pflegeheim, noch dazu eins für Geistesverwirrte. »Was für ein Tag!«, sagte sie. Der Taxifahrer, der mit den Koffern hinterhergetrampelt kam, wirkte in dieser gedämpften Atmosphäre fehl am Platz und wurde sofort von einem Portier abgelöst. Mrs Palfrey öffnete ihre Handtasche und suchte sorgfältig einige Münzen heraus. Sie tat alles ohne Eile, fast gebieterisch. Sie hatte sich immer zu benehmen gewusst. Selbst als Braut unter seltsamen, beunruhigenden Bedingungen in Burma war sie großartig gewesen: gelassen, als sie (zum Beispiel) über Hochwasser zu ihrem neuen Heim gerudert wurde; unerschüttert, als sich zeigte, dass es mehr als feucht war und eine Schlange sich zur Begrüßung um das Treppengeländer gewunden hatte. Mrs Palfrey hatte das Kreuz durchgedrückt und sich ins Gebet genommen, genauso wie heute Nachmittag im Zug.
Trotz langer Übung stellte sie fest, dass solche Entschlossenheit ihr neuerdings schwerer fiel. Als junge Frau hatte sie ihrem gerade erst geehelichten Mann, den sie bewunderte, ein bestimmtes Bild von sich zu präsentieren gehabt; dann auch sich selbst und schließlich den Einheimischen (Ich bin Engländerin). Jetzt spiegelte ihr niemand mehr dieses Bild wider, und es schien verblasst zu sein, hatte es doch zwei Drittel seines einstigen Wertes eingebüßt (kein Mann, keine Einheimischen).
So mussten sich Häftlinge fühlen, dachte sie, als der Portier ihre Koffer abgestellt hatte und gegangen war, wenn sie das erste Mal in ihrer Zelle allein gelassen wurden, sich das erste Mal zum Fenster wandten und dann zur geschlossenen Tür schauten; danach die Schritte von Wand zu Wand zählten. Sie malte es sich kurz aus.
Durch das Fenster sah sie – sah sie nur – eine weiße Backsteinmauer, an der schmutziger Regen herabglitschte, und eine schmiedeeiserne Feuerleiter, die recht anmutig war. Sie versuchte, sie anmutig zu finden. Die Aussicht – besonders an diesem schon dunkler werdenden Nachmittag – war entmutigend; doch dass die Rückseite von Hotels, in denen mittellose Damen einquartiert werden, einen Blick zu bieten hätte, war ja nicht zu erwarten. Das Beste ist Flitterwöchnern vorbehalten, wozu sie es allerdings brauchen sollten, wusste Gott allein.
Das Bett sah ziemlich hoch aus, und der Teppich war abgenutzt, wenn auch nicht fadenscheinig. Man konnte Rosen darauf erkennen. In der Ecke gab es einen Kamin, vernagelt, aber noch mit einem Funkenschutzboden aus pfauenblauen Kacheln davor. Der Heizkörper gab einen trockenen Geruch nach Versengtem und gedämpfte Geräusche von sich. Schwere Holzknäufe an den Schubladen der Kommode – das Zimmer glich eher einer Dienstmädchenkammer.
Sie nahm den Hut ab und schob ihr Haar umher. Es war kurz, grau und gleichmäßig gewellt, als hätte jemand eine Hand darüber ausgebreitet und dann zugedrückt.
Die Stille war seltsam – eine sonntagnachmittägliche Stille und Seltsamkeit; und kurz geriet ihr Herz ins Schlingern, stolperte vor Entsetzen und Verzweiflung wie schon einmal zuvor, als sie plötzlich begriffen hatte oder nicht mehr nicht begreifen konnte, dass ihr Mann, der an der Schwelle des Todes stand, sie überschreiten würde. Wider alle Hoffnung, all ihren Gebeten zum Trotz.
Um sich zu beruhigen, setzte sie sich auf die Bettkante, atmete tief durch und hob das Kinn, als wollte sie mit gutem Beispiel vorangehen.
In der Ferne jammerte der Fahrstuhl. Bald hörte sie sein Gitter zuschlagen, dann zerstiebende Geräusche – Schritte, Gespräche, Menschen, die sich näherten, von einem Flur in den anderen abbogen. Zwei höfliche Stimmen kamen schließlich an ihrer Tür vorbei. Sie war dankbar dafür.
Ihre düstere Stimmung war verflogen, und sie fing an auszupacken. Sie hängte ihre Kleider auf und dachte an frühere Wohnstätten zurück; aber dankbar, nicht mehr untröstlich. Alles, was sie jetzt berührte, war ihr vertraut – Pillen klapperten vertraut in ihren Dosen, als sie sie auf den Nachttisch stellte. Ihr kurzes Pelzcape hängte sie über einen Stuhl. Es roch nach Kampfer und Tier, wie eh und je. Sie beschloss, es zum Abendessen anzuziehen, um einen maßgeblichen ersten Eindruck zu machen. Auf wen, würde sich herausstellen oder auch nicht. Neben ihr Bett legte sie Palgraves Goldene Schatzkammer und ihre Bibel, obwohl sie nicht religiös war.
Als sie ausgepackt hatte – und sie zog es nach Kräften in die Länge, damit ihr später früher vorkommen würde –, nahm sie ihr Necessaire und ging den Flur hinunter bis zu einer Tür mit der Aufschrift »Damentoilette«.
Ihr Tisch stand in einer Ecke des Speisesaals und war leer bis auf eine silberne Vase mit einer einzelnen weißen Chrysantheme und etwas Grün. Bald kämen ihre Packung Knäckebrot und, beim Frühstück, ihre Weizenkleieflocken und ihre bessere Sorte Marmelade hinzu. Aus Hotelmarmelade machte sie sich nichts.
An anderen Tischen saßen einige ältere Damen wie sie, die für Mrs Palfrey so aussahen, als säßen sie seit Jahren dort. Die Hände im Schoß gefaltet, der Blick verträumt, warteten sie geduldig auf ihre Selleriesuppe. Es gab auch ein, zwei Ehepaare, die, dann und wann kurz aneinander erinnert, zur Wahrung des Scheins eine Bemerkung über den Tisch richteten, während sie ansonsten vage umherschauten oder an einem Stück Brot knabberten. Mehr als die alten Damen wirkten sie wie auf der Durchreise. Die Kellnerinnen liefen geräuschlos über den dicken Teppich, als assistierten sie bei einem Ritual. Viele Tische waren unbesetzt.
Nach einer zähflüssigen Selleriesuppe gab es die Wahl zwischen gebratenem Surrey-Huhn oder kaltem Norfolk-Truthahn. Dann kam der Servierwagen mit rotem Wackelpudding und schwappendem Obstsalat (hauptsächlich kleingeschnittene Äpfel und Bananen, wie Mrs Palfrey feststellte). Kaffee wurde im Aufenthaltsraum getrunken. Es war alles ziemlich schnell vorbei, ohne Gespräche, mit denen die Zeit sich hätte ausdehnen lassen. Viertel nach acht.
Im Aufenthaltsraum wurde das Strickzeug hervorgeholt, hier und da gab es sogar eine halbherzige kleine Unterhaltung. Mrs Palfrey wusste, dass die Bewohner eines solchen Hotels ihre angestammten Plätze hatten, und so setzte sie sich, mit ihrem gewohnt sicheren Gespür für das richtige Benehmen, an diesem ersten Abend in eine ziemlich dunkle Ecke an der Tür, wo es zog, legte sich das Cape enger um die Schultern und schlug ihren Agatha Christie auf.
Um neun Uhr merkte sie, dass Bewegung in den Raum kam. Stricknadeln wurden in Wollknäuel gestochen (sie beschloss, sich am nächsten Morgen ebenfalls Strickzeug zu besorgen), Bücher dankbar zugeklappt, als wären sie nur eine Übergangsbeschäftigung gewesen, und steife Körper erhoben sich mit viel Aufwand aus den Sesseln.
Nur Mrs Palfrey las weiter und wunderte sich, bis eine ältere Frau, langsamer als die anderen, von Arthritis gebeugt und an zwei Stöcken gehend, auf ihrem Weg zur Tür bei Mrs Palfreys Stuhl innehielt. »Wollen Sie nicht auch herüberkommen und sich die Serie ansehen?«, fragte sie, und es schien, als wäre da vielleicht ein Lächeln auf ihrem Gesicht gewesen, wenn sie nicht solche Schmerzen gehabt hätte.
Mrs Palfrey stand schnell auf und errötete ein wenig, als wäre sie neu an einer Schule und würde zum ersten Mal von einer Vertrauensschülerin angesprochen.
»Ich heiße Elvira Arbuthnot«, sagte die geplagte Frau knapp und schleppte sich weiter. »Wir sehen uns die Serie immer gern an«, fügte sie hinzu. »Es sorgt für Abwechslung.«
Mrs Palfrey war zufrieden mit ihrem ersten Abend. Jemand hatte mit ihr gesprochen: Sie kannte jetzt einen Namen, den sie sich merken würde. Morgen, beim Frühstück, könnte sie Mrs Arbuthnot »Guten Morgen« sagen und nicken. So würde der Tag angenehm beginnen. Danach würde sie hinausgehen und sich ihr Knäckebrot, ein Glas Marmelade und etwas Wolle kaufen. (Was um alles in der Welt könnte sie stricken, überlegte sie, und für wen?) Auf diese Weise wäre sie den ganzen Vormittag über beschäftigt.
Sie half ihrer neuen Bekanntschaft, in dem abgedunkelten Raum einen Platz zu finden. Sie selbst setzte sich auf einen harten Stuhl hinter einer Reihe von Sesseln. Köpfe mit gelichtetem Haar lehnten an den Schonern. Jemand drehte sich steif um und sah sie kurz an, wie zur Warnung, sich ja nicht zu rühren. Sie wurde ganz reglos. Von der Serie verstand sie wenig, sie war zu spät hinzugekommen.
Die ganze Nacht lang war es still im Hotel; selbst der Londoner Verkehr schien in einer anderen Welt zu fließen, gedämpft und einlullend. Mrs Palfrey schlief schlecht und war froh, als sie endlich draußen auf dem Flur jemanden entlanggehen hörte und kurz darauf das Wasser zu rauschen begann. Sie stand auf, zog sich den Morgenmantel über und setzte sich, Necessaire am Handgelenk, in Habachtstellung, um auf die zurückkehrenden Schritte zu lauschen. Als sie kamen, huschte sie aus der Tür und den Flur entlang und hatte die Hand schon am Griff der Badezimmertür, bevor irgendjemand anders auch nur um die Ecke biegen konnte.
Das Bad war warm und dunstig, der Vorleger feucht, und in der nassen Wanne fand sich ein krauses graues Haar. Sie spülte es weg und versuchte, nicht darüber nachzudenken. Sie wusch sich schnell (aus Rücksicht auf andere) und vertrieb mit ihrer nach Zitrone duftenden Seife den Nelkengeruch, der vorher dagewesen war.
Später ging sie, bekleidet mit ihrem kastanienbraunen Wollkostüm, den Tagesperlen und festen Schuhen, in den Speisesaal und nickte auf dem Weg zu ihrem Ecktisch ein, zwei Leuten ganz leicht zu. Die ältliche Kellnerin wartete mürrisch ab, bis Mrs Palfrey sich zwischen Backpflaumen und Porridge, Schellfisch und Würstchen entschieden hatte.
Während sie auf die Backpflaumen wartete, fasste Mrs Palfrey den vor ihr liegenden Tag ins Auge. Der Vormittag wäre auf recht schöne Art gefüllt; Nachmittag und Abend dagegen würden sich lange hinziehen. Ich darf mein Leben nicht fortwünschen, schalt sie sich; doch sie wusste, dass sie immer häufiger auf die Uhr schaute, je älter sie wurde, und dass es jedes Mal früher war, als sie gedacht hatte. In ihren jüngeren Jahren war es immer später gewesen.
Ich könnte ins Victoria and Albert Museum gehen, dachte sie – spürte aber, dass sie es auf einen anderen Tag verschieben würde. In London sei immer so viel los, hatte sie zu ihrer Tochter gesagt, die ihr Eastbourne als geeigneteren Ort zum Leben vorgeschlagen hatte. In London gebe es jede Menge kostenloser Vergnügungen und eine große Vielfalt an Menschen.
Vor den Fenstern des Speisesaals hingen Stores, aber ihr war so, als hätte es wieder angefangen zu regnen.
Nach dem Frühstück ging sie ins Foyer, stellte sich neben die Schwingtür und beobachtete die Menschen, die, unter Schirmen geduckt und von Bussen bespritzt, auf der nassen Straße vorbeihasteten. Unterwegs zur Arbeit. Es war ein Montagmorgen, wie er sich gehörte, befand Mrs Palfrey, ging in den Aufenthaltsraum und begann, einen heiteren Brief an ihre Tochter zu schreiben.
Um elf beschloss sie, dem Wetter zu trotzen und aufzubrechen, um ihren Brief einzuwerfen und ihre Einkäufe zu tätigen. Das nahm wesentlich weniger Zeit in Anspruch, als sie eingeplant hatte, und so lief sie trotz ihrer Krampfadern noch auf einem nahe gelegenen Platz herum. In der Mitte des Platzes war eine Grünanlage mit asphaltierten Wegen, einer Laube und triefenden Sträuchern. Es war das reinste Hundeklosett. All die Pekinesen und Pudel aus den umliegenden Wohnblöcken hatten an den Zäunen ihre kleinen Haufen hinterlassen. Sie musste aufpassen, wo sie hintrat.
Ich werde beobachten können, wie der Flieder anfängt zu blühen, dachte sie. Es wird genauso sein wie im Park von Rottingdean. Die Umgebung hätte kaum verschiedener sein können, doch hinsichtlich der Fliederbäume empfand sie Entschlossenheit. Sie würden Teil ihrer Regeln werden, ihres Verhaltenskodex. Sei unabhängig; verfalle niemals der Schwermut; rühre niemals Kapital an. Und an diese Regeln hatte sie sich gehalten.
Um zwölf ging sie zurück. Sie war eine Stunde draußen gewesen.
»Englands Manieren!«, rief Mrs Post, die hinter Mrs Palfrey durch die Schwingtür kam. »Was ist bloß mit ihnen geschehen? Sie waren doch früher so gut.«
Sie betupfte ihre metallgrauen, von einem vorbeifahrenden Wagen bespritzten Strümpfe. »Keinerlei Rücksicht.«
Mrs Palfrey schnalzte teilnahmsvoll mit der Zunge.
»Sie sind gestern Abend angekommen«, sagte Mrs Post – kaum informativ. »Wie lange bleiben Sie?«
Mrs Palfrey äußerte sich hierzu bewusst vage.
»Ich muss eilen und mir das Haar richten«, sagte Mrs Post und steuerte auf den Fahrstuhl zu. »Mein Vetter kommt zum Mittagessen. Ich habe das Claremont zu meinem Zuhause gemacht, wissen Sie; all mein geselliges Leben muss hier stattfinden.«
Als sie gemeinsam im Fahrstuhl hinauffuhren, befiel sie zunächst eine gewisse Befangenheit. Sie blickten einander auf die Füße. Schließlich gab sich Mrs Post einen Ruck. »Haben Sie Verwandte in London?«, fragte sie.
»Mein Enkelsohn wohnt in Hampstead.«
»Oh, dann werden Sie ihn ja sicher oft zu sehen bekommen. Das wird so viel ausmachen. Ist dies auch Ihre Etage?«
Sie gingen zusammen den Flur entlang.
»Verwandte machen so viel aus«, sagte Mrs Post. »Auch wenn man nie mit ihnen zusammenwohnen würde.«
»Nie«, sagte Mrs Palfrey.
»So sehr man auch in Verlegenheit ist. Aber ich sehe sie gern; ich freue mich, wenn sie mich besuchen. Wenn all meine Londoner Verwandten nicht wären, würde ich wohl nach Bournemouth ziehen. Dort ist das Klima milder, und es ist immer etwas los.«
»Ich hätte gedacht, in London wäre immer etwas los«, sagte Mrs Palfrey.
»Das stimmt, man geht ja nur irgendwie nicht hin.«
Kapitel Zwei
Im Laufe der Tage, der langsam vergehenden Tage, lernte Mrs Palfrey, die anderen Hotelgästen in Langzeitbewohner und Zugvögel zu unterteilen. Die Bewohner waren drei ältliche Witwen und ein alter Mann, ein Mr Osmond, der weibliche Gesellschaft zu missbilligen schien und selten andere hatte. Er versuchte, den betagten Ober im Speisesaal mit Gesprächen aufzuhalten, stand beim Portier herum, um mit ihm zu plaudern, lauerte dem Hotelmanager auf.
Die Bar war im Grunde nur ein Teil des Aufenthaltsraums mit einer Klingel, auf die man drücken konnte, woraufhin nach einer Weile jemand aus dem Speisesaal kam, um den Schrank aufzuschließen, in dem die Flaschen standen. Hier, auf dieser Seite, saß Mr Osmond am frühen Abend. Am anderen Ende des Raums war stets das Klappern von Stricknadeln zu hören, vermischt mit dem gedämpften Brummen des Verkehrs auf der Cromwell Road hinter den schweren Vorhängen.
Mr Osmond trank Wein. Er saß ganz still da, das Glas neben sich, als leiste es ihm Gesellschaft, und wartete auf den Manager, der gelegentlich hereinschaute. Er konnte seinen Ärger nicht verhehlen, wenn Mrs Burton seinen Teil des Aufenthaltsraums betrat und fortwährend nach Whisky klingelte. Sie gab so viel Geld für Whisky aus, dass es den anderen Damen ein Rätsel war – wie sie sich das Geld in den Hals schüttete, sagte Mrs Post. Sie leistete sich noch andere Extravaganzen, etwa malvenfarben getöntes Haar oder was Mrs Arbuthnot als Kettenrauchen bezeichnete, obwohl es das nicht war. Mrs Arbuthnot neigte, vielleicht infolge ihrer Arthritis, zur Abfälligkeit.
Mrs Palfrey wünschte sich zwar sehnlich, ihren Platz zu finden und dort anerkannt zu sein, hatte aber genügend Charakter, um sich selbst eine Meinung über Mrs Burton bilden zu wollen. »Ich sage, was ich denke«, hätte ihr Motto sein können, wäre sie nicht der Ansicht gewesen, dass so Bedienstete sprachen.
Der Haupttreffpunkt der Bewohner war das Foyer, wo in einem Rahmen neben dem Fahrstuhl jeweils etwa eine Stunde vor dem Mittag- und dem Abendessen die Speisekarte ausgehängt wurde. Um diese Zeit herum schienen sie dort herumzulungern – alte Kirchennachrichten am Schwarzen Brett zu lesen, gegen das Barometer zu klopfen, an der Rezeption nach Briefen zu fragen oder auf die Straße hinauszuschauen. Niemand wollte gierig oder übermäßig am Essen interessiert erscheinen; doch die Mahlzeiten unterteilten den Tag, und die Speisekarte bot eine kleine Auswahl und Anlass zu Zufriedenheit oder Enttäuschung, so wie es einst das Leben getan hatte.
Obwohl man darauf gewartet hatte, wurde die Karte, sobald sie im Rahmen angebracht worden war, eine Zeitlang ignoriert. Dann blieb etwa Mrs Arbuthnot auf ihrem langsamen Gang zum Fahrstuhl beiläufig davor stehen, wenn auch kaum länger als eine Sekunde. Da war nicht viel, was man sich hätte merken müssen – eine Auswahl von zwei oder drei Gerichten –, und hinzu kam (was Mrs Arbuthnot wusste, Mrs Palfrey aber noch nicht gelernt hatte), dass die Karten alle zwei Wochen, wenn nicht öfter, wiederkehrten. Es gab Umstellungen, aber keine Veränderungen.
Mr Osmond ließ sich zu dem Getue der alten Damen nicht herab. Er marschierte zur Speisekarte, wann er es wollte, stellte sich mannhaft direkt davor, las laut, summte und ahate und rief dem Portier zu: »Na, ich hoffe, der Brotauflauf ist besser als letztes Mal. Ganz wässrig war der. Verdammt scheußliches Zeug, das können Sie mir glauben.« Von Mann zu Mann. Mrs Palfrey fand diese Redeweise ziemlich derb und runzelte die Stirn (bevor auch sie näher trat). Ihr Mann hatte nie vor ihr geflucht, obwohl sie sicher war, dass er es sonst oft getan hatte, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Verschwommen sah sie aufsässige Einheimische vor sich.
Mrs Burton erschien fast nie zur Warterei auf die Speisekarte. Sie hatte anderes zu tun – etwa auf die Klingel zu drücken. Doch an Mrs Palfreys sechstem Abend kam sie auf dem Rückweg vom Friseur gerade durchs Foyer, als Mrs Palfrey auf den Fahrstuhl wartete, und sie lasen nacheinander, was auf der Karte stand. Mrs Burton seufzte. »Ach, das Freitagsfrikassee«, sagte sie. Der Fahrstuhl kam herabgejammert, und sie stiegen ein. Bei diesen Gelegenheiten, hatte Mrs Palfrey herausgefunden, ergab sich zuweilen die Möglichkeit, Bekanntschaften zu schließen, Gespräche anzufangen. Mürrisch zu schweigen war kein gutes Benehmen. »Nicht-Bewohner willkommen«, zitierte Mrs Burton verächtlich. »Dieser Anschlag draußen amüsiert mich immer wieder. Ich bezweifle, dass sich jemals irgendwer davon hat verlocken lassen.«
Ein starker Geruch nach Haarspray und ihrem mittäglichen Whisky ging von ihr aus. Ihr Haar war malvenfarbener denn je, und sie trug ein Netz darüber, das mit winzigen Samtschleifen gesprenkelt war.
Sie wohne seit fünf Jahren im Claremont, erklärte sie, und habe kaum je erlebt, dass sich ein Nicht-Bewohner hierher verirrt hätte. »Noch habe ich je einen Freitag ohne Frikassee erlebt«, fügte sie hinzu. »Diese Eintönigkeit! Aber es ist überall das Gleiche. Vorher war ich im Astor. Kennen Sie das Astor? Das ist in Bloomsbury. Ach, du grüne Neune, Bloomsbury! Wie entsetzlich traurig es dort an einem Winternachmittag sein kann – besonders sonntags. Sagen Sie, wollen wir nicht vor dem Abendessen ein Glas zusammen trinken?«
Mrs Palfrey nahm die Einladung an und fand, dass der Fahrstuhl tatsächlich Wunder wirkte; sie freute sich schon auf das Aufsehen, das sie erregen würde – und zwar kein billigendes –, wenn sie in der Bar neben Mrs Burton Platz nahm.
Als sie später in einem ihrer kastanienbraunen Kleider mit auf der Brust verstreuten aufgestickten Perlen hinunterfuhr, überlegte sie, ob sie einen halbtrockenen Sherry oder Dubonnet nehmen sollte. Sie fühlte sich zugleich verwegen und trotzig. Ihren Strickbeutel hatte sie oben gelassen. Leicht errötend ging sie in den hinteren Teil des Aufenthaltsraums und nahm ein altes, altes Exemplar der Feldsportzeitschrift The Field zur Hand. Beiläufig blätterte sie darin und hielt den Kopf die ganze Zeit gesenkt. Bald darauf kam Mrs Burton und drückte mit großer Autorität auf den Klingelknopf. Ihnen gegenüber saß Mr Osmond und beäugte sie. Er hatte ein Glas Wein neben sich auf dem Tisch stehen, rührte es aber nicht an. Er saß geduldig still, die Hände auf den Knien, als wartete er darauf, dass der Wein sich selbst trank.
Mrs Burton hatte ihr Haarnetz abgenommen und die Falten ihres Gesichts mit Puder gefüllt. Ihr Gesicht hatte sich im Grunde aufgelöst – in Beutel, Wammen und tiefe Schluchten, sodass es aussah, als hätte sich ein Erdrutsch ereignet.
»Die Trinkerei hat bereits ihren Tribut gefordert«, flüsterte am anderen Ende des Raums Mrs Arbuthnot Mrs Post zu; die schüttelte spröde den Kopf, wenn auch nicht, weil sie anderer Meinung war; sie zählte, stumm die Lippen bewegend, Stiche. Als sie damit fertig war, warf sie einen langen, klaren Blick auf Mrs Burton und schüttelte erneut den Kopf. »Es ist sehr traurig«, sagte sie, als hätte sie großes Mitleid.
Endlich kam der Ober, und Mrs Palfrey, die sich für Sherry entschieden hatte, lehnte sich zurück, um das feindselige Interesse auf der anderen Seite des Raumes heil zu überstehen.
»Mein Schwager kommt zum Essen«, sagte Mrs Burton. »Deshalb das frisierte Haar.« Sie berührte es leicht, aber es gab nicht nach. »Er kümmert sich um mich, der Harry. Haben Sie Verwandte in London?«
Sie war nicht die Art von Frau, mit der sie normalerweise Umgang gehabt hätte, dachte Mrs Palfrey, … nicht ganz … aber das Leben hatte sich verändert, und um bei Trost zu bleiben, musste sie sich mit ihm verändern.
»Ich habe einen Enkel, der im Britischen Museum arbeitet. Sonst niemanden. Seine Mutter lebt in Schottland. Nein, ich rauche nicht, danke.«
»Ach, dann wären Sie im Astor ja mehr in seiner Nähe gewesen. Kommt er Sie besuchen?«
»Oh ja. Desmond wird kommen. Er weiß ja, wo er mich findet. Wir haben immer – einen Draht zueinander gehabt, wissen Sie. Manchmal überspringen diese Beziehungen ja eine Generation.«
»Ich freue mich, wenn ich mal ein junges Gesicht zu sehen bekomme.«
Mr Osmond hatte den Ober abgefangen, der – wenn auch ungeduldig – neben seinem Stuhl stehen blieb.
»Könnte Sie interessieren, dachte ich …«, murmelte Mr Osmond. »Fiel mir plötzlich ein … muss ich Antonio erzählen … auf meinen Reisen … in Italien war das … Ihrem Land … Fresken …«
Das alte, rötliche Gesicht hatte die falsche Lebendigkeit eines Wegelagerers angenommen, denn es war mühselige Arbeit, seinen Zuhörer bei der Stange zu halten. Mrs Burton schaute leidenschaftslos zu und schob ihr Haar hoch, denn sie konnte nur Fetzen von diesem hastigen, gedämpften Gerede hören; dennoch blickte Mr Osmond auf einmal zu ihr herüber und sagte: »Hier muss ich meine Stimme senken.« Er erhob sich halb zum seitwärts geneigten Kopf des Obers und brüllte, als wäre der Mann taub: »… ein enormes Geschlechtsteil. Ganz enorm.« Dann senkte er die Stimme wieder und sagte vertraulicher: »Fresken. Italienische Fresken. Ich nehme an, Sie wissen, was ich meine.«
Mrs Burton prustete kurz vor Lachen und verwandelte es schnell in Husten. Mrs Palfrey schaute beiläufig weg und nahm einen Schluck Sherry. So ein armer alter Wicht ist er also, dachte sie.
»Enorm!«, sagte Mr Osmond erneut, und der Ober eilte davon. Wieder allein, saß Mr Osmond ganz still in seinem Sessel und lächelte. Er hatte sein Gespräch gehabt.
»Unflätiger alter Kerl«, flüsterte Mrs Burton hinter ihrem Taschentuch.
Schweigen am anderen Ende des Raums. Mrs Post löste Stiche auf, und Mrs Arbuthnot hatte sich in ihre Welt des Schmerzes zurückgezogen. Bald stand Mrs Burton auf und drückte wieder auf die Klingel.
Um halb acht schlenderte Mr Osmond als Erster in den Speisesaal, gefolgt von Mrs Arbuthnot, langsam, geisterhaft, Schritt für schmerzhaften Schritt, ihre zwei Stöcke immer ein kleines Stück voraus. Sie war wie ein verletztes Insekt. Bei Mrs Palfrey angelangt – Mrs Burton ignorierte sie –, hielt sie inne. »Was haben Sie mit Ihrem Enkel angestellt?«, fragte sie. »Wenn wir ihn nicht bald hier sehen, fangen wir noch an zu denken, dass es ihn gar nicht gibt.«
»Oh, er wird schon kommen«, sagte Mrs Palfrey und lächelte. Sie glaubte es wirklich.
Nach dem Essen holte sie ihr Strickzeug und gesellte sich nun, da sie genügend Widerstand geleistet hatte, um ihre Persönlichkeit zu behaupten, zu den anderen auf der Fensterseite des Raums. Mrs Burton kam mit ihrem Schwager zurück in die Bar, und nun war er derjenige, der auf die Klingel drückte und den Eindruck machte, als hätte er das zu seiner Zeit sehr oft getan.
Kapitel Drei
Desmond kam nicht. Der Pullover, den Mrs Palfrey für ihn strickte, würde bald fertig sein, und alle wussten, dass er nicht erschienen war, um ihn sich zu holen. Im Fernen Osten hatte es wesentlich zum Leben dazugehört, das Gesicht zu wahren, und Mrs Palfrey wahrte jetzt, so gut es ging, ihres. Für gewöhnlich führt das zu Schwierigkeiten, und so war es auch bei Mrs Palfrey, denn es bedeutete, dass sie lügen musste und gezwungen war, sich hinterher an ihre Lügen zu erinnern. Sie musste Krankheiten für Desmond erfinden und Auslandsreisen im Rahmen seiner Arbeit – die, wie sie sehr wohl wusste, keinerlei Auslandsreisen mit sich brachte. Das empfand sie als äußerst anstrengend, und hinzu kam ihr heimlicher Kummer, dass sie in London letztlich doch niemanden hatte, der zu ihr gehörte, und dass der strebsame, recht untadelige junge Mann, auf den sie immer so stolz gewesen war, sich kein bisschen für sie interessierte. Noch nicht einmal ihre Briefe hatte er beantwortet, ihre Einladungen zum Abendessen im Claremont. Junge Männer waren immer hungrig und sehr oft knapp bei Kasse, hatte sie angenommen; nun aber zeigte sich, dass ihr Enkel weder hungrig noch knapp bei Kasse genug war, um in dieser Hinsicht irgendwelche Unterstützung ihrerseits zu benötigen. Das kränkte sie nicht nur, es empörte sie. Nicht zuletzt war es eine Frage der Erziehung. Briefe sollten beantwortet werden. Sie konnte nicht umhin, diesen Fehltritt ihrer Tochter gegenüber zu erwähnen, und schrieb ihr in ihrer unnachahmlichen Art, »sie meine ja bloß«. Es kam häufig vor, dass sie etwas »bloß meinte« oder »lediglich erwähnen« oder »nur mal gesagt haben« wollte. Ihre Tochter ging ganz beiläufig auf dieses »Meinen« ein, und zwar in ihrer gewohnt forschen Art, ohne Entschuldigung oder Erstaunen. »Sie sind alle gleich. Ich habe einen Brass auf die Jugend.« Solche landschaftlichen Wörter übernahm sie gern; ihren schottischen Ehemann ließen sie zusammenzucken. Er konnte sie nicht »verknusen«, wie sie es ausgedrückt hätte.
Ob sie sich ihren Sohn zur Brust nahm oder nicht, fand Mrs Palfrey nicht heraus. Weder kam er noch schrieb er ihr, und sie wünschte von Herzen, sie hätte im Claremont nie von ihm gesprochen. Sie hatte zunehmend das Gefühl, bemitleidet zu werden. Alle anderen Bewohner bekamen Besuch – selbst einigermaßen ferne Verwandte taten von Zeit zu Zeit ihre Pflicht; sie blieben eine Weile, lobten die Annehmlichkeiten des Hotels in den höchsten Tönen und zogen erleichtert wieder von dannen. Es war Mrs Palfrey schleierhaft, wie ihr einziges Enkelkind – noch dazu ihr Erbe – sie derart vernachlässigen konnte.
An einem ihrer schlimmsten Arthritis-Tage sprach Mrs Arbuthnot ihr gehässig ihre Anteilnahme aus, und in der darauffolgenden Nacht konnte Mrs Palfrey nicht schlafen. Von panischer Angst vor Einsamkeit heimgesucht, quälte sie sich durch die Stunden nach Mitternacht.
Ich darf mich nicht nervös machen lassen, warnte sie sich. Nervosität war schlecht für ihr Herz. Sie knipste das Licht an und fragte sich, ob es je Morgen werden würde. Sie versuchte zu lesen, doch ihr Herz ruckelte so zögerlich, dass jedes Pochen in ihrem Kopf widerhallte. Wenn ihr so zumute war, schien ihr alles besser, als allein zu sein – ein Pflegeheim, wo auch andere nachts wach liegen würden, ja sogar bei ihrer Tochter zu wohnen, vorausgesetzt, so etwas wäre je vorgeschlagen worden. Am Morgen – wie sie sich jetzt schwor – wäre ihr Lebensmut, die Gewissheit, dass sie nicht aufgeben würde, wiederhergestellt. Sie würde im Claremont bleiben, solange sie konnte, und von hier aus schließlich ins Krankenhaus gebracht werden, wo sie so schnell wie möglich zu sterben hoffte, ohne irgendwem zur Last zu fallen als denen, die dafür bezahlt wurden, sich um sie zu kümmern.
»Die jungen Leute sind sehr herzlos«, hatte Mrs Arbuthnot zu sagen gewagt.
»Er würde kommen, wenn er könnte«, hatte Mrs Palfrey erwidert und die Lippen zusammengepresst, denn sie hatten gezittert.
»Wir armen alten Frauen leben zu lange«, hatte Mrs Arbuthnot mit einem Lächeln gesagt.
Wenn sie von ihrem Ehemann sprach, hatte Mrs Palfrey bemerkt, war der bloße Ton ihrer Stimme ein Vorwurf an ihn, gestorben zu sein, sie sitzen gelassen zu haben. Unter den gegebenen Umständen wäre er ihr von so großem Nutzen gewesen, hätte ihr helfen können herumzukommen, abgeholt und gestützt zu werden: Vielleicht würde sie sogar immer noch in ihren eigenen vier Wänden wohnen. Aber sie war nicht so allein wie Mrs Palfrey. Sie hatte Schwestern, die kamen und gingen, manchmal sogar mit dem Wagen, um Ausfahrten mit ihr zu unternehmen oder ihre alte Freundin Miss Benson im Krankenhaus zu besuchen. Miss Benson hatte im Claremont gewohnt, bevor sie krank wurde.
»Sie hatte niemanden«, sagte Mrs Arbuthnot, was heißen sollte, niemanden außer Mrs Arbuthnot. »Keine Menschenseele. Sie war vollkommen allein.« Ihre Augen ruhten auf Mrs Palfrey. »Nie kam irgendjemand sie besuchen. In all unseren gemeinsamen Jahren hier. Dabei war sie zu ihrer Zeit eine stadtbekannte Frau.«
»Ich bin viel im Ausland gewesen«, sagte Mrs Palfrey. »Da verliert man den Kontakt.«
»So ist es wohl. Wir müssen unsere Freundschaften instand halten. Das hat, glaube ich, Doktor Johnson gesagt. Aber Sie, Sie haben natürlich Ihren Enkel.«