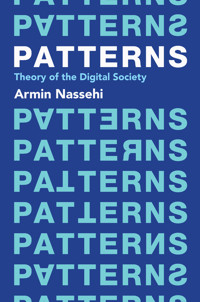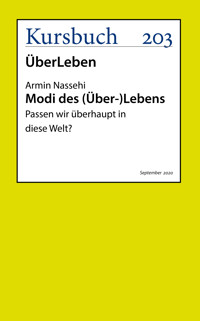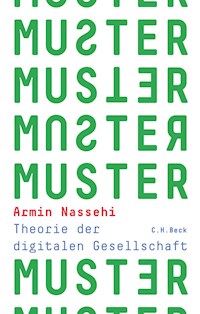
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
ARMIN NASSEHIS RADIKALE THEORIE DER DIGITALE GESELLSCHAFT
Wir glauben, der Siegeszug der digitalen Technik habe innerhalb weniger Jahre alles revolutioniert: unsere Beziehungen, unsere Arbeit und sogar die Funktionsweise demokratischer Wahlen. In seiner neuen Gesellschaftstheorie dreht der Soziologe Armin Nassehi den Spieß um und zeigt jenseits von Panik und Verharmlosung, dass die Digitalisierung nur eine besonders ausgefeilte technische Lösung für ein Problem ist, das sich in modernen Gesellschaften seit jeher stellt: Wie geht die Gesellschaft, wie gehen Unternehmen, Staaten, Verwaltungen, Strafverfolgungsbehörden, aber auch wir selbst mit unsichtbaren Mustern um?
Schon seit dem 19. Jahrhundert werden in funktional ausdifferenzierten Gesellschaften statistische Mustererkennungstechnologien angewandt, um menschliche Verhaltensweisen zu erkennen, zu regulieren und zu kontrollieren. Oft genug wird die Digitalisierung unserer Lebenswelt heutzutage als Störung erlebt, als Herausforderung und als Infragestellung von gewohnten Routinen. Im vorliegenden Buch unternimmt Armin Nassehi den Versuch, die Digitaltechnik in der Struktur der modernen Gesellschaft selbst zu fundieren. Er entwickelt die These, dass bestimmte gesellschaftliche Regelmäßigkeiten, Strukturen und Muster das Material bilden, aus dem die Digitalisierung erst ihr ökonomisches, politisches und wissenschaftliches Kontroll- und Steuerungspotential schöpft. Infolge der Digitalisierung wird die Gesellschaft heute also regelrecht neu entdeckt.
- Der Bestseller als Taschenbuch
- Einer der bekanntesten deutschen Soziologen legt seine Gesellschaftstheorie vor
- Eine völlig neue, unerwartete Perspektive auf die Digitalisierung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Armin Nassehi
MUSTER
\\\ THEORIE///DER DIGITALEN GESELLSCHAFT
C.H.BECK
Zum Buch
Wir glauben, der Siegeszug der digitalen Technik habe innerhalb weniger Jahre alles revolutioniert: unsere Beziehungen, unsere Arbeit und sogar die Funktionsweise demokratischer Wahlen. In seiner neuen Gesellschaftstheorie dreht der Soziologe Armin Nassehi den Spieß um und zeigt jenseits von Panik und Verharmlosung, dass die Digitalisierung nur eine besonders ausgefeilte technische Lösung für ein Problem ist, das sich in modernen Gesellschaften seit jeher stellt: Wie geht die Gesellschaft, wie gehen Unternehmen, Staaten, Verwaltungen, Strafverfolgungsbehörden, aber auch wir selbst mit unsichtbaren Mustern um?
Schon seit dem 19. Jahrhundert werden in funktional ausdifferenzierten Gesellschaften statistische Mustererkennungstechnologien angewandt, um menschliche Verhaltensweisen zu erkennen, zu regulieren und zu kontrollieren. Oft genug wird die Digitalisierung unserer Lebenswelt heutzutage als Störung erlebt, als Herausforderung und als Infragestellung von gewohnten Routinen. Im vorliegenden Buch unternimmt Armin Nassehi den Versuch, die Digitaltechnik in der Struktur der modernen Gesellschaft selbst zu fundieren. Er entwickelt die These, dass bestimmte gesellschaftliche Regelmäßigkeiten, Strukturen und Muster das Material bilden, aus dem die Digitalisierung überhaupt erst ihr ökonomisches, politisches und wissenschaftliches Kontroll- und Steuerungspotential schöpft. Infolge der Digitalisierung wird die Gesellschaft heute also geradezu neu entdeckt.
Über den Autor
Armin Nassehi, Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Soziologie und Gesellschaftstheorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und seit 2012 Herausgeber der Kulturzeitschrift Kursbuch.
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Wie über Digitalisierung nachdenken?
Eine techniksoziologische Intuition
Frühe Technologieschübe
Original und Kopie
Produktive Fehlanzeige und Sollbruchstelle
1: Das Bezugsproblem der Digitalisierung
Funktionalistische Fragen
Connecting Data – offline
Was ist das Problem?
Das Unbehagen an der digitalen Kultur
Die digitale Entdeckung der «Gesellschaft»
Empirische Sozialforschung als Mustererkennung
«Gesellschaft» als Digitalisierungsmaterial
Der/die/das Cyborg als Überwindung der Gesellschaft?
2: Der Eigensinn des Digitalen
Die ungenaue Exaktheit der Welt
Der Eigensinn der Daten
Kybernetik und die Rückkopplung von Informationen
Digitalisierung der Kommunikation
Dynamik der Geschlossenheit
Die Selbstreferenz der Datenwelt
3: Multiple Verdoppelungen der Welt
Daten als Beobachter
Verdoppelungen
Störungen
Querliegende datenförmige Verdoppelungen
Die Spur der Spur und diskrete Verdoppelungen
Spuren, Muster, Netze
4: Einfalt und Vielfalt
Medium und Form
Codierung und Programmierung
Die digitale Einfachheit der Gesellschaft
Optionssteigerungen
Sapere aude im Spiegel der Digitalisierung
Exkurs: Digitaler Stoffwechsel
5: Funktionierende Technik
Die Funktion des Technischen
Digitale Technik
Kommunizierende Technik
Die Funktion des Funktionierens
Niedrigschwellige Technik
Dämonisierte Technik
Unsichtbare Technik und der Turing-Test
Das Privileg, Fehler zu machen
6: Lernende Technik
Entscheidungen
Abduktive Maschinen?
Verteilte Intelligenz?
Anthropologische und technologische Fragen
Erlebende und handelnde Maschinen
Unvollständigkeit, Vorläufigkeit, systemische Paradoxien
Künstliche, leibliche, unvollständige Intelligenz
7: Das Internet als Massenmedium
Sinnüberschussgeschäfte
Synchronisationsfunktion
Synchronisation und Sozialisation
Selektivität, Medialität und Voice im Netz
Beim Zuschauen zuschauen
Komplexität und Überhitzung
Das Netz als Archiv aller möglichen Sätze
Intelligenz im Modus des Futur 2.0
8: Gefährdete Privatheit
Die Unwahrscheinlichkeit informationeller Selbstbestimmung
Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit?
Gefährdungen
Privatheit 1.0
Privatheit 1.0 als Ergebnis von Big Data?
Big Data und die Privatheit 2.0
Privatheit retten?
9: Debug: Die Wiedergeburt der Soziologie aus dem Geist der Digitalisierung
Digitale Dynamik und gesellschaftliche Komplexität
Eine Chance für die Soziologie
Anmerkungen
Einleitung
1 Das Bezugsproblem der Digitalisierung
2 Der Eigensinn des Digitalen
3 Multiple Verdoppelungen der Welt
4 Einfalt und Vielfalt
Exkurs Digitaler Stoffwechsel
5 Funktionierende Technik
6 Lernende Technik
7 Das Internet als Massenmedium
8 Gefährdete Privatheit
9 Debug: Die Wiedergeburt der Soziologie aus dem Geist der Digitalisierung
Sachregister
Vera Molnar, Hypertransformation, 74.338, Plotterzeichnung, 1974
Vera Molnar, Aleatorische Verteilung von 4 Elementen, Collage/Karton, 1959
Vorwort
Dieses Buch habe ich im Winter 2018/19 geschrieben. Abgeschlossen wurde das Manuskript im April 2019. Es verfolgt den nicht unbescheidenen Versuch, eine Leerstelle auszufüllen, nämlich nicht nur über die Folgen der Digitalisierung im Allgemeinen und über Folgen konkreter Technologien oder durch sie induzierter Praktiken nachzudenken. Über diese Fragestellungen wird sehr viel gearbeitet, und obwohl manche Diagnose Disruptionen, Transformationen und geradezu katastrophische Veränderungen in Aussicht stellt, lassen sich die akademischen Reaktionen aufs Thema nicht wirklich aus der Ruhe bringen. Man nimmt die Digitalisierung zunächst als existent hin, um dann an diesem Topos all die Feuerwerke abzubrennen, die die Sozial- und Kulturwissenschaften sonst auch im Angebot haben, also weniger Disruptionen und Transformationen, eher Routinen und die Entdeckung eines neuen Feldes für Kritik, nicht zuletzt oft die unkritische Übernahme von Begriffen – von der künstlichen Intelligenz bis hin zu Datenselbstbestimmung oder zu schützender Privatheit.
Hier wird anders angesetzt. Dieses Buch setzt Digitalität und Digitalisierung nicht voraus, sondern fragt sich, warum sie entstehen konnte, warum sie offensichtlich für diese Gesellschaft plausibel ist, also nicht nur als Störung wahrgenommen wird, und warum sie persistiert. Wenn sie nicht zu dieser Gesellschaft passen würde, wäre sie nie entstanden oder längst wieder verschwunden. Da sie aber – wer oder was immer «sie» hier ist – keine Anstalten macht, wieder zu verschwinden, lohnt es sich, die Frage systematisch zu stellen, welches Problem durch die Digitalisierung gelöst wird. Ich habe also nicht versucht, alles, was ich über Digitalisierung weiß oder was man darüber noch wissen könnte, zwischen zwei Buchdeckel zu packen. Es sollte aber alles enthalten sein, was man wissen muss, um die Frage danach zu beantworten, welches Problem die Digitalisierung löst.
Der Text wird durch zwei Bilder eingerahmt, Bilder von Vera Molnar, einer aus Ungarn stammenden französischen Künstlerin, die schon in den späten 1950er Jahren Kunst mit Hilfe des Computers geschaffen hat. Diese inzwischen 95 Jahre alte Pionierin der Computerkunst hat schon früh damit experimentiert, ihre Handzeichnungen, etwa von Quadraten, zu digitalisieren und daraus andere Formen zu berechnen oder sie mit Hilfe von computergesteuerten Zufallsgeneratoren zu erweitern. Ihre gesamte Kunst ist davon geprägt, dass sie das Faszinosum von Mustern darstellt und gerade durch die Verfremdung oder Veränderung, die Variation von Mustern und ihre Brechung gerade auf die Muster verweist. Hier kommen zwei Bilder zum Einsatz: vor dem Text «Hypertransformation», eine Plotterzeichnung von 1974. Am Ende des Buches ist eine «Aleatorische Verteilung von 4 Elementen» von 1959 zu sehen, geradezu eine Parabel darauf, wie aus sehr einfachen, gewissermaßen strikt gekoppelten Elementen durch lose gekoppelte Rekombination Muster entstehen können. Genau das wird eine der Thesen dieses Buches sein: wie einfache Medien komplexe Formen hervorbringen. Ich danke Vera Molnar für die Freigabe dieser Bilder, in denen es um das geht, wovon dieses Buch handelt: um Muster und ihre Variationsbreite.
Das Buch schließt an Arbeiten der letzten Jahre an. Auch wenn diese sich kaum mit Digitalisierungsfragen beschäftigt haben, sind sie in vielerlei Hinsicht doch Vorarbeiten zu diesem Buch. Zu danken habe ich vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Vortragsveranstaltungen und Tagungen, bei denen ich Teile der hier vorgestellten Argumente mehrfach getestet habe. Manche kritische Nachfrage hat geholfen, die Dinge zu präzisieren. Das gilt auch für Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedentlicher Lehrveranstaltungen.
Besonders profitiert habe ich wie stets von den sehr lebendigen Diskussionen an meinem Münchner Lehrstuhl. Vor allem das Mitlesen und die kritischen Kommentare von Gina Atzeni, Niklas Barth, Magdalena Göbl und Julian Müller haben mir sehr weitergeholfen. Till Ernstsohn und Christina Behler danke ich für die Hilfe bei Recherchen, Christina Behler hat darüber hinaus bei der finalen Korrektur mitgewirkt sowie an der Erstellung des Sachregisters mitgearbeitet.
Irmhild Saake kann ich ohnehin nicht genug danken für das permanente gemeinsame Nachdenken am Thema und für die langjährige Zusammenarbeit, die auch bei diesem Projekt mehr Spuren hinterlassen hat, als letztlich sichtbar werden können.
Dem Verlag C.H.Beck danke ich für die verlegerische Betreuung, insbesondere Matthias Hansl für das Lektorat.
München, Ostermontag 2019
Armin Nassehi
Einleitung
Dieses Buch will eine soziologische Theorie der digitalen Gesellschaft präsentieren. Würde ich ein Buch eines solchen Titels sehen, wäre ich vermutlich skeptisch – wenn ich es nicht selbst geschrieben hätte. Es gibt eine lange Tradition, Gesellschaftsdiagnosen an einem Merkmal festzumachen. Dabei kann man wissen, dass es in einer Risikogesellschaft nicht nur Risiken gibt, dass in einer Erlebnisgesellschaft auch gehandelt wird (wenn man an die Unterscheidung von Handeln und Erleben denkt), dass selbst in einer Autogesellschaft bisweilen geflogen oder mit der U-Bahn gefahren wird, dass man auch in einer beschleunigten Gesellschaft manchmal warten muss und dass es auch in der Multioptionsgesellschaft oft keine Wahl gibt. Es hat noch nie recht geholfen, Gesellschaft an nur einem Merkmal festzumachen. Meistens sind das Verlegenheitslösungen oder Aufmerksamkeitsgeneratoren. Es macht die Dinge auf den ersten Blick jedenfalls einfacher, eine Diagnose auf tatsächlich ein Merkmal hin zu trimmen – oft sind es auch nicht die Autorinnen und Autoren selbst, die auf solche plakativen Titel kommen, sondern diejenigen, die etwas von der Aufmerksamkeitsökonomie auf dem Buchmarkt verstehen.
Hier ist es etwas anders. Natürlich ist die Gesellschaft, in der wir leben, keine digitale Gesellschaft in dem Sinne, dass alles, was darin geschieht, sich über die Digitalität einer Technik erschließen ließe, die mit diesem Begriff belegt ist. Und dennoch: Ich werde im Verlaufe des Buches behaupten, dass die moderne Gesellschaft bereits ohne die digitale Technik in einer bestimmten Weise digital ist bzw. nur mit digitalen Mitteln verstanden werden kann. Ich gehe sogar noch weiter: Ich werde behaupten, dass die gesellschaftliche Moderne immer schon digital war, dass die Digitaltechnik also letztlich nur die logische Konsequenz einer in ihrer Grundstruktur digital gebauten Gesellschaft ist.
Diese These habe ich das erste Mal in der Hegel Lecture vom 7. Dezember 2017 an der Freien Universität Berlin ausprobiert.[1] Um die Digitalisierung zu verstehen – jene Kulturerscheinung, die vielleicht nur mit den beiden großen Erfindungen des Buchdrucks und der Dampfmaschine vergleichbar ist –, darf man die Digitalisierung nicht einfach voraussetzen. Die meisten Diskurse über die Digitalisierung wissen immer schon, was es damit auf sich hat. Ich möchte dieses Wissen in diesem Buch zunächst einklammern, um die zentrale Frage zu beantworten:
Für welches Problem ist die Digitalisierung eine Lösung?
Diese Frage ist methodisch genau formuliert. Sie ist eine Frage nach der Funktion der Digitalisierung. Sie definiert nicht, was Digitalität und Digitalisierung ist, sondern nähert sich dem Phänomen, indem sie fragt, für welches Problem die Digitalisierung eine gesellschaftliche Lösung ist. Es geht also um die gesellschaftliche Funktion, nach deren Klärung sich dann auch die technischen Dimensionen der Digitalisierung erschließen werden. Will man nicht einfach über etwas reden, was man letztlich nur anhand seiner Benutzeroberflächen kennt, muss man mit einer solchen methodisch kontrollierten Frage einsteigen.
Wie über Digitalisierung nachdenken?
Sieht man sich die Diskurse über das Digitale an, fällt an ihnen auf, dass sie das Digitale bereits ziemlich kenntnisreich voraussetzen. Entweder handelt es sich um technische Diskurse, die darüber aufklären, was die digitale Welt alles kann. Sie erklären dann Search Engine Optimizing, Big Data, Augmented Reality oder das Internet of Things als technische Phänomene. Oder sie arbeiten sich an den Folgen der Digitalisierung für Arbeits-, Produkt-, Produktions- und Aufmerksamkeitsmärkte ab, diagnostizieren Verschiebungen in der kapitalistischen (Re-)Produktion von Wertschöpfung und in der Konzentration von ökonomischer Macht und stellen mehr oder weniger starke Disruptionsprognosen.[2] Oder sie konzentrieren sich auf die alltagspraktischen Folgen dessen, was die Digitalisierung mit ihren Nutzern macht.
Neben einem generellen kapitalismuskritischen Motiv gegenüber der digitalisierten Ökonomie scheint für die sozial- und kulturwissenschaftliche Intelligenz am Digitalisierungsthema insbesondere eine Mischung aus kritischer Attitüde und alltagsnaher Beschreibung interessant zu sein – was gerade für die Soziologie ohnehin zu den anschlussfähigsten Formen der Entfaltung und Stabilisierung von Themen gehört. Nicht dass man exklusiv behaupten könnte, dass hier überall dasselbe Motiv vorherrscht, ganz zu schweigen von einem inhaltlichen Konsens, so fällt doch auf, dass ein speziell soziologischer Zugriff auf Digitalisierung unter den Stichworten «Subjektivierung», «Selbsttechniken», «Optimierung» und «Selbstkontrolle» erfolgt. Der Ansatzpunkt ist dann etwa, dass Praktiken des Self-Tracking oder der bildlichen und textlichen Darstellung des eigenen Selbst oder der Selbstkontrolle sich dem Diktat einer Selbstinszenierung unterwerfen, die durchaus an die Datenverarbeitung jener Spuren gekoppelt sind, die man durch die eigenen Praktiken hinterlässt und die uns dazu führen, uns selbst im Sinne zahlenförmiger, meist metrischer und vergleichender Praktiken zu inszenieren. Besonders attraktiv ist es, darin ein neoliberales Regime von Selbsttechniken zur Optimierung der Selbst-Welt-Schnittstelle sowie die Transformation öffentlicher Kontrolle in Selbstkontrolle bei gleichzeitiger Beobachtbarkeit durch staatlich-öffentliche und privat-marktförmige Akteure zu diagnostizieren.
Ich will diese beliebte sozial- bzw. kulturwissenschaftliche Reflexion der Digitalisierung an einigen Beispielen erläutern. Sherry Turkle hat schon vor über 20 Jahren angesichts neuer Kommunikationsformen im Netz die Identitätsfrage gestellt.[3] Heute lotet Deborah Luptons Digital Sociology die Bedeutung der Digitalisierung für die Soziologie aus und nimmt die Herausforderung eines völlig neuen Zugriffs auf Daten für die Soziologie an, landet am Ende aber doch wieder nur bei den Folgen für die Lebensführung und bei der Gefahrenabwehr.[4] Data Revolution von Rob Kitchin kapriziert sich vor allem auf die Dateninfrastruktur und deren politische, organisatorische und technische Formierung.[5] Die materialreiche Untersuchung von Shoshana Zuboff The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power reflektiert vor allem auf den Kontrollüberschuss, der mit digitalen Medien verbunden ist.[6] Und auch Digital Sociologies, herausgegeben von Jessie Daniels, Karen Gregory und Tressie McMillan Cottom, kapriziert sich auf die Folgen der Digitalisierung für konkrete Handlungsaspekte.[7] Deutschsprachige Pendants wie Steffen Maus materialreiche und sehr informative Arbeit Das metrische Wir[8] stoßen in das gleiche Horn. Digitalisierung taucht dann als ein Verhaltensaspekt auf, der sich letztlich auch am Kontrollüberschuss abarbeitet. Das gilt auch für die technisch hervorragend informierten Arbeiten von Dirk Helbing.[9] Auch medientheoretische Arbeiten wie das schon zum Klassiker avancierte Es gibt keine Software von Friedrich Kittler[10], die medientheoretische Studie von Sybille Krämer Symbolische Maschinen[11] oder die kulturwissenschaftlichen Verfremdungen der technischen Infrastruktur und ihrer Praktiken als Formen des Modellierens, des Sammelns, der Bildlichkeit und des Bezifferns[12] nehmen die gesellschaftsstrukturelle Radikalität des Digitalen gar nicht wahr, wonach in der Komplexität der Gesellschaft das Bezugsproblem solcher kulturverändernder Praktiken zu entdecken wäre. In diese Reihe gehört auch die sehr lesenswerte Arbeit Kultur der Digitalität von Felix Stalder, die eine medientheoretische Perspektive einnimmt.[13]
Solche Perspektiven sollen gar nicht in Abrede gestellt werden – zumindest noch nicht (sic!) in diesem Stadium des Nachdenkens und nicht prinzipiell. Es sind aber Perspektiven, die sich letztlich für die Frage der Digitalisierung selbst überhaupt nicht interessieren, sondern diese als technische, gesellschaftliche und kulturelle Infrastruktur bereits voraussetzen. Wenigstens andeutungsweise sei hier schon daran erinnert, dass westlich-bürgerliche Lebensformen bereits in der prädigitalen Welt von Formen des Selbsttrackings, der Selbstkontrolle und der Disziplinierung geprägt waren. Es hat den Anschein, als würden sich viele sozialwissenschaftliche Perspektiven auf die Digitalisierung gar nicht recht durch die Digitalisierung selbst aus der Ruhe bringen lassen. Sie finden vielmehr alle sonstigen gesellschaftlichen Aspekte auch als Digitalisierungsphänomene – von Genderfragen[14] über Ungleichheitsfragen[15] bis zur besagten Kritik an Selbstoptimierungsstrategien.
Anders verhält es sich in den Science & Technology Studies (STS). Der französische Soziologe Dominique Cardon nennt die Kritik an interesse-, vor allem wirtschaftsgeleiteten Kritiken an der Macht der Algorithmen simpel, weil diese letztlich nicht sehen, dass sich mit der Produktion von Algorithmen eine neue Denkungsart etabliert. Mit Rekurs auf Gilbert Simondon betont Cardon, dass man die Technik als solche ernst nehmen muss, um die Algorithmisierung gesellschaftlicher Prozesse verstehen zu können. Die zumeist kritisierten Praktiken entpuppen sich dann als eher sekundäre Folgen denn als Ausgangspunkt des Problems.[16] Dieser Einschätzung folge ich – aber nicht der Begrenzung der Fragestellung auf Praktiken, wie sie in den meisten STS-Arbeiten in zumeist ethnografischer Absicht erfolgen. Mein Impetus ist geprägt von der Frage nach der gesellschaftlichen Funktion dessen, was mit dem Begriff der Digitalisierung belegt ist.
Eine techniksoziologische Intuition
An dieser Stelle ist zunächst festzuhalten, dass man über Digitalisierungsfragen nachdenken kann, ohne über Digitalisierung nachzudenken, also ohne die Frage zu stellen, wovon wir reden, wenn wir von Digitalisierung reden. Es sei hier schon angekündigt, dass sich etwas Ähnliches auch auf einem anderen Feld zeigt, nämlich über Gesellschaft nachzudenken, ohne die Frage zu stellen, wovon wir reden, wenn wir von Gesellschaft reden. Ich nehme an, dass es einen systematischen Zusammenhang zwischen diesen beiden Diagnosen gibt. Die Gesellschaftsvergessenheit des Redens über Gesellschaft läuft parallel zu einer Digitalisierungsvergessenheit des Redens über die Digitalisierung.
Genau diesen Zusammenhang möchte ich hier systematisch entfalten, und zwar explizit soziologisch, was insofern nicht erstaunt, als die Rede über die Gesellschaft als Maß zu verwenden, bereits eine soziologische Perspektive ist. Jedenfalls möchte ich in einer ersten Annäherung betonen, dass ich die soziologische Frage nach der Digitalisierung gerade nicht in dem Stile stellen will, die «Digitalisierung» als unabhängige Variable vorauszusetzen, um dann die Frage zu beantworten, auf welche anderen Variablen sie sich auswirkt.
Es geht nicht um einen weiteren Debattenbeitrag über die Störungen der Digitalisierung und die Praktiken, die die digitale Infrastruktur befördert. Ich möchte vielmehr das Bezugsproblem, das gesellschaftliche Bezugsproblem des Digitalen auf den Begriff bringen. Es geht mir um die Frage, warum eine Technik, die ganz offenkundig nicht dafür entwickelt worden ist, was sie derzeit tut, in so radikal kurzer Zeit so erfolgreich werden und letztlich in fast alle gesellschaftlichen Bereiche eindringen konnte. Es wird sich erweisen, dass einer der Erfolgsfaktoren dieser Technik gerade ihre Technizität ist.
Die Fragestellung so aufzubauen, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf die Gesellschaft hatte, hat und haben wird, machte Digitalisierung tatsächlich zu einer unabhängigen Variablen. Ich lasse mich stattdessen von einer techniksoziologischen Intuition leiten, nach der Technik und Gesellschaft nicht unterschiedliche Größen sind, sondern Technologien und Techniken nur dann erfolgreich sein können, wenn sie anschlussfähig genug für die Struktur einer Gesellschaft sind. Oder anders formuliert: Dass die Digitalisierung (wie zuvor der Buchdruck oder die Eisenbahn oder das Automobil oder der Rundfunk oder die Atombombe oder die Technisierung des Medizinischen usw.) so erfolgreich sein konnte, kann man letztlich nur an der Erwartungsstruktur bzw. an der Verarbeitungskapazität der Gesellschaft erklären, in der sie stattfindet. Nur um ein Beispiel zu nennen: Die Etablierung des Rundfunks und der Rundfunktechnik setzt bereits Gesellschaften voraus, in denen es potentielle Hörerinnen und Hörer gibt, sie setzt eine Idee der Erreichbarkeit ebenso voraus wie dazu passende zentralistische Herrschaftsstrukturen moderner Staatlichkeit. Rundfunk und Rundfunktechnik setzen ein Reservoir von Sagbarem voraus und bearbeiten die Heterogenität eines pluralistischen Publikums mit der Unterstellung einer Homogenität von Adressen bzw. Adressaten. Sie rechnen damit, dass das im Radio Verbreitete einen Unterschied macht, der genug Aufmerksamkeit bindet und nicht zuletzt Millionen Menschen motiviert, sich einen Radioempfänger anzuschaffen. Wohlgemerkt: Nicht das Publikum ist schon da, sondern es muss eine Gemengelage vorhanden sein, deren innere Komplexität so etwas wie ein erreichbares Publikum nicht völlig unwahrscheinlich erscheinen lässt. So hat sich die Dampfmaschine nicht erst durchgesetzt, als es ihre industriellen Bedingungen schon gab, aber entgegenkommende Bedingungen gab es sehr wohl. Und welche Rolle die Eisenbahn bei der Erschließung Nordamerikas spielte, ist ein beredter Hinweis darauf, dass Technik auf einen Bedarf stoßen kann, den sie selbst erzeugt, dafür aber Voraussetzungen braucht.
Etwas Ähnliches müsste sich auch im Falle der Digitalisierung nachweisen lassen. Die Frage würde dann lauten: Welche Disposition der Moderne sensibilisiert sie für eine Technik, die so ist wie die der Digitalisierung (wenn sich überhaupt so etwas wie Digitalisierung als belastbarer Begriff finden lässt)? Was war an der Moderne, an der gesellschaftlichen Moderne womöglich vorher schon «digital», damit die Digitaltechnik darin jenen Siegeszug antreten konnte, den man tatsächlich nicht auf die Intentionen der Macher dieser Technik zurückführen kann (wie auch der Siegeszug früherer Techniken niemals intentional erklärt werden kann)? Die Kausalkette «Idee → Verwirklichung» ist zu kurz gedacht, selbst wenn man lange Kausalketten aufstellt.
Es ist hier nicht der Ort, über die Geschichte und die Untiefen des Funktionalismus zu informieren.[17] Nur so viel sei gesagt: Es geht hier nicht darum, irgendein Set von feststehenden Problemen abzuarbeiten, für die dann Lösungen gesucht werden müssen. Es geht vielmehr darum, sowohl Problem als auch Lösung genauer zu verstehen und zu bestimmen. Konkret: Für welches Problem die Digitalisierung eine Lösung ist, kann ich nur bestimmen, wenn ich sowohl sensibel für die Lösungen als auch für die Probleme bin – und vor allem für die Frage, wie diese beiden Seiten aufeinander bezogen sind.
Noch einmal: Man muss die funktionalistische Denkungsart also erheblich erweitern, um jene Frage zu beantworten, die ich schon angedeutet habe: Für welches Problem ist die Digitalisierung eine Lösung? Und die Frage muss dann so gestellt werden, dass weder das Problem noch die Lösung vorausgesetzt werden darf – also dass es weder eine bestehende Liste von Problemen noch eine allzu eindeutige Liste von Lösungen gibt, um dann die items aneinander abzugleichen. Ein angemessenes funktionalistisches Verfahren muss beide Seiten kontingent setzen, sie muss sich für die Konstellation selbst interessieren. Formal gesehen, geht es beim Funktionalismus darum: Wenn y eine Funktion von x ist (y = f(x)), dann ist sowohl y als auch x kontingent zu setzen – und das verbietet es, eine der beiden Seiten absolut zu setzen. Exakt dieses Problem wird in der Funktionalismus-Kritik bearbeitet.
Auf unser Thema bezogen: Wenn das Bezugsproblem, also die Problem-Lösung-Konstellation des Digitalen bestimmt werden soll, muss man tatsächlich an beiden Seiten beginnen. Wenn meine Ausgangsintuition stimmt, dass Techniken sich nur dann durchsetzen, wenn sie in ihrem sozialen Kontext anschlussfähig sind, heißt das, dass sie ein Problem lösen. Man muss also beide Seiten unbestimmt setzen – welches Problem und welche Lösung? Lösung heißt übrigens nur: dass weiter prozessiert werden kann, dass Anschlussfähigkeit hergestellt wird, es geht also nicht darum, was die Digitalisierung ist, sondern was sie tut und wie sie darin Problem und Lösung in Beziehung setzt.
Genau damit wird auch das erste Kapitel beginnen, das die vielleicht wichtigste These des Buches enthält: dass die Digitalisierung unmittelbar verwandt ist mit der gesellschaftlichen Struktur. Das macht nämlich die Digitalisierung zu einer merkwürdigen Störung: Sie ist fremd, weil sie in einer Radikalität auf das Vertraute verweist, wie man es zuvor nicht kannte. Ich werde sogar behaupten, dass die Digitalisierung nicht nur eine soziale Erscheinung ist, sondern sogar ein soziologisches Projekt. Vieles von dem, was die Digitalisierung betreibt, ist von geradezu soziologischer Denkungsart: Sie nutzt soziale Strukturen, sie macht soziale Dynamiken sichtbar und sie erzeugt aus diesen Formen der Mustererkennung ihren Mehrwert. Die Akteure sind natürlich keine soziologischen Akteure – es sind Unternehmen und Staaten, Strafverfolgungsbehörden und Medienanbieter, Kommunikationsagenturen und das Militär, die Stadt- und Sozialplanung ebenso wie die Wissenschaft. Das Soziologische daran ist jedenfalls, latente Ordnungsmuster zu erkennen oder zu generieren und damit etwas zu tun.
Frühe Technologieschübe
Ich werde zeigen, dass die moderne Gesellschaft bereits vor dem Einsatz digitaler Computertechnologien eine digitale Struktur hatte. Was das bedeutet, werde ich noch erläutern. Aber der Einsatz unmittelbarer Digitaltechnik ist dennoch eine relativ junge Erscheinung. Auch wenn es wenig zum Erkenntnisgewinn beiträgt: Ich selbst bin 1960 geboren und gehöre wahrscheinlich zu einem der letzten Geburtsjahrgänge, die ein Hochschulstudium ohne jede Digitaltechnik absolviert haben. Ich habe 1979 in Gelsenkirchen meine Abiturprüfung abgelegt und danach in Münster studiert – Erziehungswissenschaften, parallel auch Philosophie, jeweils mit dem Nebenfach Soziologie. Ich musste im Studium viel schreiben, wie es sich für ein Studium gehörte und gehört. Zunächst hatte ich eine mechanische Schreibmaschine von meinen Eltern, die sehr mühsam zu bedienen war. Ich weiß nicht mehr, wann es genau war, ich glaube im dritten Semester, da hat mein Studium einen ersten Technologieschub erfahren. Ich kaufte mir eine gebrauchte Robotron 202, eine elektrische Schreibmaschine aus DDR-Produktion, aus dem VEB Robotron Buchungsmaschinenwerk in Karl-Marx-Stadt. Diese Maschine robust zu nennen, wäre eine eklatante Untertreibung. Sie war sehr schwer, das Gehäuse geradezu verschwenderisch aus bestimmt zwei Millimeter dickem Metall. Der Motor der Maschine wurde sicher nicht für Schreibmaschinen entwickelt – man hätte damit auch feststofflichere Kulturgüter mobilisieren können als philosophische, pädagogische, psychologische und soziologische Hausarbeiten, Exzerpte usw. Die Maschine war – sicher keine Überraschung – sehr laut. Das galt für den Motor ebenso wie für die Typenhebel, die mit einer enormen Kraft auf Papier und Walze trafen. Ich erinnere mich noch genau, wie der Wagenrücklauf den Beistelltisch neben meinem Schreibtisch in wankende Bewegungen versetzte. Und noch genauer erinnere ich mich daran, dass sich jeder Fehler bei der Benutzung der Tastatur unmittelbar auf das Geschriebene auswirkte – und zwar so gut wie nicht rückholbar. Es ist genau das, was man eine Analogtechnik nennt, also eine Technik, die so etwas wie eine Eins-zu-eins-Übertragung von Ursache und Wirkung, Signal und Reaktion, Steuerung und Umsetzung vorsieht. Selbst die Fehlerkorrektur mit Tipp-Ex-Streifen war im Nachhinein sichtbar – das beschriebene Papier hatte zwar einen geheilten Text, aber die Narben konnte jeder sehen.
Im Jahre 1985 habe ich eine Diplomprüfung in Erziehungswissenschaften abgelegt. Dafür musste ich im Fach Soziologie eine Diplomarbeit schreiben. Diese umfasste – so viel Zeit war damals noch für die erste Qualifikationsarbeit – um die 350 Schreibmaschinenseiten, die ich zunächst handschriftlich verfasst und dann auf meiner Robotron-Maschine ins Reine geschrieben habe. Ins Reine hieß: in eine Form, die als Vorlage für ein professionelles Schreibbüro dienen konnte, das daraus eine Arbeit gemacht hat, die man abgeben konnte. Die Vorlage war schon gar nicht schlecht, enthielt aber in analoger Weise all die Unregelmäßigkeiten, Fehler und Korrekturen, die ich beim Schreiben gemacht hatte, Narben eben, die von dem mühsamen Prozess des Zusammenfuckelns von Gedanken zu einem linear lesbaren Text zeugten. Interessant war das Schreibbüro, dessen Dienste ich damals in Anspruch nahm – es warb damit, dass man vor dem endgültigen Ausdruck einen Vorabzug bekam, auf dem man Fehler noch beseitigen konnte, soweit diese Korrektur den Seitenumbruch nicht tangierte. Technisch wurde dieser Korrekturgang auf einer sehr modernen Schreibmaschine bewerkstelligt, und er war sehr teuer und nur durch einen Zuschuss meiner Eltern für mich bezahlbar. Auf einmal wurde ein ausgedruckter Text, also ein analoges Protokoll eines Eins-zu-eins-Verhältnisses von Produktion und Produkt, nicht nur wiederholbar, sondern konnte sogar verändert werden. Und die Veränderung blieb unsichtbar! Keine Narben! Das wirkte sich auf den Realitätsstatus des Textes aus, der auf einmal etwas Anderes war als vorher. Analog war nur noch das Ergebnis, nicht mehr der Prozess der Produktion.
Nach dem Studienabschluss bemühte ich mich um ein Promotionsstipendium und hatte die Fantasie, in der Zukunft genau das zu tun, was ich die nunmehr drei Jahrzehnte danach tatsächlich getan habe: als Sozialwissenschaftler zu arbeiten und die Ergebnisse dieser Tätigkeit insbesondere in Textform zu bringen. Mein gesamtes Studium ließ sich (zumindest auf der technischen Seite seiner Produktionsmittel) mit ausschließlich analogen Techniken betreiben. Selbst die Literatursuche erfolgte noch ohne Datenbanken, und zwar mit Hilfe eines Katalogsystems, das in seiner Materialität meiner Robotron-Maschine sehr ähnlich war. Ich erinnere mich noch an das Geräusch in der Münsteraner Universitätsbibliothek, wenn der Kasten mit den Karteikarten zurück in das Register geschoben wurde und veritabel knallte. Es lohnte sich übrigens, trotz eher schlechter Bahnverbindung, während des Studiums die ca. 100 Kilometer nach Bielefeld zu fahren, wo es nicht nur eine viel besser sortierte sozialwissenschaftliche Bibliothek gab, sondern sogar ein Microfiche-System, das die Recherche erleichtert hat. Aber auch das war radikal analog – blieb aber wenigstens ohne einen Apparat, der Strom verbrauchte, unsichtbar.
Ich machte mich unmittelbar nach dem Studienabschluss, den Berufswunsch im Kopf, auf die Suche nach einem bezahlbaren Computer, der anders als die sehr erfolgreichen C64-Rechner von Commodore nicht für Freizeit-Anwendungen gebraucht werden sollte, sondern tatsächlich ein Arbeitsmittel war. Es musste also das her, was schon damals als Industriestandard bezeichnet wurde, also ein mit dem Microsoft Disc Operating System (MS-DOS) kompatibles Gerät, das technisch etwa dem klassischen IBM-PC entsprach. In Münster gab es damals freilich nur eine IBM-Niederlassung – und ein Original-PC von IBM, wie er seit 1981 auf dem Markt war, wäre völlig unbezahlbar gewesen. Auch dafür musste man damals nach Bielefeld, wo es einen Laden von Computerschraubern gab, die preisgünstige Komponenten zu einem IBM-kompatiblen, dem ersten IBM-PC entsprechenden Rechner mit 8088-Prozessor, mit 4,77 MHz getaktet, anboten. Meine erste Anlage hatte keine Festplatte, sondern nur zwei Floppy-Disk-Laufwerke, von denen man eines stets mit Disketten für das Betriebssystem und Anwendungsprogramme verwenden musste. Während die erste Diskette das DOS lud, steckte man eine Diskette mit einem Textverarbeitungssystem rein – ich verwendete damals Word-Perfect. Sobald man das erste Mal eine Sonderfunktion in Anspruch nahm, etwa Kursivschrift, musste eine andere Diskette eingesetzt werden, die dieses Tool enthielt. Und wenn der Text fertig war, kam eine weitere Diskette zum Einsatz, auf der dieser dann abgespeichert wurde.
Zur Anlage gehörte ein Nadeldrucker, der bezüglich der Dezibel-Zahl der Robotron-Maschine in nichts nachstand. Die ganze Anlage war teuer – aber letztlich immer noch billiger als eine IBM-Kugelkopf-Schreibmaschine, die damals den Weltstandard darstellte – und so etwas wie ein Cadillac im Vergleich zu jenem Wartburg war, den meine Robotron symbolisierte. Diese Kugelkopf-Schreibmaschinen waren zwar kein Industriestandard mehr, aber sie standen in jedem universitären Institutssekretariat, um einer Generation von Professoren zu dienen, die fast nur handschriftlich geschrieben haben, weil ihr Schreibprogramm vor der IBM-Schreibmaschine saß und nicht mit irgendwelcher Software, dafür aber mit den idiosynkratischen Handschriften der Herren Professoren (das ist ausnahmsweise mal kein generisches Maskulinum!) kompatibel war.
Nach einem Jahr habe ich mir eine Festplatte gekauft – das ging dann sogar in Münster, und ich stand vor der schwierigen Entscheidung, ob ich eine mit 1 MB oder mit 5 MB Kapazität kaufen sollte. Ich entschied mich für 1 MB, weil es kaum vorstellbar schien, einen Speicherplatz von 5 MB in einem einzigen Leben vollschreiben zu können. Danach habe ich dann eine ganz normale digitale Biografie durchlebt: Es kam Windows, und es kamen stärkere Rechner, leistungsfähigere Peripheriegeräte, das Internet, die permanente Erreichbarkeit meiner Daten, unabhängig davon, wo ich mich aufhielt. Der Übergang vom Download- zum Upload-Internet spielte eine große Rolle, dann der Übergang vom stationären zum mobilen Internet. Mit dem Netz kamen Recherchemöglichkeiten, die die Bielefelder Microfiche-Phase als graue Vorzeit erscheinen ließen. Und so weiter und so weiter. Dieses Buch habe ich (wie schon frühere) an Dateien geschrieben und weitergeschrieben, die in einer kommerziellen Cloud eines Textverarbeitungsanbieters gespeichert waren und die ich auf allen meinen und fremden Geräten vom stationären Computer bis zum Smartphone stets in der aktuellen Form bearbeiten und konsultieren konnte.
Ich habe in meinen ersten drei Semestern, also von 1979 bis 1981 (als der IBM-PC auf den Markt kam), gutes Geld mit der Reparatur von Autos verdient – VW-Käfer und VW-Bully, Citroën 2CV und GX, Renault 4 und 5, Opel Kadett, VW Polo und Golf I, auch den alten/8-Mercedes-Diesel. Das war ebenso illegal (wenn auch mittlerweile verjährt) wie machbar, weil Autos damals tatsächlich analoge Maschinen waren, an denen man rumschrauben konnte. Kurz darauf waren Autos zwar immer noch Apparate, die fossile in kinetische Energie umgewandelt haben; gesteuert wurden die Prozesse aber immer mehr zunächst durch elektronische Regelkreise und dann durch Computertechnik. Heute kann ich an meinem Automobil (ein ziemlich digitalisierter Nachfolger des alten/8) allenfalls die Reifen und die Wischerblätter wechseln. Der Beruf des KFZ-Mechanikers – der wohl begehrteste Lehrberuf zumindest für Jungs – wurde folgerichtig im Jahre 2001 umbenannt in KFZ-Mechatroniker, das Ausbildungsprofil hatte sich schon vorher geändert.
Original und Kopie
Worauf ich hinaus will, sollte deutlich geworden sein: Man kann mich und die in den 1960er Jahren Geborenen vielleicht als die erste digitale Generation beschreiben.[18] Dabei war der erste PC eben mehr als bloß eine bessere Schreibmaschine. Er war ein Medium, das den Realitätsstatus von Arbeitsergebnissen tatsächlich verändert hat. Walter Benjamin hat in seinem berühmten Essay über Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit von 1936 die These vertreten, dass sich das Kunsterleben durch die mögliche Vervielfältigung von künstlerischen Exponaten radikal verändert hat, und zwar in die Richtung, dass das Kunstwerk nun vor einem ganz anderen Publikum sich bewähren müsse – auch vor einem Publikum, das eben nicht mehr eingebettet war in die bürgerlichen Praktiken des Kunstgenusses.[19] Es entstand so etwas wie Kunstgenuss en passant – was man freilich nur beklagen kann, wenn man an der Kunst nur die Distinktionsfunktion schätzt. Worauf es Benjamin aber ankam, war das, was er den «Verlust der Aura» nannte, also den Verlust jener kairologischen Einmaligkeit, die nun ins Chronologische verlängert werden konnte – eben durch die Wiederholbarkeit des Erlebens. Wer Benjamin zitiert, hat sicher Theodor W. Adornos ätzenden Vorwurf im Ohr, Benjamin mache das Kunstwerk zum Fetisch. Aber das scheint mir doch eine typische Reaktion auf neue Medienformen zu sein, die vergangenen Formen semantisch zu veredeln, um das Ungeheure der modernen Technik und seiner Folgen in den Blick zu bekommen, ob es nun die Sokratische Preisung des Gesprächs im Gegensatz zur distanzierenden Schrift ist oder die Kritik des Fernsehens als einer Nivellierung im Vergleich zu echten Erfahrungen mit der Welt.
Etwas ganz Ähnliches hat der Alltagsgebrauch digitaler Techniken hervorgebracht – und ich spreche jetzt ausdrücklich nicht von den großen kulturellen Veränderungen des digitalen Zeitalters, sondern von den kleinen Veränderungen bei der Textproduktion eines jungen Wissenschaftlers bzw. eines Jungen, der einer werden wollte. Der Computer als Schreibgerät hat das Schreiben nicht einfach vereinfacht oder beschleunigt – es geht also nicht um Fragen der Skalierbarkeit. Der Computer als Schreibgerät hat das Schreiben entstofflicht. Bevor Text auf analoge Weise aufs Papier kommt, lebt er in einem virtuellen Zustand. Seine Virtualität besteht darin, dass er permanent veränderbar bleibt, ohne als Ganzes verändert werden zu müssen. Einschübe, Umformulierungen, Revisionen hinterlassen keine Spuren mehr – der Text hat seine Aura verloren, würde man wohl mit Benjamin sagen. Bis zum Ende ist alles revisionsfähig – und zugleich sehen bereits vorläufige Versionen ästhetisch fertig aus. Völlig unfertige Texte konnten mit Hilfe von Funktionen einer Textverarbeitungssoftware auf einmal so präsentiert werden, als wäre der Text schon ein Text – was man zuvor, auf einer Robotron 202 zumal, unterlassen hätte, weil damit der erhebliche Mehraufwand verbunden gewesen wäre, alles stets neu fassen zu müssen. Nun geht es mir im vorliegenden Buch nicht darum, auch nur eine der populären Geschichten über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Alltagspraktiken zu erzählen, die den Großteil der soziologischen Literatur zum Thema ausmachen. Das Beispiel soll nur zeigen, wie kleinteilig und wie alltagstauglich, wie fast unbesehen und doch wirksam, wie unspektakulär und doch radikal die Digitaltechnik in die Gesellschaft hineindiffundiert ist – und wie schnell die Umstellung von der analogen auf die digitale Gesellschaft vonstattenging.
Produktive Fehlanzeige und Sollbruchstelle
Dieses Buch ist selbst keine Immunreaktion auf die Digitalisierung – auch wenn die Digitalisierung zweifellos zu Störungen von gesellschaftlichen Routinen führt, die bearbeitet werden müssen. Was die sozialwissenschaftliche Intelligenz daran interessiert, habe ich schon angedeutet. Der vielleicht wichtigste Diskurs ist der über die Zukunft der Arbeit. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die Digitalisierung sowohl der Produktion als auch der Produkte Auswirkungen auf Beschäftigung und auf die Kontinuität von Arbeitsbiografien haben. Aber wie sich die Digitalisierung auf diese Fragen auswirken wird, darüber herrscht eklatante Uneinigkeit. Vieles ist schlicht noch unbekannt. Wenig Zweifel bestehen auch daran, dass sich die Verfügbarkeit über große Datensätze auf wissenschaftliche Erkenntnisse auswirken wird. Allenthalben wird die theorielose Wissenschaft befürchtet, die einfach nach Spuren in Datensätzen sucht,[20] außerdem stellt sich die Frage, wem Erkenntnisse zugerechnet werden, wenn intelligente Algorithmen Erkenntnisprozesse anleiten.[21] Erwartbar ist durchaus, dass es zu Anpassungsproblemen individueller Lebensführung an Fremd- und Selbstkontrollmechanismen kommt, die durch die Verfügbarkeit von wachsenden Datenmassen entstehen. Ebenso wenig Zweifel gibt es darüber, dass sich das Preisgefüge in vielen Branchen aufgrund ganz neuer, digital ermöglichter Transparenz- und Vergleichsmodelle verändern wird. Ebenso unbestritten ist eine Tendenz zur Kapitalkonzentration, die sich parallel zur Datenkonzentration verhält.[22] Dafür gibt es sowohl ökonomische als auch genuin technische Gründe. Sicher ist auch, dass die Diskussion um die künstliche Intelligenz auch das Selbstverständnis der menschlichen, natürlich genannten Intelligenz beeinflussen wird.[23] Und dass mit der Digitalisierung neue Machtkonzentrationen und -konstellationen entstehen, kann niemandem verborgen bleiben.[24] All das wird seit langem in derselben Weise diskutiert, wie sich die Gesellschaft auf solche (Selbst-)Störungen einstellt. In dieser Hinsicht ist die Digitalisierung kein wirklich aufregendes Thema.
Wiewohl viele der genannten Themen im vorliegenden Buch durchaus explizit vorkommen, bilden sie nicht dessen inhaltlichen Kern. Oder anders formuliert: Sie sind nicht Ausgangspunkt der Überlegungen, sondern kommen ‹nur› als Epiphänomene des eigentlichen Untersuchungsgegenstands vor. Denn all diese Diskussionen über Störungen gesellschaftlicher Routinen durch die ausgreifende Digitaltechnik kommen letztlich ohne eine fundierte Theorie der Digitalisierung aus – sie setzen die Digitalisierung als Phänomen letztlich voraus. Diese Lücke versucht dieses Buch zu schließen.
Es ist womöglich keine Übertreibung zu behaupten, dass hier eine Leerstelle gefüllt wird. Nichts weniger ist das Programm, als die erste Gesellschaftstheorie der digitalen Gesellschaft vorzulegen. Es ist ein wissenschaftliches Unterfangen, kein vordergründig diagnostisches, noch weniger ein meinungsstarkes und schon gar keines, das Handlungsanweisungen generiert. Es ist der Versuch, die Digitalisierung als eine gesellschaftliche Kulturerscheinung zu verstehen.
Hier wird die Digitalisierung also nicht einfach als ein Thema unter anderen auch noch auf die moderne Gesellschaft appliziert. Der theoretische Anspruch ist weit größer. Denn nach meiner techniksoziologischen Intuition müsste eine angemessene Theorie der Digitalisierung eben keine Kolonial- oder Störungsgeschichte der Digitalisierung präsentieren, sondern das Bezugsproblem der Digitalisierung in der Gesellschaft und ihrer Struktur selbst auffinden können. Insofern ist der Untertitel durchaus präzise gewählt. Es geht gar nicht um eine Theorie der Digitalisierung, sondern um eine Theorie der digitalen Gesellschaft.
1
Das Bezugsproblem der Digitalisierung
Wenn ich es recht sehe, ist diese Frage nach dem Bezugsproblem der Digitalisierung noch nicht gestellt worden: Für welches Problem ist die Digitalisierung die Lösung? Es macht einen Unterschied, wie man fragt. Ich frage nicht: Was ist Digitalisierung? Ich frage auch nicht: Was ist das Problem an der Digitalisierung? Oder: Was für Probleme bereitet die Digitalisierung? Gerade über Letzteres wissen wir bisweilen mehr als über meine Leitfrage nach dem Bezugsproblem: etwa dass sie eine Gefährdung für die Privatheit darstellt, dass sie aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit vor allem in repetitiven Tätigkeiten Arbeitsplätze vernichten wird, dass sie auch eine ökonomische Chance sein kann, dass sie Kontrollmöglichkeiten eröffnet, die es zuvor nicht gab, usw. In solchen Sätzen wird die Digitalisierung gewissermaßen als unabhängige Variable vorausgesetzt, um nach ihren Folgen zu fragen. Meine Frage beginnt ganz anders: Für welches Problem ist sie die Lösung?
Meine Antwort wird so lauten: Das Bezugsproblem der Digitalisierung ist die Komplexität und vor allem die Regelmäßigkeit der Gesellschaft selbst. Das Argument lautet, dass die moderne Gesellschaft vor allem mit ihrer digitalen Form der Selbstbeobachtung auf jene Regelmäßigkeiten erst stößt, auf jenen Eigensinn und jene Widerständigkeit, die gesellschaftliche Verhältnisse ausmachen. Gesellschaft ist ein zwar fluider, ein operativer, ein echtzeitlicher, ein auf Ereignissen basierender, ein schneller, ein beschleunigter Gegenstand, und doch enorm stabil, regelmäßig, in vielen Hinsichten auch berechenbar. Dieser Gegenstand enthält Muster, die man auf den ersten Blick nicht erkennt. Der zweite Blick, dem sie freilich ansichtig werden, ist zunehmend ein digitaler Blick.
Sollte sich diese These als tragfähig erweisen, hätte das erhebliche Konsequenzen für eine soziologische Theorie der Digitalisierung, die nicht einfach Digitalisierungsfolgen und den Modus der Störung durch eine bestimmte Technologie und Technik untersucht, sondern an den Grundfesten der modernen Gesellschaft selbst ansetzt. Und das würde heißen: Wir sehen nicht Digitalisierung, sondern zentrale Bereiche der Gesellschaft sehen bereits digital. Digitalität ist einer der entscheidenden Selbstbezüge der Gesellschaft. Vorsichtshalber sei hier schon erwähnt, dass mir das Digitale hier nicht als Metapher erscheint. Aber dazu später mehr.
Es wird schon deutlich: Bei der Ausarbeitung einer Theorie der digitalen Gesellschaft stellen sich zunächst methodische Fragen, also Fragen der Theoriekonstruktion. Wenn diese nicht beantwortet werden, bleiben die wenigen vorstehenden Sätze schlicht Behauptungen. Die Frage nach dem Bezugsproblem ist eine funktionalistische Frage. Funktionalistische Fragen sind keine Kausalfragen, sondern Fragen nach der Relation zwischen Problem und Lösung.
Funktionalistische Fragen
Die vielleicht wichtigste Grundlegung einer funktionalistischen Denkungsart stammt von Ernst Cassirer. Er hat in seinem frühen Buch Substanzbegriff und Funktionsbegriff einen Übergang von Substanz- zu Relationsbegriffen postuliert und damit nicht nur eine Kritik der ontologischen Weltauffassung vorgelegt, sondern auch eine Kritik der nachträglichen Ontologisierung des Erkenntnisprozesses. Für Cassirer konstituieren sich Erkenntnisobjekte im und durch den Erkenntnisprozess selbst, der damit zu einer unbestimmten (bzw. zu bestimmenden) Stelle im Netz der Relationen wird: «Wir erkennen somit nicht ‹die Gegenstände› – als wären sie schon zuvor und unabhängig als Gegenstände bestimmt und gegeben –, sondern wir erkennen gegenständlich, indem wir innerhalb des gleichförmigen Ablaufs der Erfahrungsinhalte bestimmte Abgrenzungen schaffen und bestimmte dauernde Elemente und Verknüpfungszusammenhänge fixieren.»[1] Dass dem Erkennen «Dinge» erscheinen, nennt Cassirer eine «Bestätigungsformel» – und die erkannten Gegenstände sind somit nicht «‹Zeichen von etwas Objektivem›, sondern vielmehr objektive Zeichen»[2], deren Objektivität allein darin liegt, dass sie sich empirisch bewähren.[3]
Mathematisch gesprochen, ist die Beobachtung von etwas dann stets eine Funktion dieser Beobachtung – und diese Idee des Funktionalismus bricht mit der Vorstellung, dass die Unbestimmtheit der Welt durch eindeutige Bestimmtheit sich aufbrechen oder auflösen ließe. Diese Relationierung ist nicht nur ein Charakteristikum der wissenschaftlichen Erkenntnis, sondern von Praxis überhaupt. Durch sie wird sichtbar, wie sich konkrete Erscheinungen zu etwas verhalten und wie etwas aufgrund der jeweiligen Praxis so erscheint. Der Funktionalismus hat es also stets mit Unbestimmtheit zu tun, oder besser: mit der praktischen Herstellung von Bestimmtheit – und zwar sowohl auf der Seite der Erkenntnis als auch auf der Gegenstandsseite.
Nun soll es hier nicht um epistemologische Fragen des Funktionalismus gehen, sondern tatsächlich um die Frage der Problem-Lösung-Konstellation dessen, was wir Digitalität/Digitalisierung nennen. Die These könnte dann etwa lauten, dass wir nicht Digitales sehen, sondern dass wir digital sehen, damit so etwas wie Digitales erscheinen/entstehen/erfolgreich sein kann. Einer der Pioniere, die nicht nur das Digitale beschreiben, sondern demonstrieren, wie wir digital sehen bzw. digital sehen sollten, um die moderne Welt zu beschreiben, ist Dirk Helbing. Der gelernte Physiker beschreibt etwa die Automatisierung gesellschaftlicher Bereiche nicht nur als eine gewissermaßen von außen kommende Störung, sondern im Gegenteil als einen Teil der sozialen Struktur, was die Beschreibung von Störungen, etwa Kaskadeneffekte in komplexen Systemen (z.B. Stromversorgung), erst möglich macht.[4] Helbing beschreibt die digitale Revolution folglich als eine Revolution der gesellschaftlichen Komplexität selbst.
Connecting Data – offline
Wenn eine funktionalistische Denkungsart sich dadurch auszeichnet, dass man sowohl die Erkenntnis- als auch die Gegenstandsseite kontingent halten muss, lohnt sich zunächst eine phänomenologische Beschreibung digitaler Techniken. Es gilt, mit anderen Worten, zunächst eine offline-Perspektive einzunehmen und völlig auf eine Beschreibung der Sache selbst, also der digitalen Technik, zu verzichten, um die grundlegende Struktur der Gesellschaft in den Blick zu bekommen. Wenn es etwas gibt, das alles Digitale verbindet, dann ist es die Verknüpfungsfähigkeit von Daten mit Daten, also die Fähigkeit von Apparaten, Datenpunkte miteinander zu verbinden. Das Rohmaterial sind Daten, die in gezählter/zählbarer Form vorliegen und deren Form so niedrigschwellig ist, dass man diese tatsächlich miteinander kombinieren und rekombinieren kann.
Mit die früheste Form der digitalen, also zählbaren Form der Verarbeitung von Daten war sicher die öffentliche Sozialstatistik, die mit der Etablierung moderner Staatlichkeit entstand. So war etwa der «Sozialphysiker» Adolphe Quetelet (1796–1874) einer der Ersten, die statistische Verfahren auf die Gesellschaft und die Sozialplanung angewandt haben. Er hat sich zum Beispiel darüber gewundert, wie regelmäßig sich die Menschen verhalten, etwa wenn es ums Heiratsverhalten geht. Das Heiratsverhalten ist ein je individuelles Verhalten. Man sieht konkret zwei Menschen, die sich dafür entscheiden, zu heiraten. In der gezählten Form freilich sieht man etwas anderes: Man rekombiniert die Information «Heirat» mit anderen Merkmalen und macht dann sichtbar, was zuvor nicht wirklich sichtbar gewesen ist. Nun muss man konzedieren, dass auch unser Alltagsverständnis durchaus bereits mit Wahrscheinlichkeitsunterstellungen darüber arbeitet, welche Ehe erwartbar ist und welche nicht. Wir haben die Idee der Schichtung der Gesellschaft, der kulturellen/konfessionellen Passung, der Altersverteilung bei Paaren, der ökonomischen und biografischen Voraussetzungen etc. bereits in unseren Wahrnehmungsschemata/Typisierungen verankert und sehen letztlich nur im Falle der Abweichung die Regelmäßigkeitsunterstellungen unserer Wahrnehmungen. Die Sozialstatistik ist aber in der Lage, solche Regelmäßigkeiten auf den Begriff zu bringen und sie letztlich handhabbar zu machen, und sie ist aufgrund ihrer quantitativen Kapazität in der Lage, relativ unsichtbare Regelmäßigkeiten zu entdecken, die dem Alltagsverstand als Zufall oder Ergebnis der Kontingenz individueller Entscheidungslagen erscheint.[5]
Die Voraussetzung für all das ist die durch Umcodierung von typischen Merkmalen zählbar gewordene Form von Daten, von digitalen Daten, die miteinander rekombiniert werden können. Das Material von Datenverarbeitung/Digitalität sind also prinzipiell miteinander kombinierbare items, deren Informationswert gerade in der Begrenztheit möglicher Kombinationen liegt. Konkreter: Wenn jedes mögliche Element mit jedem anderen möglichen Element verknüpft wäre, könnten Daten keinerlei Information hergeben, also keinen Unterschied machen. Quetelet hat Abweichungen von der Normalverteilung übrigens als Störung aufgefasst und war letztlich fasziniert von einem homme moyen, einem Mittelwertmenschen, den man entsprechend berechnen kann und der zugleich die Grundlage für all jene Praktiken bildet, in denen die Menschen als selbstverantwortliche Individuen geformt werden.
Das Rohmaterial des Digitalen sind also Listen von codierten Zahlenwerten, die Lösung sind Informationen über alles Mögliche auf der Grundlage der Daten. Konkret sind das Wahrscheinlichkeitsaussagen über die Kombinatorik, über die Relation einzelner items, noch genauer: über die Grenzen der Kombinatorik, weil nur Daten, in denen nicht alles mit allem kombinierbar ist, auch Informationen enthalten bzw. erzeugen können. Das können Informationen ganz unterschiedlicher Natur sein:
die intelligente Steuerung einer Maschine, die in der Lage ist, sich selbst auf veränderte Umweltbedingungen einzustellen und Daten in der Weise zu verarbeiten, dass sie durch eigene Festlegungen darauf reagieren kann;
die intelligente Selbstbeobachtung mechanischer Maschinen mittels sensorischer Daten, die auf Unregelmäßigkeiten hinweisen;
prädiktive Möglichkeiten, aus historischen Daten über Kaufentscheidungen, abweichendes Verhalten oder Suchmaschinenabfragen Informationen über Verkaufschancen, die Eingrenzung von Verdächtigen oder die Konjunktur von Themen in einem bestimmten Raum zu erhalten;
Optimierungen logistischer Abarbeitungsregeln;
Wettervorhersagen und Klimamodelle;
Marktbeobachtung und Marktbearbeitung;
intelligente Verkehrssteuerung;
Beeinflussung von Wahlverhalten in bestimmten abgrenzbaren Gruppen bzw. Identifikation von unsicheren Entscheidungslagen beim Wahlverhalten, denn nur dort lohnt sich der Einsatz besonderer Werbemaßnahmen;
Objekterkennung als Element selbstfahrender Fahrzeuge;
Diagnoseprogramme in der bildgebenden Diagnostik in der Medizin;
Auswertungen elektrokardiographischer, elektroenzephalographischer und ähnlicher Datensätze;
forensische und literaturwissenschaftliche Bestimmung von Autorenschaften von Texten;
inzwischen sogar die Herstellung redaktioneller Texte durch Verarbeitung von Agenturmeldungen;
Übersetzungs- und Spracherkennungsprogramme;
Stimmerkennung;
Messungen des emotionalen Status;
Detektieren von Bewegungsprofilen jeglicher Art.
All diesen Beispielen ist gemein, dass die Wechselwirkung unterschiedlicher Parameter daraufhin beobachtet wird, wie sich die Relation unterschiedlicher Einflussgrößen durch die Veränderung solcher Relationen verändert, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für bestimmte erwünschte oder auch unerwünschte Zustände ist bzw. welche Einflussgrößen die Wahrscheinlichkeit in eine bestimmte Richtung verändern können. Wenn man das Digitale irgendwie auf den Begriff bringen will, dann ist es letztlich nichts anderes als die Verdoppelung der Welt in Datenform mit der technischen Möglichkeit, Daten miteinander in Beziehung zu setzen, um dies auf bestimmte Fragestellungen rückzuübersetzen. Die Vergleichbarkeit ergibt sich dadurch, dass es sich um Übersetzungen von Signalen in ein einheitliches Medium handelt, das Inkommensurables zumindest relationierbar macht.
Letztlich handelt es sich dabei schon um eine genaue Bestimmung dessen, was ein Computer macht. Ein Computer ist ein Rechengerät, das Daten mittels eigenen Datenmanagements, also per Metadaten, miteinander verknüpfen und gerade aufgrund der diskreten, also binär-zahlenförmigen Form der Repräsentation der «Welt» sehr hohe Datenmengen verarbeiten kann. Dadurch wird nicht nur die quantitative Kapazität der natürlichen Form bewusstseinsbasierter Intelligenz überschritten, sondern es erfolgt auch ein qualitativer Umschlag, weil aus den Ergebnissen von Berechnungen wieder Voraussetzungen für neue Berechnungen werden können.
Der Zusammenhang von Quantität und Qualität ist in diesem Zusammenhang durchaus komplex, weil es gerade die quantitative Form der Rückkopplung ist, die dem Computer eine besondere Qualität verleiht. Jedenfalls ist Digitalität als eine Kombination von Vereinfachung und Komplexitätssteigerung anzusehen. Man bringt analoge Formen in eine digitale Gestalt, rekombiniert diese digitale Gestalt im Hinblick auf Strukturen und wendet diese dann wieder auf die analoge Welt an, aus der die Daten stammen, oder besser: von der her die Welt in Datenform verdoppelt wurde. Ich komme auf die Verdoppelungsfunktion noch ausführlich zurück. Jedenfalls setzt die Anwendung von Computern nicht einfach auf die interne Bearbeitung von Daten, sondern auf deren Rückübersetzung in analoge Formen. Computer haben deshalb stets mindestens zwei Schnittstellen: zum einen den input von datenförmigem Material (welcher Art auch immer), zum anderen den output von datenförmigem Material, das durch eine Schnittstelle in sinnförmige Informationen (rück-)übersetzt wird. Solche Schnittstellen können Bildschirme, 2-D- und 3-D-Drucker, Plotter, Maschinensteuerungssignale, Rechenergebnisse, statistische Ladungen oder auch Text sein. Dabei erfolgt eine Rückübersetzung des Datenförmigen in andere Medien.