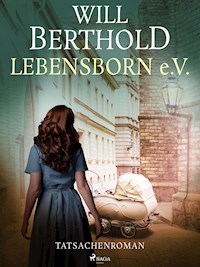Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Traumvillen, Hochseeyachten, Partys und Exzesse ohne Ende: Die Superreichen in den Steueroasen tun und lassen, wonach ihnen der Sinn steht. So auch Henry Kamossa, der so etwas wie den charismatischen Mittelpunkt dieser internationalen Szene darstellt. Kamossa scheint zu besitzen, was ein Mensch sich nur wünschen kann. Er kennt keine Skrupel und keine Spielregeln, und reitet auf einer Welle des Erfolgs durchs Leben. Bis jemand einen Mordanschlag auf ihn verübt. Denn offenbar verbirgt er ein dunkles Geheimnis, das er bisher gehütet hat wie seinen Augapfel. In der Stunde der Wahrheit bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich den Schatten seiner Vergangenheit zu stellen, denn dort lauert jemand, der keine leeren Drohungen ausspricht: Er will Kamossa töten …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Will Berthold
Nach mir komm ich
Roman
Originalausgabe
SAGA Egmont
Nach mir komm ich
Genehmigte eBook Ausgabe für Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
Copyright © 2017 by Will Berthold Nachlass,
represented by AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de).
Originally published 1990 by Heyne Verlag, Germany.
All rights reserved
ISBN: 9788711726983
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt og Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Erster teil
I
Ausgerechnet in diesen strahlenden Maitag platzt der erste Anschlag aus dem Hinterhalt, aber Henry Kamossa, den Aufsteiger ohnegleichen, reißt die Bedrohung aus dem Untergrund nicht von den Beinen. Seit langem gewohnt, in schwindelnden Höhen ohne Absturz zu operieren, ist er viel zu selbstherrlich, um sich bedrängt zu fühlen. Er hat seine Mitwisser in der Hand und seine Feinde im Griff. Der Machtmensch und Multimillionär kennt keine Ängste, wiewohl er fürchten muß, daß seine sorgfältig zubetonierte Vergangenheit eines Tages aufbrechen könnte wie ein Geschwür.
Kamossa betritt in bester Laune kurz vor neun Uhr die Terrasse seiner ›Residenza Fortuna‹; sie liegt unterhalb des Monte Verità, direkt über dem Lago Maggiore wie eine Festung über Ascona, dem St. Tropez der Schweiz. Die Sonne ist längst über den Gambarogno geklettert, und Kamossa starrt wie blind in ihren Glutkopf. Er ist kein Romantiker, aber einen Moment lang wird selbst er vom Zauber dieses Tages überwältigt.
Der Frühling auf dem Triumphzug hat über Nacht seinen Blumenfeldzug auf der Alpensüdseite gewonnen und Blüten wie Herzen geöffnet. Rhododendron und Azaleen überziehen die Hänge und Promenaden mit fantastischen Farben. Die Palmen recken ihre Kronen sehnsüchtig in die Sonne und unterhalten sich nach Art der Klapperstörche. Das Blau des Himmels spiegelt sich auf dem See. Es ist einer dieser Bilderbuchtage, an denen Zerstrittene wieder nett zueinander sind, Alte sich jung und Kranke sich wohl fühlen und tote Ehen sich vorübergehend wiederbeleben.
Kamossa, dieser notorische Drahtzieher hinter den Kulissen, betrachtet die Boote mit den weißen Segeln unter sich. Es sieht aus, als putze sich der See mit Einstecktüchern heraus. Der Multi-Unternehmer – man sieht ihm seine 65 Jahre nicht an – ist an den internationalen Treffpunkten der Schickeria gleichermaßen zu Hause wie an den wichtigsten Finanzplätzen. Er hat Besitzungen in Marbella, Monte Carlo, St. Moritz, auf den Bahamas und in Florida, hält sich aber vorwiegend in Ascona auf. Dabei nimmt der Tessin, an der Steuerersparnis gemessen, nur einen mittleren Rang in der Schweiz ein, die eine bekannte St. Gallener Wirtschaftsprofessorin bezichtigt, ›das Sparschwein korrupter Diktatoren‹ zu sein.
Henry Kamossa war gestern spätabends mit der selbst pilotierten Cessna von der Côte d’Azur nach Locarno-Magadino geflogen. Er hatte in Monte Carlo eine seiner Holdings auf Trab gebracht, in Nizza Gespräche mit dem Spitzenmanager seiner Bank geführt und war dann so nebenbei mit dessen Freundin, einer kleinen Französin, verschwunden und hatte sich mit ihr für ein paar Tage in einem Liebesnest bei Cannes verkrochen. Jedenfalls war er unerreichbar. Trotz vorrückenden Alters gilt der Wirtschafts-Potentat noch immer als ein Mann, der eine Gelegenheit eher herbeiführt als sie ausläßt. Ob die Rolle des unverwüstlichen Schwerenöters echt oder nur vorgetäuscht ist, weiß keiner genau. Zuzutrauen ist ihm alles. Jedenfalls werden seine Geschäftsfreunde und Rivalen immer unruhig, wenn Gerüchte umgehen, Kamossa sei mit einer Schönen untergetaucht. Zu oft hatten sich die angeblichen Abwege als Umwege zu einem neuen Geniestreich an der Börse erwiesen. Ein Mann wie Kamossa macht eben alles zu Geld, selbst seinen schlechten Ruf.
Wenn von den Heroen des nun schon Jahrzehnte zurückliegenden deutschen Wunders die Rede ist, wird der hochgewachsene Mann mit dem straffen Gesicht, den harten Augen und den dichten Haaren stets in eine Reihe mit Grundig, Horten, Schickedanz, Schlieker, Neckermann, Körber und anderen Titanen gestellt; er genießt diesen Nimbus, wiewohl einige der Genannten längst milde oder wilde Titanenstürze hinter sich haben. Das Wirtschaftsimperium Kamossas erreicht in diesem Frühling seine höchste Expansion. Es ist das Jahr, in dem Boris Becker seinen ersten Wimbledon-Sieg erringt, der Flick-Konzern an die deutsche Bank verkauft wird, der Bonner Regierungssprecher wegen Steuerhinterziehung zurücktreten muß, im Fernsehen die ›Schwarzwaldklinik‹ ihre Pforten öffnet, in Wackersdorf die Massendemonstrationen gegen die Wiederaufbereitungsanlage beginnen.
»Frühstücken wir zusammen, Henry?« ruft ihm Iris von oben aus ihrem Schlafzimmer zu. Er winkt hinauf. »Und zwar auf der Terrasse bitte«, erwidert er.
»Ich bin gleich fertig«, entgegnet sie. »Ich spring nur noch mal schnell ins Wasser.«
In der Wohnhalle klingelt das Telefon. Budde, der Intimus des Hausherrn, nimmt das Gespräch entgegen. »Moment, Herr Konsul«, antwortet er dem Anrufer. »Ich weiß nicht, ob Herr Kamossa schon aufgestanden ist.« Er geht auf die Terrasse. »Henry«, fragt er halblaut, »bist du für Kronwein zu sprechen?«
Der Hausherr zögert kurz und nickt dann verdrossen. Wenn ihn der Verleger um diese Zeit anruft, handelt es sich vermutlich um Wichtigeres als um die Einladung zu einer Cocktailparty. »Hallo«, meldet er sich und drückt vorsorglich auf den Knopf des Aufzeichnungsgeräts, gewohnt, wichtige Gespräche auf Tonband mitzuschneiden.
»Guten Morgen, Herr Kamossa – und entschuldigen Sie bitte die Unzeit, zu der ich Sie störe«, meldet sich der Inhaber des Kronwein-Buchverlags, der auch Zeitschriften unterschiedlichen Niveaus herausbringt. »Aber ich muß Sie so schnell wie möglich sprechen.«
»Ich komme gerade von der Côte d’Azur zurück und bin leider zeitlich sehr im Druck«, wehrt Kamossa den Geschäftspartner ab. Seine Firmen inserieren häufig in den Kronwein-Blättern, und ihre Geschäftsführer sorgen dann dafür, daß im Textteil bestimmte Meldungen erscheinen – und andere in den Papierkorb fliegen.
»Kann ich mir denken«, versetzt der Anrufer beflissen. »Ich fasse mich kurz: Meinem Lektorat wurde soeben ein Manuskript angeboten, bei dem es sich um eine Art unautorisierter Kamossa-Biographie handelt – eine recht einseitige und verzerrte Darstellung. Sicherlich liegt es in Ihrem Interesse, daß das Machwerk nicht als Buch und womöglich gar als Vorabdruck in einer dieser obskuren Zeitschriften herauskommt.«
»Ach wissen Sie, über mich wird so viel geschrieben, daß es mir eigentlich schon gleichgültig ist«, behauptet der Angerufene betont gelassen. »Letztlich ist ja doch alles nur Reklame.«
»In diesem Fall aber eine verdammt schlechte«, versetzt der Verleger, bestrebt, sich seine Verärgerung über die Herunterspielung nicht anmerken zu lassen. »Ich hab zwar erst ein Teilmanuskript in Händen, aber es läßt sich jetzt schon absehen, daß es sich um ein bestürzendes, giftiges Geschreibsel aus Halbwahrheiten, Klatsch und Sex-Geschichten handelt.« Er dämpft ein wenig die Stimme: »Darunter gestreut vielleicht auch echte Tatsachen. Jedenfalls«, fährt er hastig fort, »ich hab das Manuskript gelesen und …«
»Sie?« unterbricht ihn der Geldmagnat lachend. »Dabei ist doch hinreichend bekannt, daß Sie noch nie ein Werk gelesen haben, das in Ihrem geschätzten Verlag herauskommt.«
»Branchengeschwätz«, erwidert der Geltungs-Konsul gereizt. »Barer Unsinn. Wie stellen Sie sich das vor – alljährlich erscheinen in meinem Haus sechzig bis siebzig Titel und …«
»Trotzdem halte ich das Gerücht für gar nicht so abwegig«, kontert Kamossa genüßlich. »Ein Bestattungsunternehmer verkauft schließlich auch Tausende von Särgen, bevor er selbst einen benötigt.«
Der Verleger aus München lacht gezwungen. »Bewahren Sie sich Ihren sonnigen Humor, Herr Kamossa!«
»Ich will’s versuchen. Jedenfalls bin ich Ihnen dankbar für Ihre Mitteilung.«
»Ich fürchte, daß Sie die Situation unterschätzen, Herr Kamossa«, entgegnet der Verleger. »Selbstverständlich kann ich den Autor für eine Weile hinhalten und später sein Meisterwerk ablehnen. Aber dann geht der Mann zum nächsten Verleger, zum übernächsten und so weiter, bis er einen findet, der das Geschäft machen will oder unter Umständen nicht so gut auf Sie zu sprechen ist, und dann erscheint das Pamphlet, womöglich in Massenauflage – und Sie wissen ja selbst, daß bei solchen – solchen Schweinereien immer etwas hängenbleibt.«
»Gleich kommen mir die Tränen«, spottet Kamossa.
Durch die Panoramascheibe sieht er Iris mit federnden Schritten auf den Swimmingpool zugehen. Die ehemalige ›Miß Austria‹ bietet einen hinreißenden Anblick, sogar für den eigenen Mann. Mit dem weißen Badeanzug und der gebräunten Haut gleicht sie eher einer ›Miß Italia‹. Prächtig gewachsen zeigt sie – wie die Regenbogenpresse immer wieder beteuert – eine Traumfigur. In diesem Fall stimmt das Klischee sogar.
»Entschuldigung«, sagt der Bedrohte nach kurzer Pause. »Wo waren wir stehengeblieben? Wer ist eigentlich der Autor?« fragt er dann so nebensächlich, als gähne er dabei.
»Offensichtlich ein Nobody«, antwortet Kronwein. »Sein Name ist mir im Moment entfallen, aber auch in meinem Lektorat hat ihn bislang noch keiner gehört. Es kann sich dabei natürlich auch um das Pseudonym eines Insiders handeln oder das eines gefeuerten Mitarbeiters, der sich an Ihnen rächen will. Wenn Sie das Manuskript lesen, kommen Sie vielleicht von selbst auf den Urheber. Ich bin gern bereit, es Ihnen – natürlich streng vertraulich – zu zeigen.«
»Danke«, versetzt Kamossa. »Ich ruf Sie an, sobald ich hier mit der Arbeit aus dem Gröbsten heraus bin.«
Er legt auf und sieht einen Moment lang ins Leere. Er kennt Kronwein gut, zu gut, schon seit seinen Gründerjahren. Das übrige besorgt Asconas Gerüchteküche. Jedermann weiß, daß der Verleger ein Masochist ist, der mit seiner Frau Carlotta (ihrer roten Haare wegen ›La Carota‹ genannt) in einer Schlangengrube lebt. Der Mann versucht der Mitinhaberin seines Verlags so oft wie möglich zu entkommen, um sich bei anderen Damen vom Schmerzgenuß zu erholen oder neuen zu suchen. Nach seiner Rückkehr wird ihm dann die haßgeliebte Dompteuse die spitzen Stöckelschuhe wieder in den Körper rammen. Diese Details sind beliebter Gesprächsstoff unter den Beautiful people der schönen Halbinsel. Aber Kamossa interessieren mehr die geschäftlichen Machenschaften des Titular-Konsuls. Der Wirtschaftsmagnat sammelt Informationen über seine Partner, Gegner und Mitarbeiter wie andere Briefmarken oder Münzen, und so traut er dem Verleger so ziemlich alles zu.
Die ›Residenza Fortuna‹ ist umgeben von einem großen Areal mit eigenem Tennisplatz neben dem Swimmingpool, dazu ein Indoorbecken, ein Fitneßraum und eine Squashhalle. Etwas unterhalb des Hauptgebäudes befindet sich das Gästehaus und auf der anderen Seite über den Garagen ein komfortabler Trakt für die Mitarbeiter, die der Konzernherr ständig um sich haben will: Neben Budde, seinem Groß-Wesir, bewohnen die luxuriösen Apartments der Pilot Robeller, Patrick, der Benjamin der Kamossa-Söhne, vorwiegend als Sparringspartner beim Sport und als Laufbursche in der Firma beschäftigt, und Schmeißer, ein gerissener Privatdetektiv, der bei dem Chef der Unternehmensgruppe in Vollbeschäftigung steht.
Iris sieht, daß ihr Mann auf die Terrasse zurückgekehrt ist, und klettert aus dem Schwimmbecken, schlüpft in hochhackige Schuhe. »Ärger, Henry?« ruft sie schon von weitem.
»Geschäfte«, erwidert er. Ihr Erscheinen regeneriert seine Laune.
Sie nähert sich ihm lächelnd, strahlt ihn mit ihren dunklen Augen an, schüttelt die schwarze Haarpracht, rankt an ihm empor, küßt ihn wie Katharina Howard, die sechste und letzte Gemahlin den englischen König Heinrich VIII., die einzige, die der Blaubart nach Meinung der Historiker wirklich geliebt hat – was sie vor späterer Enthauptung nicht bewahren konnte.
Eine Umarmung lang spürt Kamossa ein Gefühl von Besitzerstoiz und Eifersucht. Iris ist die erste Frau, die seine Selbstherrlichkeit dämpft und seine Überlegenheit einschränkt. Die ehemalige ›Miß Austria‹ und stellvertretende ›Miß Europa‹ – es hatte damals bei der Wahl einen Aufruhr gegeben, weil das Publikum sie als Erste sehen wollte – ist mehr als eine prächtige Vorzeigefrau, bewundert von vielen, vorwiegend Männern, vom Pubertätsjüngling bis zum Lustgreis. Die gebürtige Wienerin muß die erste seiner Frauen sein, die Kamossa wirklich etwas bedeutet; er spürt es gerade dann am meisten, wenn er sie hintergangen hat. Es geschieht immer seltener, vielleicht liegt es an ihrer Persönlichkeit – attraktiv waren alle seine Ehefrauen gewesen – oder an seinen Jahren.
Kamossa brauchte lange, um die Umschwärmte für sich zu gewinnen. Realist, der er ist, gestand er sich hinterher ein, Iris vor vier Jahren eher gekauft als erobert zu haben. Es lag nicht nur daran, daß der erhebliche Altersunterschied seinen Preis forderte. Der schönen Iris war von mindestens einem halben Dutzend anderer Nabobs eine Sofort-Ehe angeboten worden. Kamossa hatte zunächst nicht mithalten können, weil Mable, seine vierte – amerikanische – Ehefrau, sich hartnäckig geweigert hatte, nach zwanzig Jahren in eine endgültige Trennung einzuwilligen. Während einer über zwölf Monate dauernden Schlammschlacht mußte er bangen, Iris könnte sich für einen jüngeren – und trotzdem wohlhabenden – Kandidaten entscheiden. Schließlich schaffte er gegen eine Fünf-Millionen-Abfindung eine blutige Scheidung: sie machte Iris nicht nur zur liebsten, sondern auch teuersten seiner Ehefrauen.
»Du wirst jeden Tag schöner«, stellt er am Frühstückstisch fest.
»Und du immer galanter«, gibt Iris zurück »Wenigstens mit Worten.«
»Unzufrieden?«
»Allerdings.« Sie geht zum Angriff über. »Ich nehme es künftig nicht mehr hin, daß du dich tagelang irgendwo herumtreibst, ohne daß ich weiß, wo genau du dich in dieser Zeit aufhältst. Seit zwei Tagen habe ich in unserem Haus im Cap d’Antibes und im Hotel angerufen. Zuletzt sogar bei der Bank in Nizza. Ich konnte nicht erfahren, wo du bist und stand da wie ein depperter Dotsch’n.«
Immer wenn sie in ihren heimischen Dialekt fällt, ist sie wirklich zornig.
»Tut mir leid, Iris«, beteuert der Großunternehmer und tätschelt ihr begütigend die Hand.
»Deine Geschäftsfreunde haben immer wieder bei mir angerufen. Sie wollten dich dringend sprechen. Micha war nicht da, und ich, deine Frau, mußte ihnen sagen, daß ich nicht weiß, wo du steckst.« Sie schiebt seine Hand weg. »Ich bin 34 Jahre jünger als du und …«
»Dreiunddreißigeinhalb«, verbessert er sie.
»… stand da wie eine betrogene Ehefrau und mußte Erklärungen stottern, auf die sich jeder Anrufer seinen Vers machen konnte. Und dann kommst du unangemeldet mitten in der Nacht, stürmst mein Schlafzimmer wie Attila, der Hunnenkönig – eine Stunde, nachdem ich meine Schlaftablette genommen hatte – und erwartest von mir prompte Liebesbereitschaft.«
»Entschuldige, Iris – es war wirklich eine Ausnahme.«
»Denk an unsere Krise im zweiten Ehejahr! Seinerzeit, als ich auf Schritt und Tritt von deinen Kontrollschranzen überwacht wurde. Als ich fast schon fürchten mußte, daß du in irgendeinem arabischen Land auch noch Eunuchen aufkaufen könntest, hab ich dir gedroht, dich zu verlassen. Es war mir ernst damit, Henry. Du erinnerst dich doch noch?«
»Sei vernünftig, Iris!« versucht Kamossa sie zu besänftigen. »Du hast das in den falschen Hals bekommen. Ich geb’ ja zu, daß für dich die Situation ziemlich peinlich war. Für meine Geschäfte war sie außerordentlich wichtig. Ich mußte ausgebuffte Konkurrenten austricksen. Um sie zu bluffen, war es nötig, für ein paar Tage für Gott und die Welt – und auch für meine geliebte Frau – unerreichbar zu sein.«
»Warum hast du dann nicht wenigstens deine geliebte Frau vor dem Abflug in Nizza angerufen?«
»Ich hatte zunächst keine Starterlaubnis und bekam sie dann ganz plötzlich. Trotzdem«, gesteht er ein, »ein schlimmes Versäumnis. Aber ich habe das Geschäft des Jahres gemacht.«
»Und das hast du nötig – Geldverdienen! Das ist bei dir schon zur Neurose geworden.«
»Mag sein«, antwortet Kamossa. »Aber es ist mein Leben.«
»Dein Leben ist, daß du am Leben vorbeigehst«, giftet Iris.
»Und du wirst eines Tages davon den Vorteil haben«, entgegnet der Hochgewachsene gereizt.
»Wie schön!« antwortet Iris. In ihren Augen sprühen Funken. Die Grübchen an den Mundwinkeln tänzeln. »Soll das heißen, daß du immer noch mehr Vermögen zusammenraffst, um es mir eines Tages zu vererben?« fragt sie den Mann, der sein eigenes Tabu verletzt hat: Er kann es auf den Tod nicht ausstehen, an den Tod zu denken oder über ihn zu sprechen.
»So war es nicht gemeint …«
»Ich bin nicht so besitzgierig, wie du offensichtlich annimmst. Ich möchte dir helfen, dein – dein Ableben in – in weiteste Ferne zu rücken«, erwidert die Ex-Schönheitskönigin. »Ich möchte noch lange etwas von dir haben.« Sie spürt seinen Blick. »Weil wir nun schon beim Thema sind: Professor Kleiber hat bereits zweimal moniert, daß du dich bei ihm nicht sehen läßt. Wann fährst du endlich nach Wiesbaden zur diesjährigen Generaluntersuchung?«
»Dieser Quacksalber!« kontert der Selbstherrliche. »Ich fühle mich pudelwohl.«
»Du sollst dich ja auch nicht ansehen lassen, weil du krank bist, sondern weil du gesund bleiben sollst.«
»Der alte Grams, dessen Unternehmen ich gerade gekauft habe – das steckte hinter meinem Ausflug an die Côte d’A-zur –, verbrachte vier Wochen in einem berühmten Sanatorium. Die Ärzte machten ihm vor dem Abschied am letzten Tag noch ein Elektrokardiogramm und versicherten ihm nach der Auswertung des EKG, daß er mit diesem Herzen mindestens noch zwanzig Jahre lang leben könne. Einen Tag später ist er dann gestorben. Am Herzinfarkt.« Er lacht trocken »Was nützt also die ganze Vorsorge?«
»Zumindest beruhigt sie die Nerven«, entgegnet Iris. »Und die Angehörigen.«
»Gesundheit ist Charaktersache«, albert der Mann mit dem glatten Teint, der leichten Hakennase und dem mächtigen Kinn.
Iris weiß, daß er mit den Ärzten umgeht wie mit seinen Angestellten: Eröffnet ihm ein Mediziner einen Befund, der ihm nicht paßt, geht er zum nächsten Weißkittel und erzählt ihm prompt, warum er den Vorgänger wechselte.
»Meinst du denn, daß meine Kräfte nachlassen?«
»Das nicht«, entgegnet Iris und setzt anzüglich hinzu: »Bestimmt nicht die Manneskräfte.«
»Na, also.« Kamossa lächelt geschmeichelt. Er zieht die junge Frau an sich, streichelt sie mit kundigen Händen, spürt das Verlangen wie eine Stichflamme. Er hebt sie hoch und versucht die fuchtelnd um sich Schlagende ins Haus zu tragen.
»Nicht jetzt«, sagt Iris und strampelt sich frei. »Und nicht hier.«
»Wann dann?« fragt er keuchend.
»Wenn ich bereit bin, dir dein Verhalten zu verzeihen«, entgegnet sie lächelnd. »Und dann an jedem Ort, wo du es wünschst.« Sie sieht auf die Uhr. »Entschuldige Henry, ich bin beim Coiffeur angemeldet.«
Kamossa gelingt es nur mit Mühe, eine Verärgerung hinunterzuschlucken, wie sie nahezu alle Männer spüren, wenn ihr Spontanverlangen abgelehnt wird.
Budde, der Freund und Vertraute des Hausherrn, hat von seinem Arbeitszimmer im ersten Stock aus unfreiwillig die Szene verfolgt und dabei festgestellt, daß sich Henry wieder einmal zum Narren macht. Er konnte Kamossas Rolle als unaufhaltsamer Macho nie etwas abgewinnen, aber der Allgewaltige, jenseits der besten Jahre, der von seiner viel zu jungen Frau zunehmend beherrscht wird, gefällt ihm noch weniger.
König Salomon, der Weise, hat sich in alttestamentarischen Zeiten im hohen Alter blutjunge Mädchen ins Bett geholt, um sich durch ihren Atem verjüngen zu lassen. Obwohl nicht überliefert ist, ob die Prozedur geholfen hat, wird sie seitdem von weit weniger salomonischen Männern häufig angewandt.
Budde nimmt Zeitungen und Briefe vom Schreibtisch und geht nach unten. Er hat eine fast lautlose Art, sich zu bewegen. Seine mittlere Statur ist eigentlich das einzig Durchschnittliche an ihm. Schon auf den ersten Blick wirkt er wie ein Mann, der mehr denkt, als er spricht. Der 45jährige hat eine hohe Stirn, dichte Augenbrauen in einem straffen Gesicht mit einem knappen Mund. Auffallend sind seine Augen mit ihrer fast suggestiven Kraft. Der promovierte Volkswirt – mit Ausbildung in London und New York – wirkt gewandt und sportiv, ein Mann, wie er Frauen gefällt, ihnen aber nicht nachläuft. Nach seinem ersten Eheflop vor Jahren ist er dem schönen Geschlecht gegenüber kritisch, zudem fehlt ihm auch die Zeit für Affären. Verheiratet ist er allenfalls mit Kamossas Lebenswerk, und zwar monogam. Als Groß-Wesir dieses Titanen unterzeichnet er Schecks bis zu einer halben Million ohne Rücksprache und trifft auf eigene Faust heikle Vereinbarungen, die vom Konzernchef hinterher ausnahmslos abgesegnet werden. Seit vielen Jahren rätselt die Branche, was die beiden Männer miteinander verbinden könnte. Echte Freundschaft traut man dem Top-Aufsteiger so wenig zu wie familiäre Bande zu seinen Söhnen und seiner Tochter. Daß Kamossa mit Leuten arbeitet, die ihm ergeben sein müssen, weil er zuviel über sie weiß und sie dadurch beherrscht, ist allgemein bekannt.
»Hast du Zeit für mich, Henry?« fragt der Stellvertreter und weist auf einen Berg Zeitungen. »Nur die ›Süddeutsche‹ und die Frankfurter« bringen erste Meldungen über deinen Grams-Coup, versehen sie aber noch mit einem Fragezeichen«, schießt er los. »Der richtige Sturm wird erst morgen losbrechen«, vermutet der Vertraute. »Auch bei den anderen Posteingängen ist nichts, womit du dich befassen mußt.«
»Geh ins Wohnzimmer, Micha, und spul’ das Tonband zurück. Hör dir mein Gespräch mit Kronwein an«, fordert ihn Kamossa auf und erwägt einen Moment lang, den vermutlichen Bettelbrief – vielleicht auch ein Reklameschreiben – ungeöffnet wegzuwerfen.
Er schneidet den Umschlag auf.
Die Worte, aus verscheidenen Zeitungen ausgeschnitten, sind sorgfältig zu einer Nachricht aufgeklebt wie bei einer Kidnapper-Forderung:
An henry kamossa
liest er, und die Buchstaben kreiseln ihm vor den Augen.
Hiermit kündige ich ihnen im namen zahlloser geschädigter an, dass ich ihre unnötige existenz beenden werde: ich bin kein erpresser. ich will kein geld und würde keine noch so hohe summe jemals von ihnen annehmen!
Ich werde ihre kriminellen machenschaften zug um zug vor der öffentlichkeit aus-breiten wie auf einem mistbeet. sie wissen, dass es eine ununterbrochene kette von manipulationen, nötigungen, erpressungen, steuerhinterziehungen, betrügereien und urkundenfälschungen ist.
Ich werde die faulen beziehungen zu ihren politkumpanen ebenso entlarven wie die gemeinheiten ihres privatlebens und die behandlung ihrer frauen und mätressen. ich könnte sie mit einem schlag vernichten, aber ich mæchte, dass sie vorher noch empfinden, was sie anderen angetan haben. dass es sich hier um keine leeren drohungen handelt, werde ich ihnen umgehend beweisen.
Einer im namen vieler.
Kamossa knallt den Brief auf den Tisch, nimmt ihn noch einmal zur Hand und steckt ihn dann ein. Er schmeckt die Galle im Speichel, spuckt ihn aus, aber er kann einen widerlichen Geschmack nicht loswerden. Er spürt ein Stechen in der Brust und schluckt eine Pille.
Er stapft in die Wohnhalle, wo Budde zum zweiten Mal die Gesprächsaufzeichnung mit Kronwein abhört. »Diesen Konsul hast du ja prächtig ins Leere laufen lassen, Henry«, stellt er fest.
Erst jetzt fällt ihm auf, daß Kamossa verändert wirkt. »Der Brief?« fragt er.
»Hier«, sagt Kamossa und überreicht ihm das Schreiben. Budde betrachtet den Umschlag mit dem Poststempel Locarno, das auffällige gelbe Papier. Dann liest er langsam, bedächtig, so gründlich, als müßte er jedes Wort einzeln buchstabieren. Sein Gesicht wirkt dabei konzentriert und unbewegt wie immer.
Er lehnt sich zurück, denkt einen Moment lang angestrengt nach.
»Wenn dieser Schmierfink Geld verlangen würde, wär’ es mir lieber«, beginnt der Berater. »Dem ersten Anschein nach ist es ein amoklaufender Psychopath. Vielleicht eine Art Michael Kohlhaas, aber der war schließlich auch einer.«
»Viel Gift und Galle, aber wenig Substanz. Diese allgemeinen Vorwürfe kannst du mehr oder weniger jedem Aufsteiger ab einer entsprechenden Größenordnung machen«, konstatiert Kamossa.
Dr. Budde nickt zustimmend. »Bei Psychopathen denke ich immer zuerst an rachsüchtige Frauen«, fährt der Analytiker fort. »Du hast ein Leben lang dafür gesorgt, daß daran kein Mangel herrscht. Kannst du die Frauen noch zählen, die dir zürnen oder dich hassen?«
»Ich bin doch kein Adam Riese, Micha«, spottet Kamossa. »Schließlich ist keine zu kurz gekommen, weder finanziell noch auf der Spielwiese.«
»Nun gibt es in deinem Vorleben auch Geschichten, bei denen du weniger gut abschneidest«, entgegnet Budde.
»Das ist mir ziemlich gleichgültig«, behauptet Kamossa. »Heilige sind heutzutage out. Die Frage ist: Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Telefonanruf Kronweins und diesem anonymen Gewäsch?«
»Dem Verleger ist zuzutrauen, daß er deine Lotter-Biographie von seinen Leuten zusammenschreiben läßt, sie dir anzudrehen versucht und sich dabei noch als wahrer Freund aufspielt. Ich schlage vor: Halt ihn hin, und wir gehen dieser Frage auf den Grund.«
»Richtig, Micha«, sagt Kamossa und klopft dem Freund auf die Schulter. Der Chef eines Mischkonzerns von neun selbständigen Firmen und zahlreichen, raffiniert geschachtelten Beteiligungen stapft zum hauseigenen Tennisplatz, wo Patrick dem untersetzten Rechercheur gerade einen Schmetterball hart auf die Linie knallt.
Schmeißer, der Schnüffler, unterbricht sofort das Match: »Nichts zu machen«, brammelt er. »Ihr Sohn ist einfach unschlagbar.«
»Im Sport schon«, entgegnet Kamossa gedehnt.
Er läßt selten eine Gelegenheit aus, seinen Jüngsten vor anderen zu demütigen. Der 24jährige würgt die Beleidigungen stumm hinunter; er hat keine andere Wahl. Er ist von allen Schulen geflogen und sieht zudem seiner Mutter Mabel so ähnlich, daß sein Vater bei jeder Begegnung an die verhaßte Vierte erinnert wird.
»Sie müssen sofort nach München, Schmeißer«, eröffnet Kamossa seinem Hausdetektiv und präzisiert seinen Auftrag.
II
Draußen dämmert schon der neue Tag, aber in der rauchigen ›Isole‹-Bar geht es noch immer hoch her, sosehr der Patron auch versucht, die letzten Nachtschwärmer loszuwerden. Die verlängerte Polizeistunde ist längst abgelaufen, er hat das Schild ›Geschlossene Gesellschaft an die Tür gehängt und abgesperrt. Doch die Runde der letzten neun macht einen solchen Krawall, daß sich die Anlieger morgen mit Sicherheit wieder beschweren werden.
»Sei doch vernünftig, Ferry!« fleht der Pächter. »Was habt ihr denn davon, wenn mir die Polizei den Laden dichtmacht? Nimm deine Freunde mit – ihr könnt doch bei dir zu Hause weitersaufen.«
Ferry, der zweitjüngste Grams-Sohn, ist der Wortführer seiner vier Kumpane, alle zwischen 20 und 30 und, bis auf einen, Söhne aus superreichen Häusern, geübte Trinker, gute Sportler und routinierte Verführer, doch alle fünf mehr oder wenig unfähig, einer geregelten Tätigkeit nachzugehen. Ihre vier Begleiterinnen, die blonde Marion, Nina, die Dunkelhaarige, die rote Daisy und die brünette Doris, sortiert wie aus einem Farbkatalog, sind jung, hübsch und unverfroren. Von keiner würde man annehmen, daß sie etwas anbrennen läßt.
»Aber wirklich jetzt die letzte Flasche.«
Der Patron gibt noch einmal nach und stellt den Schampus auf den Tisch.
»Und dann kommst du am besten gleich mit uns«, lädt ihn Ferry ein. »Wenn du heute nacht noch etwas vom Leben haben willst.«
»Ich muß doch noch die Abrechnung machen. Aber ich komm später nach. Ganz bestimmt.«
»Dann will ich dich inzwischen mal scharfmachen«, entgegnet der 28jährige Berufserbe, der auf schnellstem Weg den goldenen Löffel versilbert mit dem er zur Welt gekommen ist. »Zeig mal, was du hast, Marion!« fordert er den 20jährigen Busenstar an seiner Seite auf. »Gleich werden dir die Augen übergehen, Rio.« Er knöpft seiner Favoritin die Bluse bis zum Nabel auf, legt ihre freitragenden Werte offen. »Zier dich doch nicht so! Faß mal an, Rio! Alles Marions Kapital: fest und griffig.« Ferry streichelt die Rundungen, bis die Knospen stehen. »Solche Titten findest du in ganz Ascona nicht mehr«, stellt er kennerisch fest, als wüßte es Rio nicht längst.
Die Feriensaison wird erst in den nächsten Wochen richtig anlaufen. Junge Männer sind in der ›Zeit der Haselnüsse‹ – so nennen die Tessiner die Zwischenzeit – Mangelware. Die Mädchen an ihrer Seite genießen es, sich nicht wie während des Winters mit Methusalem-Machos herumplagen zu müssen. Sie gehören zum Bild des einstigen Fischernests, späteren Künstlerorts und heutigen Millionärtreffs wie die kleinen Pinten, idyllischen Winkel, die Boote und die Möwen.
Die hübschen weiblichen Dauergäste sind hier absichtlich oder zufällig hängengeblieben und schlagen sich mehr schlecht als recht durch. Einige arbeiten tagsüber regelmäßig, andere schlafen bei Tageslicht und gammeln nachts vor sich hin. Alle aber warten sie auf die Chance ihres Lebens, die Hochzeit mit einem alternden Nabob oder noch besser dessen Sohn. Tatsächlich schafft es die eine oder andere, während bei den Anläufen der übrigen nicht mehr herausschaut als ein warmes Nachtmahl mit anschließendem Barbesuch nebst nachfolgender Rückzahlung im Bett.
»Bevor du weinst, Rio, verlassen wir dich jetzt«, sagt der junge Grams zum Hausherrn. »Die Rechnung. Ihr seid alle meine Gäste«, verkündet er großkotzig.
»Quatsch!« erwiderte Patrick. »Meinst du, wir sind Nassauer?«
»Du hast’s nötig. Dein Alter zahlt dir doch höchstens ein Laufburschengehalt«, fordert er Kamossas Benjamin heraus.
In das Gelächter hinein erwidert der Verspottete kleinlaut: »Er kann auch sehr spendabel sein.«
»Aber Weihnachten ist öfter«, albert der Gastgeber. »Du bleibst noch lange auf Taschengeld gesetzt. Dein Erzeuger hält sich noch ziemlich flott auf den Beinen. Geduld, Patrick, eines Tages wirst du an die große Kohle rankommen.«
»Und dann heißt’s teilen«, prophezeit Schampi hämisch. Der einzige Sproß einer Großbrauerei führt den Spitznamen wegen seiner Vorliebe für das Nobelgetränk. »Mindestens die Hälfte für die schwarze Iris, deine Stiefmutter, die Schönheitskönigin, und je einen Löwenanteil an Schwester und Bruder sowie an die vier Geschiedenen.«
»Die sind doch längst abgefunden«, unterbricht Patrick verärgert. »Außerdem sind es nur drei«, korrigiert er. »Eine ist gestorben.«
»Ich hab ’ne Patentlösung für dich, Patrick«, lästert der junge Grams. »Sieh zu, daß du den Alten irgendwie um die Ecke bringst und heirate deine Stiefmutter.«
»Ganz schön geschmacklos«, versucht der Gefoppte das wiehernde Gelächter zu übertönen. Er hat zuviel getrunken. Alles dreht sich ihm vor den Augen wie ein Karussell – die Mädchen, die Kumpane, der Tisch. Er spürt, wie ihm der Schampus hochkommt, und stemmt sich dagegen, schluckt und rülpst.
»Dann«, lästert Ferry weiter, »kannst du uns alle einladen.« Er droht an seinem Lachen zu ersticken. »Zur Hochzeit.«
»Halt sofort die Klappe, oder ich polier dir die Fresse, Ferry!« Der Verspottete rafft sich auf und verläßt den Raum, um draußen frische Luft zu schnappen. Er lehnt sich mit dem Rücken an die Wand und fragt sich, warum er nicht endlich nach Hause geht. Er findet keine Antwort, und so versäumt er den Absprung.
»Patrick versteht keinen Spaß, wenn es um seine schöne Stiefmama geht«, stellt die rote Daisy fest. »Manchmal glaube ich, er ist in sie verliebt.«
»Armer Hund«, erwidert Schampi. »Die läßt doch keinen an sich heran.«
»Zumindest in Ascona nicht – oder wenn der Alte in der Nähe ist«, behauptet Ferry, der Fachmann.
Sie kennen die junge Frau Kamossa von mehreren Partys, die sie nie ohne ihren Mann besucht. Iris flirtet gern, geht dabei aber nie zu weit. Wie alles, was sie nicht erreichen können, provoziert ihr Verhalten die jungen Taugenichtse.
»Ich kann mir einfach nicht vorstellen, daß sie auf die Dauer mit dem alten Haifisch zufrieden ist.«
»Das ist wie bei ’ner Nonne, die zu selten von ihrem Beichtvater besucht wird«, entgegnet Marion und löst eine Lachsalve aus.
»Die reizvolle Iris weiß genau, was sie will«, kommentiert Schampi. »Die wird doch nicht so doof sein und eine Weiß-Gott-wie-viele-Millionen-Erbschaft vervögeln. Sie ist noch jung, sie kann geduldig abwarten, bis der Alte abkratzt.«
»Zu lange«, versetzt Ferry. »Wißt ihr, was dieser alte Hurenbuck schon alles überlebt hat?«
Sie sehen, daß Patrick wieder zurückkommt, und wechseln das Thema.
»Die Rechnung, Vreni!« erinnert sie der junge Grams und zieht ein Bündel Scheine aus der Tasche. »Zahlt alles meine Scheißfirma.«
»Erstens ist es nicht deine Firma«, lästert Schampi. »Und sieh bloß zu, daß sie dir euer High-Tech-Unternehmen nicht unter dem Hintern verkaufen.«
»Bei dem Geschäft bin ich doch dabei, du Blödmann«, kontert Ferry. »Auf mich rollt jetzt die ganz große Penunze zu. Und als erstes kauf ich mir ein Riva-Boot mit 250 PS, und ihr schaut dann dumm in die Auspuffröhre …«
»Gratuliere«, sagt Marion, jetzt wieder zugeknöpft; sie ist die Favoritin des Verschwenders, besser gesagt, eine seiner Favoritinnen, denn sie ist klug genug, zurückzutreten, wenn sie vorübergehend von einer Rivalin ausgestochen wird, Lovestyle in Ascona. »Wie ich dich kenne, wirst du mit der Kohle ganz schnell fertig werden, Ferry.«
»Dann mußt du eine dieser reichen Witwen heiraten«, tröstet Schampi schadenfroh. »Zum Beispiel die Juwelen-Olga.«
»Oder dich erschießen«, revanchiert sich Patrick.
»Dann bin ich für Erschießen«, blödelt der Bankrotteur von morgen. »Aber das hat ja wohl noch Zeit.« Die Haare hängen ihm wirr in die schweißnasse Stirn; er ist stark angetrunken, doch selbst in diesem Zustand wirkt er noch attraktiv. Der schlanke Große gilt unter den Neo-Asconesern als der Platzhirsch. Jedenfalls geht er bei seiner Damenwahl nach der Strichliste vor. Dabei ist er bereits so tief unten angelangt wie das Guthaben auf seinem Bankkonto.
Er und seine Kumpane pflegen einen zynischen Umgangston; die jungen Gesichter wirken bereits alt und abgestanden. Die Lufthoheit über ihren Stammtischen hat der Frust, ein lediges Kind der Langeweile. Die Junioren gebärden sich, als stünden sie Modell für eine Gesellschaft, die einer einzigen Regel folgt: Nach mir komm ich.
Die Barmaid bringt das Wechselgeld.
»Schon gut, Vreni.« Grams schiebt es zurück.
»Du hast mir drei Scheine zuviel gegeben.«
»Mein Gott, bist du doof!« Ferry winkt die Deutschschweizerin ganz nahe an sich heran, nimmt die Banknoten vom Teller, rollt sie zusammen. »Hier«, sagt er und schiebt sie ihr ins Dekolleté. »Mach dir einen schönen Tag.«
»Dann – vielen Dank«, erwidert Vreni pikiert. Als Profi hinter der Theke versteht sie ihr Geschäft, aber es geht einfach gegen ihr schweizerisches Gewissen, Geld so zu verschwenden, selbst wenn es ihr zugute kommt.
Der Miterbe des verstorbenen Industriellen stützt sich schwer auf zwei Mädchen, als sie die Bar verlassen. Im ersten Moment droht ihn die frische Luft umzuwerfen, dann erwachen seine Lebensgeister wieder.
Die Lottergenossen lachen und lärmen in der engen Gasse.
»Und jetzt gehen wir zu mir«, fordert der Grams-Sohn mit lauter Stimme auf. »Und veranstalten ’ne richtige Schweineparty.« Er wendet sich an die vier Mädchen. »Aber alle müssen mitkommen. Keine Ausnahme.«
»Angeber!« bremst ihn Marion. »Du kannst doch kaum mehr stehen. Wie willst du denn noch bumsen?«
»Vai via, stronzo!« ruft eine Tessinerin erbost über die Schlafstörung aus einem Fenster im ersten Stock.
»Halt’s Maul, alte Hexe!« schreit Ferry hinauf.
Die Alte ist schlagfertig, kippt ihr Nachtgeschirr aus und landet einen Volltreffer auf Ferrys Kopf. Dem Begossenen läuft die widerliche Flüssigkeit über die Nase, in die Gehörgänge, über die Mundecken in den Kragenausschnitt. Er kann nicht einmal fluchen, weil ihm die ekelhafte Brühe sonst in den Mund rinnen würde.
»Du Urinator!« spottet Marion. »Pfui Teufel, stinkst du vielleicht.«
Der Malträtierte wird den üblen Geruch leichter loswerden als den neuen Spitznamen. The party is over. Der Morgengruß aus dem Nachttopf wird in Ascona heute Tagesgespräch sein und die Zuhörer mehr interessieren als zum Beispiel ein Störfall in einem Atomkraftwerk.
Weitere Fenster öffnen sich. Die Nachtschwärmer flitzen auseinander, um nicht ebenfalls begossen zu werden. Als sie sich angetrunken in ihre Autos setzen, ist es taghell. Das melodische Glockengeläut der Pfarrkirche mit dem großartigen Altarbild und den Wandmalereien des Giovanni Serodine, nach dem auch das gegenüberliegende Haus mit der Prachtfassade benannt ist, ruft zur Morgenmesse.
Patrick spürt, wie ihm die Übelkeit wieder hochschießt. Er kommt gerade noch um die Ecke, lehnt sich gegen die Wand und übergibt sich. Aus den Augenwinkeln stellt er fest, daß seine Schampus-Genossen in ihre Autos steigen und angetrunken losfahren. Das läßt er sein, seit im September vorigen Jahres die Amüsier-Gesellen auf der Autobahn München-Nürnberg mit den entsprechenden Promille im Blut als Mutprobe eine Wahnsinnswette ausgetragen hatten: Wer sich als Geisterfahrer in falscher Richtung am längsten halten konnte, bevor er von der Polizei geschnappt oder von anderen Verkehrsteilnehmern daran gehindert wurde. Egon, der einzige Sohn eines bekannten Grundstücksspekulanten, hatte es geschafft. Einundzwanzig Minuten lang. Im Radio war bereits die vierte Warnung durchgegeben worden und noch immer keine Polizeistreife zu sehen.
Da passierte es. Der Geisterfahrer rammte einen Golf mit einem jungen Ehepaar und einem Kleinkind frontal. Die Benzintanks explodierten. Vier Tote. Wer beim Zusammenprall nicht auf der Stelle getötet worden war, wurde in den Wracks zu einem kleinen Klumpen zusammengeschmort.
Wiewohl die Verkehrspolizei Hinweise auf die tatsächlichen Zusammenhänge sicherstellte, gelang es gerissenen Anwälten, das Desaster zu vertuschen. Für eine kurze Weile standen die Teilnehmer der Wette, die der Tod gewonnen hatte, unter Schock, aber er sollte sich bald legen. Egon war tot, Kismet. Bei dem jüngsten Kamossa hielt das Entsetzen länger an, so daß er sich bis jetzt nicht mehr betrunken ans Steuer gesetzt hatte; er war offensichtlich sensibler als seine Sauf- und Bums-Gesellen.
Der Ernüchterte schiebt sich weiter, auf unsicheren Beinen erreicht er die Piazza, wo die Tische für die ersten Frühstücksgäste gedeckt werden. Die Sonne badet schon im Lago. Die Wellen gluckern vor Zufriedenheit. Die klare Luft belebt den unfreiwilligen Spaziergänger, auch wenn zwischendurch wieder die Nachwehen des Alkohols hochkommen. Aus den Rauchschwaden steigen Erinnerungsfetzen auf, und wieder hört der ausgewachsene Junge diesen Widerling sagen: › … sieh zu, wie du den Alten irgendwie um die Ecke bringst, und heirate deine Stiefmutter. ‹ Dann lachen sie wieder – Patrick versäumt abermals, Ferry für seine Patentlösung die Fresse zu polieren.
Aber er spürt nicht nur Zorn und Ekel, sondern auch Ohnmacht. Es gibt viele Gründe, mit seinem Übervater zu hadern, aber gegen einen Titanen kommt man nicht an. Wenn man sich gegen einen Riesen stellt, wird man zum Zwerg, und bei dem willensstarken Martin, seinem Halbbruder – dem Lieblingssohn –, führte die Rebellion vor drei Jahren zur Katastrophe. Von dem Alten war auch dieser Schlag verkraftet worden. Keiner kommt gegen ihn an, keiner in der Geschäftswelt und auch keine seiner vier Frauen, die nacheinander auf der Strecke geblieben waren: Kamossa kennt kein Canossa.
Wenn Patrick an seines Vaters Fünfte denkt, rührt sich etwas in ihm, deshalb versucht er fast verkrampft, die schöne Iris aus dem Bewußtsein zu verdrängen. Es gelingt ihm nicht ganz, immer wieder turnt sie vor seinen Augen herum, nickt ihm zu mit diesem undefinierbaren Lächeln. Sie ist viel netter zu ihm als Vater, auch wenn sie ihn wie einen kleinen Jungen behandelt, wiewohl sie doch nur fünf Jahre älter ist. Wenn Patrick am Swimmingpool liegt und die schöne Wienerin auftaucht und er sich dann zurückziehen will, um nicht zu stören, ermuntert sie ihn meistens zu bleiben. Dann muß er sich auf den Bauch legen, damit sie seine Erektion nicht sieht. Er dreht auch seinen Kopf weg, um zu vermeiden, daß die Frau seines Vaters in seinem Gesicht wie auf einer Skala seinen Drang und Trieb ablesen kann.
Abrupt bleibt Patrick stehen, starrt ein Plakat an, fürchtet einen Moment lang, daß ihn das Gesöff um den Verstand gebracht hat, was er insgeheim schon länger befürchtet.
Allmählich begreift er, daß er keine Fata Morgana der nächtlichen Ausschweifung erlebt, sondern vor einem nachgemachten Fahndungsplakat steht. Unter den großen Lettern Wanted – prangt das Foto seines Vaters.
Darunter steht:
Gesucht wird der grossbetrüger henry ka-mossa wegen bestechung, erpressung und anstiftung zum mord. vorsicht bei der festnahme. der täter ist mit millionen bewaffnet.
Patrick reißt das Plakat ab, knüllt es zusammen und steckt es in die Tasche. Auf dem Weg zur ›Residenza Fortuna‹ stellt er fest, daß weitere Plakate neben einer Bank und auf der Auslagenscheibe eines Lebensmittelladens angebracht sind.
Er steigt die Treppen hoch zur Collina, dem Monte Verità entgegen, dem Berg der Wahrheit, auf dem zu Beginn dieses Jahrhunderts vegetarische Naturapostel in weißen Hemden begonnen hatten, das Gelände zu erschließen und ihre Nahrung selbst anzubauen. Die ersten Aussteiger und Vorläufer der Hippies, hatten seinerzeit auch den Besitz des Kamossabesitzes erschlossen, den Patrick jetzt betritt. Prompt läuft er dem Hausmeister seines Vaters in den Weg.
»Ausgeschlafen?« fragt ihn Budde anzüglich.
Statt einer Antwort zieht der Spätheimkehrer das Plakat aus der Tasche, entfaltet es. »Hier, Doktor«, kontert er.
Der Manager sieht sich das Plakat genau an: schlechtes Papier, schlechter Druck, unscharfes Foto. Der Text paßt zu dem anonymen Brief von gestern morgen und vielleicht auch zu dem Manuskript, mit dem Verleger Kronwein wedelte.
Er stellt fest, daß sich der Hausherr gerade mit seiner Frau am Swimmingpool tummelt und das Mädchen dabei ist, das Frühstück aufzutragen, Er entschließt sich, den Kamossas vorerst nicht die Laune zu verderben.
Der Mann für alles holt den kleinen BMW aus der Garage und fährt mit Patrick los. Sie drehen eine Runde durch Ascona und stellen dabei fest, daß im Borgo neben der ›Banca dello Stato‹ zwei Uniformierte ein Pseudo-Fahndungsplakat entfernen.
Sie rollen weiter und lassen den Wagen vor dem Rathaus stehen.
Polizeichef Farinelli, ein Mann von kräftiger Statur, mit grauen Haaren, grauen Augen und einem grauen Schnauzbart empfängt sie höflich und zuvorkommend. »S’accomodi«, fordert er die Besucher auf und deutet auf die Stühle. »Kaffee, Dottore?«
»Grazie«, erwidert Budde und präsentiert Patricks Beutestück.
»Ich weiß, was da heute nacht passiert ist«, sagt der Uniformierte. Er spricht fast perfekt Deutsch, ebenso wie Englisch und Französisch; das ist auch nötig, er hat viel mit den im Tessin angesiedelten Ausländern zu tun. Keine größeren Verbrechen bisher – ohnedies müßte er sie an die Kantonspolizei abgeben –, aber die typischen Delikte einer Vergnügungsgesellschaft, deren Spielregel alles erlaubt außer der Armut. »Ich habe sofort veranlaßt, daß diese – diese porcheria entfernt wird«, eröffnet Farinelli. Als Chef der dem Bürgermeister unterstellten Gemeindepolizei ist er so etwas wie ein halber Kurdirektor. »Es tut mir leid, daß ausgerechnet Signor Kamossa, dem Ascona soviel verdankt, auf diese häßliche Weise beleidigt wurde.«
»Besten Dank, Signor Farinelli«, erwidert Budde. »Wir würden gern so rasch wie möglich erfahren, wer hinter dieser Gemeinheit steckt.«
»Wir auch«, entgegnet der Graue grimmig und mustert Patrick einen überlangen Moment lang. »Sie haben also das Plakat als erster entdeckt?« Ohne die Antwort abzuwarten, setzt er hinzu; »Da sieht man einmal wieder, wie nützlich es sein kann, wenn man sich die ganze Nacht in der Isole-Bar um die Ohren schlägt.« Er wickelt seinen Tadel in Bonbonpapier. »Es liegt erneut eine Anzeige wegen nächtlicher Ruhestörung vor. Sagen Sie Ihren Freunden, daß ich ihnen künftig nichts mehr durchgehen lasse. Dies ist meine letzte Warnung. Entschuldigen Sie, Dottore«, wendet er sich wieder an Budde, »wir tun, was wir können. Zeugen haben heute nacht einen jungen Burschen beobachtet, wie er ein Plakat anklebte. Sie kamen aus der Lago-Bar und waren nicht ganz nüchtern. Sie gerieten mit dem Täter in einen Wortwechsel. Der Mann machte sich davon, ohne daß sie ihn festhalten konnten.«
»Hat er deutsch gesprochen?«
»Nein, es war ein Tessiner oder ein Italiener. Das steht fest«, antwortet Farinelli und sieht für einen Moment zum Fenster hinaus. »Er könnte aber auch im Auftrag einer Ihrer Landsleute gehandelt haben.« Gespielt naiv setzt er hinzu: »Hat denn Signor Kamossa Feinde?«
»Viele«, versetzt Budde. »Neider, Konkurrenten. Sie wissen ja, Signor Farinelli, je höher ein Denkmal steht, desto mehr wird es vom Spatzendreck besudelt.«
Der Polizeichef lacht. »Wir werden unsere Streifentätigkeit verstärken«, verspricht er. »Wir werden versuchen, die Druckerei ausfindig zu machen, die das Pamphlet erstellt hat. Die Plakate wurden bereits entfernt, bevor sie die Öffentlichkeit richtig sehen konnte; ich glaube nicht, daß sie zum Tagesgespräch werden.«
»Dafür bin ich Ihnen dankbar. Ich möchte Sie noch bitten, die Geschichte streng vertraulich zu behandeln und mich mit den Fahndungsergebnissen auf dem laufenden zu halten. Zudem möchte ich – intern natürlich – eine Belohnung von 5000 Schweizer Franken aussetzen.«
»Das ist sehr großzügig von Ihnen. Ich denke, wir werden den Fall im Handumdrehen klären.« Farinelli gibt sich optimistisch. »Sagen Sie bitte Herrn Kamossa, daß ich mich ausdrücklich entschuldige, daß so etwas bei uns passieren konnte.«
Er sieht den beiden nach. Immer Ärger mit den Fremden, aber das schweizerische St. Tropez verdankt ihnen mehr als überfüllte Parkplätze, Autoraserei, Preissteigerungen, den Lärm der Motorboote auf dem Lago und nächtliche Alkoholexzesse.
Ascona ist tolerant, seitdem den ›Grasfressern‹ – so hatten die Einheimischen die Naturapostel auf dem Monte Verità verspottet – Exoten aller Art gefolgt waren: Schriellheiler, Zukunftsdeuter, Sektengründer, Scharlatane, Kartenleger, Gesundbeter, Meditations-Gurus, Gaukler und Sexprediger mit den Schwulen und den Lesben im Gefolge. Es kamen aber auch Künstler auf der Weltflucht, berühmte Maler neben solchen, die es sein wollten; weltbekannte Schriftsteller neben Schreibern, die sich ihr Manuskriptpapier erst noch verdienen mußten und in den Hinterstuben der Gasthöfe vor drei, vier mitleidigen Zuhörern ihrer Dichterlesungen veranstalteten.
Ein Ort, den man kaum auf der Landkarte gefunden hat, ist weltberühmt geworden, weil das einstige Fischernest allen Gastfreundschaft gewährt hatte, den Aussteigern wie den Einsteigern, den Satten wie den Hungrigen, den Verschwendern wie den Nassauern.
Problemgäste, so dämmert es Polizeichef Farinelli, sind erst die letzten Zuwanderer, die Millionäre mit ihrem Schikkeria-Troß.
III
Schon am frühen Morgen strengt sich der neue Sonnentag an, als wolle er den gestrigen an Glanz noch überbieten. Um neun Uhr morgens wirken die Hänge über dem Westufer des Lago wie mit Gold überzogen. Die Sonne klettert weiter, dem Gipfel des Ghiridone entgegen. Der Schönwetterdunst hebt sich wie ein Vorhang über dem See, der Blick reicht jetzt über die Inseln weit nach Italien hinein.
In den Luxusvillen mit den Parkgrundstücken der Steinreichen, Neureichen und Scheinreichen schlafen die Bewohner noch. Etliche müssen sich vom nächtlichen Alkoholgenuß und Bargeschwätz erholen und Kräfte für die Strapazen des heutigen Müßiggangs sammeln, aber es gibt eine schweigende Mehrheit von Neusiedlern, die keine Schlagzeilen macht und im Tessiner Paradies zurückgezogen und unauffällig lebt, ohne an dem Narrentreiben des Amüsierpöbels teilzunehmen.
Nicht nur Schwärmer nennen die Region zwischen Locarno und Brissago den schönsten Landstrich der Südschweiz. Noch verschleiert die Blütenpracht, daß der traumschöne Fleck mit der herrlichen Aussicht auf die schneebedeckten Berge von Herrschaftssitzen und Ferienhäusern zersiedelt wurde. Hübsche architektonische Einfälle stehen neben monströsen Protzbauten. Einem der Superreichen ist es gelungen, die untere Strecke eines zweitausend Jahre alten Römerwegs einreißen und für seine Autozufahrt asphaltieren zu lassen. Die Legionärsstiefel des großen Geldes trampeln über Geschichte, Kultur und Landschaftsschutz hinweg.
Der Verleger Kronwein wohnt in Moscia, in dem weißen weiträumigen Gebäude inmitten einer schönen Gartenanlage, zwei Kilometer von Ascona entfernt und fünfzig Meter hoch über dem Schweizer Becken des Lago Maggiore. Überzeugt, daß Kamossa sein Desinteresse an dem Manuskript nur vortäuscht, in Wirklichkeit jedoch darauf brennt, es einzusehen und einzusargen, hat er gestern den ganzen Nachmittag über vergeblich auf einen Rückruf des Macht-Moguls gewartet. Am Abend war es dem Ungeduldigen mit dem leicht schwammigen, aber noch immer jungenhaften Gesicht gelungen, sich aus dem Haus zu stehlen und Carlotta ein paar Stunden zu entfliehen, um Abwechslung im Dorf zu suchen und dabei vielleicht Kamossa ›zufällig‹ zu begegnen.
Der Endfünfziger hat mit nichtssagenden Leuten gespeist und ist dann im ›Club‹ hängengeblieben. Whisky auf Vorrat in sich hineinschüttend, hat er verdrossen den hübschen Mädchen auf dem Parkett zugesehen. Sicher hätte er die eine oder andere beim Blondschopf packen können, aber er wollte mit ihr ins Bett und nicht aufs Parkett. Es ist schon ziemlich spät geworden, als er mißmutig in die häusliche Schlangengrube zurückfindet, die ausgerechnet den romantischen Titel ›Villa Paradiso‹ trägt. Carlotta hat sich in ihr Schlafzimmer eingesperrt – es wird Ärger geben.
Der Spätheimkehrer quartiert sich in seinem Arbeitszimmer ein wie in einer Ausnüchterungszelle. Er kann nicht richtig schlafen und erhebt sich beizeiten, ergeht sich im Garten, immer in Hörweite des Telefons.
Zehn Uhr. Der schweizerische Rundfunk bringt Nachrichten. Nichts Besonderes. Am Ende der Wetterbericht: Die Meteorologen sagen für die Südschweiz ein langes Hoch voraus, aber in diesem Moment hört der Verleger, daß seine Frau aufgestanden ist, und stellt sich auf ein Sturmtief ein.
Die Unterlippe hängt durch wie ein schlaffes Sprungseil; er fürchtet, haßt und begehrt Carlotta. Er hatte ihr schon nachgestellt, als sie noch mit einem bekannten Regisseur verheiratet war, dessen Karriere in einer Trinkerheilanstalt beendet wurde. Inzwischen sind fünfzehn Jahre Gemeinsamkeit über das Verlegerpaar hinweggewalzt; eine Zeit enormen wirtschaftlichen Erfolgs über den Abgründen des Privatlebens. Die Gefühle der Kronweins – so es sie je gegeben hat –, wurden zersägt wie die Jungfrau in der Schaubude.
Carlotta hat ihrem Mann nicht nur das Trinken, sondern nahezu alles verboten, und er übertritt nahezu alle Zwänge mit Wonne. Er wird von ihr laufend auf Abwegen ertappt – und dafür bestraft. Die Versöhnungen arten jedesmal in Exzesse aus.
In letzter Zeit sind sie seltener geworden. Kronwein ist der abwegigen Spiele müde. Er ist es leid, von seiner Frau als ewiger Zweiter behandelt zu werden, weil ihm von Carlotta der Regisseur ständig als der Genialere, Berühmtere und Attraktivere vorgehalten wird. Dabei hat der Verleger im ersten Liebesrausch seine Frau zur Mitbesitzerin seines Unternehmens gemacht. Das war sein größter Fehler; daß er es nunmehr täglich feststellt, ändert nichts an der Tatsache.
Carlotta ist keine stille, sondern eine laute Teilhaberin. Sie hat sich in München neben seinem Arbeitszimmer ein Studio als Beobachtungsstand eingerichtet. Von hier aus mischt sie sich ständig in Geschäfte ein, von denen sie nichts oder wenig versteht. Sie fuhrwerkt in der Personalpolitik herum, verfügt Einstellungen oder Entlassungen nach hausgemachten astrologischen und graphologischen Gutachten. Trotzdem kann sie nicht verhindern, bei ihrem Mann immer wieder Taschentücher zu finden, die dieselben roten Flecken aufweisen wie das Rouge auf den Lippen ihrer weiblichen Günstlinge.
Bei Carlotta wurde es zum Wahn, den Ungetreuen an die Dressurleine zu nehmen, wie es bei ihm zum Zwang wurde, sich von seiner Herrscherin loszureißen.
Kronwein hört sie kommen; gleichzeitig klingelt das Telefon.
Der Anrufer ist Kamossa, er trifft eine Verabredung zum Mittagessen.
»Also 13 Uhr 30 im ›Ascolago‹, Herr Kamossa«, bestätigt der Verleger, legt auf und wendet sich der Eintretenden zu.
»Guten Morgen«, begrüßt er sie eilfertig, aber sie antwortet nicht.
Ihr Gesicht wirkt wie versteinert. Sie trägt einen knappen Bikini unter einem seidenen Morgenmantel, der den Blick auf ihre mollige, aber noch immer respektable Figur mehr freigibt als verhüllt. In ihren wasserblauen Augen brennt das kalte Feuer einer rachsüchtigen Domina, die statt der Peitsche Schriftstücke in der Hand hält.
Kronwein stellt mit Erschrecken fest, daß Carlotta während seiner Abwesenheit seinen Schreibtischschlüssel gefunden und in seinen Papieren herumgewühlt haben muß. Er überlegt, worauf sie gestoßen sein könnte, aber das ist schwierig; wenn sie die Fundgrube tatsächlich aufgeschlossen hat, ist es so, als würde ein Klorohr platzen.
»Diesen Kamossa werd ich diesmal ordentlich aufs Kreuz legen«, sagt er zu Carlotta. »Diesen arroganten Pinkel.«
»Und wen hast du heute nacht aufs Kreuz gelegt?« fragt sie mit einer Stimme, die tief von unten kommt.
»Unsinn!« wehrt er ab. »Ich hab ein paar Leute getroffen und bin eben …«
Carlotta tritt näher an ihn heran. »Du hast wieder getrunken«, stellt sie fest. »Und du stinkst wie ein andalusisches Freudenhaus. Sag dieser Schlampe, daß sie gefälligst ihr Parfüm wechseln soll.«
»Eifersucht macht duftblind«, versetzt Kronwein.
Das Hausmädchen rollt den Frühstückswagen auf die Terrasse und unterbricht dadurch den Schlagabtausch, aber gleich wird sich die Szene einer Ehe fortsetzen.
Carlotta greift das Stichwort auf. »Eifersucht?«, versetzt sie. »Lächerlich! Oder meinst du, daß ich deinen Pimmel überschätze?« Früher hat es ihn besonders amüsiert, daß Carlotta von einem Moment auf den anderen aus der Haut der feinen Dame schlüpfen und hundsordinär werden konnte. »Du weißt doch selbst am besten, was ich alles anstellen muß, um deinen lächerlichen Minimax ab und zu noch mal hochzubringen.« Sie trifft ihren Mann am Punkt.
»Du vielleicht«, gibt er ihr heraus. »Aber andere Damen haben mehr Mühe damit, meinen lächerlichen Minimax wieder herunterzukriegen.«
»I am the greatest«, kreischt sie scheppernd. »Cassius Schmäh als Cassius fuck.«
»Immerhin Weltmeister im Schwergewicht«, versetzt Kronwein.
»Es war einmal, so beginnen alle Märchen«, höhnt die Mitvierzigerin.
»Das ist nur natürlich«, fährt Kronwein fort. »Ein bekannter Mann hat einmal gesagt: ›Die Ehe ist eine Gemeinschaft zur Unterdrückung des Geschlechtstriebs‹.«
»Du Schwein«, erwidert sie, »du widerlicher Sexprotz, senil, doch mobil.«
»Vielleicht zu Hause«, räumt er ein. »Aber ich bin nun mal ein Verächter der Ehe.« Seine hängende Unterlippe spannt sich, wird gerade. »Ein Mann wie ich hat nur eine Alternative.« Erstaunt bemerkt Carlotta, daß er heute nicht vor ihr zurückweicht. »Jede zu heiraten oder keine.«
Im ersten Moment ist sie zu verblüfft, um zu reagieren. Dann verwandelt sich La Carota in La Furiosa: »Und was ist das?« fragt sie und schlägt ihm ein Schriftstück ins Gesicht. »Fünfzigtausend Mark für diese Tippse! Warum? Was hast du mit ihr angestellt?«
Der Verleger zieht den Kopf zurück, weicht einen halben Schritt zurück, aber sie schlägt mit den Schnüffelpapieren weiter auf ihn ein, bis sie auseinanderfallen; beflissen bückt er sich, um sie einzusammeln.
»Was hast du mit ihr getrieben?« bohrt sie weiter. »Warum kann sie dich erpressen?«
»Unsinn«, antwortet der Mißhandelte. »Frau Melber ist eine dreisprachige Chefsekretäin. Solche Leute kosten heutzutage sehr viel Geld. Sie hat ein paar Dinge herumgequatscht – deshalb mußte ich sie feuern.«
»Mit fünfzigtausend Mark Abfindung?«
»Es ist ein außergerichtlicher Vergleich. Ich wollte nicht, daß vor dem Arbeitsgericht Dinge zur Sprache kommen, die ich großenteils auch deinen Auftritten im Betrieb und deiner Unbeherrschtheit verdanke.« Kronwein atmet schwer. »Und vor allem deiner krankhaften Eifersucht«, setzt er hinzu.
»Lächerliche Ausflüchte!« Carlotta mustert ihn verächtlich. »Ich krieg das raus. Es ist wieder eine deiner miesen Weibergeschichten im Büro.«
»Schluß!« erwidert Kronwein. »Aus. Die Schmerzgrenze ist überschritten.« Er atmet schwer. »Wir werden uns trennen«, setzt er hinzu. »Ich werde unverzüglich die Scheidung einreichen, koste es, was es wolle.«
Carlotta lacht ihm ins Gesicht.
»Ich werde auch Mittel und Wege finden, dich aus meiner Verlagsgruppe zu entfernen, selbst wenn ich unsere Häuser bis unters Dach belasten und den letzten Stuhl verpfänden muß.«
»Besser würdest du wohl einen Irrenarzt in Mendrisio aufsuchen«, entgegnet sie kalt und tippt sich mit dem Finger an die Stirn. »Das ist billiger und nützlicher. Du willst dich von mir trennen? Du bleibst an mich gebunden, solange du lebst, du Schlappschwanz!«
»Ich werde dir ein faires Angebot machen«, antwortet Kronwein, mühsam beherrscht. »Ich möchte die Sache so lautlos wie möglich regeln. In deinem wie in meinem Interesse.«
»Du bist ja wirklich verrückt«, versetzt Carlotta.
»Wenn du im Gerichtssaal mit Dreck um dich werfen willst – na bitte, ich halt’s aus.«
»Über Leichen vorwärts!« spottet sie. »Gerichtssaal? Du bist wirklich ein Dummkopf. Meinst du, ich habe deine krummen Touren vergessen? Das gefälschte Testament? Den Steuerbeschiß? Die fingierten Anweisungen? Die manipulierten Abrechnungen?«
»Du willst mich also erpressen«, erwidert der Verleger.
»Nenn es, wie du willst. Zunächst möchte ich nur dein Gedächtnis auffrischen. Und dann wirst du bei mir zu Kreuz kriechen, und zwar auf dem Bauch.« In der Tür bleibt Carlotta stehen, dreht sich noch einmal um. »Mich loswerden?« höhnt sie. »Da müßtest du mich schon umbringen. Aber dazu bist du ja wohl zu feige.« Sie wirft die Tür zu.
Der Geschmähte droht k.o. zu gehen durch den Schlag unter die Gürtellinie. In Gedanken hat er Carlotta schon hundertmal ermordet, was nichts daran ändert, daß sie noch lebt. Er muß ihr alles zutrauen. Sie ist tatsächlich in der Lage, ihn ins Gefängnis zu bringen. Kronwein faßt sich mit der Hand in den Kragenausschnitt, als spüre er das Dressurband um den Hals.
Er geht an sein Versteck in der Schreibtischschublade, holt die Flasche Cognac heraus, gießt sich einen ordentlichen Schluck ein, kippt ihn in einem Zug. Der Alkohol wattiert seinen Zorn, aber er weiß nur zu gut, daß er sein Problem weder durch Alkohol noch durch Streit oder Haßausbrüche lösen kann. Es macht wenig Sinn, der Schlangengrube für Stunden oder Tage zu entgehen.
Er muß sie sprengen. Das ist ihm bisher immer mißlungen, weil er es nie ernsthaft gewagt hat.
Viel zu früh fährt Kronwein ins Dorf, versucht sich auf Kamossa einzustellen, aber seine Gedanken taumeln immer wieder zu Carlotta zurück. Er ist ein schlechter Fahrer und zudem zerstreut. Er bremst im letzten Moment, Beinahe hätte er eine Fußgängerin überfahren. Das hätte ihm an diesem Tag gerade noch gefehlt – es sei denn, die Frau hieße Carlotta.
Er findet eine Parklücke, zwängt mit großer Mühe seinen Jaguar hinein, steigt aus und durchschreitet die hübsche Parkanlage zwischen dem › Ascolago‹ und dem Schloßhotel, dem alten ›Castello dei Grilioni‹, dem falsche Zinnen aufgepfropft wurden wie dem Garten Eden die Steuerflüchtlinge.
Kronwein passiert blicklos die leuchtenden Blumenrabatten. Fast ganzjährig blüht und grünt die Tessiner Landschaft. Den frühen Mimosen und Forsythien folgen die Kamelien, Magnolien, Azaleen und der Rhododendron, der Ginster und im späten Sommer noch die Glyzinie.
Wenn die kalte Jahreszeit der Flora zusetzt, blüht zumindest noch der Klatsch, und der nicht nur zur Winterszeit. Die Wahlbürger der Prominenten-Oase begrüßen einander mit ›Buon Giorno‹ oder ›Buona Notte‹, aber – so spotten die Eingeweihten – die echte Ascona-Floskel müßte lauten: ›Wie geht’s mir?‹, da der Gesprächspartner immer besser weiß, wie es um den Begrüßten steht.
Ascona ist zu klein für Diskretion oder Geheimnisse. Die ausländischen Privilegierten der schweizerischen Sonnenstube – neben Nordschweizern, Italienern, Deutschen und Amerikanern, Engländern und Schweden auch ein paar Exoten – verkehren in den gleichen Cafés, speisen in denselben Restaurants und amüsieren sich in den nämlichen Nachtklubs. Wie in den Salons und in den Betten, bei den Friseuren und in den Schönheitswerkstätten so werden auch in den Lokalen Tag und Nacht Gerüchte gargekocht, Beobachtungen weitergegeben, ausgeschmückt oder erfunden – die Fama als Tausendfüßler.