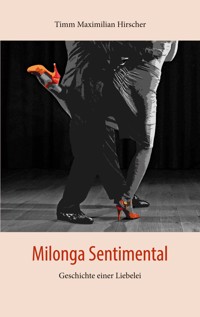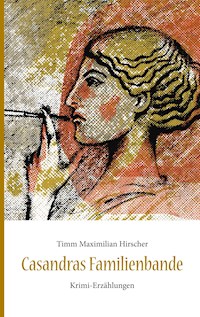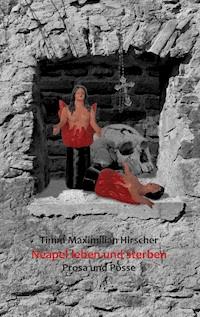
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Universitätsprofessor Hans Herrmann lehrt Geschichte der Philosophie in Neapel. Als er vor vielen Jahren eine Neapolitanerin zur Frau nahm, wusste er nicht, dass er in einen Camorra-Clan eingeheiratet hat. Zwar beginnt er mit den Jahren von der verhängnisvollen Verwandtschaft zu ahnen, doch will er nichts davon wissen. Er beschäftigt sich lieber mit dem Schreiben einer Posse über das Leben der Schriftsteller Heinrich und Thomas Mann in Italien. Da erreicht das mörderische Treiben des organisierten Verbrechens seine eigene Familie. Einzigen Halt in der Katastrophe findet der Deutsche bei einem neapolitanischen Original, seinem Frisör. Der ist nicht Gelehrter der Philosophie, aber vielleicht Philosoph – und Scharlatan, wie der andere. „Philosophieren können sie alle, sehen keiner.“ (Lichtenberg)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor lebte sieben Jahre in Neapel und arbeitete dort als Lektor an der Universität „Federico II“ sowie als Lehrer am Goethe-Institut. Später war er weitere sieben Jahre in Rom Korrespondent einer Nachrichtenagentur.
Bisherige Veröffentlichungen: „Tango Tenebrista. Ein Schmöker zum dramatischen Helldunkel von Tango Argentino, Sex & Crime“, „Tango up & down“ und „Tödliches Tangotreiben. Die wahre Geschichte der Freiburger Vampirmorde‘“.
Inhalt
Neapel leben und sterben
Anhang
Auf der Suche nach dem verlorenen Hund oder Ein Tag der Brüder Mann in Palestrina
Neapel leben und sterben
1.
„Si è sciolto, si è sciolto!“ - Es hat sich verflüssigt, es hat sich verflüssigt, rief die Portiersfrau dem Professor zu, als dieser am 19. September jenes Jahres aus dem Haus trat. Hans Herrmann nickte ihr zu und machte sich auf seinen Gang zum Frisör. Verflüssigt hatte sich an Neapels Patronatsfest das Blut von San Gennaro, dem heiligen Januarius. Das Jahr stand also unter einem guten Zeichen.
Der Deutsche überquerte den Largo Ecce Homo im Quartier S. Giuseppe in Neapels historischer Innenstadt, schaute dann in seine Stammbar hinein, wo er zwei Kaffee bestellte, und ging die wenigen Schritte weiter zu Ò Saracin, dem Sarazenen. Diesen neapolitanischen Spitznamen hatte Giuseppe Fresco erhalten, weil er angeblich in langer Vorzeit, vermutlich noch unter Kaiser Friedrich II., einen Araber in der Familie hatte. So wurde zumindest erzählt, wobei sich der Frisör nie zu diesen Gerüchten äußerte, ihnen allerdings durch immer wieder erzählte Geschichten aus dem Orient neue Nahrung gab. Man munkelte sogar, dass er Muslim sei. In seinem kleinen Frisörgeschäft hingen zwar Bilder der Madonna und San Gennaros, aber was besagte das schon. Daneben prangten Fotos des neapolitanischen Fußballgottes Maradona.
„Buon giorno, Professore.“
„Buon giorno, Maestro.“
Ò Saracin, als Meister der Schere und des Rasiermessers tituliert, hatte auf einem der zwei Frisörstühle gesessen und in der auf rosa Papier gedruckten Sportzeitung gelesen. Er erhob sich, und die beiden Männer tauschten einen Händedruck aus. Der Frisör brachte ihn auf den neuesten Stand, was Diego Armando Maradona und den SSC Neapel betraf. In diesem gelobten Jahr war der Fußballverein mit Hilfe Maradonas zum ersten Mal italienischer Meister geworden.
Herrmann setzte sich auf den anderen Stuhl, damit ihn Ò Saracin rasiere, wie er das nun seit Jahr und Tag jeden Morgen tat. Es war ein Ritual geworden für den Deutschen, eigentlich der einzige Luxus, den er sich seit vielen Jahren leistete. Früher hatte er immer gesagt, den Rest seines Geldes würden seine zwei Frauen ausgeben, seine Frau und seine Tochter nämlich. Aber das war früher.
Der Frisör hatte neben der Sportzeitung noch ein Pornoheft zur Seite gelegt und auf den fragenden Blick des Deutschen ein neapolitanisches Sprichwort zitiert:
„La mugliera sia come lo presutto: né magro affatto né sia grasso tutto.“ - Die Frau sei wie der Schinken: nicht ganz mager und nicht völlig fett.
Ò Saracin zeigte auf das Titelbild des Heftes.
„Professore, so eine. Ab und zu muss doch etwas Leben in meinen alten Schwanz fahren.“
Während er seinem Kunden das Gesicht einseifte, kam der Junge von der benachbarten Bar und brachte die zwei Espressotassen und zwei Gläser mit Wasser. Herrmann zog den vorbereiteten Betrag nebst Trinkgeld aus der Tasche, und der Junge zog mit einem lauten „Grazie, Professore“ ab.
Ò Saracin unterbrach kurz seine Arbeit, und sie tranken Kaffee und Wasser. Dann machte er sich wieder ans Geschäft. Er zog das Rasiermesser ein paarmal über einen Lederriemen und begann, die Bartstoppeln von den Wangen seines Kunden zu schaben.
„Es hat sich also verflüssigt“, sagte der Frisör mit einem ironischen Unterton. Er wusste, dass zwei Skeptiker unter sich waren. Keiner der beiden glaubte an ein Wunder bei der Verflüssigung des Märtyrerblutes, doch begrüßten beide den Vorgang, den keiner von ihnen erklären konnte. Einen billigen Trick hielten sie für ausgeschlossen; dafür waren die Neapolitaner seit Jahrhunderten zu gewitzt.
„Vor zwei Jahren hatte es sich nicht verflüssigt – und das Unglück brach herein“, murmelte Herrmann. Beim ersten Wort hatte der Frisör sein Rasiermesser abgesetzt.
„Professore, so war es im Buch Allahs geschrieben.“
Wobei der Hinweis auf Allah wohl den gleichen Stellenwert hatte wie das Blutwunder.
„Wenn man nur glauben könnte“, seufzte der Professor. Er lehrte Philosophiegeschichte der deutschen Aufklärung und des deutschen Idealismus an der nicht weit entfernt liegenden Orientale-Universität. Wenn er sein Arbeitsgebiet vorstellte, fügte er gewöhnlich hinzu, er sei der einzige in Neapel, der Kant verstehe, und das auch nur halbwegs. Ausnahme sei natürlich der Heidelberger Philosoph Gadamer, der immer wieder zu Gastvorträgen nach Neapel kam. Als der Frisör sein Geschäft beendet hatte und die Wangen Herrmanns nach Rasierwasser dufteten, setzte er sich auf den anderen Stuhl, da kein neuer Kunde wartete. Die zwei Männer schauten sich im Spiegel an, lächelten, schwiegen eine Weile, bis der Deutsche leise sagte:
„Man rief mich an und sagte, dass demnächst die Gebeine ausgegraben und gesäubert würden. Ob ich dabei sein wolle. Den Termin würden sie aus Sicherheitsgründen kurz vorher mitteilen. Aber ich will nicht. Es ist eine barbarische Sitte. Warum lassen sie in Neapel nicht die Toten ruhen? Aber nein, jetzt wird eineinhalb Jahre nach der Beerdigung die Tote ausgegraben, die Knochen von gegebenenfalls noch vorhandenen Hautresten gesäubert, in einen Sack gesteckt und in einer Grabwand beigesetzt. Aber wem erzähle ich das.“
„Eine barbarische Sitte“, bestätigte der Frisör. „Aber eine barbarische Sitte ist immer die der andern. Doch, bei Allah“, fuhr er fort, „die Toten sollte man besser ruhen lassen.“
Die zwei Männer schwiegen. Ein Kunde trat ein, der sich die Haare schneiden lassen wollte. Der Frisör stand auf und machte Platz. Herrmann blieb sitzen, hörte die zwei über Maradona diskutieren, schaute geistesabwesend in den Spiegel, sah sich, sah sich in die Augen, hörte nichts mehr von dem Gespräch und erinnerte sich. Eigentlich hatte die Katastrophe zwei Jahre zuvor ihren Anfang genommen.
2.
Damals schreckte Immacolata Herrmann mitten in einem Alptraum aus dem Schlaf. Es war am frühen Morgen des 21. Dezember 1985: Ein dumpfes Geräusch, die Fensterscheiben klirrten. Imma, wie sie gerufen wurde, lag zitternd und Schweiß gebadet da, hielt es aber nicht länger im Bett aus, knipste das Licht an, sah auf dem Wecker, dass es kurz nach fünf Uhr war, schlüpfte in ihre Pantoffeln, streifte einen Morgenmantel über und trat auf die Terrasse. Entsetzt starrte sie in Richtung des Stadtviertels San Giovanni a Teduccio, wo haushohe Flammen lohten und die Nacht dort zum Tag machten. Eine Hand legte sich auf die Schulter des Mädchens. Es fuhr herum und warf sich an die Brust ihres Vaters, bebend vor Angst, Tränen in den Augen.
„Aber, aber, Imma“, sagte er, „hat dich der Schlag so erschreckt? Himmel, was für ein infernalisches Feuer! Es muss eine Explosion in den Raffinerien dort gewesen sein. Und jetzt brennt alles. Deine Mutter und ich wurden durch den ungewohnten Schlag wach. Aber nein, wie das brennt! Aber Imma, nun beruhige dich doch! Du lieber Gott, Mädchen!“, sagte er und drückte die Tochter an seine Brust, strich ihr über das rote Haar, das wie ein Widerschein des Flammenmeers erschien. Doch Imma war nicht zu beruhigen, ihr fror und zugleich trat ihr Schweiß auf die Stirn. Sie stammelte Worte, halb Italienisch, halb Deutsch, ohne Zusammenhang. Erst Tage später erzählte ihm die Tochter von dem Alptraum.
Inzwischen war auch Herrmanns Frau Concetta auf die Terrasse getreten, hatte angesichts des Riesenfeuers in der Ferne ein „mamma mia“ ausgestoßen, dann aber diagnostiziert, dass die Tochter Fieber habe und sofort ins Bett müsse. Bevor sie Imma unter der Bettdecke begrub, steckte sie ihr noch ein Fieberthermometer unter die Achsel. Imma ließ alles widerstandslos über sich ergehen, lag mit geschlossenen Augen schwer atmend in den Kissen.
Während Herrmann besorgt neben dem Bett saß und nicht verstand, warum seine Tochter so durch die Explosion und das Feuer geschockt war, telefonierte seine Frau mit ihrer Tante in S. Giovanni, hörte, dass die Explosion dort die Fensterscheiben habe zerspringen lassen, aber bei ihnen selbst sonst alles in Ordnung sei. Im Hintergrund hörte Concetta das Heulen von Polizei- und Feuerwehrsirenen.
Nachdem sie den Hörer aufgelegt hatte, kehrte sie ans Bett ihrer Tochter zurück. Das Thermometer zeigte nur einen geringen Anstieg der Temperatur an. Da Imma in den Schlaf gefallen schien, löschte die Mutter das Licht und schloss die Tür hinter sich. Das Ehepaar zog sich etwas über und trat erneut auf die Terrasse. Schon dämmerte der Morgen herauf, der Himmel über ihnen klarte auf, doch drüben über S. Giovanni dräute über den Flammen eine ungeheure pechschwarze Wolke, die sich Richtung Capri wälzte.
„‘ans“, sagte Concetta zu ihrem Mann, wobei ihr das „H“ auch nach 18-jähriger Ehezeit nicht gelingen wollte. Aber sie strengte sich auch nicht wirklich an, hatte es nie richtig probiert. Warum auch, meinte sie, da man ja in Italien wohne.
„‘ans“, sagte sie, „ist Neapel nicht wirklich eine verdammte Stadt? Der Vesuv bricht aus, die Erde bebt, in Pozzuoli hebt sie sich. Letzte Weihnachten legten sie eine Bombe in den Zug, und jetzt, vier Tage vor Weihnachten explodiert eine Ölraffinerie. Womit haben wir Neapolitaner das verdient? Wofür haben wir eigentlich San Gennaro? Und Imma? Was ist denn mit ihr passiert?“
Ohne auf eine Antwort ihres Mannes zu warten, murmelte sie ein Ave Maria und bekreuzigte sich ein halbes Dutzend Mal.
Die Rauchwolke stand noch Tage über dem Unfallort, verdunkelte das Weihnachtsfest, schien der Stadt zu drohen. Fünf Tage dauerten die Löscharbeiten. Es gab sechs Tote, über hundert Verletzte und mehr als zweitausend Obdachlose. Straßen und Eisenbahnlinien waren im Umkreis der brennenden Raffinerie gesperrt, der Verkehr ein Chaos. Das Hupen der in der Schlange stehenden Autos wollte nicht abschwellen.
3.
„Wie kann einer so intelligent sein – und zugleich so dumm?“ Es gab gewöhnlich keinen triftigen Anlass für diese Bemerkung. Sie war bei Concetta in den vergangenen Ehejahren zu einer Litanei geworden. Es handelte sich um keine Frage, sondern um eine Feststellung. Als Herrmann sich auf die Terrassenbrüstung lehnte, hatte er die Worte seiner Frau schon vergessen. Er schaute auf die Treppen des Pendino S. Barbara hinunter, fünf Stockwerke unter ihm, wo gerade das Huhn der Bewohnerin des ebenerdigen Wohn- und Schlafzimmers heraus spazierte und nach Krümeln auf den Stufen pickte. Dann blickte er nach rechts auf den Golf von Neapel mit Capri im dunstigen Hintergrund. Die Aussicht war durch die schwarze Wolke getrübt, die auch am Tag nach der Explosion und bis Heiligabend noch über San Giovanni de Teduccio weilte und sich träge Richtung der Insel bewegte.
Als „Herr Mann“ stellte sich der Deutsche gerne selbstironisch vor, manchmal mit einer Entschuldigung für seine Initialen HH. Er sei 1935 zur Welt gekommen und sein Vater ein überzeugter Nazi gewesen. Was in Italien meist mit einem verständnisvollen Nicken beantwortet wurde, denn wer hatte nicht einen Faschisten in der Familie gehabt oder hatte gar wieder einen. Concetta, damals seine Verlobte, hatte ihn verständnislos auf diese Bemerkung hin angesehen. Was interessierte sie die Politik, wenn es ums Heiraten ging.
Als Herrmann dann überraschend schnell als junger Vater zum Universitätsprofessor für Philosophiegeschichte ernannt worden war, wurde Concettas rhetorische Frage zur stehenden Wendung. Intelligent musste er ja als Philosophieprofessor sein. Auch spielte er Schach und sprach sogar Deutsch neben seinem anfangs holprigen Italienisch. Aber dass einer so intelligent und zugleich so „fesso“ sein konnte, so naiv, beschränkt, begriffsstutzig, auf den Kopf gefallen, dumm...! Jeder neapolitanische Straßenjunge war da mit fünf Jahren gescheiter, gewitzter, schlagfertiger, lebensgewandter... – eben „furbo“. Hermann war rasch klar geworden, dass er in den Augen seiner lieben Neapolitaner und Neapolitanerinnen der sympathische Deutsche war und zugleich „il fesso“ blieb. Ja, der Philosophieprofessor war eben der tumbe Deutsche. Natürlich sagten die Einheimischen es dem freundlichen Nachbarn, dem Verwandten, dem hilfsbereiten Hochschullehrer und Kollegen nicht ins Gesicht wie Concetta. Seine Frau meinte es ja auch nicht böse, sondern liebevoll, mit gespielter Verzweiflung, schicksalsergeben. Vermutlich wäre sie nicht zufriedener gewesen, wenn ihr Mann wirklich neapolitanischer geworden wäre, auch wenn sie immer wieder seufzend diesen Wunsch äußerte. Es war eine Neckerei geworden, und die mit beiden Füßen auf dieser neapolitanischen Erde stehende Concetta wusste, dass sie ihren Deutschen nicht überfordern durfte und verschwieg ihm manches. Leider nicht nur Alltagsgeplänkel, wie sich herausstellen sollte.
Herrmann war anfangs leicht beleidigt gewesen über seinen Status als „fesso“, kokettierte im Laufe der Zeit dann aber mit dieser Rolle und spielte diese Karte zuweilen bewusst aus. Aber wenn der Ehemann dann wieder einmal richtig Deutsch reagierte und Concetta gut aufgelegt war, was meistens der Fall war, sagte sie zu ihrer Tochter:
„Dein Vater ist halt Philosoph.“
Und dann erzählte die Mutter der Tochter eine Geschichte, die ihr ihr Mann selbst einmal erzählt hatte, nämlich die Geschichte von der erdverbundenen thrakischen Magd, die den Philosophen Thales auslachte, weil der, während er zu den Sternen hinaufblickte, in eine Grube fiel, oder war es ein Brunnen, egal, der Sternengucker wusste nicht fest auf der Erde zu gehen.
„Aber“, sagte die damals achtjährige Imma, „dieser Thales hat wundervolle Sterne gesehen, diese Magd aber nur Jauche oder so.“
„Brava, Imma, brava“, mischte sich da ihr Vater ein. „Aus dir kann noch eine tüchtige Philosophin werden.“
„Santa Lucia“, rief Concetta, „zwei Philosophen in der Familie! Wer könnte das aushalten?“
„Ein Philosoph wie du, Papa?“