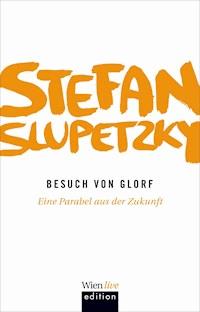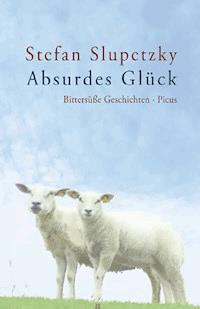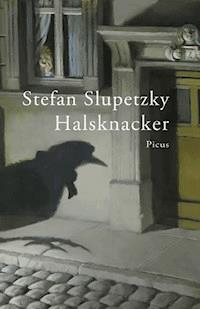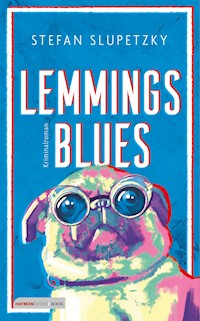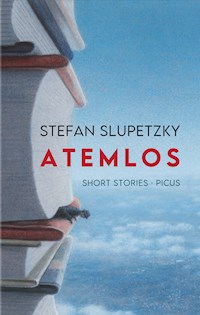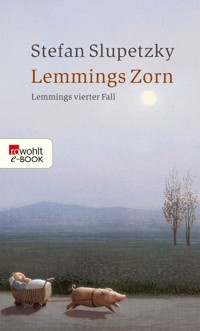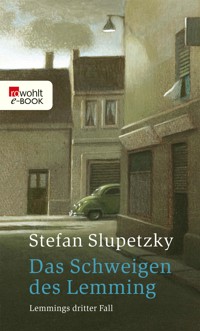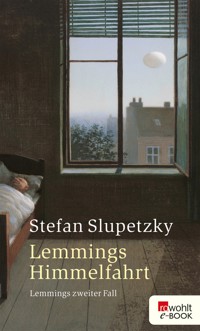15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über Tote, heißt es, soll man nichts als Gutes sagen. Stefan Slupetzkys pointierte und hintergründige fiktive Grabreden erzählen ebenso viel über die Verstorbenen wie über die Redner selbst. Grabreden sind eine literarisch vernachlässigte Kurzform des biografischen Erzählens. Stefan Slupetzky lässt in seinen Miniaturen seine Grabredner und Grabrednerinnen stets nicht nur über die Toten, sondern auch über sich selbst erzählen, über Versäumnisse und Sinn des eigenen Lebens: Der Chef eines tüchtigen Mitarbeiters muss erkennen, dass es über den Toten schier gar nichts zu sagen gibt, eine Grabrede für einen verstorbenen Grabredner, ein Stand-up-Comedian, der dem Toten die Pointen neidet, ein Interessensvertreter, der den Anlass zu einer politischen Ansprache nutzt oder ein Geistlicher, der in der Trauerrede die Identität eines Mädchenmörders enthüllt.Stefan Slupeztky findet das Komische im Tragischen und zaubert Leserinnen und Lesern ein Schmunzeln ins Gesicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Gefördert von der Stadt Wien Kultur.
Copyright © 2021 Picus Verlag Ges.m.b.H., WienAlle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, Wien
Umschlagabbildung: © VikiVector/iStockphoto
ISBN 978-3-7117-2111-2
eISBN 978-3-7117-5453-0
Informationen über das aktuelle Programm des Picus Verlags und Veranstaltungen unter
www.picus.at
Stefan Slupetzky, Schriftsteller, Musiker und Zeichner, wurde 1962 in Wien geboren. Zwischen 1994 und 2000 schrieb und illustrierte er mehr als ein Dutzend Kinder- und Jugendbücher, für die er zahlreiche Preise erhielt. Seither verfasst er Romane, Kurzgeschichten, Theaterstücke und Liedtexte. Im Picus Verlag erschienen seine Erzählbände »Absurdes Glück« und »Halsknacker«, das Kinderbuch »Pauls Reise« (2013), die Lesereise Mauritius (2016) sowie der Erzählband »Atemlos« (2020). Stefan Slupetzky war für seinen Roman »Im Netz des Lemming« für den Friedrich-Glauser-Preis 2021 nominiert.www.stefanslupetzky.at
Stefan Slupetzky
Nichts als Gutes
Grabreden
Picus Verlag Wien
Inhalt
Sprachlos
Mustermann
Marketing
Madame Jaquespierre
Stand up
Blutsbrüder
Superspreader
Geehrter Kollege
Besuch im All
Traumscham
Alles verschlissen
Nachlassen
Losgesprochen
Jongleur
Im Mittelmeer
Aus aller Welt
Die große Null
Der Mond ist längst betreten und die Erde längst erforscht. Die Meere und die Kontinente sind vermessen, Fauna, Flora, Minerale und Metalle, unbelebte und organische Substanzen bis ins Kleinste exploriert und katalogisiert. In einen flirrenden Kokon aus Satelliten eingewoben, können wir per Street View durch Tasmanien trampen und mit einem Knopfdruck nach Spitzbergen reisen. Unsere Welt hat keinen Arsch mehr, ihre Karte keinen weißen Fleck. Sie ist ein abgewohntes Haus, ein kahler Baum, ein braches Feld, eine geplünderte, minuziös geleerte Vorratskammer unserer Fantasien. Als Projektionsfläche für unsere Neugier bieten wir uns allenfalls noch selbst an, unsere geistigen Mount Everests und seelischen Marianengräben.
Sind aber die großen Abenteuer, die Christoph Kolumbus und Neil Armstrong noch erleben durften, wirklich endgültig Geschichte? Gibt es wirklich keine neue Welt mehr, die sich noch entdecken lässt?
Im Gegenteil. Natürlich gibt es sie, diese Terra incognita. Sie ist kein Wunschziel, und doch werden wir sie alle ausnahmslos bereisen. Der Termin des Aufbruchs ist zwar ungewiss, aber der Reiseleiter wartet schon. Er lauert an der nächsten Straßenecke, im Operationssaal oder auch daheim im Bett. Und eines Tages, meistens völlig überraschend, nimmt er einen an der Hand und startet die Expedition.
Wie seltsam, dass wir nichts über den Kosmos wissen, dem wir Tag für Tag entgegenaltern, obwohl doch alle Menschen, Tiere, Pflanzen, alle Lebewesen, die je existiert haben, dorthin gegangen sind.
Weil aber keiner je zurückgekommen ist, fehlen uns die Landkarten und Tourguides, die Hoteltipps, Fahrpläne und Handyvideos. Per Street View durch das Jenseits, ja, das wäre was – und wenn auch nur ein interessanter Buchtitel.
Natürlich gibt es Unmengen an Hypothesen, die sich mit dem Leben nach dem Tod beschäftigen. Mit einem Dasein also, dessen vorrangige Eigenschaft das Fortsein ist. Fast alle diese Theorien haben ihren Ursprung in der Religion, sodass ihre Beweiskraft etwa der des Glaubens an Vampire, Feen und Einhörner entspricht. Ob wir wohl in Walhall an Odins Tafel Wildschwein essen werden oder mit dem lieben Gott auf einer Wolke sitzen und dem Harfenspiel der Engel lauschen? Ob die Männer unter uns im Paradies mit zweiundsiebzig Jungfrauen kuscheln werden (die sich jeden Morgen runderneuern), während sich die Frauen unter uns damit zufriedengeben werden müssen, einen ausgelaugten Mann mit einundsiebzig anderen Frauen zu teilen? Ob wir als Napoleon, Gandhi oder – Gott behüte – als wir selbst wiedergeboren werden?
All das können wir natürlich glauben, aber wissen können wir es nicht.
Genauso wenig können wir nun aber wissen, dass nach unserem Tod nichts von uns übrig bleibt als Fleisch und Knochen, Plomben und Titangelenke. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts legte der amerikanische Arzt Duncan MacDougall Sterbende auf eine Waage und bezifferte ihren Gewichtsverlust im Augenblick des Todes mit durchschnittlich einundzwanzig Gramm. Dagegen stellte er bei fünfzehn Hunden, die er anschließend vergiftete und auf der Präzisionswaage verenden ließ, keine Gewichtsabnahme fest, woraus er schloss, dass Hunde keine Seele haben. Falls MacDougall eine solche hatte, muss sie wohl ein ziemlich düsteres Gewächs gewesen sein – so düster und verworren wie seine Annahme, man könne Seelen abwiegen. Als würde ein Gehirnchirurg in einem aufgesägten Schädel nach Gedanken stöbern oder ein Kardiologe in den Herzen seiner Patienten nach der Liebe suchen.
Tatsache ist, dass wir unseren Körper nach Verwendung wieder an die Erde retournieren. Ein Vorgang, der an Autowracks erinnert, die im Zuge des Recycling ausgeschlachtet und zu gleichförmigen Schrottquadern gepresst werden. Egal ob Lada oder BMW: Im Tod werden sie alle gleich, als Individuen haben sie ausgedient. Nur, was ist mit den Individuen, von denen sie gesteuert wurden? Was ist mit den Fahrern? Vielleicht sitzen die ja mittlerweile schon hinter dem Lenkrad eines neuen Wagens. Vielleicht haben sie den Pilotenschein gemacht und jetten durch die Welt, oder sie haben sich eine Jahreskarte für die Straßenbahn gekauft. Auch wenn der eine oder andere mit seinem Auto mitgestorben sein mag, dürften doch die meisten weiterleben.
Wieder eine Sackgasse auf unserer Suche nach der Seele. Gut, versuchen wir es anders: 1842 formulierte der Heilbronner Mediziner Julius Robert Mayer erstmals eine physikalische Maxime, die der Physiker und Physiologe Hermann Helmholtz fünf Jahre danach bestätigte: den Energieerhaltungssatz. Dieses bis heute unbestrittene Prinzip besagt nichts anderes, als dass sich Energie weder erzeugen noch vernichten lässt. Sie kann zwar umgewandelt werden (etwa Licht in Wärme, Wärme in Bewegung), aber es ist schlicht unmöglich, dass sie sich in nichts auflöst.
Man fragt sich also (und ich denke, diese Frage sollte sich auch ein Agnostiker gestatten dürfen): Wohin geht die Energie des Menschen im Moment des Todes? Sein Temperament und seine Ausstrahlung, sein unverwechselbarer, spürbarer Charakter, dieses Kraftfeld, das ihn eben noch umgeben hat? Wohin geht seine Lebensenergie, wenn sie doch nicht verloren gehen kann?
Es ist zumindest ein Indiz, das uns die klassische Physik hier liefert, eine Anregung, die Julius Robert Mayer mit den folgenden Gedichtzeilen auf den Punkt bringt:
Es bleiben erhalten
Des Weltalls Gewalten,
Die Form nur vergeht,
Das Wesen besteht.
Was meinen nun aber moderne Physiker dazu? Wie antworten die Quantenkoryphäen und Raumzeitpioniere auf die Frage nach der Seele und dem Jenseits?
Anscheinend schlägt die quantenmechanische Erkenntnis der Verschränkung, also der über beliebige Entfernungen bestehenden Verkettung kleinster Energieeinheiten für so manchen dieser Wissenschaftler eine Brücke hin zum Metaphysischen, wenn nicht zum Esoterischen. Max Planck, der Wegbereiter der modernen theoretischen Physik, beschrieb die Wissenschaft sogar als Pfad zu Gott, denn für den Wissenschaftler stehe Gott laut Planck »am Ende aller Überlegungen«. Und der Nobelpreisträger Werner Heisenberg, der die Quantenmechanik erstmals mathematisch formulierte, bezeichnete die cartesianische Trennung zwischen Materie und Geist, zwischen Körper und Seele als gefährliche philosophische Vereinfachung. Der Quantenphysiker und Schüler Heisenbergs Hans-Peter Dürr war schließlich davon überzeugt, dass allem Lebenden und Toten ein universeller Quantencode zugrunde liege, dem der ganze Kosmos seit dem Urknall folge. Unsere Existenz, so meinte Dürr, sei mit dem Tode nicht zu Ende: »Was wir Diesseits nennen, ist im Grunde die Schlacke, die Materie, also das, was greifbar ist. Das Jenseits ist alles Übrige, die umfassende Wirklichkeit, das viel Größere. Insofern ist unser gegenwärtiges Leben bereits vom Jenseits umfangen.«
Schluss mit Theorien und Hypothesen. Was wir wissen, ist, dass wir nichts wissen, aber denken, ergo sind. Bleibt einzig die Erkenntnis, dass der Mensch, seit es ihn gibt, nicht nur darüber nachgrübelt, womit er sich den Magen füllen und mit wem er sich paaren sollte, sondern auch darüber, wo er hergekommen ist und wo er hingehen wird. Und dass sein Dasein deshalb zwei Momente mit sich bringt, die denkwürdiger sind als alle anderen: den Augenblick der Ankunft und den Augenblick des Abschieds. Es sind die zwei Schnittstellen seines Lebens, die zwei Buchdeckel, zwischen denen seine Geschichte klemmt.
Der vordere Deckel pflegt nicht viel darüber zu verraten, was im Inneren des Buchs geschehen wird. Er trägt in der Regel nur den Titel und den Namen des Verfassers, meistens auch den des Verlags, in dem das Buch erschienen ist. Er ist gewissermaßen die Geburtsurkunde, auf der wir zwar lesen können, wie das Neugeborene und seine Eltern heißen und in welchem Krankenhaus es auf die Welt gekommen ist, die aber nicht verrät, was ihm das Leben bringen wird.
Die Quintessenz dagegen finden wir auf dem hinteren Deckel. Hier erwartet uns eine Zusammenfassung, eine Rückschau auf die Hauptfiguren und die Handlung, hier finden sich auch Interpretationen oder Rezensionen, selbstverständlich so gewählt, dass sie ein möglichst vorteilhaftes Bild vermitteln. Insofern ähnelt der hintere Deckel einem Nachruf oder einer Grabrede: Über die Toten soll man ja, so haben es nicht nur die Lateiner unter uns gelernt, ausschließlich Gutes sagen.
Totenreden sind gleichsam des Lebens Klappentexte. Aber oft genug sind sie auch mehr als das: Wenn sie sich nicht auf halbherzige Lobgesänge und beschönigende Litaneien beschränken, können sie ein substanzielles Stück der Welt enthüllen. Sie können uns erschüttern, uns empören, uns staunen, weinen, lachen machen. Denn wer eine solche Rede halten muss, befindet sich, sofern er kein professioneller Trauerredner ist, in einer Ausnahmesituation. Normalerweise zählt er zum Bekannten-, Freundes- oder auch Verwandtenkreis des oder der Verstorbenen, und vor den anderen Angehörigen trägt er nun die Verantwortung, den Spuren, die der Tote hinterlassen hat, gewissenhaft zu folgen und die Karte seiner Lebensreise nachzuzeichnen. Dafür stehen dem Redner meistens nur ein paar Minuten zur Verfügung, eine denkbar kurze Zeit, besonders angesichts der Tatsache, dass er nur diese eine Chance hat: Was jetzt nicht ausgesprochen wird, das bleibt für immer ungesagt.
Zu allem Überfluss gilt für den Trauerredner auch noch das Gebot der Ehrlichkeit. Als Navigator durch ein Meer der aufgewühlten Herzen darf er sich nicht mit Gemeinplätzen zufriedengeben. Er muss – und das ist wohl das Schwierigste – sein eigenes Herz so weit wie möglich öffnen. Wenn ihm das gelingt, spiegelt das Leben sich im Tod so plastisch wider, dass das Spiegelbild lebendiger wirkt als das Leben selbst. Dann führt der Redner uns nicht nur durch Höhen und Tiefen, himmlische und höllische Momente eines Menschenlebens, sondern auch durch leise und poetische. Es sind ja letztlich nur zwei Dinge, die wir auf der Erde hinterlassen, wenn wir uns verabschieden: Geschichten und Gefühle. Vielleicht waren wir ja nie mehr als das. Vielleicht ist das unsere Seele.
Was kann sich ein Schriftsteller mehr wünschen, als die Ernte aus einem so fruchtbaren Garten einzufahren, aus einem Garten, in dem neben den Geschichten der Verstorbenen auch die Gefühle derer sprießen, die an ihrem Grab das Wort ergreifen?
Erntezeit. Ich wünsche Ihnen Lachen, Weinen, Staunen mit der vorliegenden Sammlung – wohlgemerkt fiktiver – Grabreden.
Sprachlos
Ich hatte einen zugegeben etwas boshaften Gedanken: Was, wenn es der Trauerredner selbst ist, der begraben wird, und wenn sein Chef, der Leiter des Bestattungsinstituts, die Abschiedsworte sprechen muss? Vielleicht, so dachte ich, steht dieser arme Mann dann vor dem Sarg und stammelt hilflos vor sich hin: ein Vorgesetzter, der dem toten Untergebenen nicht das Wasser reichen kann. Er hat nichts vorbereitet, steht mit leeren Händen da, vertraut auf eine momentane Eingebung – und dann fehlen ihm die Worte.
Aber nach den ersten Zeilen stellte sich heraus, dass die Figur des Redners anderes im Sinn hatte als ich, der Autor. Von seinen Erinnerungen an den Toten überwältigt, breitete er plötzlich eine sehr persönliche Geschichte aus, mit der weder die Zuhörer noch ich gerechnet hätten. Meine Aufgabe erschöpfte sich darin, sie staunend mitzuschreiben.
GRABREDE FÜR DEN GRABREDNER GUSTAV STEINBERG (1980–2018)
gehalten vom Besitzer des Bestattungsinstituts Cum Angelis, Bernd Molterer
Sehr geehrte, liebe Trauernde, Sie müssen mir verzeihen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der Gustl, also Gustav Steinberg, war so jung. Er ist so plötzlich … also es hat ihn so plötzlich von uns fortgerissen. Es. Der Tod.
Dieser verdammte Tod. Das sage ich, obwohl er ja die Lebensgrundlage für meine Firma ist. Obwohl er meine Kinder, meine Frau und mich ernährt. Es ist schon angebracht, könnte man sagen, dass das Leben auch sein Ende hat. Die Dinge wandeln sich in einem fort: der Stein zum Sand, der Trieb zum Baum, das Ei zum Huhn. Der Mensch entsteht und geht. Das ist schon angebracht. Die Zeit hat ihren Zahn, und dieser Zahn nagt an uns allen.
Aber der Gustl?
Er war achtunddreißig! Bitte seien Sie mir nicht böse, aber das ist eine Schweinerei. Und seien Sie mir gleich noch einmal nicht böse, weil ich, also weil ich kein geübter Trauerredner bin. Es ist ja eigentlich der Gustl, der statt mir hier stehen sollte, das war sein Beruf. Nein, es war mehr als sein Beruf, es war seine Berufung. Er hat bei Cum Angelis, also in unserem Institut, so viele Menschen in den Tod begleitet. Also nicht direkt begleitet, sondern … Na, Sie wissen schon, wie ich es meine. Er hat sich hineinversetzt in unsere Toten, in ihr Leben, aber auch in ihre Lieben. In die Hinterbliebenen.
Und heute sind wir selbst die Hinterbliebenen. Seine Geschwister und Kollegen, seine Freunde, seine Angehörigen und … ich. Und weil bei einem Abschied irgendjemand etwas sagen muss, und weil die meisten Anwesenden zu erschüttert sind für eine Trauerrede, und weil ich als Chef die Arschkarte, also, verzeihen Sie, den schwarzen Peter zugespielt bekommen habe, stehe ich jetzt hier. Als wäre ich in erster Linie Chef und erst in zweiter Mensch. Als wäre ich nicht auch erschüttert.
Wenn Sie wüssten …
Wenn Sie wüssten, dass ich ihn, den Gustl, seit fast zwanzig Jahren kenne. Dass wir uns in unserer Studienzeit begegnet sind. Ich habe so wie er Philosophie studiert, gegen den Willen meines Vaters, der mich lieber an der Wirtschaftsuniversität gesehen hätte. Seine Firma habe ich nach seiner Pensionierung trotzdem übernommen, und so arbeite ich jetzt schon seit acht Jahren, wie es der Gustl einmal ausgedrückt hat, in der Landwirtschaft, im Totenackerbau. Man kann das philosophisch konnotieren, aber nur mit sehr viel gutem Willen. Beim Gustl selber war das anders, er war bis zum Schluss ein Philosoph: als Mensch, als Trauerredner und als Freund.
Er war kein leichter Mensch. Nicht leicht im Inneren und auch nicht leicht nach außen hin. Er hat es manchmal, wie er selbst gesagt hat, kaum ertragen, einer Spezies anzugehören, die ständig ihre primitivsten Eigenschaften auf den grell erleuchteten Seziertisch legt, um sie zu obduzieren, zu taxieren und zu katalogisieren. Die jedes Augenzwinkern, jeden Atemzug und jeden Furz nach ökonomischfunktionellen und – noch viel schlimmer – nach moralischen Gesichtspunkten bewerten muss. Und dann hat er gelacht, der Gustl, und gemeint, dass er mit seiner ablehnenden Wertung dieses zwanghaften Bewertungswahns ja selbst genau das Gleiche macht.
Sie merken schon, ich rede um den heißen Brei. Ich muss ja reden. Deshalb muss ich auch versuchen, die Erschütterung in den Griff zu kriegen, weil sie mich sonst sprachlos macht. Ich muss meine Erschütterung mit Worten abfedern, so wie ein Architekt die Häuser abfedert, die er in erdbebengefährdeten Gebieten baut.
Mein Haus droht einzustürzen, seit der Gustl tot ist.
Nicht, dass wir einander damals schon, während des Studiums, sehr nah gewesen wären. Im Gegenteil, wir sind einander aus dem Weg gegangen, haben einander regelrecht gemieden, so als hätten wir eine Gefahr gewittert, ein diffuses Unheil, das vom jeweils anderen ausgeht. Und so haben sich unsere Wege nach der Universitätszeit dann auch rasch und vollkommen getrennt.
Bis vor acht Jahren. Kurz nachdem ich den Betrieb von meinem Vater übernommen habe, ist der Gustl im Empfangsraum von Cum Angelis gestanden. Meine Frau, die Vera, die ja heute auch unter den Trauergästen ist, war damals mit dabei. Kannst du dich noch erinnern, wie er ausgeschaut hat vor acht Jahren, der Gustl? Abgezehrt und blass ist er gewesen, so wie man sich einen Philosophen vorstellt. Einen Menschen, der über das Leben nachgrübelt, statt es zu meistern. Einen Restaurantkritiker, der so lang auf seinen Teller starrt, bis er verhungert.