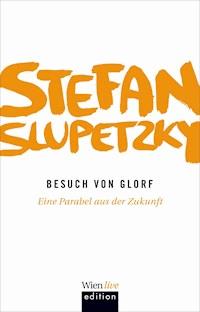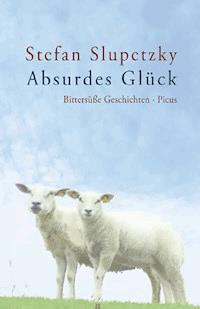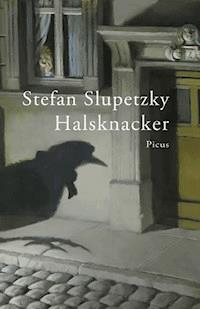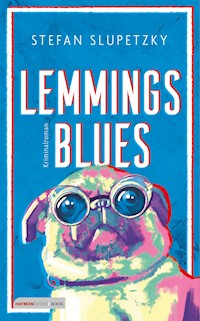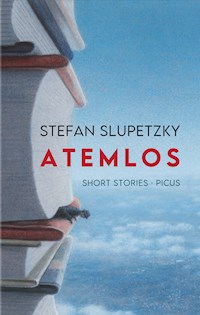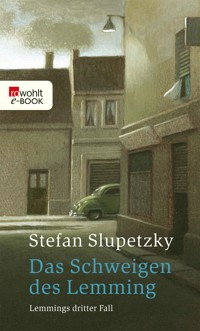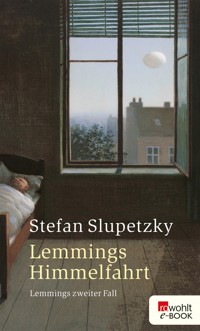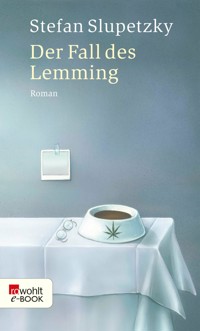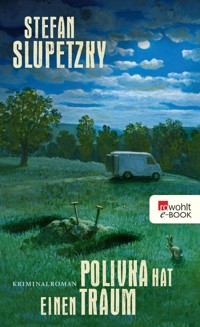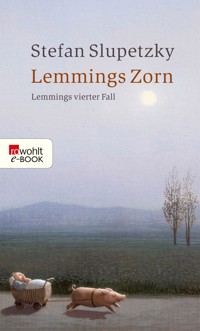
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Privatdetektiv Lemming ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein Engel wird zum Todesboten. An einem Maitag spaziert der Lemming mit seiner hochschwangeren Klara durch die Straßen Wiens. Plötzlich setzen die Wehen ein, viel zu rasch, um noch das Krankenhaus zu erreichen. Da taucht wie vom Himmel gesandt eine fremde Frau auf und hilft bei der Geburt. Nach diesem Erlebnis wird Angela zur besten Freundin der Familie. Bis zum Weihnachtsabend, an dem der Lemming ihr kurzzeitig seinen Sohn anvertraut und daraufhin eine grausame Entdeckung macht ... «Mochten Sie den österreichischen Kommissar Kottan? Und Falco? Dann mögen Sie auch dieses Buch. Weil der Lemming so sympathisch ist. Und der Krotznig so böse. Und die Geschichte so fabelhaft.» («Stern» über «Der Fall des Lemming») «Ein funkelndes, sprachlich meisterhaftes Stück reinster Weltekel-Prosa, verpackt mit der Zärtlichkeit dessen, der noch in der Lage ist, eine bessere, eine gerechtere Welt zu ersehnen. Ein wahres Glück, solch ein Krimi.» (Hessischer Rundfunk über «Lemmings Himmelfahrt») «Der bisher beste Fall des Lemming. Dabei waren schon die ersten zwei nicht ohne.» («Kurier» über «Das Schweigen des Lemming»)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Stefan Slupetzky
Lemmings Zorn
Lemmings vierter Fall
Nein, nein, ich höre
Nicht länger von ferne
Den Lärm mit Geduld.
Johann Wolfgang von Goethe
Meinen Kindern Fanny und Samuel
1
Geboren werden ist wie in Rente gehen. Man leert den Schreibtisch und räumt das Büro. Man händigt dem Portier die Schlüssel aus, verlässt zum letzten Mal die Firma und bricht in eine ungewisse Zukunft auf. Es wird schwierig sein, sich in sein neues Leben hineinzufinden. Mit jedem Schritt aber, den man tiefer in dieses neue Leben macht, vergisst man das alte: Noch ehe man gelernt hat, aus einer Schnabeltasse zu trinken, ist alles Vergangene ausgelöscht.
Geboren werden heißt, den Sinn für die Einheit der Welt zu verlieren. Um jede Erinnerung an ein Vorher zu tilgen, hat die Natur eine Schleuse eingerichtet, in der man neun Monate lang verharren muss, ehe man in die materielle Welt entlassen wird. Diese Wartezeit verstreicht nicht ungenutzt, sie dient der Auslöschung unserer kosmischen Software. Im Umerziehungslager Mutterbauch werden die Festplatten neu bespielt; hier lernt man alles, was man braucht, um sich als stoffliches Einzelwesen gegen andere zu behaupten. Die Sinne spalten sich auf und werden von innen nach außen gestülpt: die Augen, um zu sehen, was man besitzen will, die Ohren, um zu hören, wer es einem streitig macht. Die Nase zum Aufspüren des Feindes, die Hände zum Töten, der Mund zum Zerfleischen.
Die Geburt eines Kindes ist also ein großes Vergessen: Was immer davor war, es zählt nicht mehr. Und das gilt ganz besonders für die Eltern, da können sie noch so geplant und getüftelt, phantasiert und orakelt haben. Kein Luftschloss hält den Urgewalten stand, die drei Kilo Mensch in ihr Leben bringen, kein vorab ersonnener Zeitplan und kein liebevoll möbliertes Kinderzimmer. Eine Spieluhr, die Vivaldi spielt? Das Kind wird Mozart hören wollen. Wiege, Stubenwagen, Babykorb? Das Kind wird im Ehebett liegen. Rosa Tapeten? Das Kind wird ein Bub sein. Ganz abgesehen davon, dass es sein eigenes Zimmer – egal, wie es gestaltet ist – mit ähnlichem Enthusiasmus bewohnen wird wie Hannibal Lecter sein panzerverglastes Verlies.
«Wart einmal, Poldi…» Klara greift nach dem Arm des Lemming und verlangsamt ihre Schritte. «Wart kurz…» Sie bleibt stehen, senkt den Kopf. Lauscht tief in sich hinein. Unfassbar schön ist sie, denkt – wie so oft in letzter Zeit – der Lemming. Schön sind die ruhigen, leuchtenden Augen, schön auch die prallen Brüste über dem mächtig gerundeten Bauch. Schön ist das ganze blühende, duftende, vollreife Weib. Sogar der etwas entenhafte Gang, mit dem sie die Last zweier Körper trägt, ist wunderschön. Das Herz des Lemming schlägt höher, wie das eines Kindes, dem vom festlichen Gabentisch her ein verheißungsvolles Paket entgegenlacht.
«Nein, es war nichts.» Klara schüttelt den Kopf. «Nur so ein Ziehen: Senkwehen, du weißt schon.»
Selbstverständlich weiß der Lemming, was Senkwehen sind. In den vergangenen Monaten hat er ein halbes geburtsmedizinisches Studium absolviert. Mit Austreibungsphasen und Steißlagen, Spinal- und Periduralanästhesien, Kardiotokographien und vorzeitigen Blasensprüngen ist er auf Du und Du. Auch sein Geschick bei der Handhabung unverzichtbarer Accessoires wie indischer Tragetücher oder japanischer Fläschchenwärmer hat er perfektioniert. Seine Wickeltechnik ist ebenso unübertroffen wie seine Fertigkeit bei der Zwei-Finger-Bäuchleinmassage. Kurz gesagt: Der Lemming ist bereit. Mehr als bereit. Er fiebert dem Augenblick entgegen, da er all das Gelernte auch anwenden kann. Nicht an einer zerschlissenen Stoffpuppe wie bisher, sondern (bei diesem Gedanken hüpft wieder sein Herz) an seinem eigenen warmen, lebendigen Kind.
Über eines aber ist der Lemming nicht im Bilde, und das ist der Zeitpunkt dieses alles verändernden Augenblicks. Wüsste er, was ihn in Kürze erwartet, er stünde wohl nicht so verträumt auf dem Gehsteig…
«Kommst du?» Klara schenkt ihm ein unergründliches Lächeln und watschelt voraus, die menschenleere Berggasse hinab in die Senke der Rossau.
Ein wunderbar friedlicher Frühlingsmorgen liegt über den Dächern der Stadt. Vom wolkenlosen Himmel strahlt die Sonne und wärmt den – für gewöhnlich mit Autos verbarrikadierten – Asphalt. Gott lacht sich ins Fäustchen, er weiß, warum er den Wienern justament heute ein klassisches Kaiserwetter beschert: Es ist der Erste Mai, und für den alljährlichen Maiaufmarsch der Sozialdemokraten kann es kein schlechteres Wetter geben. Proletarisches Wirgefühl hin oder her: Den arbeitsfreien Tag der Arbeit im sonnigen Grünen zu verbringen, ist nun einmal erbaulicher, als Parolen skandierend den Ring entlangzumarschieren. Nur die armen Parteifunktionäre müssen in Wien bleiben, statt in ihren Datschen und Chalets nach dem Rechten zu sehen. Und auch der Lemming und Klara: Sie müssen in der Wohnung des Lemming nach dem Rechten sehen, statt in Klaras Ottakringer Häuschen zu bleiben.
«Scheiße… Schon wieder…» Klara hält abermals an. Sie schließt die Augen und beugt sich vor. «Ich bin mir… nicht sicher, Poldi, aber… Ich glaub fast, es geht los.»
«Es… Es geht… Was?» Der Lemming erstarrt. Für einen Moment glotzt er Klara verständnislos an, dann aber durchzuckt ihn der Blitz der Erkenntnis. «Mein Gott, wir müssen… Wir müssen sofort in die Klinik!»
«Nicht werd mir gleich panisch», stößt Klara mit gepresster Stimme hervor. «Wir haben doch Zeit.» Sie atmet ein paarmal kräftig durch und richtet sich auf. «Die täten sich schön bedanken im Krankenhaus, wenn ich ihnen bis morgen den Kreißsaal blockier.»
Eröffnungsphase, natürlich, rekapituliert der Lemming. Bis Muttermund und Zervix zur Genüge ausgeweitet sind, dauert es bei erstgebärenden Frauen im Durchschnitt zehn Stunden. Zunächst macht sich der Fötus reisefertig. Er prüft die Lage der Glieder und kontrolliert den Sitz der Nabelschnur. Er rückt den Kopf in Position und legt noch ein Nickerchen ein, bevor er sich gemächlich zur Abschussrampe begibt. Erst, wenn er im Cockpit Platz genommen, sich in den Schalensitz geschmiegt und angeschnallt hat, kann der Countdown – die sogenannte Austreibungsphase – beginnen.
Andererseits: Was zählen schon statistische Mittelwerte? Fühlt man sich durchschnittlich wohl, wenn man oben verbrennt und unten erfriert?
«Ja aber… Was willst du denn sonst tun?»
«Gar nix, mein Lieber. Wir gehen jetzt in aller Ruhe deine Post holen, wie geplant. Und dann schauen wir weiter.» Knapp zweihundert Meter liegen noch zwischen ihnen und der Servitengasse, in der das Wohnhaus des Lemming steht. Zweihundert Meter, für die sie eine gute Stunde brauchen werden.
«Ist dir klar, was das bedeutet?» Der Lemming reißt die Augen auf und starrt auf die Uhr seines Handys, während sich Klara keuchend gegen ein Straßenschild lehnt. «Drei Minuten, verstehst du? Drei Minuten seit der letzten Wehe! Vergiss die Post! Ich ruf jetzt ein Taxi!»
«Ja… Wahrscheinlich hast… du recht…»
Während der Lemming mit fiebrigen Fingern die Nummer in das Telefon tippt, ertönt – ganz leise zunächst, dann immer durchdringender – ein Brummen über den Häusern.
«Taxifunk, grüß Gott», meldet sich eine barsche weibliche Stimme am anderen Ende der Leitung.
«Ja, grüß Sie auch, ich hätt gern…», der Lemming hält sich mit der freien Hand das rechte Ohr zu, «ich hätt gern einen Wagen, und zwar möglichst…», er dreht den Kopf und sieht nach oben, wo gerade ein Hubschrauber über der Dachkante auftaucht. «Möglichst rasch! Verstehen Sie? Können Sie mich… In die Berggasse! Nein, Berg! Berg wie Tal! Verdammt! Der Trampel hat aufg’legt!»
Ein kurzer, hilfloser Blick zu Klara, die in gekrümmter Haltung den Pfosten umklammert, dann wieder zum tiefblauen Himmel hinauf: Wie eine hässliche, stählerne Wolke hängt dort der Helikopter und verwandelt die Straße in eine dröhnende Höllenschlucht.
«Schleich dich!» Mit hektischen Gebärden springt der Lemming hoch, als könne er den Störenfried auf diese Art verscheuchen. «Weg! Verschwind doch! Schleich dich endlich!» Ein eleganter Schlenker, die Maschine dreht ab und gleitet Richtung Rathausplatz. Zitternd vor Wut drückt der Lemming die Wiederwahltaste. Presst den Hörer an sein Ohr und lauscht.
«Scheiße! Besetzt!»
Jetzt ist er es, der durchatmen muss. Verbindung trennen. Wiederwahl. Freizeichen.
«Hallo? Taxi? Hören Sie, es ist wirklich dringend! Ich brauche sofort einen Wagen in die… Wie? Ich kann Sie nicht… Sie können was? Sie können mich nicht… Verflucht!»
Abermals schiebt sich der Hubschrauber über die Häuserzeile. Der Pilot scheint Gefallen am neunten Bezirk gefunden zu haben.
«Maiaufmarsch!» Klara deutet nach oben; mit all ihrer Stimmkraft versucht sie, den Radau zu übertönen. Der Lemming kann trotzdem nur einzelne Wortfetzen hören. «Polizei… Überwachungshub… Ministerium…» Zwar begreift eine ferne, verborgene Kammer seines Gehirns, was Klara ihm sagen will, doch ändert das nichts an der Art der Gedanken, die sein Bewusstsein beherrschen: Mörser! Panzerfaust! Raketenwerfer!
Nichts, hat Stefan Zweig einmal geschrieben, macht einen wütender, als wenn man wehrlos ist gegen etwas, das man nicht fassen kann, gegen das, was von den Menschen kommt und doch nicht von einem einzelnen, dem man an die Gurgel fahren kann. Und so tut er nun etwas, der Lemming, das er Sekunden später schon bereuen wird. Er kann nicht anders, er muss es einfach tun, um nicht auf der Stelle vor Zorn zu zerplatzen. Mit wüstem Kampfgebrüll holt er aus und schleudert dem Feind das Geschoss entgegen – die einzige Waffe, die gerade greifbar ist.
Das Handy steigt hoch, verharrt in der Luft und nähert sich wieder der Erde. Keine fünf Meter entfernt zerschellt es auf dem Straßenpflaster. Der Klang seines Aufpralls ist nur zu erahnen; er wird vom Getöse der wirbelnden Rotorblätter verschluckt. Im selben Moment schwenkt der Helikopter zur Seite und verschwindet in östlicher Richtung.
«Ha!», schreit der Lemming und schüttelt die Fäuste zum Himmel. «Ha…», fügt er etwas leiser hinzu. Dann senkt er langsam den Kopf. Klaras Mobiltelefon, das wird ihm soeben bewusst, liegt draußen in Ottakring. Die Funkwellen, die Strahlung: Als werdende Mutter kann man nicht achtsam genug sein…
«Komm, Poldi…» Klara ist an seine Seite getreten; sie streicht ihm begütigend über den Rücken. «Komm schon, lass uns zum Taxistand gehen.»
Vierzig Minuten und acht Wehen später stehen sie vor der verheißungsvollen gelben Tafel des Standplatzes in der Porzellangasse. Ruhig ist es hier. Eine Taube stelzt gurrend den Rinnstein entlang und sucht nach verlorenen Körnern. Autos, geschweige denn Taxis, sind keine zu sehen.
«Hast du Kleingeld?» Klara zeigt zur anderen Straßenseite, wo – gleich neben der Einmündung in die Servitengasse – ein Telefonhäuschen steht.
Der Lemming kramt in seinen Taschen und schüttelt betreten den Kopf. Er zieht sein Portemonnaie heraus und klappt es auf. «Nur einen Fünfziger.» Ein Königreich für ein Pferd, denkt er im Stillen, zehn Cent für ein Baby…
«Und was sollen wir jetzt tun?», murmelt Klara.
«Also… Wir… Wir machen Folgendes: Ich lauf hinüber in die Wohnung und ruf uns vom Festnetz ein Taxi – nein, besser gleich einen Krankenwagen. Und du… Du wartest hier, es dauert nicht lange…»
«Ich muss aber… sitzen.» Klara wird blass und schnappt nach Luft, aufs Neue von einer Welle des Schmerzes erfasst. «Ich komm… dir nach, so gut ich kann. Vor der Kirche… gibt’s Bänke.»
Der Lemming stürmt los, er hastet über die Kreuzung und biegt in die Servitengasse ein. Keine zehn Sekunden später erreicht er sein Haus am Rande des trauten, von Bäumen umgebenen Kirchenplatzes. Im dritten Stock des zartgelben Hauses ist seine Wohnung, im Vorraum der Wohnung sein treuer, altgedienter Fernsprechapparat…
«Komm schon!» Fieberhaft sucht er den passenden Schlüssel am Bund, rammt ihn ins Schloss und stößt das Haustor auf. An Säcken voll Schutt und Stapeln von Brettern entlang läuft er durchs Vorhaus zum Lift.
«Das gibt’s ja nicht…»
Da ist kein Aufzug mehr. Ein leerer Schacht gähnt ihn an, notdürftig vernagelt mit hölzernen Planken und Plastikplanen. «Die Schweine… Die miesen… Die dreckigen Schweine», stößt der Lemming hervor, während er – immer zwei Stufen auf einmal – die Treppe hinaufkeucht.
Zweieinhalb Jahre dauert der Terror nun an, der sich Dachausbau nennt. Zweieinhalb Jahre, in deren Verlauf das Wort Wohnen zu einer zynischen Karikatur seiner selbst verkommen ist. Wie viele ungezählte Male hat ihn der Lärm aus dem Schlaf gerissen, ihn vom Lesen, vom Essen, vom Denken, vom Sein abgehalten? Wie oft hat er sich auf die Straße geflüchtet, bei jeglichem Wetter aus seinen vier Wänden verjagt wie ein Hund? Einen Winter lang ist er beinahe erstickt – die Arbeiter hatten Gerüste errichtet und alle Fenster luftdicht mit Kunststoff verklebt–, im Sommer darauf beinahe ertrunken – man hatte die Dachhaut entfernt, obwohl die Meteorologen Regen vorhergesagt hatten. Der einzige Grund für die meisten der Wohnparteien, die Stellung zu halten, ist ein Aushang der Hausverwaltung: Der Bauherr und Eigentümer, der das Gebäude vor drei Jahren gekauft hat, sei bereit, für die Instandsetzung der Steigleitungen aufzukommen, so heißt es darin. Ein generöses Angebot, wenn man bedenkt, dass er dazu ohnehin verpflichtet ist. Wie auch immer, manche werden’s wohl nicht mehr erleben: Die alte Schestak aus dem zweiten Stock zum Beispiel, oder der kranke Novotny, der seine Krücken erst kürzlich gegen einen Rollstuhl getauscht hat.
Zweieinhalb Jahre, und jetzt das. Ein Segen nur für den Lemming, dass er Zuflucht bei Klara gefunden hat, und ein noch größerer Segen, dass er sie weiterhin finden wird. Am besten für immer…
Endlich hat er die dritte Etage erreicht, mit brennenden Lungen und rasselndem Atem steht er vor seiner Wohnungstür. Keine Zeit zu verschnaufen: Schon suchen die zitternden Hände das Schlüsselloch, stoßen den Schlüssel hinein.
Er lässt sich nicht drehen.
Der Lemming packt zu, er zerrt und rüttelt und lehnt sich mit vollem Gewicht an die Tür, doch der Schlüssel steckt fest; er rührt sich keinen Millimeter.
«Du verfluchter… Sakra… Hurrns!»
Mit all seiner Kraft versucht der Lemming, das widerspenstige Ding aus dem Schloss zu reißen. Ein trockenes Knacken, er taumelt zurück…
Gut, dass es nur der Schlüssel zum nicht mehr vorhandenen Dachboden war. Schlecht, dass sein abgerissener Bart nun im Wohnungsschloss steckt.
Als der Lemming aus dem Haustor taumelt, ist er vor Verzweiflung den Tränen nah. Er hat sich mehrmals gegen seine Tür geworfen, dann gegen jene der Nachbarn gehämmert – erfolglos. Niemand ist heute daheim, das Haus ist verwaist wie die Straßen: Keine Menschenseele lässt sich blicken. Außer Klara.
Im Schatten einer alten Linde kauert sie auf einer Parkbank, regungslos – nahezu regungslos: Ein leichtes Beben durchläuft ihren Körper, begleitet von einem verhaltenen Wimmern. Der Lemming setzt sich neben sie, umfasst ihre Schultern von hinten und stiert auf die andere Seite des Platzes, zum grünen Portal des Café Kairo hin. Nicht, dass das Kairo am Ersten Mai Ruhetag hätte – genauso wenig wie zu Ostern oder zu Weihnachten–, doch wird es seine Pforten erst in einer halben Stunde öffnen: entschieden zu spät für ein dringendes Telefonat.
«Kommt jetzt wer?» Klara wendet sich um, ihr Gesicht ist fahl und schmerzverzerrt. «Ich glaub, es wär schön langsam an der Zeit – die Fruchtblase ist grad geplatzt…»
Unter der Parkbank hat sich ein kleiner, glitzernder Teich gebildet. Mit nassen Schuhen springt der Lemming auf. Nur wenige Schritte, und er steht vor dem mächtigen Kirchentor, die Arme erhoben wie Moses vor dem Roten Meer.
«Hilfe», brüllt er über den Platz. «Hilfe! Kann mich denn keiner…»
Und da ertönt nun endlich ein Geräusch, das, wenn schon nicht auf menschliches, so doch auf primitives Leben in diesem Winkel der Stadt schließen lässt: Schräg vis-a-vis, zwei Stockwerke über dem Kairo, werden energisch die Fenster geschlossen.
«Hilfe! So helft uns doch jemand! Wir brauchen doch nur…»
Abrupt verstummt der Lemming und wendet sich lauschend nach rechts: Dort, um die Ecke, lässt sich auf einmal ein leises Quietschen und Rumpeln vernehmen: Zweifellos Räder, die über das Kopfsteinpflaster rollen.
«Gott sei’s gedankt…»
Auf der anderen Straßenseite erscheint jetzt ein Rollstuhl, in dem ein zusammengesunkener Mann sitzt. Dahinter – mit hurtigen Schritten – geht eine Nonne. In wehendem, langem Gewand, den Kopf von einem schwarzen Schleier fest umhüllt, so schiebt sie den Rollstuhl den Gehsteig entlang.
«Verzeihen Sie! Schwester! Könnten Sie uns bitte…»
Keine Reaktion. Weder Nonne noch Mann scheinen den Lemming bemerkt zu haben; keiner der beiden wendet den Kopf.
«Hallo! Sind Sie’s, Herr Novotny?»
Natürlich ist er es nicht. Der kranke Nachbar des Lemming ist älter und schmächtiger, und er trägt – im Gegensatz zum regungslosen Mann im Rollstuhl – immer nur Hut, niemals eine blau-gelbe Schirmmütze.
«Schwester! Bitte! Ich brauche Hilfe!»
Die Klosterfrau beschleunigt ihre Schritte, sie verfällt in leichten Trab, um zügig in die Grünentorgasse zu biegen.
«Herrgottsakra! Können S’ mich denn nicht verstehen?»
Wieder läuft der Lemming los, er quert den Platz, bereit, sich der Frau in den Weg zu stellen. Aber auch sie beginnt nun zu laufen: Wie ein archaischer Bauer den Pflug, so stößt sie den Rollstuhl voran. Das Holpern der Räder wird zum Rattern, der Kopf mit der blau-gelben Kappe schlingert haltlos hin und her. Schon hat die eilige Schwester die Hahngasse erreicht; mit wehenden Schößen huscht sie nach links um die Ecke.
Der Lemming bleibt fassungslos stehen.
«Du… Du… beschissene Nonnensau! Du…»
So verlassen die Rossau an diesem Ersten Mai auch sein mag, gottverlassen ist sie nicht: Gleich einer himmlische Drohung beginnen im Kirchturm die Glocken zu läuten; ihr gellender, blecherner Klang verschluckt die Flüche des Lemming. Auch Klara scheint jetzt zu schreien, mit offenem Mund und zusammengekniffenen Lidern kniet sie neben der Parkbank, die Finger in das Holz der Sitzfläche gekrallt. Der Lemming eilt zu ihr und ringt die Hände. Er kann nicht helfen, kann nichts tun, war nie zuvor so niedergeschmettert und aufgewühlt.
Minutenlang schallt das Geläute über den Platz, dann kommen die Glocken langsam zur Ruhe, klingen aus, hallen nach und verstummen endlich vollends.
«Kommen Sie! Schnell!»
Eine Hand auf der Schulter des Lemming. Er zuckt zusammen, wirbelt herum und sieht – kaum kann er es glauben – das Gesicht einer Frau vor sich. Mitte dreißig mag sie sein, auch wenn ihre Augen um einiges älter wirken: Ein fester, entschlossener Blick, gebettet in traurige Falten. Graue Strähnen ziehen sich durch ihr fuchsrotes, halblanges Haar, das von zwei Spangen hinter den Ohren gehalten wird.
«Na kommen Sie schon!»
«Ja aber… Wohin denn?»
«Hauptsache weg von der Straße. Am besten… dort hinein.» Sie deutet zur breiten Fassade gleich neben der Kirche, hinter der sich der Hof des Servitenordens befindet. «Was ist jetzt? Worauf warten Sie?»
Während Klara – auf den Lemming und die unbekannte Frau gestützt – dem hölzernen Tor entgegenwankt, huscht ein flüchtiges Lächeln über ihren Mund. «Ausgerechnet…», seufzt sie leise. «Ausgerechnet ins Kloster…»
2
Hurtig durchquert er den Kreuzgang, mit Schritten, gerade so lang, wie seine enge Soutane es zulässt. In seinen Händen trägt er die Banner der Güte und Herzlichkeit, leuchtend und weiß; meterweit flattern die Flaggen hinter ihm her.
Pater Pius hat in der Eile nichts Besseres gefunden. «Ein weiches, sauberes Tuch, wenn Sie hätten», hat die fuchsrote Frau zu ihm gesagt, «zum Aufbreiten, und nachher dann zum Einwickeln. Wir wollen ja nicht, dass das Butzerl friert auf dem kalten Steinboden.» Also ist der Pater kurz entschlossen zur Toilette neben dem Refektorium gelaufen, um zwei Klosettpapierrollen zu holen. Ein wenig mitgenommen hat ihn die vergangene Viertelstunde schon, den guten alten Pius: Die gepressten Schreie der Gebärenden haben seine Nerven strapaziert, unheimlich, beinahe tierisch sind sie durch die Gänge des Klosters gehallt. Schauriger ist nur die Stille, die jetzt – ganz plötzlich – über dem Hof und den Arkaden liegt.
Halb neun war es, als ihn der ungewohnte Radau aus dem Gebet gerissen hat. Ein weibliches Wimmern und Stöhnen, dazwischen die sonoren Hilferufe eines Mannes. Manchmal, das weiß er genau, ist es dem Herrgott ganz recht, wenn man ihn warten lässt. Beten kann man auch später, helfen womöglich nicht mehr. Also hat der Pater seine Kammer im ersten Stock verlassen, um Nachschau zu halten.
Im hintersten Winkel des sonnendurchfluteten Hofs, im Schatten des offenen Bogengangs hat er sie dann gefunden, die beiden Frauen und den Mann. Unter der großen Vitrine des heiligen Peregrin ist die zur Hälfte entkleidete Schwangere gehockt, zu ihren Füßen, in einer Lache aus blutigem Schleim, kniete die Rothaarige. Nur der Mann ist – regelrecht hysterisch – hin und her gelaufen, um, sobald er den Pater bemerkte, händeringend auf ihn zuzustürzen.
«Pater Pius! Gott sei Dank!»
«Moment einmal… Ich kenn dich doch», hat Pius gemurmelt und nachgedacht. «Du bist doch der… Leopold! Der kleine Leopold Wallisch! Stimmt’s?»
Legendär ist das Gedächtnis des beinahe achtzigjährigen Ordensbruders, und er hat gerade bewiesen, dass Legenden keine Ammenmärchen sind. Sechs Jahre alt war der Lemming, als sich der Pater erstmals seiner angenommen hat – im obligatorischen Religionsunterricht, der den kleinen Besuchern der Volksschule in der Grünentorgasse zuteil wurde. Ein stiller, herzensguter Mann, das ist der schmächtige Pius schon damals gewesen: Grund genug für den Lemming, Freundschaft mit der christlichen Kirche zu schließen. Nicht Grund genug allerdings, diese Freundschaft auch beizubehalten: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und ein Heiliger noch keinen Himmel. Mochte es im Schoß der Kirche auch den gütigsten Menschen der Welt geben, so wusste der Lemming den starren, verknöcherten Dogmen und Riten des Christentums trotzdem nichts abzugewinnen. In der vierten Volksschulklasse, vor gut dreißig Jahren, hat er seine letzte Messe besucht; kurz danach hat er auch Pater Pius aus den Augen verloren.
«Leopold Wallisch, natürlich, ich kann mich erinnern: Ein lieber Bub bist du gewesen, brav, aber aufgeweckt. Ich weiß noch, wie du mich einmal gefragt hast, ob sich der liebe Gott in den Spiegel schauen kann. Aber sag einmal, Leopold, was kann ich tun für dich?»
«Einen Krankenwagen! Wir brauchen sofort…»
«Nur mit der Ruhe», ist dem Lemming da die fuchsrote Frau ins Wort gefallen, ohne sich umzuwenden. «Schauen S’ einmal her: Man kann schon ein Stück vom Kopferl sehen.»
Gleich darauf hat sie den Pater um das Tuch gebeten, und Pius hat sich – sichtlich dankbar – vom Ort des Geschehens entfernt. Der Anblick des behaarten Schoßes, gepaart mit dem Hecheln, dem Schnaufen, dem Schmerzensgebrüll: All das war doch ein bisschen viel für seine Nerven. Auch wenn es (dessen war sich der Pater durchaus bewusst) zu Gottes Schöpfungsplan gehörte, so kann die Schöpfung eben auch ziemlich beängstigend wirken, selbst auf einen alten Ordensbruder, der ja sozusagen höchstpersönlich in der Herstellerfirma beschäftigt ist.
Mit wehenden Fahnen biegt Pater Pius jetzt um die Ecke, aber zu spät: Auf den Boden gebreitet liegt schon das Hemd des Lemming; er selbst sitzt mit nacktem Oberkörper daneben, ein blutiges, zuckendes Bündel in seinen Armen.
«Halleluja…» Pater Pius bleibt ruckartig stehen und lässt die Klosettrollen sinken. «Halleluja», sagt er noch einmal. «Es ist ein Wunder…»
Und es ist auch ein Wunder.
Ein kleines Stück Leben, das – ohne zu wissen, wie ihm geschieht – in einer nie gekannten Dimension erwacht. Das nicht nach Hause kommt, nicht heimkehrt, sondern auf einen gewaltigen, unsagbar fernen Planeten geschleudert wird. Eine Sturzflut fremder Reize bricht mit einem Schlag auf seine verletzlichen Sinne nieder, Gerüche, Geräusche und gleißendes Licht vermengen sich mit dem Gefühl der Kälte auf der bloßen Haut: Zu viele Empfindungen, um sie zu entwirren oder gar ihre Bedeutung zu verstehen. Das kleine Stück Leben ist vollkommen hilflos, es weiß nichts und kann nichts: ein unnützes Sandkorn im Mahlwerk der Welt.
Aber eben doch ein Sandkorn. Die einzige Fähigkeit, die es besitzt, wendet es gnadenlos an: Es bringt das Getriebe des Mahlwerks zum Stocken, wobei es sich einer Methode bedient, die zwar einfach erscheint, aber zweifellos magisch ist: Das kleine Stück Leben ruft Liebe hervor. Pure und bedingungslose, kurz gesagt: vollkommene Liebe.
Es ist tatsächlich ein Wunder.
Der Lemming kriegt schon wieder feuchte Augen. Er blinzelt hinab auf das schrumplige Etwas, das sich – gerade so lang wie sein Unterarm – an seiner Brust räkelt. Die erbsengroßen Zehen, die dünnen, bebenden Glieder am auberginenförmigen Rumpf, der nach wie vor an der weißlichen Nabelschnur hängt. Dann der langgestreckte Schädel, am Scheitel fast kahl, aber von einem blauschwarzen Haarkranz umrahmt. Darunter die samtigen Ohren, deren Ränder sich in Rüschen legen wie die Blätter einer Blüte, die sich erst entfalten muss. Und schließlich das runde Gesicht, ganz zerknautscht von der Reise ins Licht. Große, dunkle Augen sehen den Lemming an.
«Sag, Poldi… Was haben wir eigentlich?»
Klaras Stimme klingt müde und weich. Sie lehnt an der Wand, mit geschlossenen Lidern, und lächelt. Der Lemming rückt näher und schmiegt sich an sie.
«Wenn’s ein Mädchen ist, dann hat es ziemlich große Eier», meint er leise.
In der Zwischenzeit hat sich die fuchsrote Frau die Spangen aus ihren Haaren gezogen. Sie beugt sich über den Säugling, dessen winzige Finger sich fest in den Brustpelz des Lemming krallen, und heftet die zwei Klammern an die Nabelschnur. Dann zieht sie eine handliche Küchenschere aus ihrer Jackentasche.
«Wollen Sie das machen?»
Zaudernd greift der Lemming zu, und ebenso zögerlich setzt er die Schere an.
«Worauf warten Sie noch?»
Ein Schnitt nur. Er kappt das zähe Gewebe, zerschneidet das Band, trennt endgültig Mutter von Kind. Und als wäre der Kleine sich dessen bewusst, dass seine Versorgungsleitung nun endgültig stillgelegt ist, saugt er sich schmatzend an der rechten Brustwarze des Lemming fest.
Pater Pius ist leise näher getreten und hat die Papierrollen auf den Boden gelegt. Er steht jetzt mit ausgebreiteten Armen da und strahlt von einem Ohr zum anderen. «Ich wünsch euch von Herzen das Beste, Leopold. Alles Gute, Frau Wallisch. Und dir, kleiner Mann», der Pater beugt sich vor und hält die Hand über den Kopf des Säuglings, «ein langes und erfülltes Leben in Christo…»
«Danke, Pater. Haben Sie vielen Dank», gibt Klara schmunzelnd zurück. «Nur: Frau Wallisch bin ich trotzdem keine. Mein Name ist Breitner, Klara Breitner. Weil der Poldi und ich, wir sind nicht verheiratet.»
«Nicht?» Pius richtet sich auf und mustert das frischgebackene Elternpaar mit traurigen Blicken. «Na ja», meint er dann wieder fröhlicher, «vielleicht muss man nicht alles der Reihe nach machen, solang etwas Gutes herauskommt dabei… Und wegen der Taufe: Wenn ihr wollt, kann ich den Kleinen gleich…» Er hält inne, legt die Stirn in Falten und dreht lauschend den Kopf zur Seite: Durch das Eingangstor am anderen Ende der Arkaden dringt – noch leise, aber klar vernehmbar – der Klang eines Folgetonhorns.
Irgendjemand hat die Rettung gerufen. Eine Rettung in mehrfacher Hinsicht: Zum einen enthebt sie den Lemming der peinlichen Pflicht, dem alten Pater zu gestehen, dass sein Sohn als Heide aufwachsen wird, zum anderen bedarf Klaras geschundener Schoß der medizinischen Versorgung. Schließlich sprengt der Vorgang der Geburt nicht nur die Grenzen der Vorstellungskraft. «Wie ein Kamel, das durch ein Nadelöhr geht», so hat es Klara einmal ausgedrückt. Dem Lemming hingegen war dieser Vergleich nicht blumig genug. «Ich hätte keine ruhige Nacht mehr», hat er mitfühlend geantwortet, «wenn ich wüsste, dass ich schon bald eine Kokosnuss scheißen muss…»
Es gibt also doch noch gute Geister hinter den verschlossenen Fenstern der Rossau. Ganz abgesehen von Pater Pius, der sich nun wieder umdreht und loseilt – nicht, um noch rasch geweihtes Wasser für die Taufe zu holen, sondern um die Sanitäter zu empfangen.
Und ganz abgesehen natürlich von der fuchsroten Frau, die wohl von allen guten Geistern der beste ist.
«Wie können wir Ihnen nur danken?», fragt Klara. «Wie heißen Sie eigentlich?», fügt sie hinzu.
Zum ersten Mal zieht jetzt ein Lächeln über das schmale Gesicht der Frau. «Angela», antwortet sie, «Angela Lehner. Und wenn Sie mir danken wollen, dann…» Sie verstummt und schüttelt errötend den Kopf.
«Angela, das bedeutet doch Engel», meint der Lemming sanft. «Also sagen Sie schon: So schlimm kann der Wunsch eines Engels gar nicht sein.»
«Ich… Ich würde gern… ab und zu wissen, wie es dem Kleinen so geht. Ihn vielleicht manchmal besuchen dürfen. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich will mich nicht aufdrängen, und… Ich bin auch keine von diesen, Sie wissen schon, diesen Verrückten, die anderer Leute Kinder entführen. Es ist nur, wie soll ich sagen… Dieses Maiwunder hat mich wohl auch ein bisschen mitgenommen…»
«Sie müssen gar nichts erklären.» Der Lemming tauscht einen Blick mit Klara, die ihm begütigend zunickt. «Wann immer Sie wollen, Frau Lehner. Und so oft Sie wollen. Die Freunde unseres Sohnes sind uns jederzeit willkommen.»
Wie zur Bekräftigung nimmt ihm nun Klara behutsam den Säugling ab und reicht ihn an Angela Lehner weiter. «Könnt sein, dass ihm jetzt schon ein bisserl kühl ist. Was meinen Sie?»
Der Engel antwortet nicht. Im Gegenlicht des Atriums sieht es so aus, als breite er seine schützenden Schwingen über das Baby. Dabei fängt Angela Lehner nur damit an, es mit geübten, aber liebevollen Griffen in das klösterliche Klopapier zu wickeln.
3
«Otto?»
«Ohne mich. Ich bin einmal einem begegnet.»
«Einem was?»
«Na, einem Otto.»
«Aha…»
«Nicht, was du denkst. Nein, das war ein widerlicher Kerl, so ein aufgedunsener Spanner mit Plattfüßen. Wenn ich den Namen nur höre… Wie wär es mit Walter?»
«Walter Wallisch! Wie das schon klingt: ein doppeltes Weh!»
«Er wird aber Breitner heißen.»
«Ja, ja, ich weiß schon. Aber… vielleicht nicht für immer…»
«Kann es sein, dass ich mich grad verhört hab? Oder war das jetzt so etwas wie… ein Heiratsantrag? Hat dir der gute Pius einen gebenedeiten Floh ins Ohr gesetzt?»
«Hat er nicht. Also nicht wirklich, aber…»
«Aber?»
«Nix aber. Man kann sich ja manchmal auch selbst zu etwas… durchringen.»
«Durchringen also.»
«So hab ich’s nicht gemeint.»
«Schon gut, du Charmeur… Jetzt lass einmal hören: Was hältst du von Paul?»
«Paul Breitner! Soll er ’leicht Fußballer werden? Ausgerechnet in Österreich? Da wäre ja… Thorward noch besser.»
«Auch nicht schlecht. Oder Siegesthor.»
«Stürmertrutz.»
«Stoßefrey»
«Flankebald.»
«Flankebald Wallisch… Das hat Rhythmus, das gefällt mir.»
Klara und der Lemming brechen unisono in Gelächter aus. Ein Gelächter, das bislang noch jede ihrer Namensdiskussionen vorzeitig beendet hat.
Schon vor Monaten haben die zwei eine seltsame Liste aufgesetzt: Keine Namen, die ernsthaft in Frage kommen, sondern nur solche, mit denen man ein Kind schon strafen kann, bevor es das erste Mal unfolgsam ist. Dörthe ist der Spitzenreiter bei den Mädchen, knapp gefolgt von Erdmute und Notburg, bei den Buben führt Rüdiger vor Blasius, Detlef und Roderich. Aber auch Neukreationen und Anleihen aus artfremden Genres sind hier vertreten. Beispielsweise die grazile Lada mit ihrem Bruder, dem bulligen Moskwitsch. Oder der virile Hokuspokus und sein weibliches Pendant, die liebliche Abrakadabra (selbstverständlich hat der Lemming auch das Baby der beiden, das herzige Simsalabim, auf der Liste vermerkt).
Wahrscheinlich liegt dem Impuls, bei diesem Thema ins Absurde abzudriften, eine Art Befangenheit zugrunde, eine Scheu davor, dem kleinen, bislang ungeprägten Menschen seinen ersten Stempel aufzudrücken. Es ist ja auch ein grober Eingriff in das Unberührte, wie das erste Wort auf einem leeren Blatt Papier, der erste Schritt auf einer frisch beschneiten Wiese…
«So kommen wir nicht weiter», meint Klara, nun wieder ernst geworden. Sie blickt auf das Bündel in ihren Armen. Der Kleine – ermattet vom Saugen an ihrem üppigen Busen – ist eingeschlafen. Im Spiel der Sonnenstrahlen, die durch das Grün der Weinlaube fallen, hebt und senkt sich rasch und rhythmisch seine Brust.
Der Lemming nickt und zuckt die Schultern. «Castro, was meinst du: Wie soll dein neues Herrli heißen?»
Zu seinen Füßen ertönt jetzt ein Brummen, und schon taucht unter der Kante des Gartentischs die feuchte Schnauze des Leonbergers auf. Castro blinzelt ins Licht; er gähnt und lässt seinen wuchtigen Schädel in den Schoß des Lemming sinken.
«Was? Was hat er gesagt?», grinst Klara.
«Nichts. Er überlegt noch.»
Und wie zum Beweis für den außergewöhnlichen Tiefgang seiner Gedanken fängt Castro jetzt lautstark zu schnarchen an.
«Sag, Poldi, hat dir unser roter Engel eine Adresse gegeben?»
«Die Lehnerin? Nur eine Telefonnummer. Warum?»
«Wir könnten ja auch sie nach ihrer Meinung fragen. Schließlich war sie nicht ganz unbeteiligt an der sicheren Landung unseres… kleinen Prinzen.»
«Ja, wenn du meinst…»
«Du darfst auch mein Handy benutzen, solange…» Klara verbeißt sich ein weiteres Grinsen.
«Solang ich damit keinen Eurofighter vom Himmel hol? Meinetwegen. Wo ist es denn?»
«In der Küche, auf der Kredenz. Ich möcht mich dann auch gern noch einmal bedanken.»
Behutsam hebt der Lemming Castros Kopf von seinen Schenkeln. Dann steht er auf und tritt in den kühlen Schatten des Hauses.
Freizeichen. Nach langen Sekunden erst wird am anderen Ende der Leitung der Hörer abgenommen.
«Hallo? Sind Sie es, Frau Lehner?»
Statt einer Antwort schmettert infernalisches Gedröhn gegen das Trommelfell des Lemming: der dumpfe, hämmernde Rhythmus elektronischer Bässe, vermischt mit dem Kreischen undefinierbarer Blas- oder Streichinstrumente. Dazu gesellt sich ein dichter Nebel aus Stimmen, dem hin und wieder gellendes Gelächter entsteigt. Dann das Aufröhren eines Motors, heiser und grollend, anscheinend ein Motorrad.
«Hallo? Frau Lehner?»
Nichts als der stampfende Lärm der Musik ist zu hören. Der Lemming verzieht das Gesicht, streckt den Arm aus, hält das Handy möglichst weit von seinen Ohren entfernt. Aber dann – von einem Augenblick zum anderen – endet der Radau.
«Wer spricht denn da?», fragt Angela Lehner in die plötzliche Stille hinein. Sie klingt ungeduldig und reizbar, schon fast an der Grenze zur Schroffheit, wie der Lemming überrascht vermerkt.
«Wallisch hier, Leopold Wallisch. Vielleicht erinnern Sie sich noch: das Nervenbündel vom Samstag. Der frischgebackene…»
«Aber natürlich! Herr Wallisch! Was macht der Kleine, geht’s ihm gut?»
Wie weggeblasen ist der rüde Unterton in Angela Lehners Stimme. Weich und offen ist sie jetzt und voller Freude.
«Wunderbar, danke. Er lebt den ewigen Traum seines Vaters: Nur trinken, schlafen und hin und wieder ein bisserl raunzen. Sagen Sie, der Krach… die Geräusche, ich meine die Klänge da vorhin: Sind Sie im Gastgewerbe?»
Eine Pause tritt ein. Schon befürchtet der Lemming, dass die Verbindung unterbrochen ist, als doch noch – nun wieder in merklich kühlerem Tonfall– Angela Lehners Antwort erfolgt.
«So ähnlich», meint sie knapp. «Warum rufen Sie an, Herr Wallisch?»
«Ich… Es ist nur, weil… Meine Frau und ich, wir hätten da eine Bitte an Sie. Wir sind schon lange auf der Suche nach einem geeigneten Vornamen, aber… Irgendwie schaffen wir’s nicht. Über Blödsinnigkeiten wie Conan oder Flankebald», der Lemming muss schon wieder kichern, «kommen wir einfach nicht hinaus. Und da wollten wir Sie fragen, ob Ihnen dazu etwas einfällt.»
«Sie… Sie meinen, ich soll… mich da einmischen? Ist das ihr Ernst?»
«Ernst? Das ist mir ein bisserl zu, na ja, ernst. Aber vielleicht einen anderen Vorschlag, wenn Sie hätten.»
«Ben», sagt Angela Lehner, ohne zu zögern.
«Ben?»
«Ja. Benjamin: Sohn des Glücks. So würde ich ihn nennen.»
4
Ein großer Sommer ist das gewesen, eine helle und frohe, erregte und zärtliche Zeit. Eine Zeit der Liebe und des Lachens, rundum gut. Und ein noch größerer Herbst: Ende Oktober hat der Lemming Abschied genommen. Mit einem Liter Veltliner bewaffnet hat er seinen letzten Nachtdienst im Schönbrunner Tiergarten angetreten.
Es ist nun einmal so, dass sich der Lohn eines Wachebeamten nicht mit dem einer Tierärztin messen kann: Für den Gegenwert eines von Klara verabreichten Nilpferdklistiers musste der Lemming zwei lange Nächte hindurch das Zoogelände durchstreifen. Trotzdem waren es nicht nur finanzielle Gründe, derentwegen er die Pflichten des Verdieners und Ernährers (und damit den glorreichen Status des Jägers und Sammlers) Klara überließ. Im Gegenteil: Sie stellten nicht mehr für ihn dar als ein weiteres Argument, um endlich einen Logenplatz an der Wiege seines Sohnes zu ergattern. Das erste Halbjahr Elternschaft war absolviert, die Stillzeit beendet, und so stand der Erfüllung seines Wunsches nichts mehr im Wege: «Ich will auch», hatte er eines Abends zu Klara gesagt, die gerade den rosigen Hintern des Kleinen eincremte. «Ich will auch.» Das musste genügen.
Im mittlerweile wohlgeheizten Wächterhäuschen hat der Lemming zur Feier der Nacht seinen Wein entkorkt, als – in charmanter Begleitung einer Flasche Burgunder – sein Freund und Kollege Pokorny erschien, um mit ihm anzustoßen.
«Sag, was bist du jetzt eigentlich?», hat Pokorny gefragt. «Arbeitsloser, Rentner oder Privatier?»
«Ich weiß gar nicht, wie man das nennt», hat der Lemming geantwortet. «Wahrscheinlich so ähnlich wie… Karenzier.»
«Und du bist sicher, dass du dir das antun willst?»
«Was?»
«Na, die ganze Maloche halt: füttern, beruhigen, wickeln, herumtragen, wickeln, beruhigen und füttern…»
Da hat der Lemming nur genickt und zufrieden gelächelt.
«Alter Frauenversteher», hat Pokorny zurückgegrinst. «Prost, Poldi, du Sitzbrunzer. Ich trink auf den Benny.»
«Prost, Pepi. Ja, auf meinen kleinen Ben.»
Wahrhaftig: eine rundum gute Zeit.
Nicht zuletzt wegen Angela Lehner. Im Lauf der vergangenen Monate hat sie sich unaufhaltsam von der Freundin zur Geliebten gemausert – zur Geliebten des kleinen Ben, versteht sich. Anfangs ist sie nur gelegentlich in Ottakring erschienen, nicht ohne sich jedes Mal minutiös vergewissert zu haben, dass sie ganz sicher nicht störte. Allmählich jedoch sind ihre Besuche regelmäßiger geworden: Besuche, die – und daran ließ sie keinen Zweifel – in erster Linie Benjamin und erst in zweiter Klara und dem Lemming galten. Wenn Ben noch nicht empfangsbereit war, weil er im Obergeschoss seinen Milchrausch ausschlief, übte sie sich in Geduld und begnügte sich vorerst mit seinen Eltern. Dann saß sie im Garten oder beim Küchentisch, schweigsam und ernst und immer ein wenig in sich gekehrt. Für die Erzählungen Klaras und für die Geschichten des Lemming zeigte sie stets großes Interesse, während sie Fragen zu ihrem eigenen Leben unbeantwortet ließ, indem sie sie freundlich, aber entschieden umschiffte.
«Woher können Sie das so gut? Ich meine, Babys zur Welt bringen?», hat Klara sie zum Beispiel eines Nachmittags gefragt.
«Ich war schon einmal dabei… bei einer Geburt.»
«Und Sie selbst? Haben Sie keine Kinder?»
«Nicht, dass Sie das missverstehen», hat Angela Lehner geantwortet. «Aber ich hab ja jetzt… Ihres.» Und ihr herzlicher, dankbarer Blick hat alles Befremdliche von ihren Worten gewischt.
Sobald dann der erste, zaghafte Klagelaut Benjamins aus dem ersten Stock ertönte, ging eine jähe Verwandlung mit dem roten Engel vor. Er horchte auf und lauschte und begann zu strahlen, er breitete die Flügel aus und öffnete sein Herz. Meistens stand Angela Lehner schon beim Treppenabsatz, wenn Klara mit dem Kleinen auf dem Arm herunterkam. Ihre Augen leuchteten Ben entgegen, und Bens Augen leuchteten zurück. Selbst wenn ihn schon wieder der Hunger plagte und er der widrigen Welt mit verweintem Gesicht sein Leid entgegengreinte: Kaum, dass er die hagere Frau mit den fuchsroten Haaren erblickt hatte, huschte ein Lächeln über seine Lippen.
Benjamin hat es – noch vor seinen Eltern – begriffen: Angela Lehner ist einer der seltenen Menschen, die man lieben kann, auch ohne etwas über sie zu wissen. Ähnlich einem Musikstück, das man auch dann zu genießen vermag, wenn man den Komponisten nicht kennt.
Und so ist es irgendwann dazu gekommen, dass Klara und der Lemming Brüderschaft mit dem Engel getrunken haben – Klara bei einer Tasse Stilltee, die anderen zwei bei einem Achtel Wein.
«Prost, Angela, ich bin der Poldi.» Gläserklirren. Castro hat leise gebrummt und die Ohren gespitzt, Ben dagegen hat seelenruhig weitergeschlafen, eingerollt in Morpheus’ Armen und im Schoß des Lemming.
«Leopold… Das hätt mir damals auch gefallen», hat Angela Lehner nach einer Weile gedankenverloren gemurmelt.
«Du meinst… statt Benjamin?»
«Ja… Ja, genau.»
«Ich weiß nicht. Leopold bedeutet so viel wie der Kühne aus dem Volk. Und jetzt schau dir an, was aus mir geworden ist: ein Schnullerkombattant und Windeldesperado, der Inbegriff eines wackeren Volkshelden, oder?»
«Du brauchst gar nicht so zu grinsen.» Angela kämpfte nun selbst mit einem Schmunzeln. «Ich finde, die Welt könnte mehr solche Helden vertragen.»
«Amen», hat Klara ihr beigestimmt.
«Trotzdem ist mir der Sohn des Glücks lieber.» Der Lemming hat sich zu Ben hinuntergebeugt, um ihm einen Kuss auf den schütteren Scheitel zu drücken. «Der ist seinem Namen schon jetzt mehr als gerecht geworden…»
Wahrhaftig: eine Zeit der Liebe und des Lachens.
Überhaupt Benjamin.
Die ersten sechs Monate sind ein einziger süßer Schmerz für den Lemming gewesen. Wenn er morgens von der Arbeit heimkam und im ersten Dämmerlicht das Haus betrat, klopfte sein Herz wie das eines frisch Verliebten. Er schlich jedes Mal geradewegs ins Schlafzimmer, um Ben zu betrachten. Dann saß er da und vertiefte sich – Stunde um Stunde – in den Anblick seines Sohnes. Und immer konnte es nur eine flüchtige Linderung sein: Sobald er mittags alleine im Bett erwachte, war die unstillbare Sehnsucht wieder da. Der Lemming war süchtig, er konnte sich einfach nicht satt sehen an Ben.
Und wie denn auch.
Es ist schon unglaublich, was ein paar Kilo Mensch zu leisten vermögen, um sich Tag für Tag aufs Neue interessant zu machen. Von der stetigen Entfaltung des zerknitterten Gesichts bis hin zum ersten Lächeln des zahnlosen Mundes bot Ben eine endlose Folge verblüffender Attraktionen. Er spiegelte die Welt im selben Ausmaß wider, in dem er sie aufsaugte – und das tat er in atemberaubendem Tempo. Beispielsweise, wenn er – von verschlagenen Winden geplagt – in gellendes Kreischen ausbrach: Schon nach wenigen Wochen suchte er in seinem Schmerz den Blick des Lemming, und seine ungeübten Lippen fingen an, Konsonanten zu formen, also den Jammer zu artikulieren. Er schrie und er weinte, aber er nahm auch Kontakt auf, er teilte sich mit. So gab es täglich etwas Neues zu bestaunen: das Jauchzen und Mitkrächzen, wenn er Musik hörte, oder das genüssliche Gestrampel, wenn er – seiner Windel entledigt – ins handwarme Wasser des Waschbeckens getaucht wurde. «Ben kann schon…», das wurde zur ständigen Floskel zwischen Klara und dem Lemming. «Ben kann seinen Kopf schon halten.» – «Ben kann sich schon auf den Rücken drehen.» – «Ben kann schon nach der Rassel greifen.» Es war ein stetiges, ein pausenloses Lernen, und die Brennpunkte dieses Lernens, die Schnittstellen zwischen Bens Innen und Außen, waren seine großen schwarzen Augen. Wie durch zwei weitgeöffnete Schleusen brauste hier der Kosmos in ihn hinein – und aus ihm heraus. Wenn er in seiner Wippe saß, breit und behäbig, aber mit hellwachem Blick und gerunzelter Stirn, dann konnte man fast meinen, er bestehe nur aus diesen Augen. Und aus dem wabbelnden Doppelkinn, das – dank Klaras gehaltvoller Kost – sein rundes Gesicht umsäumte.
Ben und Klara, Castro und der rote Engel: Ein wahrhaftig großer Sommer war das, und ein noch größerer Herbst. Das Schicksal hat es gut mit dem Lemming gemeint, es hat ihn mit einer Überfülle nie geahnten Glücks bedacht.
Aber das Glück ist bekanntlich ein Vogerl: Es fliegt gnadenlos weiter, sobald sich das Jahr seinem frostigen Ende zuneigt.
5
Das Aufreißen ist eine eigene Sportart in Wien, ein Massensport, dessen Facetten und Variationen von schier unendlicher Vielfalt sind. Den Amateuren bleibt das Aufreißen von Briefkuverts und Fenstern vorbehalten, darüber hinaus das von Ärschen und Goschen, von Haserln und Haberern, Räuscherln und anderen Unpässlichkeiten. Will man dagegen ein richtiger Profi sein, dann muss man in einer der städtischen Mannschaften anheuern, die mit der Wartung des Straßennetzes und der darunterliegenden Leitungen betraut sind. Das Öffnen der Straßendecke hat sich nämlich in der Donaumetropole längst zur Königsdisziplin des Aufreißens entwickelt. Obwohl vom Wesen her ein Sommersport, wird es auch gerne im Winter ausgeübt, sofern die Witterung das zulässt. Ist die Jahreszeit bei der Planung der Spieltermine also nur nebensächlich, so müssen die Aufreißer trotzdem eine gravierende zeitliche Einschränkung hinnehmen: Der tägliche Verkehrsfluss, der ja – als pumpende Ader der Wirtschaft – dem Wohl aller Bürger dient, darf nicht unterbrochen werden. Deshalb wird möglichst nur während der Nachtstunden aufgerissen. Kaum ist der Autolärm versiegt, kaum neigt sich der Tag, des steten Donnerns der Motoren müde, seinem Ende zu, da flammen die Flutlichter auf, und die Athleten betreten das Spielfeld. Der Magistrat hat sein Team mit flotten orangefarbenen Dressen ausgestattet, brandgefährlich wirken die Männer im Gleißen der Scheinwerfer. Zu Recht: Was Österreichs Fußballer schon seit Jahrzehnten nicht mehr zuwege bringen, das schaffen die Aufreißer Wiens: Sie gewinnen. Sie besiegen den Asphalt in jeder Nacht aufs Neue, da kann die Begegnung Mann gegen Straße noch so brutal sein…
«Entschuldigen Sie… Entschuldigen Sie! Hallo!»
Keine Chance, sich verständlich zu machen. Der Lemming kann sich selbst nicht hören; er spürt nur die sanften Vibrationen der Stimmbänder in seinem Kehlkopf. Ein Stück weiter unten, im Zwerchfell, wüten dagegen die Stöße des Drucklufthammers. Ein Betonsplitter spritzt an seiner Schläfe vorbei und verschwindet im Dunkel der Nacht.
«Entschuldigen Sie!»
Endlich eine Pause. Der Mann im gelbroten Trikot blickt auf; sein Gesichtsausdruck ändert sich schlagartig: Eben noch – beinahe meditativ – in seine Attacke gegen die Fahrbahn versunken, geht er jetzt unwillkürlich in Abwehrhaltung, als hätte er diesen Spielzug hundertmal trainiert: Abschätzig sieht er den Lemming an.
«Ja?», meint er knapp. Dann aber huscht ein belustigtes Grinsen über seine Lippen, ein Grinsen, das ohne Zweifel dem Dress seines Gegners gilt: ein rotgeblümter Schlafrock, aus dem fahle, nackte Beine schauen. Die Füße des Lemming stecken in klobigen Stiefeln, seinen Kopf ziert eine dicke Pudelmütze. Es ist die lächerliche Kleidung eines Dilettanten, hastig zusammengerafft, um in kalter Adventnacht den Angriff auf einen Titanen der Straße zu wagen.
«Ich wollte nur fragen… was machen Sie hier um drei Uhr früh?»
«Na, aufreißen halt.»
«Und warum?»
«Leitungsarbeiten.»
«Ich meine, warum heute, warum jetzt? Am dreiundzwanzigsten Dezember, mitten in der Nacht!»
«Auftrag, gnä’ Herr. Is alles genehmigt. Sie wollen ja selber auch mit’n Auto fahren untern Tag.»
Der Lemming fröstelt. «Ich habe kein Auto», sagt er und zieht den Kragen des Schlafmantels enger.
Der Aufreißer stutzt. Skeptisch zunächst, dann mitleidig, schließlich verächtlich, so mustert er sein Gegenüber. Ein Mann ohne Auto, das will erst einmal verdaut sein. «Meiner Seel», brummt er nach einer Weile und schüttelt den Kopf, um sich vom Lemming ab- und wieder seiner Arbeit zuzuwenden. Doch der Lemming lässt nicht locker.
«Jetzt hören S’ einmal her: Meine Frau und ich, wir haben ein kleines Baby daheim. Wir brauchen unseren Schlaf, verstehen Sie? Und jetzt dieser Krach, da kriegt keiner ein Auge zu, völlig unmöglich. Allein diese Stöße, diese Erschütterungen, das ist ja wie ein… wie ein…»
«Presslufthammer», vollendet der andere den Satz. «Schafft zweitausend Schlagzahl, das Burli. Soll i vielleicht einen Zahnstocher nehmen? I kann ja auch nix…»
«Moment!», unterbricht ihn der Lemming. «Lassen S’ mich raten, ich weiß nämlich schon, was jetzt kommt: Sie können ja auch nichts dafür, Sie tun schließlich nur Ihre Arbeit, die Entscheidungen werden woanders getroffen, stimmt’s?»
«Stimmt haargenau. Oder stimmt’s vielleicht net?»
«Es… Ja, natürlich… Sicher stimmt’s…» Eigentor, Lemming. Schon ist es passiert. Wie soll man aber auch ein Match für sich entscheiden, in dem man von vornherein chancenlos war? Wie soll man sich wehren gegen ungreifbare Mächte, gegen namenlose Kader, kurz: gegen die Obrigkeit? Die einzige Trophäe, die einem hier winkt, ist die Urne, in der man seinen Stolz begraben kann. Und deshalb schickt sich der Lemming nun an, zum geordneten Rückzug zu blasen.
«Können S’ mir wenigstens sagen, wie lang das noch gehen soll? Die Arbeiten, mein ich.»
«Für unsereins bis in der Früh. Um sechse werden wir ab’glöst, da kommt die neue Schicht, weil morgen geht’s tagsüber auch noch weiter…»
«Wie? Am Weihnachtstag?»
«Extra für Sie, damit’s Ihnen net anschei… net aufregen müssen wegen der Nachtarbeit.» Ein hämisches Lachen: Verhöhnung des Gegners. Der Champion kostet ihn aus, den Triumph. «Nix für ungut, kleiner Scherz», fügt er gnädig hinzu. «Z’ Weihnachten is nämlich eh fast nix los auf der Straßen. Morgen is dann Schluss, dann haben S’ Ihren heiligen Frieden. Bis z’ Mittag sollten wir fertig sein, aber nur, wenn S’ uns jetzt in Ruhe arbeiten lassen.»
«In Ruhe? In… Ruhe?»
Der Lemming ringt die Hände, dreht sich wortlos um und geht. Nach wenigen Schritten vernimmt er noch einmal die Stimme des gelbroten Mannes in seinem Rücken: «Wie schön die Welt ohne Anrainer wär!» Dann setzt wieder das Rattern des Meißels ein.
«Ich liebe euch.» Leise hat das der Lemming gesagt und verträumt; er hat mehr zu sich selbst als zu Klara und Ben gesprochen. In der frostklaren Luft dieses frühen Abends aber sind seine Worte ganz deutlich zu hören gewesen. Klara bleibt stehen. Zieht ihn an sich und küsst ihn, begierig und lange. Zwischen ihnen, an der Brust des Lemming, baumelt Ben in seinem Tragesack. Fest verpackt ist der Kleine, mit dicken Pullovern und Decken vermummt. Der Kuss interessiert ihn nicht weiter. Gebannt betrachtet er die Atemwölkchen, die seinem Mund entweichen. Weiß sind sie, beinahe so weiß wie die Bäume, die Häuser, die Welt. Ein glitzernder, schöner und vollkommen unverständlicher Traum.
«Frohe Weihnachten, Poldi.»
«Dir auch. Ich glaub, ich hab sie schon.»
Es hat zu schneien begonnen heut Mittag. Wie um es allen Beteiligten recht zu machen, haben die Wettergötter den Winter erst gegen halb zwölf aus dem Käfig gelassen, als sich die Straßenarbeiten dem Ende zuneigten. Ein heftiger Wind hat die Kälte gebracht, und kaum, dass die Arbeiter ihre Geräte zusammengerafft und die – notdürftig wieder versiegelte – Straße verlassen haben, ist auch der Schnee gekommen. Tief und grau war auf einmal der Himmel, durchwirbelt vom dichten Gestöber der Flocken. Nicht lange, und der Wind hat nachgelassen, hat Platz gemacht für das Flüstern und Rauschen, für das kaum hörbare Knistern des Schneetreibens. Winterstille.
Später kamen zwei Krähen, schwarz und zerrupft, die sind durch den Garten gehüpft wie zwei nervöse Dorfpfarrer. Ihr heiseres Krächzen klang wie ein Abgesang auf das sterbende Jahr. Durch die beschlagenen Scheiben der Küche hat Ben die beiden entdeckt, und er hat mit begeistertem Quietschen signalisiert, dass er – und zwar sofort! – auf einem Spaziergang bestand.