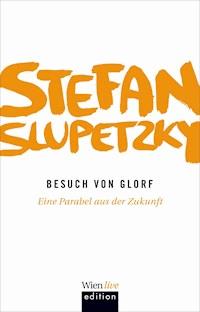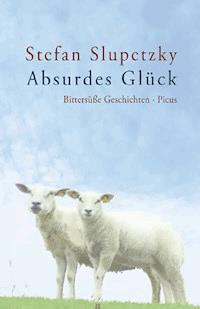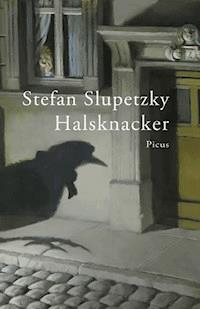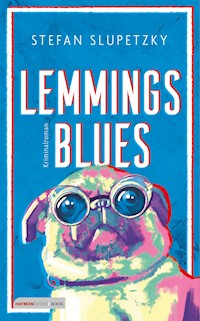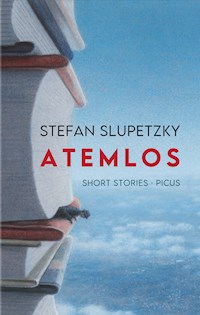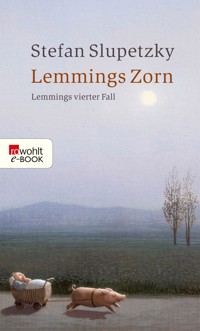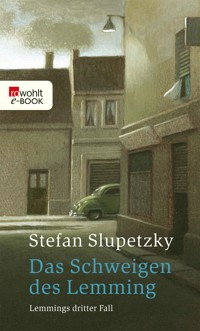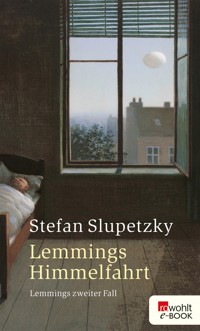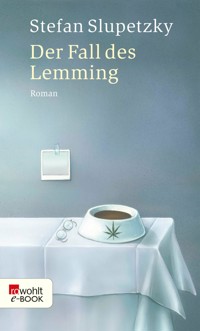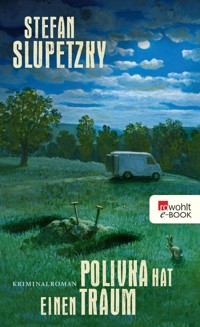9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stefan Slupetzky, bisher als Krimiautor bekannt und vielfach ausgezeichnet, legt einen berührenden Roman über die Bürde der Geschichte und das Abschiednehmen vor. Friedenszeit in Österreich – seit zwei Generationen schon – ist für Daniel Kowalski eine Selbstverständlichkeit. Für seine Eltern war es das nicht. Sein seit langem verstorbener Vater entstammte einer der prominentesten Kriegsverbrecherfamilien der Nazizeit, in der Chemiefabrik des Großvaters wurde Zyklon B hergestellt. Daniels Mutter hingegen ist Jüdin und verlor ihre ganze Familie im Holocaust. Eines Tages erhält Daniel einen Brief seiner Großtante aus Israel. Sie teilt ihm mit, dass sie ein Haus aus Familienbesitz verkaufen will, in dem er seine Kindheit verbracht hat. Ob er es vorher noch einmal besuchen möchte? Als Daniel den Keller des Hauses entrümpelt, macht er eine Entdeckung. Er stößt auf ein Tagebuch, dessen Lektüre den Verdacht in ihm weckt, dass sein Vater seinen Tod nur inszeniert hat, um ein zweites Leben zu beginnen. Aber warum? War die Last der Geschichte zu erdrückend für diesen sensiblen Mann? Daniel beschließt, sich auf die Suche zu machen. Stefan Slupetzky hat seine eigene Familiengeschichte zum Anlass genommen, diesen ergreifenden Roman über das Reisen und die Suche nach Identität zu schreiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Stefan Slupetzky
Der letzte große Trost
Roman
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Stefan Slupetzky, bisher als Krimiautor bekannt und vielfach ausgezeichnet, legt einen berührenden Roman über die Bürde der Geschichte und das Abschiednehmen vor.
Friedenszeit in Österreich – seit zwei Generationen schon – ist für Daniel Kowalski eine Selbstverständlichkeit. Für seine Eltern war es das nicht.
Sein seit langem verstorbener Vater entstammte einer der prominentesten Kriegsverbrecherfamilien der Nazizeit, in der Chemiefabrik des Großvaters wurde Zyklon B hergestellt. Daniels Mutter hingegen ist Jüdin und verlor ihre ganze Familie im Holocaust.
Eines Tages erhält Daniel einen Brief seiner Großtante aus Israel. Sie teilt ihm mit, dass sie ein Haus aus Familienbesitz verkaufen will, in dem er seine Kindheit verbracht hat. Ob er es vorher noch einmal besuchen möchte?
Als Daniel den Keller des Hauses entrümpelt, macht er eine Entdeckung. Er stößt auf ein Tagebuch, dessen Lektüre den Verdacht in ihm weckt, dass sein Vater seinen Tod nur inszeniert hat, um ein zweites Leben zu beginnen. Aber warum? War die Last der Geschichte zu erdrückend für diesen sensiblen Mann?
Daniel beschließt, sich auf die Suche zu machen.
Stefan Slupetzky hat seine eigene Familiengeschichte zum Anlass genommen, diesen ergreifenden Roman über das Reisen und die Suche nach Identität zu schreiben.
Über Stefan Slupetzky
Stefan Slupetzky, 1962 in Wien geboren, schrieb und illustrierte mehr als ein Dutzend Kinder- und Jugendbücher, für die er zahlreiche Preise erhielt.
Seit einiger Zeit widmet er sich vorwiegend der Literatur für Erwachsene und verfasst Bühnenstücke, Kurzgeschichten und Romane. Für den ersten Krimi um seinen Antihelden Leopold Wallisch, «Der Fall des Lemming», erhielt Stefan Slupetzky 2005 den Glauser-Preis, für «Lemmings Himmelfahrt» den Burgdorfer Krimipreis. «Lemmings Zorn» wurde 2010 mit dem Leo-Perutz-Preis ausgezeichnet. Im selben Jahr gründete Slupetzky ein Wienerliedtrio, das Trio Lepschi, mit dem er seither als Texter und Sänger durch die Lande tourt. Stefan Slupetzky lebt mit seiner Familie in Wien.
Inhaltsübersicht
In jeder großen Trennung liegt ein Keim von Wahnsinn; man muss sich hüten, ihn nachdenklich auszubrüten und zu pflegen.
GOETHE
Für meine Frau und meine Kinder
Teil 1
1997
Das dumpfe Poltern einer zuschlagenden Autotür, das Scharren unsicherer Schritte auf dem Kies. Ein Mann tritt in den Garten, sein Gesicht ist schmal, es schimmert blass im Mondlicht wie die Zeiger einer Armbanduhr. Benommen schlingert er über den Rasen, ein Stück Treibholz in der Brandung, in der Linken hält er eine Flasche, die er wiederholt zum Mund zu führen versucht. Es will ihm nicht gelingen, und so kniet er sich ins Gras und trinkt mit großen Schlucken, kippt dann still nach hinten, bis er auf dem Rücken liegt, und starrt, die Arme ausgebreitet, in den Sternenhimmel.
Lange liegt er so, man könnte meinen, er sei eingeschlafen. Aber irgendwann stemmt er sich wieder hoch, mit einem leisen Ächzen, stolpert, stürzt, nimmt, auf der Seite liegend, einen weiteren Schluck, kommt endlich auf die Beine und wankt weiter.
Er beginnt zu reden, bald zu brüllen: groteske, unartikulierte Laute, die zugleich nach Jubel und Verzweiflung klingen. Offenbar gibt es hier keine Nachbarn, denn um diese Uhrzeit aus dem Schlaf gerissen, hätten sie wahrscheinlich schon die Polizei gerufen. Er macht einen mächtigen Radau, gespenstisch hallen sein Lachen und sein Schluchzen durch den Garten. Wieder strauchelt er, schlägt auf dem Rasen auf, sitzt dann gebeugt und wiegt die Flasche in den Armen. Seine Stirn ist blutverschmiert, wahrscheinlich ein im Gras verborgener Stein. Das Brüllen ist abgeklungen. Eine Zeitlang murmelt er noch vor sich hin, dann schweigt er. Nur das leise Rauschen aus dem Wald ist noch zu hören, und eine Wolke schiebt sich vor den Mond.
Ruths Brief
Der Weg war ihm vertraut und fremd zugleich: Die Häuser schienen niedriger, die Straße enger. Wo es seinerzeit mit Bäumen und Gebüsch bewachsene Baulücken gegeben hatte, urwaldartiges und offensichtlich kaum zu bändigendes Grün, das regelrecht aufs Trottoir herausgewuchert war, da hatte sich die Phalanx der Gebäude mittlerweile fest geschlossen. Nur die Streckenführung selbst, die Abfolge von Kurven, Steigungen und Senken hatte sich anscheinend nicht verändert, und so stellte sich bei ihm das Bild eines historischen Theaters ein, auf dessen Bühne die Kulissen für ein zeitgenössisches Spektakel stehen.
Obwohl der Himmel klar war und die Luft, die durch das Seitenfenster in den Wagen strömte, kühl und trocken, lag ein Druck auf seinen Schläfen, schwer wie in der Schwüle eines nahenden Gewitters. Als die Häuserzeilen sich lichteten, sodass der Wald die Herrschaft übernahm, verstärkte sich die Unruhe. Zwei Kurven noch, dann musste links die Zufahrt sein. Ein schmaler Schotterweg, von Bäumen überdacht.
Holunderbüsche.
Eine Fliederhecke.
Und das Gartentor.
Er parkte den Mazda auf der kleinen Lichtung gegenüber, stieg dann aus und nestelte den Schlüssel aus der Tasche. Seine Hände waren kalt und taub, die Beine zitterten ein wenig, als er sich dem Eingang näherte. Das Vorgefühl eines Gewitters wuchs mit jedem Schritt, die ersten Blitze zuckten über seinen flimmernden Bewusstseinshorizont.
Seit siebzehn Jahren war er nicht mehr hier gewesen. Nicht mehr hier und auch an keiner anderen Stätte seiner Kindheit. All die Jahre seit dem Schlaganfall der Mutter war er immer nur ins Pflegeheim nach Klosterneuburg und anschließend gleich nach Wien zurückgefahren, er hatte nie den Weg verlassen, war nie abgewichen, so als quere er ein dunkles Moor und fürchte sich vor jedem noch so kleinen Fehltritt.
Nur dass dieses Moor in seinem Herzen lag: ein blinder Fleck in seiner Mitte, der sich – wie ein verlorenes Puzzleteil – durch nichts als durch die Ränder seiner angrenzenden Teile definierte.
Daniel Kowalski hatte sich mit diesem Mangel abgefunden; er betrachtete sich selbst mit jenem stillen Phlegma, das er auch seinem Beruf als Fotograf entgegenbrachte. Den Zweck der Dinge zu ergründen, die er täglich abzulichten hatte, war nicht seine Aufgabe, und so hatte er vor Jahren beschlossen, sich nicht mehr dafür zu interessieren. Es waren Objekte, deren Form, Textur und Farbe er zwar registrierte, deren Seele und Bestimmung aber keinerlei Bedeutung für ihn hatten. Wenn man bei Hydraulikkupplungen, Schlaffseilschaltern oder Achsmanschetten überhaupt von so etwas wie Seele sprechen kann.
Mit klammen Fingern schob er den Schlüssel ins Schloss. Er konnte ihn erst drehen, als er – die Erinnerung an diese kleine Finte hatte sich in seinen Gliedern festgesetzt – den Griff des Gartentors mit einem Ruck zu sich zog. Das Geräusch des aufschnappenden Riegels klang vertraut; es ähnelte dem Klicken eines Super-8-Projektors, der beginnt, den Film zurückzuspulen.
Mit zwölf Jahren hatte Daniel sich der Kunst verschrieben, hatte große, wenn auch vage Träume von sich selbst geträumt, in denen er (viril und selbstvergessen, unbeeindruckt vom eigenen Weltruhm) prächtige Gemälde schuf. Pablo Picasso war ein Jahr vorher in Mougins gestorben, und die Eltern hatten Daniel einen opulenten Bildband über den berühmten Andalusier geschenkt. Nun sah auch er sich in pompösen, von mediterranem Sonnenlicht durchströmten Ateliers zugange sein, inmitten eines Ozeans aus Farben, die sein Geist zu nie gekannter Schönheit ordnete. Empfindsam und entschlossen, energiegeladen, aber voller Zärtlichkeit: ein durch und durch begehrenswerter Mann, das wollte Daniel vor allem werden.
Als er an seinem fünfzehnten Geburtstag eine Kamera bekam, verblasste seine Schwäche für die Malerei. Man Ray war ein Jahr vorher in Paris gestorben, und die Fotografie rückte stärker denn je in den Fokus der internationalen Kunstszene. In Kassel widmete die documenta den Meistern der Fotokunst eine Sonderschau, deren Katalog auf verschlungenen Wegen in Daniels Hände gelangte. Er durchblätterte das Heft, bis dessen Seiten auseinanderfielen. Mit seiner Kamera durchstreifte er die Gegend auf der Suche nach Motiven, variierte und justierte, schoss ein Foto nach dem anderen, Bild um Bild und Film um Film. Nach einer Weile hatte er sich ausreichend in die Materie vertieft, um sich im Keller des Weidlingbacher Hauses eine kleine Dunkelkammer einzurichten.
Der Liebe zur Fotografie blieb Daniel auch nach seinem Schulabschluss treu. Er inskribierte an der Hochschule für Angewandte Kunst und galt bei seinen Studienkollegen bald als Spezialist für Fotomontagen und -installationen. Eine exquisite Hasselblad (die Kosten waren von den Eltern übernommen worden) wurde seine ständige Begleiterin. Daniels Zukunft schien geebnet; seine Regsamkeit, sein schöpferischer Schwung und seine Neugier sicherten ihm einen Startplatz auf der Abschussrampe in die erste Künstlerliga.
Dass er wenig später eine andere Laufbahn eingeschlagen hatte, war auf eine Kette von Ereignissen zurückzuführen, die er, darauf angesprochen, nur sehr knapp zu kommentieren pflegte: Kurz nach seinem zweiundzwanzigsten Geburtstag sei sein Vater gestorben, im folgenden Jahr sei er Marion begegnet, habe sie geschwängert und aus dem daraus erwachsenden Verantwortungsgefühl den ersten kommerziellen Auftrag seines Lebens angenommen: Zwei Tage lang habe er Seifen aus der Kollektion einer Kosmetikfirma abgelichtet, am dritten sei er in das Sekretariat der Hochschule gegangen, um zu exmatrikulieren.
Daniel mehr zu dieser Zeit des Umschwungs zu entlocken, war unmöglich; er hielt das Kapitel verschlossen, auch dann, wenn ein anderer es aufklappen wollte. Ja, es wirkte so, als habe er ein düsteres Geheimnis zu verbergen, eine Leiche im Kellerabteil seiner Jugend. Tatsache war aber, dass er selbst nichts mehr aus dieser Phase seines Lebens wusste. Das Kapitel ließ sich auch von ihm nicht öffnen, die Seiten waren verklebt, und die wenigen Daten, die er noch wiederzugeben vermochte, musste er mühevoll rekonstruieren. Der Duft nach Lavendel und Marions gerundeter Bauch, das blieben seine einzigen unmittelbaren Erinnerungen an die Jahre 1984 und 1985.
Was danach geschehen war, trat wieder deutlicher in sein Bewusstsein. Als die Zwillinge zur Welt gekommen waren – sie wurden nach Marions Großeltern Anna und Michael genannt –, verstärkte er seine beruflichen Aktivitäten. Er fotografierte Pommes frites und Apfelstrudel für die Speisekarten einer Autobahnraststättenkette und nahm für den Hochglanzprospekt einer Zierpflanzengroßgärtnerei Forsythien und Rhododendren auf. In den Bereich der Industrietechnik verschlug ihn schließlich das kulante Angebot eines Bekannten. Seither hatte er die fachgerechte Darstellung von Motor- und Getriebeteilen in Gebrauchsanweisungen und Katalogen zu verantworten, gelegentlich auch die Bebilderung des einen oder anderen Artikels in diversen Fachzeitschriften. Zweimal jährlich, wenn der Prospekt eines Baumarkts auf seiner Agenda stand, war es ihm möglich, die Sujets vor seiner Kamera zu identifizieren, denn Gartenmöbel, Heckenscheren und Vorschlaghämmer kannte selbst der Laie. Daniel irritierte nur, dass ihm dabei vom zuständigen Art-Director ein paar drittklassige Models aufgenötigt wurden, die (überschminkt, mit wasserstoffgebleichten Haaren und winzigen Bikinis) das Sortiment erfrischend sexy präsentieren sollten. Während er versuchte, ihre schlaffen Körper so penibel auszuleuchten, dass Orangenhaut und Krähenfüße keine Schatten warfen, überkam ihn manchmal der Gedanke, dass sich diese Frauen von den Gartenmöbeln überhaupt nicht unterschieden: Sie waren nicht mehr als Materie, tote Objekte, sie waren das traurige Treibgut einer abgestumpften Zivilisation.
Er selbst war mittlerweile fünfunddreißig, gut in Form und gut verheiratet; er hatte gute Kinder, die er – wie auch seine Frau – von Herzen liebte. Abends trank er guten Wein und rauchte gute Zigaretten. Selbst sein Job war halbwegs gut: Er deckte die laufenden Kosten und entsprach, wenn auch nur sehr am Rande, seinen alten, längst erloschenen Ambitionen.
«Das ist es doch, was du schon immer machen wolltest», hatte ihm sein Bruder Georg bei einem ihrer sporadischen Telefonate gesagt. Und Daniel hatte sanft in den Hörer genickt: «Wir haben beide, was uns zusteht: ich meine Linsen und du deinen Kautschuk.»
Georg lebte schon seit gut zehn Jahren in Amerika; im Zuge seines Studiums hatte er in Kalifornien ein Auslandssemester absolviert und war nach seiner Diplomierung in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt. In Los Angeles hatte er Arbeit gefunden – einen Job als Chemiker in einem Autozulieferbetrieb –, hatte ein Häuschen gemietet, eine unscheinbare Frau geheiratet und schien inzwischen (trotz des Umstands, dass die beiden kinderlos geblieben waren) das typische Leben des amerikanischen Mittelstandsbürgers zu führen, so wie man es auch in Europa aus Hollywoodfilmen kannte: ein Leben in der Linearität adretter, bis zum Horizont von gleichförmigen Bungalows gesäumter Vorstadtstraßen, ein schablonenhaftes Dasein mit gepflegtem kleinem Vorgarten, Garagenauffahrt und den beiden obligaten Pkw. Wahrscheinlich ein Geländewagen und ein Kombi; Daniel hatte seinen Bruder nie danach gefragt.
Seit seinem Exodus war Georg zweimal zu Besuch in Wien gewesen, das Gepäck zum Bersten voll mit Dingen, die man auch in Österreich in jedem Supermarkt bekommen konnte, und den Mund zum Bersten voll mit Lobliedern auf den American Way of Life. Gerade er, der einstige Rebell und passionierte Konsument hypnotischer und psychedelischer Substanzen (tausend bunte Gründe für ein Studium der Organischen Chemie), verherrlichte nun einen Lebensstil, der in den Augen Daniels auf kollektiver Oberflächlichkeit, Gewinnsucht und Gesundheitsfanatismus, einem unerbittlichen gesellschaftlichen Zwang zur Uniformität und einem Höchstmaß an Verschleiß von stofflichen und menschlichen Ressourcen gründete. Die Arbeit Georgs sprach für sich: Als Werkstoffchemiker entwickelte er neue Gummimischungen im Dienst der Reifenindustrie, was aber keineswegs bedeutete, dass er um die Verbesserung der Qualität, der Sicherheit beziehungsweise Haltbarkeit der Pneus bemüht war. Nein, der Auftrag seiner Firma lautete, den Gummiabrieb so zu steigern, dass sich jeder Autofahrer in bestimmten, von den Ökonomen in der Chefetage kalkulierten Intervallen neue Reifen kaufen musste.
Was auch immer seinem Bruder anzukreiden war, im Stillen musste Daniel sich eingestehen, dass ihr Verhältnis sich durch Georgs Abschied nach Amerika gebessert hatte – trotz der Differenz, die diesem Abschied seinerzeit vorausgegangen war. Im Verlassen von sinkenden Schiffen war der um zwei Jahre ältere Georg schon immer der Flinkere gewesen, aber damals hatte er ein wahres Meisterstück an Rücksichtslosigkeit geliefert. Vierzehn Tage nach dem Hirnschlag ihrer Mutter war er mit Sack und Pack in den Flieger gestiegen, hatte Europa den Rücken gekehrt und Daniel mit einem Pflegefall der Stufe drei in Wien zurückgelassen: Das motorische und sprachliche Niveau der Mutter war – mit einem sprichwörtlichen Schlag – auf den Stand eines Säuglings zurückgesackt, sodass sich Daniel unverhofft als dreifacher Vater wiederfand: als Vormund zweier Neugeborener und einer achtundvierzigjährigen Frau. Dass ihn die letzten zwei Trabanten seiner Jugendzeit verlassen hatten – seine Mutter geistig und sein Bruder körperlich –, bedeutete ein weiteres Verlöschen der Vergangenheit. Daniel hatte seine Chronisten verloren, er war nun endgültig Vollwaise.
Hätte Marion ihn bei diesen Siebenmeilenschritten ins Erwachsensein nicht so beherzt begleitet, Daniel würde sich wohl endgültig von Georg abgewendet haben. Aber durch ihr wohldosiertes Mitgefühl und ihre Unermüdlichkeit bei der Bewältigung des anfänglichen Chaos (endlose Telefonate mit Ärzten und Versicherungen, ständiges Wechseln von Baby- und Inkontinenzwindeln, sogar die Organisation der notwendigen Renovierungsarbeiten in seiner elterlichen Wohnung in der Josefstadt) ermöglichte sie ihm, die räumliche Distanz zu seinem Bruder nicht nur zu verkraften, sondern zunehmend als Chance zu betrachten. Eine Chance darauf, sich nun auch innerlich von seinen einstigen Bezugspersonen zu befreien, die alten Muster abzuschütteln, sich gewissermaßen selbst neu zu erschaffen. Und so hatte er im Lauf der Jahre wieder mit Georg zu reden begonnen, selten zwar, doch – und das war bemerkenswert – mit einem Anflug von ehrlich empfundenem Wohlwollen.
Einmal war er sogar kurz davor gestanden, mit Marion und den Kindern nach Los Angeles zu fliegen: Zur Feier von Annas und Michaels achtem Geburtstag hatte er Tickets besorgt. Doch am Tag vor der Abreise hatten die Kinder zu fiebern und über heftige Schmerzen zu klagen begonnen: Sie waren an Mumps erkrankt, natürlich zeitgleich, wie es sich für Zwillinge gehört. Am Abend hatte Daniel bei seinem Bruder angerufen, um ihn von dem Missgeschick zu informieren.
«Die armen Kleinen», hatte Georg angemerkt. «Sie haben sich doch sicher schon auf Disneyland gefreut.»
«Wir werden es beizeiten nachholen», hatte Daniel erwidert, und er hatte es sich nicht verkneifen können, einen kleinen Seitenhieb hinzuzufügen: «Abgesehen davon weiß man nie, wofür es gut ist; mir war sowieso nicht wohl bei dem Gedanken, unsere Mutter hier so lang allein zu lassen, ohne Unterhaltung und Gesellschaft.»
In der Tat kam Daniel die Absage der Reise nicht ganz ungelegen, aber weniger aus Sorge um die Mutter als aus einem grundsätzlichen Hang zur Immobilität. Er konnte Menschen, die, danach gefragt, was sie mit einem Lottosechser machen würden, ansatzlos und mit verklärtem Blick verkündeten, sie würden reisen, einfach nicht verstehen. Denn Reisen hieß für ihn, mit sperrigem (und dennoch immer unvollständigem) Gepäck beladen, mittels einer teuren und mühevollen Prozedur von A nach B zu wechseln, nur um dann in B die gleichen Autos auf den gleich geteerten Straßen und die gleichen Waren in den gleich möblierten Filialen großer Handelsketten zu bestaunen. Oder sich in einer Sprache einwickeln und ausnehmen zu lassen, die man allenfalls mangelhaft beherrschte.
Ohne seine Muttersprache fühlte Daniel sich schutzlos; pure Mimik oder Gestik waren für ihn ein steter Quell von Missverständnissen, sie konnten klare Worte nicht ersetzen. Insofern war sein versteckter Vorwurf gegenüber Georg doppelt unfair: Von Verständlichkeit war bei der Mutter nämlich keine Rede mehr. Geschweige denn von Unterhaltung.
Marions Bemühungen war es zu danken, dass man sie nach ihrem Schlaganfall in einem Pflegeheim in Klosterneuburg aufgenommen hatte, wo sie nun das Leben einer leidlich konservierten Zimmerpflanze führte. Daniel besuchte sie zwar regelmäßig, aber ohne jeden inneren Ansporn; alle vierzehn Tage stieg er in den Zug, um, wie er sagte, seine Pflicht als Sprössling zu erfüllen. Im Sommer spürte er die Mutter meist im Park auf, grau und welk und mit gesenktem Kopf in ihrem Rollstuhl kauernd, aber mit weit aufgerissenen und unnatürlich starren Augen. Wenn die Tage kühler wurden, fand er sie im Inneren des Sanatoriums, in irgendeiner Ecke des Gesellschaftsraums von irgendeinem Pfleger abgestellt, wo sie genauso dumpf und sprachlos auf den Boden stierte. Ihre Pose blieb die Jahre über unverändert, einzig die Kulisse wechselte von Zeit zu Zeit.
Der Garten breitete sich nun vor Daniel aus, er hob und senkte sich in sanft geschwungenen Terrassen völlig unterschiedlichen Charakters. Linker Hand, im Schatten kaum zu sehen, die dunkle und erdige Ecke, ein indischer Dschungel, von wuchernden Büschen gesäumt, rechts oben das schottische Hochplateau, dessen nördlicher Ausläufer von einem mächtigen Nussbaum markiert wurde. Schräg gegenüber ein mit Wildkräutern bewachsenes Alpinum, wie es in den Siebzigern bei Hobbygärtnern so beliebt gewesen war. Es gab die geheimen, vergessenen Landschaften und die von Hand kultivierten Regionen, kurz: Der Garten war eine ganze, vollkommene Welt.
Im Himmel über dieser Welt aber hing jetzt ein großes Fragezeichen: Was hatte Daniel nach seinem heutigen Besuch im Pflegeheim hierhergetrieben? Lag es wirklich nur an diesem Stück Papier von gestern Abend?
Auf der alten Truhe in der Josefstädter Wohnung hatte es auf ihn gewartet, das Kuvert. Es hatte sich in einem Berg aus anderen Schriftstücken versteckt gehalten, die sich Tag für Tag im Briefkasten ablagerten wie Schlacke auf einer Abraumhalde: Flugblätter von Umzugsfirmen, Teppichhändlern und Installateuren, Bittschreiben von Menschenrechts- und Kinderhilfs- und Tierschutzorganisationen, Postwurfsendungen verschiedener Versandhäuser und Restaurants. Der Umschlag wäre wohl zusammen mit dem anderen Müll im Altpapier gelandet, hätte Anna auf der Suche nach einer verloren geglaubten Haarspange nicht zufällig den Absender gelesen.
«Schau doch, Papa: Sander, war das nicht der Mädchenname von der Omama?» Auf Zehenspitzen (ihrer kürzlich erst erwachten Liebe zum Ballett geschuldet) brachte Anna Daniel das Kuvert.
Die zittrige und schräggestellte Handschrift ließ den Schluss zu, dass der Brief von einem relativ betagten Menschen stammte, und der Name auf der Rückseite des Umschlags bestätigte den Eindruck. Er lautete Ruth Sander.
«Und? Wer ist das?», fragte Anna.
«Deine Groß-, nein … deine Urgroßtante», antwortete Daniel.
In der breitgefächerten Familiengenealogie der Sanders und Kowalskis hatte er sich nie sehr firm gefühlt, der Clan der mütterlichen Seite aber hatte in der Zeit des Dritten Reichs so sehr an Umfang eingebüßt, dass wenigstens die kargen Reste leicht zu überschauen waren: Wie eine Handvoll vertrockneter Blätter hingen sie an ihrem toten Stammbaum. Ruth und Jakob Sander waren Daniel also – wenn auch nur vom Hörensagen – ein Begriff: Bis zum Ende der siebziger Jahre hatte ihre Geschichte zum oft strapazierten Erzählinventar seiner Eltern gehört; sie hatten als Verkörperung der jüdischen Diaspora gegolten, als ewige Opfer des großen Martyriums, deren Leid mit jeder Katastrophe, die sie überlebten, nur noch weiterwuchs. Dann aber hatten sie etwas getan, das ihren Namen den Geschmack einer neuen, andersgearteten Bitterkeit verlieh, sodass sie fortan nicht mehr in den Mund genommen wurden – von der Mutter aus persönlicher Gekränktheit und gerechtem Zorn, vom Vater, um Konflikte mit der Mutter zu vermeiden.
Vor dem Krieg war Jakob Sander so wie auch sein Bruder Leon, Daniels Großvater, bei einer Hamburger Handelsagentur beschäftigt gewesen. Als stolzer Prokurist der Wiener Niederlassung und nicht minder stolzer junger Vater eines Sohns und einer Tochter hatte er die düsteren, aus dem Norden aufziehenden Wolken ignoriert – zum Teil aus einem angeborenen Mangel an Vorstellungskraft, zum Teil wohl auch, um seine Frau Ruth nicht zu verängstigen. Er war, salopp gesagt, so lange ohne Schirm und Regenhaut durch Wien spaziert, bis das Gewitter losbrach.
Im März des Jahres 1938 büßten die zwei Brüder mehr als nur die Arbeit ein.
Sobald die erste Welle der Pogrome in der nunmehrigen Ostmark abgeebbt war, schickte Jakob Ruth und die Kinder mit dem Zug nach Innsbruck, in der Hoffnung, sie würden dort bei Freunden unterkommen. Dann fuhr er mit Leon an den Weidlingbach im Westen Wiens, an dem das Elternhaus der Brüder stand.
Die Mutter und der Vater lagen hinter einem Holzstoß, von marodierenden Nazis ermordet und mit einer Handvoll Laub bedeckt. Dass Leon weitsichtiger gewesen war als Jakob, hatte ihnen nicht das Leben retten können: Noch im Februar hatte Leon versucht, für sich und seine schwangere Frau und eben auch die Eltern Dauervisa nach Australien zu bekommen, die ihm aber unter Hinweis auf das fortgeschrittene Alter seines Vaters schlicht verweigert worden waren.
Die schockierten Brüder trennten sich, um noch zu retten, was vielleicht zu retten war. Sie sollten einander nicht wiedersehen. In der Nacht auf den 10. November, also in der von den Nazis so genannten Reichskristallnacht, kam nach stundenlangen Wehen Leons Tochter Miriam – Daniels Mutter – auf die Welt, und tags darauf entschlossen sich die jungen Eltern, mit dem Baby Richtung Ungarn aufzubrechen: von der Traufe in den Regen, wie sie damals dachten. Im zu dieser Zeit bereits als judenrein gerühmten Burgenland gelang es ihnen, bei zwei alten Bauern Aufnahme zu finden, die sich scheinbar nicht für ihre Herkunft interessierten.
Als Leon am nächsten Morgen zur Erkundung des Geländes aus dem Haus ging, griff ihn die Gestapo auf – und schob ihn prompt nach Ungarn ab. Von Frau und Kind getrennt, begab er sich auf eine jahrelange Irrfahrt, deren Einzelheiten später nur sehr fragmentarisch nachvollzogen werden sollten. Tatsache war aber, dass die Odyssee von Daniels Großvater kurz vor dem Kriegsende an ihren Ausgangspunkt zurückführte: Im März 1945 wurde Leon gemeinsam mit zweihundert weiteren jüdischen Zwangsarbeitern ins burgenländische Rechnitz transportiert, von einer fröhlichen Horde betrunkener Nazis erschossen und auf einem Feld verscharrt.
Keine zwei Kilometer entfernt erwarteten in diesen Tagen Leons Frau und die inzwischen sechsjährige Miriam den Einmarsch der Russen: Sie waren über all die Jahre von dem alten Bauernpaar versteckt worden, das sich als tapfer, gütig, subversiv und stur erwiesen hatte.
Daniel war mitten auf dem Rasen stehen geblieben. Er zog das Kuvert hervor, das er am Morgen aus der Josefstädter Wohnung mitgenommen hatte, und betrachtete die Briefmarken. Unter der Flagge Israels mit dem zentralen blauen Davidstern zwei Schriftzüge, der eine auf Hebräisch (und daher für Daniel unlesbar), der andere auf Englisch: 100 years since the 1st Zionist Congress 1897.
Großonkel Jakob hatte sein Heil in der anderen Richtung gesucht. Gleich nach der Trennung von Leon war er nach Tirol gefahren, zu seinen Innsbrucker Freunden, bei denen er seine Frau Ruth und die Kinder wähnte. Seine Freunde aber waren keine mehr: Statt ihn auch nur in ihre Wohnung einzulassen, raunten sie ihm durch den Türspalt zu, dass Ruth zwar hier gewesen sei, dass sie ihr aber nachdrücklich geraten hätten, sich – schon um der Kleinen willen! – von Innsbruck fernzuhalten. Jakobs Frau sei also wieder aufgebrochen, weiter nach Vorarlberg, von wo aus sie versuchen wolle, mit den Kindern in die Schweiz zu kommen. Für den Fall, dass ihr die Flucht gelingen sollte, würde sie nach Zürich weiterreisen.
Anfang Mai 1938 überquerte Ruth Sander die Alpen. An den Füßen trug sie sommerliche Leinenschuhe, auf den Armen ihren zweijährigen Sohn und ihre dreijährige Tochter. Ihre Kräfte waren aufgezehrt, als sie an einem kühlen Morgen einem Schweizer Grenzwachtkommandanten in die Arme lief. Statt sie befehlsgemäß nach Österreich zurückzuschicken, erbarmte sich der Polizist und brachte sie zu seinem Hauptmann nach St. Gallen, einem Mann namens Paul Grüninger, der dafür bekannt war, Flüchtlingen entgegen den Bestimmungen die Einreiseerlaubnis zu erteilen (aufgrund dieser Praxis sollte Grüninger ein Jahr darauf fristlos entlassen, vor Gericht gestellt und wegen Pflichtverletzung und Urkundenfälschung verurteilt werden). Ruth und die zwei Kleinen durften bleiben; sie begaben sich nach Zürich, wo sie – voller Sorge, voller Zuversicht – auf Jakob warteten.
Und dieser traf drei Wochen später wirklich ein. Sein Retter war Ernest Prodolliet gewesen, ein Beamter der Schweizer Gesandtschaft in Bregenz, der, mit Diplomatenpass und einem Auto ausgestattet, höchstpersönlich Fluchthilfe zu leisten pflegte.
Durch den Beistand eines Schweizer Hilfswerks waren Ruth und Jakob bald wieder vereint; sie fanden in der Nähe Zürichs eine Unterkunft und schworen sich, nie wieder österreichischen Boden zu betreten.
Nach zehn Jahren hatten sich die Sanders halbwegs eingelebt. Sie wohnten nun in Rapperswil am östlichen Ufer des Zürichsees, wo Jakob eine Anstellung als Buchhalter gefunden hatte. Sie erfreuten sich an ihren Kindern – Hans und Hedda – und standen unterdessen auch im brieflichen Kontakt mit Leons Witwe, deren Wiener Wohnadresse sie ermitteln hatten können. Alles andere als privat war aber eine Mitteilung, die sie im Frühjahr 1949 zugestellt bekamen. Das Schreiben stammte von der kantonalen Fremdenpolizei und lautete:
Die neuliche Anerkennung des Staates Israel hat für die Ausreise nach Palästina wesentliche Erleichterung geschaffen. Wir weisen speziell Sie darauf hin, jede sich bietende Gelegenheit zur Auswanderung zu benützen. Sie stehen in einem Alter, in welchem Ihnen die Ausreise nach Israel zugemutet werden darf. Ferner dürfen Sie aus der Tatsache, derzeit noch erwerbstätig sein zu dürfen, nicht den Schluss ziehen, dass es so bleiben wird. Sie müssen vielmehr damit rechnen, dass die seinerzeit erteilte Arbeitsbewilligung bei der gegenwärtig rückläufigen Bewegung des Arbeitsmarktes widerrufen wird.
Im Herbst desselben Jahres liefen die Sanders mit dem Dampfschiff Galiläa im Hafen von Haifa ein. Die laute, fremde Welt, die sie empfing, versetzte Ruth und Jakob einen weiteren Schock, und trotzdem schien ihnen der Preis, in Chaos, Staub und Hitze alt werden zu müssen, für die Sicherheit von Hans und Hedda nicht zu hoch. Die Kinder selbst waren von der neuen Heimat wie verzaubert. Sie bejubelten die kollektive – und seit kurzer Zeit auch nationale – Aufbruchsstimmung mit einer Begeisterung, die Ruth und Jakob schon alleine deshalb nicht zu teilen vermochten, weil sie der Aufbruchsstimmungen müde waren.
Jakob widmete sich in der Folge der Vergangenheit: Von Tel Aviv aus strengte er mit Hilfe eines Wiener Anwalts ein Verfahren zur Rückgabe des Weidlingbacher Hauses an, das nach dem Mord an seinen Eltern von einem reichstreuen Fleischermeister in Besitz genommen worden war. Drei Jahre später wurde das Haus restituiert; es fiel zur Hälfte an Jakob, zur Hälfte an Daniels Großmutter zurück.
Am 16. März 1954 stieg die neunzehnjährige Hedda Sander in den Bus vom Roten Meer nach Tel Aviv. Es war schon Nacht, als auf den steilen Serpentinen des Machtesch Ramon, eines mächtigen Kraters in der Wüste Negev, das Feuer auf den Bus eröffnet wurde. Hedda starb zusammen mit zehn anderen der vierzehn Passagiere; die Spuren der Mörder verloren sich im Sand der nahen jordanischen Grenze.
Heddas Bruder Hans war einunddreißig, als er während des Sechstagekriegs im Juni 1967 bei einem Einsatz über den Golanhöhen abgeschossen wurde. Er hatte nach der Ausbildung zum Kampfpiloten eine junge, russischstämmige Israelin aus Safed geheiratet und einen Sohn mit ihr bekommen, der am Tag des Kriegsbeginns sieben Jahre alt geworden war.
Die mageren Reste, die sie noch an Menschenliebe in sich finden konnten, konzentrierten Ruth und Jakob nun auf diesen ihren Enkelsohn Daniil (der Zufall wollte es, dass Daniels israelischer Cousin zugleich sein Namensvetter war). Aus Sorge um den Kleinen dachten sie sogar an einen weiteren Exodus: Sie schlugen ihrer Schwiegertochter vor, mit ihnen und dem Buben nach Amerika zu gehen. Doch Daniils Mutter lehnte ab, weil sie der Ansicht war, dass Hans umsonst für Israel gestorben wäre, wenn sein Sohn es nun verließe.
Auf dem Rücken liegen, weich im frisch geschnittenen Gras, und in den Himmel staunen. Leises Blätterrauschen, ab und zu das Brummen einer Hummel. Die langgezogenen Pfiffe der Mauersegler, zart wie Glasfäden über das Firmament gespannt. Man sollte diese Hymne eines frühen Sommers malen können …
Aus der offenen Haustür dringt das Schrillen des Telefons, und Daniel hält unbewusst den Atem an. Es läutet nicht so oft, das Telefon; der sanft geschwungene, aus schwarzem Bakelit geformte Zauberapparat mit seiner abgenutzten Wählscheibe wird eigentlich nur dann genutzt, wenn im Familien- oder Bekanntenkreis etwas geschehen ist, das der umgehenden Mitteilung bedarf. Er ist den Weichen vorbehalten, die den Schienenstrang des Alltags unterbrechen, und sein durchdringendes Klingeln schlägt für einen Augenblick die Brücke zwischen Hoffnung und Angst: Es unterscheidet nicht zwischen Tragödien und Glücksfällen.
An diesem Vormittag ist es eine Tragödie. Daniel erkennt es an den bebenden, gesenkten Stimmen, an den Tränen seiner Mutter, am fahlen Gesicht seines Vaters.
«Daniil», hört Daniel immer wieder.