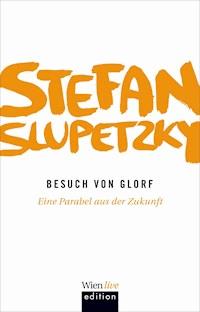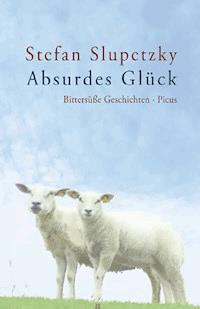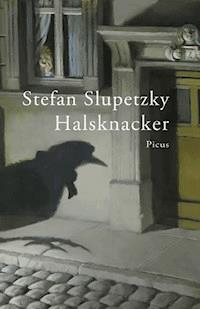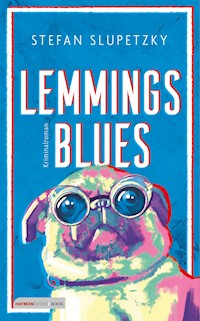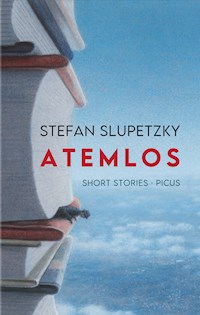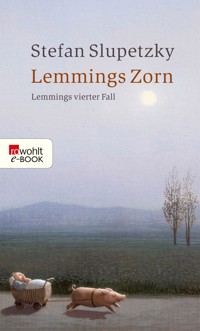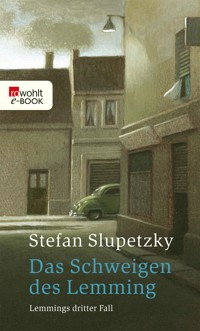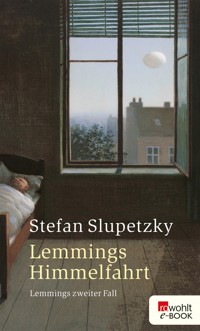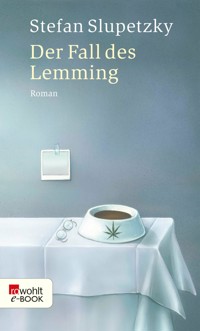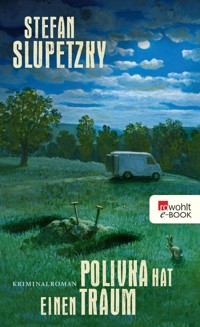9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Privatdetektiv Lemming ermittelt
- Sprache: Deutsch
Eine Straßenbahn, ein ehemaliger Kriminalbeamter und zwei schräge Vögel: Der Lemming ist zurück. Der junge Straßenbahnfahrer Theo Ptak ist jedenfalls bis über beide Ohren in eine Frau verliebt, die jeden Morgen in seinen Triebwagen steigt. Eines Tages muss er entsetzt mit ansehen, wie sie von zwei Männern entführt wird. Theo bittet den ehemaligen Kriminalbeamten Leopold Wallisch, auch Lemming genannt, um Hilfe. Widerwillig macht sich der Lemming mit Theo auf die Suche nach den Kidnappern, und bald stoßen die beiden auf die erste Leiche, einen Reisejournalisten. Was zwei seltsame Vögel namens Kaspar und Pannonia mit diesem Fall zu tun haben, liegt noch im Dunkeln. Sie sitzen kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg im Laderaum eines Ostindienseglers und fahren die afrikanische Küste entlang.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Stefan Slupetzky
Die Rückkehr des Lemming
Privatdetektiv Lemming ermittelt
Kriminalroman
Über dieses Buch
Eine Straßenbahn, ein ehemaliger Kriminalbeamter und zwei schräge Vögel: Der Lemming ist zurück.
Der junge Straßenbahnfahrer Theo Ptak ist jedenfalls bis über beide Ohren in eine Frau verliebt, die jeden Morgen in seinen Triebwagen steigt. Eines Tages muss er entsetzt mit ansehen, wie sie von zwei Männern entführt wird. Theo bittet den ehemaligen Kriminalbeamten Leopold Wallisch, auch Lemming genannt, um Hilfe.
Widerwillig macht sich der Lemming mit Theo auf die Suche nach den Kidnappern, und bald stoßen die beiden auf die erste Leiche, einen Reisejournalisten.
Was zwei seltsame Vögel namens Kaspar und Pannonia mit diesem Fall zu tun haben, liegt noch im Dunkeln. Sie sitzen kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg im Laderaum eines Ostindienseglers und fahren die afrikanische Küste entlang.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Oktober 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Umschlagillustration Kai Würbs
ISBN 978-3-644-40135-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
1.
Der Mensch ist der Windstoß unter den Bäumen.
Wenn ihm die Natur etwas geschenkt hat, das ihn von der Pappel unterscheidet, ist es weniger sein weiches Hirn als vielmehr sein bipedischer Bewegungsapparat. Die Beine haben ihm am Anfang seiner Hominisation dazu gedient, mit einer griesgrämigen Miene, die ihm die Genetik ohnehin auf das Gesicht geschneidert hatte, neue Jagdreviere zu erschließen; erst nach mehreren Jahrmillionen fanden sie dann auch bei Einkaufsbummeln und beim klassischen Ballett, beim Nordic Walking und bei Mondspaziergängen Verwendung.
Umso interessanter, dass der Mensch im Laufe seiner jüngeren Entwicklung nichts unversucht gelassen hat, um Fortbewegungsarten ohne Beine zu ersinnen – ohne eigene Beine jedenfalls. Wenn die Eroberung der Meere das noch nahelegt (die ersten Einbäume sollen schon im Mesolithikum gefertigt worden sein) und wenn auch die verschrobene Idee des Reitens auf dem Rücken anderer Lebewesen (Elefanten, Strauße, Esel und natürlich Pferde) halbwegs akzeptabel, weil begründbar ist, so kann die Praxis der ägyptischen und babylonischen Elite, sich in Sänften hin- und hertragen zu lassen, nur als dekadent bezeichnet werden. Als die unsympathische Marotte einer Schickeria, die sich, weil sie hundertmal so reich ist wie der Rest der Welt, auch gleich für hundertmal so wertvoll hält.
Dagegen, grübelt Theo, während er geduldig hinter einem Taxi wartet, das in zweiter Spur gehalten hat, ist doch die Krone jeglichen Verkehrs der öffentliche. Nur ein Mensch, der hundert andere transportiert: ein wahrer Held der Neuzeit, ein Odysseus des Verkehrswesens, der sich vom Helden der Ilias höchstens dadurch unterscheidet, dass er seine Passagiere niemals in die Irre führt.
Obwohl die Straße breit ist und die Gegenfahrbahn frei, kann Theo an dem vor ihm stehenden Mercedes nicht vorbeifahren, auch wenn er das gerne täte. Schienen kennen keine Abweichung, sie sperren sich gegen jeden Umweg, weil sie fest darauf beharren, der einzig gültige, der einzig zielführende Weg zu sein. Freilich ein Weg, in den die anderen Verkehrsteilnehmer immer wieder Steine legen. Bei der nächsten Haltestelle werden Theo wieder vorwurfsvolle Blicke, wenn nicht gar geballte Fäuste und Verwünschungen erwarten. Keiner wird verstehen, dass Heldentum und Pünktlichkeit zwei grundverschiedene Kategorien sind. Aber bitte, auch Odysseus ist zehn lange Jahre unterwegs gewesen, und auch er ist während seiner Reise selten freundlich aufgenommen worden. Offene Arme? Nein. Schon gar nicht an der Endstation. Die kleinen Helden lästert man, die großen nagelt man ans Kreuz.
Ein freundliches Grüß Gott hört Theo nie, ein Danke schön nur selten. Wenn er in der Haltestelle fünf Sekunden wartet, um noch einen rasch herbeilaufenden Fahrgast aufzunehmen, kann es schon geschehen, dass ihm der solcherart Begünstigte ein nettes Wort schenkt – aufgewogen allerdings durch die Beschwerden anderer Passagiere, die das Amen im Gebet des goldenen Wienerherzens bilden: «Stehen kann ich zu Hause auch!», heißt es dann, oder: «Meiner Seel, die Nächstenliebe!», oder auch: «Ey, Alter, bist du Straßenbahn oder Sozialverein?»
So bunt und vielgestaltig die Horde der Fahrgäste auch sein mag, etwas eint sie, und das ist eine latente Unzufriedenheit. Kaum einer, der sich nicht das Privileg einer privaten Sänfte wünschte: ein eigenes Auto, in dem er – abseits der optisch, olfaktorisch und akustisch unerquicklichen Präsenz der anderen – durch die Stadt fahren könnte. Kurz gesagt: Die Frustration ist der einzige Fahrgast, der nie aussteigt.
Einen aber gibt es, der sich in der Tramway wie im siebten Himmel fühlt, obwohl – oder vielleicht gerade weil – er selbst nicht höher als drei Käse ist.
«Zu spät, Herr Ptak!» Der pummelige Zehnjährige klettert durch die offene Falttür, wuchtet seine Schultasche auf einen freien Platz und stellt sich dann auf seinen angestammten Posten direkt hinter Theos Fahrersitz. «Schon wieder zwei Minuten in Verzug; jetzt müssen wir dazuschauen!»
«Servus, Fabian», seufzt Theo und verdreht die Augen. Ja, der Kleine geht ihm manchmal auf die Nerven, trotzdem mag er ihn, den Buben, dessen größter Wunsch es ist, in seine, Theos, Fußstapfen zu treten und den roten Wurm, wie er die Straßenbahn bezeichnet, durch die Stadt zu lenken (ein Begriff, der im Zusammenhang mit einem Schienenfahrzeug fragwürdig erscheint). Die meisten anderen Kinder sehen sich als zukünftige Tiefseeforscher oder Astronauten, und auch Theo selbst ist ja in diesem Alter hochtrabenden Zukunftsplänen nachgehangen: Ein berühmter Jazzmusiker wollte er werden. Theo Ptak, in einem Atemzug genannt mit Charlie Parker, Dexter Gordon und John Coltrane!
Letztlich haben seine Fähigkeiten leider nur dazu gereicht, ein Engagement bei den Verkehrsbetrieben zu ergattern. Angesichts der dauernd wechselnden und nicht gerade fürstlich honorierten Arbeitszeiten ist es noch ein Glück, dass er trotz seiner achtundzwanzig Jahre keine Kinder hat. Dass er bisher auch keiner Frau begegnet ist, die unter diesen Umständen eine Familie mit ihm gründen wollte, ist dagegen kein Glück. Aber eben auch kein Wunder.
Dienstag, sieben Uhr dreiunddreißig, Julius-Tandler-Platz. Noch fließt das Leben wie die schöne blaue Donau, nämlich grau und monoton. Zwei Haltestellen später, an der Augasse, wird sich schlagartig alles ändern. Denn so ist das Schicksal: Es bewegt sich nicht auf Schienen.
Theo kann sie schon von weitem sehen: eine junge Frau, von einer Menschenschar umringt, die etwa in der Mitte der Station der Straßenbahn entgegenschaut. Sie unterscheidet sich in nichts von all den anderen Wartenden; rein äußerlich entspricht sie vollkommen dem Durchschnitt: mittelgroß und mittelschwer, die mittelbraunen Haare mittellang, normal gekleidet (eine dunkelgraue Strickjacke und eine beige Bluse, Jeans und Turnschuhe), mit einem Mittelding aus Handtasche und Rucksack an den Schultern. Trotzdem sticht sie aus der Schar der anderen heraus, als wäre – wie in einer Filmszene – ein Scheinwerfer auf sie gerichtet, der sie schon von fern als Hauptfigur erkennbar macht.
Als Hauptfigur für Theo jedenfalls.
«Was tun Sie denn, Herr Ptak? Wir müssen doch …» Der kleine Fabian verstummt, ihm fehlen die Worte vor Bestürzung. Theo hat den Triebwagen zu früh zum Stehen gebracht (fast zehn Meter vor dem korrekten Haltepunkt!), sodass die Fahrertür sich etwa in der Mitte der Station befindet. Fluchend setzen sich die Leute aus dem vorderen Bereich der Haltestelle in Bewegung, eine träge, aber aufgebrachte Masse, die den Rest des Tages ob des frühen Ärgernisses schon um diese Uhrzeit abgeschrieben hat.
Die Falttür neben Theo öffnet sich und gibt den Blick auf eine graue Strickjacke und eine beige Bluse frei. Kein Dienst nach Vorschrift, aber – rein navigatorisch – Maßarbeit. Die Meute zetert.
«Guten Morgen», sagt die scheinbar Unscheinbare und nickt Theo zu, bevor sie sich am immer noch verstörten Fabian vorbeidrückt und sich in den hinteren Wagenteil begibt.
«Äh, guten Morgen», nuschelt Theo. Viel zu leise, viel zu spät, sie kann es nicht mehr hören. Die bösen Blicke und Bemerkungen der anderen hereindrängenden Passagiere perlen an ihm ab, er überlegt nur noch, wie er sich für den ungewohnten Morgengruß bedanken kann, ohne das Fahrerpult zu verlassen. Kurzerhand greift er zum Mikrophon, das eigentlich nur für den Notfall vorgesehen ist – oder für die Ansage der Haltestellen, falls die Tonbandstimme ausfällt.
«Guten Morgen.» Theo hört die Worte durch den Wagen hallen, er spürt, wie ihm die Röte ins Gesicht steigt. Während er beschleunigt und die Augasse entlang dem Liechtenwerderplatz entgegensteuert, schaut er in den Innenspiegel. Über Fabians entgeistertem Gesicht kann er weit hinten im Waggon den mittelbraunen Haarschopf sehen – und unter diesem Schopf den Anflug eines Lächelns. Grund genug, dass Theos Kopf endgültig die Befehlsgewalt verliert, es ist nur noch sein Mund, der jetzt das Sagen hat. Ein Mund, der fest entschlossen scheint, sein zaghaftes Getändel mit dem Mikrophon zu einer handfesten Romanze auszuweiten.
«Guten Morgen, meine Damen und Herren», sagt der Mund. «Es freut mich, Sie als Kapitän der Tramwaygarnitur 4028 auf der Fahrt vom Hauptbahnhof nach Nussdorf-Beethovengang begrüßen zu dürfen. Bitte verzeihen Sie den nicht ganz einwandfreien Halt bei unserem letzten Zwischenstopp; der Grund dafür war eine Bremskraftüberprüfung, die zumindest in technischer Hinsicht zur vollen Zufriedenheit ausgefallen ist. Auf unserer noch etwa dreizehnminütigen Fahrt ist mit gutem Reisewetter zu rechnen; in Nussdorf erwarten uns Sonnenschein und Temperaturen um die zwanzig Grad. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt und hoffe, Sie genießen Ihre Zeit bei uns an Bord. Unser nächster Halt: Liechtenwerderplatz.»
Das Lächeln im Heck des Waggons ist breiter geworden, und es hat sich mittlerweile in der Art eines Infekts auf eine Reihe anderer Passagiere übertragen. Ein gebrechlicher, auf einen Stock gestützter Mann durchquert den ganzen Wagen, nur um vorn bei Theo auszusteigen. «Schönen Tag noch, Herr Pilot», lacht er ihm zu.
Nicht ganz so nette Worte findet Fabian, als er sich an der Haltestelle Spittelau von Theo und dem roten Wurm verabschiedet. Er murmelt etwas von Missbrauch der Lautsprecheranlage, fügt ein «Sie haben mich sehr enttäuscht, Herr Ptak!» hinzu und geht dann hocherhobenen Hauptes seines Schulwegs, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Die scheinbar Unscheinbare wird noch sechs Stationen weiterfahren. Erst an der Grinzinger Straße wird sie aufstehen, einen letzten stillvergnügten Blick nach vorne werfen und den Zug verlassen.
Dass die Tramfahrer im Schichtdienst arbeiten, hat gute Gründe. Niemand will jahrein, jahraus fünf Tage wöchentlich bis weit nach Mitternacht hinter dem Steuer sitzen oder – auch an jedem Wochenende – schon um vier Uhr früh auf seinem Posten sein. Aus diesem Grund ändern die Fahrer alle sieben Tage ihren Schlaf- und Arbeitsrhythmus, bis das Rad sich nach drei Wochen neu zu drehen beginnt.
Zwei heitere Wochen ohne Fabian, denkt Theo, aber vierzehn trübe Tage ohne die scheinbar Unscheinbare. Dabei kann er noch von Glück reden, dass seine beiden freien Tage auf den Sonntag und den Montag fallen, geht er doch davon aus, dass er die Frau – wie eine Vielzahl anderer morgendlicher Fahrgäste – am Sonntag ohnehin nicht zu Gesicht bekommen würde.
Seit dem letzten Dienstag ist sie jeden Morgen an der Augasse gestanden, um zu Theo in den Triebwagen zu steigen. Noch am Mittwoch hat sie wieder in der Mitte der Station gewartet, sodass Theo den Zug – unter entrüsteten Protesten Fabians – abermals weit vor dem Haltepunkt zum Stehen brachte, aber schon am Donnerstag hat sie sich so positioniert, dass eine weitere Bremskraftüberprüfung überflüssig wurde. Seine kuriosen Lautsprecherdurchsagen hat er trotzdem beibehalten.
Es ist Samstagfrüh, sieben Uhr zweiunddreißig.
«Guten Morgen», sagt die scheinbar Unscheinbare.
«Guten Morgen.» Theos Stimme ist ein sanftes Schnurren.
«Schönen guten Morgen», nickt ihm nun auch eine hagere Frau mit wasserstoffgebleichten Haaren zu.
«Was geht, Mann», grinst ein circa Sechzehnjähriger mit einer grauen Skatermütze auf dem Kopf.
«Ahoi, Herr Kapitän», hört Theo einen Herrn mit Anzug und Krawatte sagen. Während er den Gruß erwidert und die Türen schließt, rückt er das Mikrophon zurecht.
«Liebe Fahrgäste, verehrte Damen, Herren und Kinder, wie immer freue ich mich, Sie im Morgenexpress nach Nussdorf begrüßen zu dürfen. Ich tue das heute mit Bedauern, weil ich diejenigen unter Ihnen, die die Linie D ausschließlich in der Früh benutzen, wegen meiner Diensteinteilung in den kommenden zwei Wochen leider nicht chauffieren werde können.» Hinter sich im Fahrgastraum kann Theo einen kollektiven Klagelaut vernehmen, der ihn an das mitleidige Aufseufzen eines fiktiven Sitcom-Publikums erinnert. «Allen anderen», spricht er weiter, «stehe ich ab Dienstag wieder zur Verfügung, und zwar zwischen fünfzehn Uhr und null Uhr fünfzig, übernächste Woche dann im Zeitraum zwischen zwölf und zweiundzwanzig Uhr. Nun bleibt mir, Ihnen eine gute Fahrt zu wünschen, mich im Namen der Verkehrsbetriebe für Ihr Vertrauen zu bedanken und mich auf ein Wiedersehen zu freuen.»
Die Reaktion der Fahrgäste ist einhellig: Sie spenden Theo einen halblauten, der frühen Stunde angemessenen Applaus. Nur Fabian verdreht die Augen. «Warum sagen Sie den Leuten nicht, dass Sie auch manchmal auf anderen Linien eingesetzt sind?»
«Viel zu kompliziert», meint Theo, während er wie nebenher den Kopf hebt und ein lächelndes Gesicht im Innenspiegel sucht.
Die Gewohnheit ist die Schildkröte unter den Leidenschaften.
Camel oder Marlboro, Melange oder Espresso, Missionar oder a tergo: Tägliche Gewohnheiten besitzen eine große Zähigkeit, meist eine größere als Vorschriften oder Verbote. Wenn das Glöckchen klingelt, legen sich die Speicheldrüsen in die Riemen, sprudeln los wie ein Gebirgsbach in der Frühlingszeit, weil Herrchen gleich den Schinken bringen wird. Der gute alte Pawlow hat das jetzt fünf Tage lang getan, das Klingeln soll ihn offensichtlich an die Fütterung erinnern; die Verdauungssäfte wallen hoch.
Fünf Tage nur, fünf Tage widerrechtlicher Gebrauch des Fahrermikrophons, und schon wächst sich die Eskapade zur Gewohnheit aus. Auch ohne die scheinbar Unscheinbare – also gleichsam ohne Schinken – lässt sich Theo nämlich nicht mehr davon abhalten, mit seinen Fahrgästen zu plaudern, sie mit wohlgesetzten Worten zu begrüßen und ihnen die geographischen und meteorologischen Gegebenheiten der bevorstehenden Reise zu erläutern. Er hat Blut geleckt, er ist auf den Geschmack gekommen. Alle drei bis vier Stationen fabuliert er los, als schöpfe er das Brackwasser aus einem lecken Kahn. Es ist ein neuer Rhythmus, einer, der den nicht vorhandenen Tagesrhythmus eines Straßenbahners wenn schon nicht ersetzen, so doch wenigstens vergelten kann. Ob Theo nun um drei Uhr nachts oder um drei Uhr nachmittags vom Wecker aus dem Schlaf gerissen wird: Er steigt mit einem Lächeln aus dem Bett, er freut sich auf den Arbeitstag, der ihm nicht wie bisher ein Rudel schlecht gelaunter Fahrgäste bescheren wird, sondern ein geneigtes Publikum.
Zwei Wochen sind vergangen, und er hat sie hauptsächlich am Fahrerpult des D-Wagens verbracht. Nur zweimal war er anderen Linien zugeteilt; so ist er einen Tag lang mit dem Sechser zwischen Rudolfsheim-Fünfhaus und Simmering gependelt, einen zweiten mit dem O-Wagen zwischen der Leopoldstadt und Favoriten. Auch auf diesen Gastspielreisen ist er mit den Passagieren auf Tuchfühlung gegangen, und er hat sich gleichzeitig dabei ertappt, die Gehsteige und Straßen abzusuchen, gegen jede Logik darauf hoffend, eine junge braunhaarige Frau in einer beigen Bluse zu erspähen.
Natürlich hat die Logik einmal mehr über die Hoffnung gesiegt, denn unglaubliche Zufälle passieren in Büchern oder auf der Kinoleinwand, aber nicht im echten Leben. Theo ist nun einmal keine Film- oder Romanfigur, und deshalb ist die Hoffnung unerfüllt dahingeschwelt, zwei Wochen lang bis heute, bis zu diesem Dienstagmorgen, an dem sich das schwerfällige Dienstrad endlich wieder auf die lang ersehnte Frühschicht dreht.
Der Mond hängt über Favoriten wie ein alter Mühlstein. Es ist kurz nach fünf, und Theo steht schon vor den Toren des Betriebsbahnhofs, obwohl er seine erste Fahrt erst um halb sechs antreten muss. Vereinzelt trudeln die Kollegen ein, den meisten steht der Schlaf noch ins Gesicht geschrieben, ihre Morgengrüße klingen wie das Krächzen eines fernen Krähenrudels.
Einmal Nussdorf und retour, der Mühlstein ist im Morgengrauen versunken, um dem gelben Käselaib der Sonne Platz zu machen. Theo gondelt schweigend durch die Stadt, er spart sich seine Kräfte für die zweite Fahrt auf, für die Haltestelle Augasse, wo er – die Hoffnung lodert heiß in seiner Brust – die scheinbar Unscheinbare wiedersehen wird.
Um sieben Uhr fünfundzwanzig bremst er hinter einem schwarzen Taxi ab, das in der Porzellangasse in zweiter Spur gehalten hat. Mit einem leisen Fluch drückt Theo auf den Klingelknopf, Geduld ist heute kein Kriterium für ihn, im Gegenteil, er würde den Mercedes liebend gern mit einem Schiffshorn von der Straße fegen, bis zur Donau, bis hinauf zum Kuchelauer Hafen würde er ihn blasen, doch er hat kein Schiffshorn, er hat nur die jämmerliche Klingel, die seiner Verärgerung nicht annähernd gerecht wird, weil ihr heiseres Gebimmel weniger nach einem aufgebrachten Straßenbahnchauffeur klingt als vielmehr nach Santa Claus in seinem Rentierschlitten, ja genau, nach Weihnachten.
Der Taxifahrer öffnet jetzt das Seitenfenster, um seine zur Faust geballte Hand hinauszustrecken. Langsam wie ein Kran, der einen Maibaum hochzieht, fährt er den gestreckten Mittelfinger aus. Ein blauer Edelstein glitzert im Sonnenlicht.
Zwei Tage Deeskalationstraining hat Theo während seiner Ausbildung bei den Verkehrsbetrieben absolviert. Die dort gelernten Strategien der Konfliktbewältigung – in erster Linie die Fähigkeit der sogenannten lösungsorientierten Kommunikation, gepaart mit einer sogenannten optimierten Körpersprache – helfen ihm nun endlich auch im echten Leben weiter: «Arschloch!», brüllt er, seine Fäuste schüttelnd, durch die eilig aufgeklappte Falttür, springt dann aber kurz entschlossen wieder auf den Fahrersitz und löst die Feststellbremse. Langsam rollt die Straßenbahn auf den Mercedes zu.
Im letzten Augenblick, kurz vor dem Kuss der beiden Fahrzeuge, gibt auch der Taxifahrer Gas, beschleunigt jäh und bleibt zehn Meter weiter ebenso abrupt am Rand des Gehsteigs stehen.
Es geht doch.
«Viel zu früh, Herr Ptak!» Mit einem vorwurfsvollen Kopfschütteln steigt Fabian die Stufen hoch. «Fast zwei Minuten!»
«Dir auch einen guten Morgen. Wie war deine Mathematikarbeit?»
Fabian stutzt, sein Blick wird düster. «Leider nicht genügend.»
«Ob das wohl für einen Job bei den Verkehrsbetrieben reichen wird?», fragt Theo boshaft.
«Bremswege und Ankunftszeiten kann ich gerade noch berechnen», kontert Fabian. «Nicht wie gewisse andere Leute.»
Dienstag, sieben Uhr dreißig, Julius-Tandler-Platz. Die Ungeduld steht Theo ins Gesicht geschrieben, freundlich, aber kurz erwidert er den Morgengruß des einen oder anderen Passagiers. Noch zwei Stationen, durch die Althanstraße, an der Postfiliale und am Universitätszentrum vorbei …
Die Ampel an der Haltestelle Althanstraße steht auf Rot. Mit offenen Türen wartet Theo auf das Freigabesignal, als ihn ein markerschütterndes Geräusch zusammenzucken lässt: das Aufkreischen von Reifen auf dem trockenen Asphalt, ein jähes Bremsmanöver.
«So ein Trottel!» Fabian schnaubt wütend auf.
Rechts neben ihnen kommt schlingernd ein Wagen zu stehen – ein Wagen, dessen Fahrer nicht nur einen losen Mittelfinger, sondern offensichtlich auch ein weiches Hirn besitzt: Es ist das schwarze Taxi aus der Porzellangasse. Durch die getönten Seitenscheiben lassen sich die Silhouetten zweier Insassen erkennen, die des Trottels und – am rechten Vordersitz – die einer weiteren Person.
«Ein Volltrottel», gibt Theo Fabian recht. «Das muss bei dem in der Familie liegen.»
«Wie, in der Familie?»
«Anscheinend hat sich schon sein Vater beim Verkehr den Gummi ruiniert.»
Ein paar Sekunden lang denkt Fabian nach. «Versteh ich nicht», sagt er dann grübelnd.
«Das beruhigt mich.» Theo schließt die Türen. Vertrottelte Taxler hin oder her, denkt er, wenn alles gutgeht, wartet an der nächsten Haltestelle eine mittelgroße Frau mit mittellangem Haar auf mich, ein Lichtblick selbst an diesem hellen Tag. Und wenn sie auf mich wartet, werde ich ihr … Blumen schenken. Morgen …
Aber leider geht nicht alles gut.
Die Ampel springt auf Grün, und Theo biegt gemächlich in die Kurve, die sich vor dem Universitätszentrum nach links zieht. Gleichzeitig tritt auch der Taxifahrer hart aufs Gaspedal, legt einen sogenannten Kavalierstart hin (ein Euphemismus ähnlich der berühmten Bremsspur in der Unterhose). Er versucht tatsächlich, Theo rechts zu überholen, trotz der zu schmalen Fahrbahn, die auch noch von einem schlecht geparkten Lastwagen blockiert wird. Theo lässt sich nicht beirren, fährt weiter, und das Taxi bremst im letzten Augenblick, um knapp hinter dem Tramwayheck nach links zu schlittern. Wütend heult sein Motor auf, als es sich auf der Gegenspur am roten Wurm vorbeischiebt und von außen in die nächste Kurve schneidet. Vor der Kurve steht ein Abbiegeverbotsschild, gleich dahinter liegt die Haltestelle Augasse.
«Das darf der nicht!», kreischt Fabian. «Dort dürfen nur die Straßenbahnen fahren!»
Die Vorahnung steht Theo plötzlich klar vor Augen, und die Wirklichkeit, die fünf Sekunden später folgt, spiegelt sich in ihr wider wie ein Déjà-vu. Der Triebwagen biegt um die Ecke, Theo, halb aus seinem Sitz erhoben, beugt sich vor.
Er kann die junge Frau sofort erkennen. Wieder wirkt sie wie von einem Spot beleuchtet, optisch aus der Schar der anderen Wartenden herausgehoben. Einer Schar, die noch dazu vor ihr zurückgewichen ist … Nein, nicht vor ihr, sondern vor dem Mercedes, der jetzt mitten in der Haltestelle auf den Schienen steht. Der Beifahrer, ein großer blonder Mann mit einer dunkelgrauen Lederhose und einem zerknautschten ledernen Jackett, springt aus dem Wagen und läuft auf die scheinbar Unscheinbare zu. Drei Schritte, vier, dann ist er bei ihr. Sie macht keine Anstalten zu fliehen, sie wehrt sich nicht, als er sie packt, sie steht nur da und hält sich an der Eisenstange fest, an der die Tafel mit dem Fahrplan hängt, und schaut mit abgewandtem Kopf und müdem, resigniertem Blick – in Richtung Theo. Ja, sie sieht ihn an.
Ein harter Ruck geht durch die Straßenbahn, der Bremssand knirscht unter den Rädern, man kann einen Aufschrei hören, im hinteren Wagenteil ein dumpfes Poltern, als etwas zu Boden fällt. Ein Fahrgast? Ein Gepäckstück? Theo wird sich später darum kümmern. Schon hat er die Falttür aufgerissen, hechtet auf die Straße und stürmt auf das Taxi zu, während der Lederne die scheinbar Unscheinbare auf den Rücksitz zerrt. Ihr Turnschuh ragt noch aus der Wagentür, da drehen schon die Reifen durch und schleudern Theo eine Staubfontäne ins Gesicht. Er hält die Luft an, aber er läuft weiter und schlägt mit den Händen auf den Kofferraum. Das Blech quietscht unter seinen Fingern, als es ihm entgleitet. Der Mercedes jagt die Augasse hinauf, und Theo setzt ihm nach, hetzt hinterher, als könne er mit einer Menschenstärke hundertvierzig Pferdestärken überflügeln. Eine Haltestelle und dreihundertfünfzig Meter weiter, auf dem Liechtenwerder Platz, gehen ihm die Kräfte aus. Er hockt sich hin und keucht und hustet, seine Augen tränen.
«Pünktlich sind Sie ja, aber … Haben Sie nicht was vergessen?» Eine alte Frau beugt sich zu ihm hinunter, sieht ihn fragend an.
«Wie bitte?», stößt er atemlos hervor.
«Na, Ihre Straßenbahn, wo haben Sie die denn … Ah, da kommt sie ja!»
Der rote Wurm erinnert an ein frisch lackiertes Schaukelpferd. Mit einem breiten, stolzen Lachen, das am unteren Rand der Windschutzscheibe klebt, schiebt er sich frohgemut in die Station und kommt – exakt am vorgeschriebenen Haltepunkt – zum Stehen.
Das Lachen gehört Fabian.
2.
Die Schokolade ist der Paintball des Kindersoldaten.
Benjamin markiert die Einrichtung des Wohnzimmers zwar erst seit zwei Minuten mit kakaofarbenen Schlieren und Fingerspuren, aber schon ist klar: Das Hemd des Lemming zählt zu den Primärzielen seiner süßen Offensive.
«Papa, kämpf mit mir!»
«Vielleicht ein bisschen später, Ben. Vielleicht. Wenn du dir jetzt die Hände wäschst.»
«Dann halt mich fest, und ich muss mich befreien!» Der Neunjährige krallt sich in den dünnen weißen Stoff und schmatzt dem Lemming einen braunen Lippenabdruck auf die Brust.
«Geh bitte, Ben, schau dir mein Hemd an …»
«Kämpf mit mir!»
«Ich will jetzt aber nicht. Ich bin ein alter Mann, und du …»
«Du, Papa, damals, wie du noch ein Polizist warst, wie haben dich die Leute da genannt?»
«Das hab ich dir schon hundertmal erzählt.»
«Ich hab’s aber vergessen.»
«Lemming», brummt der Lemming.
«Und warum?»
«Na, weil ich halt ein schlechter Polizist war.»
«Glaub ich nicht. Wann ist man denn ein schlechter Polizist?»
«Wenn man zu wenig auf sich achtgibt. Wenn man zu den anderen netter ist als zu sich selbst.»
«Dann wärst du damals auch zu mir so nett gewesen?»
«Nein, dich hätt ich eingesperrt.»
«Dann sperr mich ein! Versuch’s doch! Sperr mich ein!», kräht Ben. Er wirft den Kopf zurück, zeigt lachend seine großen weißen Schneidezähne, seine großen braunen Augen, stößt sich unversehens vom Sofa ab und landet mit den Knien auf dem Schoß des Lemming.
«Herrgott, Benjamin!»
«Entschuldige, Papa. Das wollt ich nicht …» Jetzt glitzern Tränen in den braunen Augen.
«Meine Eier, meine Eier!», schallt es plötzlich durch das Zimmer. Es ist nicht der Lemming, der gerufen hat; die Stimme kommt von draußen, aus dem Hausflur, der zugleich als Warteraum für Klaras Tierarztpraxis dient.
Trotz seiner Schmerzen muss der Lemming grinsen. Ben rutscht flink vom Sofa, um zur Tür zu laufen – seine Tränen sind vergessen –, und der Lemming folgt ihm in gebeugter Haltung.
«Meine Eier, meine Eier!»
In der Diele sitzt eine nicht mehr ganz junge Frau, nein, eine Dame: silberfarbene Dauerwelle, weiße Bluse und ein graues, klassisches Kostüm, das mit den Schatten unter ihren Augen harmoniert. Und grau ist auch der taubengroße Vogel, der in einem Käfig neben ihr die Flügel plustert.
«Meine Eier, meine Eier!», kreischt er.
«Wirst du endlich still sein, Falko!», zischt die Frau und ringt die Hände. Resigniert sieht sie den Lemming an. «Das geht seit Tagen so. Ich weiß nicht, wo er das gelernt hat, aber sicher nicht bei mir.»
«Die meisten Leute freuen sich, wenn ihr Vogel redet», meint der Lemming.
«Ja, vielleicht. Aber nicht so. Was sollen sich denn die Nachbarn denken? Ihre Frau ist meine letzte Hoffnung.»
«Meine Eier!»
«Schlimmer Vogel! Pfui!»
In diesem Augenblick kommt Klara aus dem Untersuchungszimmer, und sie bringt ein breites, warmherziges Lächeln mit. Von allen Dingen, denkt der Lemming, die ich an ihr liebe, ist es dieses Lächeln, auf das ich am wenigsten verzichten könnte. Dieses Lächeln und die großen braunen Augen und die Wangengrübchen und der schimmernde, von einem zarten goldenen Flaum bedeckte Nacken und der feste, knackige …
«Wen haben wir denn da?», sagt Klara. «Guten Tag, Frau Lagler, servus, Falko. Na, was fehlt dir?»
«Meine Eier!»
Kurz davor, in einen Lachkrampf auszubrechen, starrt der Lemming angestrengt auf Klaras weißen Ärztemantel. Einen Ärztemantel, dessen lose Enden jetzt verräterisch vibrieren.
«Bitte sehr», sagt Klara mit gepresster Stimme, während sie zur Seite tritt, «gehen Sie schon einmal vor in den Behandlungsraum, Frau Lagler. Ich bin gleich bei Ihnen.»
«Mama, sag, was ist das für ein Vogel?»
«Ein … ein …», Klara schnappt nach Luft, «Graupapagei, mein Schatz.» Sie wischt sich mit dem Ärmel eine Träne aus dem Augenwinkel, hebt den Kopf und sieht den Lemming an. «Was ist denn, Poldi? Warum stehst du so gebückt?»
Die Antwort liegt dem Lemming auf der Zunge, aber er verbeißt sie sich. Stattdessen deutet er zur Eingangstür, durch die ein junger Mann das Vorzimmer betritt, ein schlanker blasser Mann mit dunkelgrauem Anzug und hellblauem Hemd. Die Uniform der Wiener Linien.
«Klara Breitner?», fragt er leise.
Klara neigt den Kopf zur Seite. «Ja?»
Ein scheues Lächeln. «Dann sind Sie … bist du also die Tante Klara, die Cousine meiner Mutter.»
Ein Moment des Grübelns, dann setzt die Erinnerung ein, und Klara hebt mit einem Ruck die Augenbrauen. «Theo?», ruft sie. «Theo Ptak? Der dicke kleine Wurm?» Mit einem ungläubigen Kopfschütteln hält sie die Hand vors Knie, als wolle sie ein unsichtbares Hündchen streicheln: die vertraute Geste aller alten Tanten. «Wie ich dich das letzte Mal gesehen hab, warst du so! Und weißt du, was dein Lieblingsspielzeug war? Kannst du dich noch erinnern?»
«Meine Eier!», schallt es durch die Tür des Untersuchungszimmers.
Es ist keine Hexerei, eine probate Therapie für einen kerngesunden Papagei zu finden. Schwieriger ist es, seine Besitzerin zu kurieren. Fünf Minuten später schon wird Falko als geheilt entlassen, während sich Frau Lagler erst nach einer Viertelstunde auf dem Weg der Besserung befindet. Klara hat sie endlich davon überzeugen können, einen größeren Käfig und ein Weibchen für den Vogel anzuschaffen. Papageien, hat sie gemeint, seien nun einmal Gesellschaftstiere, und das Nachahmen der Menschensprache meistens nur ein Ausdruck ihrer Einsamkeit. Abgesehen davon, dass der Ausruf «Meine Eier!» in einem ganz anderen, weit unverfänglicheren Kontext aufzufassen wäre, wenn sich auch ein Weibchen in der Voliere befände.
«Also werden wir uns halt auf Brautsuche begeben», seufzt Frau Lagler. «Trotzdem vielen Dank, Frau Doktor.»
Falko war für heute Klaras letzter Patient, und so begibt sie sich jetzt eilig in die Küche, in der Ben, der Lemming und ihr Neffe Theo auf sie warten. Als sie aber durch die Tür tritt, prallt sie regelrecht zurück: Ein Stimmungstief schlägt ihr entgegen, eine atmosphärische Beklemmung, die wie eine düstere Wolkenwand den Raum verdunkelt. Während Ben so tut, als widme er sich seinen Hausaufgaben, und der Lemming schweigend aus dem Fenster stiert, läuft Theo zwischen Herd und Kühlschrank auf und ab; er wirkt verzweifelt.
«Was ist denn passiert?», fragt Klara. «Habt ihr euch gestritten?»
Theo und der Lemming tauschen einen langen Blick, nur Ben sieht Klara an und sagt: «Der Papa soll auf Gangsterjagd.»
«Wie meinst du das?»
«Schau, Tante Klara, es ist so …», hebt Theo an.
«Nur Klara bitte, ohne Tante», unterbricht ihn Klara schmunzelnd.
«Gut, in Ordnung. Also, heute früh ist etwas Schreckliches passiert, direkt vor meinen Augen. Man hat meine … Man hat eine Frau entführt.»
«Okay. Und weiter?»
«Na, da muss ich doch was tun! Natürlich war die Polizei da und hat mich und meine Fahrgäste vernommen, aber … Das sind doch nur Lahmärsche! Lethargische Beamtentrottel!»
Ben horcht auf und kichert, während Klara abwehrend die Hand hebt. «Schön der Reihe nach», sagt sie. «Du bist also bei den Verkehrsbetrieben? Ein Beamter?»
«Ja, aber kein Trottel.»
«Umso besser. Aber wie kommst du auf die Idee … Ich meine, was genau führt dich zu uns? Dass du nicht hergekommen bist, um deine altersschwache Tante zu besuchen, ist mir mittlerweile klar.»
«Ganz einfach.» Theo hält kurz inne und wirft einen scheuen Seitenblick zum Lemming, der nun wieder aus dem Fenster schaut, als ginge ihn die Angelegenheit nicht das Geringste an. «Ich selber hab doch keine Ahnung, was man da beachten muss, wo man mit seinen Nachforschungen anfängt und so weiter. Und ich weiß noch, dass es seinerzeit bei mir daheim geheißen hat, die Klara hätte sich jetzt endlich einen Mann geangelt, einen Kriminalinspektor außer Dienst, der sich seit seinem Abschied von der Polizei als Detektiv versucht. Da hab ich mir gedacht …»
Der Lemming fällt ihm barsch ins Wort. «Noch einmal, junger Mann, zum Mitschreiben: Ich bin seit vierzehn Jahren kein Detektiv und auch kein Krimineser mehr. Ich bin ein kleiner Nachtwächter im Tiergarten Schönbrunn, weil ich nach einem kurzen Ausflug in die Hölle der Privatwirtschaft so schnell wie möglich in den Himmel der Beamtentrottel heimgekehrt bin. Übrigens in einen Himmel, wo ich mir die Nächte mit Tapiren und Affen um die Ohren schlage, was nichts anderes heißt, als dass ich mich tagsüber ausruhen muss.»
«Es tut mir leid, Herr …»
«Wallisch», brummt der Lemming, um dann etwas freundlicher hinzuzufügen: «Nenn mich meinetwegen Leopold, du bist ja so was wie mein Schwiegerneffe.»
Benjamin, der zwischen Theo und dem Lemming hin- und hergeschaut hat wie ein Schiedsrichter zwischen zwei Tennisspielern, beugt sich vor. «Ich heiße Wallisch wie mein Papa», strahlt er Theo an, «du kannst aber Ben zu mir sagen, schließlich sind wir ja Cousins.»
«Das ist lieb von dir, Ben», gibt Theo zurück. «Ich kenne einen Buben, der ist ungefähr so alt wie du, vielleicht ein bisserl älter …»
«Und was will der einmal werden, wenn er groß ist?»
Theo seufzt. «Er kennt sich gut mit Straßenbahnen aus. Und du?»
«Natürlich Kommissar», meint Ben entschieden. «Wie der Papa.»
«Früher», wirft der Lemming ein.
«Im Fernsehen hab ich nämlich vorgestern gehört», spricht Ben mit ernster Miene weiter, «wenn man Gangster jagen will, braucht man zwei Dinge: Hirn und Eier.»
Ein Moment der Stille, nur ein kurzer Augenblick, in dem sich die Gedanken ordnen. Jeder hier im Raum denkt etwas anderes, und trotzdem wissen alle, was die anderen denken. «Erstens, Ben», sagt Klara jetzt, «heißt das Verstand und Mut, vor allem, wenn Besuch da ist, und zweitens weiß ich, dass der Papa beides hat. Auch heute noch. Es ist kein Honiglecken, auf die vielen Tiere aufzupassen, überhaupt, wenn man nicht mehr der Jüngste …»
«Wisst ihr, was?» Mit einem ärgerlichen Schnauben steht der Lemming auf. «Ich hab verstanden. Gut? Ich hab’s ja schon kapiert.» Er tritt zu Theo und packt ihn am Arm, um ihn zur Tür zu ziehen. «Dann zeig mir halt, wo sich diese angebliche Entführung abgespielt hat. Hoffentlich», fügt er hinzu, indem er sich zu Ben und Klara umdreht, «ist die Diskussion damit beendet.»
«Diskussion?», fragt Klara. «Diskussion worüber?»
«Meine Eier», sagt der Lemming barsch und schließt die Tür.
Tatorte sind die Grüfte der Erinnerungen, Detektive aber sind die Frankensteins, die das Gedächtnis aus seinen begrabenen Fragmenten wiederherzustellen versuchen.