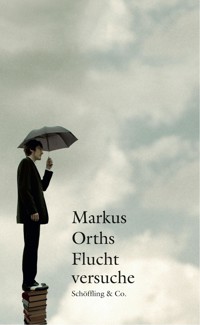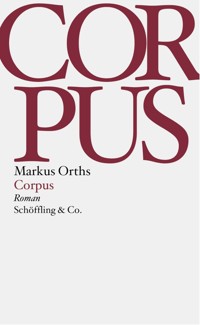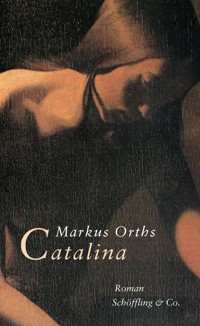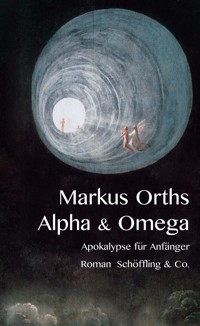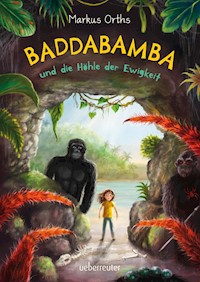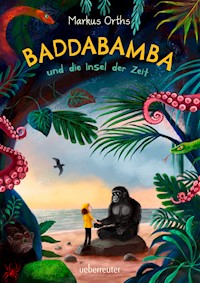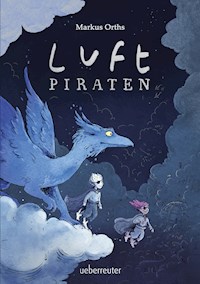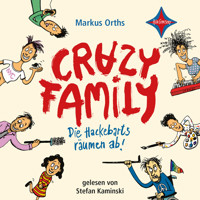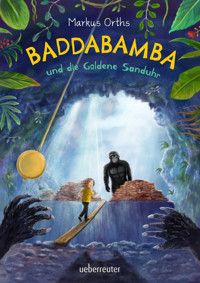15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein argloser Zugreisender bekommt es mit der Angst zu tun, als sich ein zwielichtiger Mann in sein Abteil setzt und ihm auffällig viele Fragen stellt. Ein Billard-liebender Auftragsmörder spielt ein haarsträubendes Spiel mit seinem widerspenstigen Opfer. Und ein unheilbar Kranker ist fest entschlossen, dem Tod durch Einfrieren seines Körpers ein Schnippchen zu schlagen. In Markus Orths Erzählungen liegen Komik und existenzielles Grauen nah beieinander. Mit skurrilem, oft schwarzem Humor entführt uns der preisgekrönte Autor in eine ganz eigene Welt und zeigt gewitzt die menschlichen Abgründe auf, die hinter dem scheinbar Gewöhnlichen und Alltäglichen lauern. Mal beklemmend, mal zum Schreien komisch lesen sich die hier ausgewählten Erzählungen von 2001 bis heute (aus Wer geht wo hinterm Sarg, Fluchtversuche und Irgendwann ist Schluss) und laden zum (Neu-)Entdecken dieses begnadeten Erzählers ein. Mit einer neuen, bisher unveröffentlichten Erzählung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Im Stühlinger
Der Gräber
Hinweise für den, der nicht weiß, wer er ist
Krakenkampf
Kleine Welt
Vom Töten
Konrad spricht
Von einem, der aufhört
Das große O
Im Séparée
Shot to Nothing
Die Stimme
Ins Kalte
Über den Autor
Kurzbeschreibung
Impressum
Im Stühlinger
Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmte, als der Mann, der sich später als Gerber namens Bartok ausgab, zu mir ins Abteil trat, er war unglaublich dick, schwitzte, kümmerte sich nicht die Spur um mich, sondern setzte sich in die Mitte der Dreierreihe mir schräg gegenüber, jedoch erst, nachdem er die Armstützen hochgeklappt hatte, da ein einziger Sitz für ihn nicht breit genug gewesen wäre. Die Fahrt führte mich vom Süden hinauf, ich hatte gerade, kurz vor Bartoks Erscheinen, aus dem Fenster geblickt, der Rhein floss dicht neben der Bahnlinie, wir mussten kurz vor Koblenz sein, der Wasserstand war hoch, und die Wolken hingen so tief herab, dass alles Licht grau gefärbt war. Zwei Stunden saß ich nun schon allein im Abteil. Ich hatte mir seit einiger Zeit angewöhnt, nur noch am Ende des Zuges einzusteigen, in den Waggon mit den alten Sechserabteilen, denn nur dort kann man noch das Fenster öffnen, den Kopf hinausstrecken, Luft schlucken und, wenn man müde ist, die Sitze nach vorn schieben, zueinander hin, um aus ihnen ein einziges großes Bett zu machen, auf das man sich legen und schlafen kann.
Diese Möglichkeit war mir nun genommen. Ich wunderte mich, warum Bartok zu mir ins Abteil kam, denn ich hatte nicht erkennen können, dass außergewöhnlich viele Menschen unterwegs waren, es musste in dem Waggon noch weitere Abteile geben, die leer standen. Bei seinem Eintreten schaute ich auf, nickte kurz, doch da Bartok nur Augen für den Dreiersitz hatte, auf den er sich niederließ, bemerkte er mein Nicken nicht, und ich presste ein Hallo hervor, aber wie jedes Wort, das man nach einer langen Zeit des Schweigens spricht, war dieses Hallo ohne Klang, und ich wiederholte es. Er sagte nichts.
Ich schätzte ihn auf Ende vierzig, und nachdem seine Masse sich im engen Raum ausgebreitet und ich mich darauf eingestellt hatte, die Luft und den geringen Platz mit ihm zu teilen, fielen mir zunächst seine Hände auf. Sie sind das Einzige an ihm, dachte ich, das dünn ist, sie passen nicht zu ihm, wie kommt so ein Koloss zu solchen Händen? Sie waren lang und fast fein, ihnen fehlte das Fleisch, das den restlichen Körper so reichlich umgab. Seine Hände ruhten auf den Beinen, Bartok selbst hielt den Kopf leicht vornübergeneigt und atmete. Das war das Einzige, was er tat: atmen. Langsam und gleichmäßig und ohne dass man es hätte hören können, denn der Zug verschluckte alle leiseren Geräusche. Bartok trug eine Baseballkappe, deren Schirm den oberen Teil seines Gesichtes verbarg, sodass die Augen im Schatten lagen und für mich nicht erkennbar war, ob er unter dem Schirm zu mir hinüberblickte oder auf den Linoleumboden oder auf seine Hände oder ob er die Augen einfach geschlossen hielt.
Während wir uns still gegenübersaßen, begann ich mich unwohl zu fühlen, bedroht von seinem massigen Körper, der etwas ausströmte, eine Art Geruch, jedoch kein Schweiß, etwas, das mich mehr und mehr umgab und die wenige Luft um mich her in Beschlag nahm. Ich hätte aufstehen, meinen Rucksack schultern und das Abteil verlassen können. Da der Zug gerade in Koblenz einfuhr, hätte ich so tun können, als müsste ich aussteigen, doch blieb ich sitzen. Vielleicht schreckte ich vor der Vorstellung zurück, mich beim Verlassen des Abteils an dem breiten, den halben Raum versperrenden Körper vorbeischieben zu müssen, ihm dabei ganz nahe zu sein, ihm, wer weiß, in die Augen zu blicken, wenn er, gestört in seinem ewig gleichen Atemholen, zu mir aufsehen würde. Vielleicht aber war es auch, ganz im Gegenteil, eine Art Neugier auf diesen Menschen, der anders war als die Menschen, die ich kannte. Jedenfalls blieb ich sitzen, still, an meinem Platz, und der Zug setzte sich wieder in Bewegung. Was soll schon passieren, dachte ich mir. Ich brauche nur zu rufen, und in kürzester Zeit würde mir jemand zu Hilfe eilen. Und außerdem – ich blickte mich im Abteil um – gab es hier jede Menge Waffen. Ich könnte den verblichenen Vorhang vom Fenster reißen und dem Angreifer ins Gesicht schleudern. Ich könnte nach der Bahnzeitschrift greifen, die an einer Plastikschlaufe neben meinem Kopf hing, sie zusammenrollen und als Schlagstock verwenden. Ich könnte den kleinen Handaschenbecher aus seiner Schiene an der Armstütze zerren und den harten, spitzen Gegenstand beim Kampf in der hohlen Hand halten. Aber ich schaute zum Fenster hinaus und versenkte meine Gedanken im Rhein, der durch die Wassermassen, die er mit sich führte, doppelt so schnell zu fließen schien wie sonst, und die langen, flachbrüstigen Schleppkähne kamen kaum von der Stelle.
Fahren Sie nach Köln?
Ich zuckte zusammen, fuhr herum, sah ihn an. Er saß da, hatte seine Kappe abgenommen, drehte sie in den Händen, doch war dies kein Zeichen von Verlegenheit: Sein Blick war klar. Ohne die Lider zu senken, sah er mich an. Ich verneinte, sagte ihm, dass ich noch weiterfahren würde. Wohin, fragte er, und ich sagte, nach Braunschweig. Was ich in Braunschweig wolle, fragte er, und er fragte in einer schroffen Weise, fast unverschämt, offen heraus, nicht höflich, nicht, als wolle er mit einem Unbekannten ein unverbindliches Gespräch beginnen, nein, eher, als wolle er zu Informationen gelangen, mich aushorchen, als könne ich ihm etwas sagen, das wichtig für ihn wäre. Ich sei unterwegs zu meinen Eltern, sagte ich und ärgerte mich darüber, es gesagt zu haben. Er hatte mich überrumpelt. Schon fragte er weiter, und ich antwortete. Er fragte, wo ich herkäme, ich sagte, aus Freiburg, er fragte, was ich dort machte, ich sagte, studieren, er fragte, welches Fach, ich sagte, Philologie. Das alles innerhalb kürzester Zeit, und ich schwitzte. Seine Art zu fragen ließ mich nicht eine Sekunde lang zögern, ihm auf die Fragen zu antworten, die er mir stellte, ich dachte nur, sag ihm, was er wissen will, sag es ihm schnell, und dann sei still und schau zum Fenster hinaus. Doch er hörte nicht auf. Er sagte, auch er habe früher in Freiburg gelebt, gewohnt, studiert, wo genau ich denn meine Bude hätte. Ich sagte, im Stühlinger. Ach, sagte er, das sei ja ein Zufall, auch er habe dort gewohnt, und er wollte wissen, in welcher Straße ich lebte, und dies war der Punkt, an dem ich merkte, dass es Zeit war, sich zu wehren, aus dem Gespräch auszusteigen, den Mann höflich, aber klar zum Schweigen aufzufordern, ihm in einfachen, knappen Worten vor Augen zu führen, dass ich an einem weiteren Wortwechsel nicht interessiert sei und es vorzöge, meine Zeit still und allein oder mit einem Buch auf dem Schoß zu verbringen, doch in ebenjenem Moment, da ich ansetzen wollte, mich zu wehren und ihn aufzufordern, seine Fragen einzustellen, traf mich sein Blick, nein, kein Blick, eher eine Art unsichtbare Geste des ganzen Körpers, eine bewegungslose Geste, etwas, das von innen zu kommen schien, ein Aufstöhnen, ein warnendes Aufstöhnen, aber lautlos, nicht zu sehen, nicht zu hören, doch ich spürte deutlich, wie es aus ihm kam, wie es zu mir herüberwehte, wie auf diese Weise der Wille, mich zu wehren, von mir abfiel, und ich sagte leise, geduckt, geschlagen: Ferdinand-Weiß-Straße. Nein, sagte er, das sei kein Zufall mehr, das könne man kaum glauben, dass er, kurz hinter Koblenz, mit einem jungen Mann spreche, der behaupte, in derselben Stadt, im selben Viertel, ja gar in derselben Straße zu wohnen, wo er selbst vor Jahren gewohnt habe, und jetzt solle ich nur noch sagen, ich lebte im Haus Nummer 24. Ich verneinte. Und welche Nummer dann? fragte er. Ich sagte 5, und bereute, es gesagt zu haben, 5, ihm, einem wildfremden Menschen, der seinen Körper zu mir ins Abteil geschoben und begonnen hatte mich auszufragen, doch es war zu spät, ich hatte es ihm gesagt, und was mich am meisten ärgerte, war, dass ich ihm die Wahrheit gesagt hatte, es wäre ja ein Leichtes gewesen, zu sagen 4 oder 6 oder 39, er hätte es nicht nachprüfen können, aber nein, ich sagte 5, ich gab ihm exakt die Nummer des Hauses, in dem ich wohnte, und es beunruhigte mich, kaum dass ich es ausgesprochen hatte. Seit wann ich denn in Freiburg lebte, fragte er, seit vier Jahren, sagte ich. Wie lange ich in Braunschweig bliebe – zwei Wochen. Ob es mir bei meinen Eltern nicht zu langweilig werde – nein, es lebten noch einige alte Freunde aus der Schulzeit dort. Er fragte mich weiter aus, wollte wissen, wie mein Verhältnis zu meinen Eltern sei, ob wir eher am Rand der Stadt oder zentral wohnten und was ich am Abend zu tun gedächte und in welche Kneipe man in Braunschweig nach zwei Uhr noch gehen könne. Ich beantwortete all seine Fragen kurz, klar, genau. Vom Augenblick jener unbeschreibbaren Geste an hatte er mir die Luft zur Verteidigung genommen. Ich atmete kaum noch. Alles, was ich wollte, war, das Abteil, nein, den Zug verlassen. Er fragte einige Minuten so weiter, und während ich meine Antworten gab, brav fast, hoffte ich, ja, betete ich inständig, dass der Zug bald in Bonn einfahren würde, denn ich könnte ja sagen, dass ich in Bonn umsteigen müsse, in einen ICE zum Beispiel, und dass es von Bonn aus eine direkte Verbindung nach Braunschweig gebe, ich könnte dann meinen Rucksack vom Gepäckständer nehmen und mich an ihm vorbeischieben, in der Hoffnung, dass er den Fahrplan nicht kannte. Aber was, dachte ich, wenn er über sich griffe, wenn er von der goldbegitterten untersten Gepäckstütze das Fahrplanfaltblatt nähme, es sich vor die Nase hielte, mich daraufhin ansähe, böse ansähe, um mir zwischen den Zähnen hindurch zu sagen: Warum lügst du?
Und dann hörten die Fragen auf. Plötzlich, ohne dass ich hätte sagen können, wie und warum und wann und was die letzte Frage gewesen war. Er fragte einfach nicht mehr, und mir war, als hätte ich eine Flutwelle überstanden, nass zwar, erschöpft, aber noch am Leben, noch atmend, ich schloss kurz die Augen und lehnte den Kopf an die Kopfstütze, die nach Rauch stank. Ich wollte hinausgehen, allein sein, doch ich hatte das Gefühl, dass etwas passieren könnte, wenn ich jetzt aufstehen und an ihm vorbeigehen würde. Ich dachte nicht an Gewalt, nicht daran, dass er mich packen und aus dem Fenster werfen oder seine feinen, schlanken Finger mir um den Hals legen könnte, nein, das nicht, ich hatte ein anderes Bild vor Augen, ich dachte, er könnte meinen Arm fassen, mich zu sich herabziehen und mir etwas ins Ohr flüstern, etwas, das ich mein Lebtag nicht vergessen würde. Und so blieb ich sitzen und rührte mich nicht.
Zugleich aber begann ich zu spüren, dass er jetzt etwas von mir wollte. Ich wusste sofort, was es war, das er wollte, und wehrte mich dagegen, versuchte, mich seiner Macht zu entziehen, heftete meinen Blick nach draußen, wo es zu dunkeln begann und ein Regen eingesetzt hatte, der die Scheiben mit Tropfen beschoss. Einiges an Wasser spritzte auch durch die undichten Ritzen des Fensters hindurch, mir ins Gesicht. Ich war froh über die Kühlung, erhoffte mir frische Gedanken für den Kampf mit Bartok. Der schwieg. Der wollte, dass ich zu reden anfing. Der wollte mich dazu zwingen. Wir rangen stumm. Ich, indem ich aus dem Fenster starrte, er, indem er mich aus den Augenwinkeln heraus beobachtete. Der Druck nahm zu, mein Atem wurde schwerer und lauter und begann, die Geräusche des Zuges zu übertönen, und schließlich gab ich auf. Ich drehte mich zu ihm um. Sah ihm ins Gesicht. Jetzt, da er wusste, dass er gewonnen hatte, wirkte sein Gesicht beinah weich, ich konnte sogar Lachfalten erkennen, als er mir zunickte, wie um mir den letzten Anstoß zu geben, das zu tun, was er von mir wollte, und ich tat es. Ich fragte ihn nach seinem Namen und ob er nach Köln fahre und was er in Freiburg studiert habe und ob seine Eltern noch lebten und welchen Beruf er ausübe. Es schien etwas von ihm abzufallen, als ich ihn fragte. Er lehnte sich zurück, seine Gegenwart schwoll ab, es war, als lasse er etwas Luft aus seinem Körper, er setzte sich die Kappe wieder auf, mit dem Schirm nach hinten, sodass seine Augen frei blieben, unbedeckt, und er lachte, erstmals, und als er lachte, lachte ich mit ihm, und dann sagte er, es freue ihn, dass ich mich so sehr für ihn und sein Leben interessierte, und er sei gerne bereit, mich über alles, was ich wissen wolle, aufzuklären, er rieb sich die Hände dabei, und dies war ein Zeichen der Wärme, die plötzlich von ihm ausging, ich rutschte sogar etwas in seine Nähe, da mir die ins Abteil spritzenden Regentropfen unangenehm zu werden begannen, berührte dabei unabsichtlich sein Knie und sah mir seine Augen an. Diese Augen, sagte ich mir, sind friedfertige, kleine, runde, blinzelnde Augen, wie sollen solche Augen zu einem Mann gehören, der mir Böses will? Und ich hörte ihm zu, wie er von sich und seinem Leben sprach. Gewiss, er habe studiert, sagte er, aber sein Studium vorzeitig abgebrochen und eine Lehre als Gerber begonnen. Ein Beruf, der fast ausgestorben sei, heutzutage. Und er begann, frisch draufloszureden, von der Konservierung der Häute, vom Trocknen und Frosten, vom Einweichen und Waschen, er beschrieb alle Instrumente, die er für sein Handwerk benötigte, er sprach vom beidhändig geführten Scherdegen und vom Spannen der Haut über den Gerberbaum, und davon, wie schwierig es sei, die Haut zu entfleischen, ohne Löcher in sie zu schneiden. Er sprach vom Kalkäschern und von der Chromgerbung, aber immer nur kurz, in knappen, abgehackten Phrasen. Am hingebungsvollsten redete er von der Hirngerbung, bei der man das Hirn des Geschlachteten kochen und den entstehenden Brei, der aussehe wie geklumptes Eiweiß, auf das Fell verschmieren müsse, damit das Fell an Flauschigkeit gewinnt und sein Fett verliert, denn das Hirn sei ein Füll- und Lösestoff zugleich.
Fast abrupt brach er dann seine Erklärungen zum Gerben ab und begann, vom Häuten zu reden, er sprach vom Aufhängen des Geschlachteten, vom Herunterhängenlassen des getöteten Körpers, der an den Füßen festgemacht sei. Er sprach vom Rundschnitt an den Knöcheln, vom Längsschnitt und von der Vorsicht, die man an den Tag zu legen habe beim Freilegen des Beckenbereichs, weil, wie er sagte, sich der Darminhalt, wenn man nicht aufpasse, leicht über den toten Körper und die eigenen Hände entleeren könne. Und dann sagte er, dass man nach diesen Schnitten fast ohne weitere Schwierigkeiten und Widerstände die Haut abziehen könne, über den Oberkörper hinweg. Und erst als er dieses Wort aussprach, begriff ich, dass sein Gerede nichts war als ein böses Spiel. Ich sah hinter die Maske, die er seit einigen Minuten aufgezogen hatte, sah, wie in seinen Lachfalten das bös blitzende Vergnügen saß, mich im Unklaren zu lassen über das, wovon er eigentlich sprach, sah sein ins Unermessliche sich steigernde Ergötzen an der Zweideutigkeit seiner Worte, sah, wie sein fleischiger Körper wieder – mit jedem scheinbar so harmlosen Wort – mehr und mehr das Abteil in Beschlag nahm, ich merkte, wie mich seine Masse wieder tiefer in die Ecke ans Fenster drückte, und seine Zähne, ja, ich sah es, hingen wie einzelne Zacken zwischen den scharfen Lippen, erst jetzt fielen sie mir auf, Stumpen, aber spitz. Als er nun weiter beschrieb, wie einfach das Lösen der Haut vor sich ging, sah ich mich plötzlich selber kopfüber an der Stange hängen und fühlte sie förmlich, seine Hand, ich fühlte, wie sie die Haut vom Fleisch zu lösen begann, von meinem Fleisch, ich fühlte, wie seine Hand, seine feine, flache Hand, mir langsam unter die Haut fuhr, die Haut vorsichtig abzuziehen begann, über die wenigen noch verbleibenden Spannstellen hinweg, und wie seine Messerspitze die Reste von angewachsener Haut durchtrennte. Und mehr noch, ich sah mich plötzlich an meinem Fenster in Freiburg stehen, im Stühlinger, und aus diesem Fenster blickte ich hinab auf die Straße, und ich sah, wie Bartok unten stand, an der Ecke gegenüber, beobachtend, die Tür im Blick, Hausnummer 5, und er wartete darauf, dass ich mein Zimmer verließ, er wartete, ohne zu verbergen, dass er wartete, in ruhiger, fetter Gewissheit, dass ich irgendwann aus der Haustür würde treten müssen. Und das war der Moment, da die Luft im Abteil nicht mehr reichte für mich, der Moment, in dem Bartok, der Gerber, sie aufgeatmet hatte, und um nicht zu ersticken, stand ich auf. Dies geschah, als der Zug den Bahnhof von Bonn erreichte, Bartok hielt inne im Fluss des Erzählens, ich beugte mich zu ihm hinüber und ging in die Offensive, griff über seinen Baseballkopf hinweg, trat die Flucht nach vorn an, wusste nicht, woher ich die plötzliche Kraft nahm, es zu tun, aber ich griff über seinen Kopf hinweg zum Fahrplanfaltblatt, das auf dem goldbegitterten untersten Gepäckgerüst lag, warf einen kurzen Blick hinein, sagte ihm, ich müsse umsteigen, Bonn, mein ICE, direkt nach Braunschweig, er aber tat nichts, als ich meinen Rucksack herunternahm, tat nichts, als ich im Moment des Vorbeischiebens kurz zwischen ihm und den Sitzen stand, tat nichts, als ich ihm den Rücken zukehrte und die Tür aufzerrte, tat nichts, als ich hinaustrat auf den Gang und von dort noch einmal kurz zurückblickte und sah, wie er sich ans Fenster setzte. Ich eilte den Gang entlang und schaffte es gerade noch rechtzeitig, hinauszuspringen, ehe die Türen zuschlugen und der Zug sich wieder in Bewegung setzte. Als ich aber dort stand, auf dem Bahnsteig, ein wenig erleichtert, und als dann der Zug sich an mir vorbeischob, sah ich, ich gestehe, aus Neugier, ein letztes Mal hinein, in das Abteil, in dem ich gesessen hatte, und mit mir Bartok. Und als ich hineinsah, sah er hinaus, es trafen sich unsere Blicke, er verzog keine Miene, doch dann hob er plötzlich die Hand, seine rechte Hand, mit den langen, spitz zulaufenden Fingern, hob die Hand ans Fenster und presste sie vor die Scheibe, presste sie neben das aufgeschwemmte Gesicht unter der Baseballkappe, und ich dachte, er winkt, er will mir winken, er will mir ein Zeichen geben, ein versöhnliches Zeichen, und ich winkte zurück, seine Hand aber blieb reglos, wie ans Fenster geklebt, er ließ sie nicht hin- und herpendeln, er hielt sie ganz ruhig, sodass ich, wäre ich näher gestanden, die geplättete Haut seiner Handfläche hätte sehen können, nein, das war kein Winken, kein Abschiedsgruß, das war ein Zeichen, eine Zahl, eine Nummer.
Der Gräber
Ihr letztes Ausatmen entlädt sich mit trockenem Pfeifen und riecht nach altem Fahrradschlauch. Ihr Blick läuft leer: geradeaus zur Decke und hindurch. Ich nehme ihr die Augen vom Gesicht.
Ich stehe auf, verlasse das Wohnzimmer und trete hinaus in den Garten. Der Schuppen ist mit Dreck und Staub bezogen. Mein alter Spaten hat Rost angesetzt. Ich hocke mich auf den Schemel, nehme, mit zittrigen Fingern, die Gartenschuhe und schüttle sie aus. Die Schuhe sind hart und trocken, das Leder ist klobig geworden mit der Zeit. Ich stülpe die Schuhe über die Socken.
Die Stelle, an der ich grabe, ist dunkler als die übrige Fläche des Ackerbodens. Ich stoße meinen Spaten hinein, hart ist der Dreck, klumpig, halb gefroren. Es fällt mir schwer, den Spaten herauszuziehen und die Erde zur Seite zu kippen. Ich stehe still und stütze mich auf den Spaten, frostiger Atem vor mir.
Nur eine Schicht, denke ich, das muss genügen, mehr ist nicht drin: mein Rücken, meine Zitterhände, meine abgeschlafften Muskeln. Nach einer halben Stunde ist das flache Loch lang genug. Ich steche den Spaten in die aufgehäufte Erde neben mir. Meine Brust fiept wie ein Blasebalg. Ich lege mich ins Loch. Zunächst sind die Augen geschlossen. Der Rücken schwimmt in Kälte.
Das erste Mal habe ich gegraben, als ich achtzehn war und kurz vor dem Abitur stand. Um genau zu sein: Es war der Tag vor der mündlichen Prüfung. Ich spreche vom Graben eines Loches und nicht vom Umpflügen des Gartens im Herbst, zu dem ich schon viel früher (wohl mit dreizehn) herangezogen worden bin, weil der Garten sehr groß war. Über dieses Umgraben im Herbst will ich nur so viel sagen, dass ich es gern getan habe, dass ich, wenn ich aus der Schule kam, sofort nach dem Essen meine alten Arbeitsklamotten überwarf und Stunde um Stunde grub, immer wieder mit der Schubkarre vom Misthaufen frischen Dung herbeiholte, den ich untermischte, bis am Abend eine ganze Parzelle des Gartens statt hart, verkrustet und mit Unkraut bewachsen, nunmehr offen, frisch und atmend dalag, als hätte ich die Erde aus einer langen, bitteren Kerkerhaft befreit. Wenn dann mein Vater nach Hause kam, schritt er die umgegrabene Fläche ab, mit prüfendem Blick, bückte sich manchmal, um einen Stein oder ein Fitzelchen Unkraut aus dem Dreck zu ziehen und auf den Gartenweg zu werfen, sagte, na ja, hier ist noch ein kleines Loch, aber alles in allem zeigte er sich zufrieden und nickte anerkennend.
Als ich also in der Nacht vor der mündlichen Prüfung im Bett lag und nicht schlafen konnte, stand ich auf, zog mich an und ging in den Garten. Ich wollte eigentlich nur ein wenig frische Luft schnappen, mich vom Sauerstoff müde machen lassen, doch es war eine überaus helle Nacht, und als ich ein kleines, freies Stück Boden sah – mein Vater hatte tags zuvor die ersten Kartoffeln geerntet –, befiel mich plötzlich dieser Drang. Ich zog im Schuppen meine Stiefel an, nahm den Spaten und begann zu graben. Ich grub ein Loch. Ich maß dem, was ich tat, keine Bedeutung bei, sondern folgte einfach blind dieser Lust, die mich ergriffen hatte. Es war die Lust, wie wild zu graben, und da es nur ein kleines Stückchen war, welches mir zur Verfügung stand, grub ich nicht in die Breite, sondern in die Tiefe. Als das längliche Loch fast einen Meter tief war und ich in Schweiß stehend meinen Spaten wegstach, zögerte ich nicht, sondern legte mich hinein. Es war zu klein, ich musste meine Beine anwinkeln.
Ich lag dort und schaute hinaus.
Der Mond war von meiner Lage aus nicht zu sehen, nur Wolken, die durch die helle Nacht zogen. Die Kühle der Erde war unangenehm. Ich blieb nicht lange liegen, aber lange genug, um ruhig zu werden, meine Atemzüge zu zählen und einen klaren Kopf zu bekommen. Das Zuschaufeln des Loches ging mir leicht und gleichmäßig, fast rhythmisch von der Hand. Ich nahm eine warme Dusche, legte mich ins Bett, es war fünf Uhr morgens, und ich schlief sofort ein.
Ich grub weiter. Ich grub vor den Prüfungen im Studium und vor meinem Vorstellungsgespräch und als unsere Firma kurz vorm Bankrott stand. Ich grub auch, als mein Vater starb und als meine Frau nach der Geburt unserer Tochter noch lange im Krankenhaus bleiben musste. Ich grub immer an derselben Stelle im Garten. Mal grub ich mit Bedacht und langsam und sorgfältig, mal wild und wie im Rausch. Mal grub ich lange und ausdauernd und bis ich vor Erschöpfung beinah umkippte, mal kurz und schnell und ohne dass sich Schweiß auf meinem Körper zeigte. Mal grub ich so tief, dass der Boden seine braunschwarze Farbe verlor und sandhell zu werden begann, mal nur eine flache Grube, auf deren Ränder ich meine Hände legen konnte. Mal war die Erde erhitzt und trocken und staubte auf, wenn ich grub, mal war sie feucht und klebte in Klumpen am Spaten, sodass ich innehalten und den Matsch mit dem Fuß abschaben musste. Und wenn ich nach dem Graben im Loch lag, öffneten sich alle Engen in mir, ich atmete tief ein und versuchte dem Geruch der Erde nachzuschmecken, ich lauschte auf das grauviolette Kringeln der Regenwürmer, rieb mit den Handflächen über den dunklen Innenraum der Grube und sah in den kleinen, eckigen Ausschnitt Welt, den das Loch mir bot.
Einmal, ich war 60 damals, war meine Tochter zu Besuch – sie hatte ihren Mann mitgebracht –, wir saßen lange und redeten, bis ich eine neue Flasche Wasser holen wollte, doch im Flur merkte, dass ich vergessen hatte, die leere Flasche mitzunehmen, sodass ich umkehrte und auf der Wohnzimmerschwelle stand, als meine Tochter, die mich nicht sah, diesen Satz sagte, diesen einen Satz, zu ihrem Mann, mit Stöhnen in der Stimme: Komm, lass uns bald gehen, ich kann sein Gerede nicht länger ertragen. Da drehte sie sich um und sah mich und erschrak. Sie wollte sich entschuldigen, mir klarmachen, dass sie es nicht so gemeint hatte, doch ich sagte nur: Ihr wolltet doch gehen. Und schickte sie hinaus.
Dann nahm ich meine Taschenlampe und begann zu graben. Es war stockdunkel, und ich sah nicht wirklich, was ich tat und wohinein ich meinen Spaten stach, das Licht der Lampe verzerrte nur, erhellte kaum. Die Erde war in dieser Nacht seltsam fremd für mich. Ich sah sie nicht, ich roch sie nicht, ich hörte sie nur: der schlitzende Stich hinein, wie ein scharfer Riss von Papier; das pfropfende Hochheben der Erde; und das dumpfe Fallen des Aushubs, wie ein ganz leichter Schlag auf ein Bongo. Als ich schließlich unten lag, keuchend und mit Tropfen der Wut im Gesicht, brauchte ich lange, um ruhig zu werden, brauchte ich sehr sehr lange, ehe die Erde mir die Schwere nahm und ich aufstehen und den Dreck an seinen alten Platz zurückschaufeln konnte.
Ich lasse das Loch offen heute, werfe es nicht wieder zu, weil mir kalt ist. Und ich bin müde. Ich nehme ein Bad. Danach, im Bademantel, betrete ich das Zimmer, in dem meine Frau liegt. Ich müsste eigentlich jemanden anrufen. Aber man würde sie abholen, und dann wäre sie fort. Warum? Die dümmste Frage, die man stellen kann, wenn ein Mensch einen Menschen verlässt, ist: Warum?