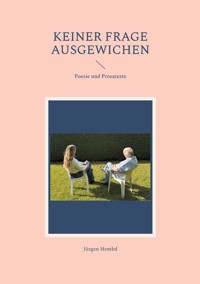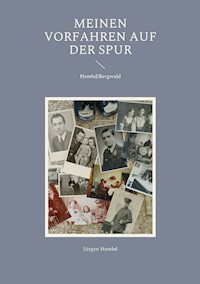4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Autor Jürgen Hembd lernte seine spätere Frau Ingrid während des Evangelischen Kirchentages in Dortmund kennen und lieben. Sie heirateten 1968 und erlebten fortan die Höhen und Tiefen einer langlebigen Ehe, aus der zwei Kinder und drei Enkelkinder hervorgingen. Dieses Buch widmete er posthum seiner Frau.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Dieses Buch ist für
unsere Kinder und Enkel geschrieben
und
posthum
Ingrid Hembd
gewidmet
Inhaltsverzeichnis
Vorwort oder Vorgeschichte?
Vorwort oder Vorüberlegungen?
Die Jahre 1963 bis 1968
1968: Wir – ein ideales Brautpaar?
Entropie als sozialer Begriff
Universitätslaufbahn – etwas für mich?
Ingrids Berufsanfänge
Ingrids ehrenamtlicher Einsatz für die Vereinigung für Jugendhilfe
Meine Berufsentscheidung: Schule oder Universität?
Mein Lehrauftrag an der FU
Ingrid als Tochter ihrer Eltern und Mutter ihrer Kinder
Ingrid und ihr Musizieren
(
Mit) Ingrid auf Reisen
Anekdotische Anmerkungen zu unserer ersten Kanada-Reise
Auf dem Wege zur Familiengründung
Die Jahre 1975 bis 1979
Ingrid und die politische Wendezeit
Unterwegs mit Ingrid
Die Jahre 1990 bis 2000
Ingrid und ihr Berliner Seniorenchorfest
Ingrids Frühpensionierung
Ingrids Engagement für russlanddeutsche Spätaussiedler
Die Jahre 2001 bis 2011
Die Jahre 2011 bis 2017
Die Jahre 2017 bis 2019
Ingrid und einige ihrer liebenswerten Eigenschaften
Ein leises Lied für meinen Schatz
Fiktives Interview mit Ingrid
Ingrid in den Mund gelegt
Danksagung
Nachwort
Bilddatierung
Vorwort oder Vorgeschichte?
Unser gemeinsames Leben als unzertrennliches Ehepaar ist leider Vergangenheit. Nie wieder Hand in Hand – aber lass mich einen Blick in Dein Leben vor 1963 werfen, dem Jahr, in dem wir uns im Gewühl des Kirchentages in Dortmund kennenlernten.
Du, Ingrid Gudrun Rückert, wurdest am 28.02.1945 in Berlin geboren, in Neukölln, in der Leinestraße 8, inmitten eines Luftalarms und ohne die Hilfe der zuvor benachrichtigten Hebamme. Du, das dritte Kind Deiner Eltern, genauso ein Kriegskind wie ich auch.
Nach Angaben einer viel später gedruckten Geburtstagskarte für den Jahrgang 1945 warst Du ein Baby unter 1.407.490 Babies, die in jenem Jahr in Deutschland geboren worden seien, das einzige übrigens, das in Deiner Straße überlebte. Unter welchen lähmenden Ängsten müssen unsere Mütter damals gelitten haben angesichts der allgegenwärtigen Kriegsgefahren und der Ungewissheit über das Schicksal der Väter ihrer Kinder, nicht wissend, ob diese „da draußen im Felde“ überleben würden?
Deine Geburtstagskarte verrät uns, dass der durchschnittliche Monatslohn eines Arbeiters im Jahre 1945 RM 158 betragen habe, was bei ungefähr 180 monatlichen Arbeitsstunden einem Stundenlohn von 0,82 RM entsprochen hätte. (Ich erinnere mich, dass mein Vater nach 1947 davon träumte, irgendwann einmal 5,00 Mark pro Stunde zu verdienen.)
Wenn also ein Kilo Fleisch 1,70 RM kostete, musste ein Arbeiter dafür mehr als 2 Stunden arbeiten. Anfang Oktober 2020, also 75 Jahre später, wurden 1000 Gramm Rinderrouladen (oder Rindergulasch) im Supermarkt vorteilhaft für € 7,84 angeboten. Legen wir einen gesetzlichen Mindeststundenlohn von € 12,00 zugrunde, würde ein Käufer für eine Arbeitszeit von 2 Stunden heutzutage dafür etwa 3 Kilo Fleisch erhalten. Also das Dreifache und sicherlich zum Nachteil der Schweinezüchter!
Für das Luxusgut Kaffee musste im Jahre 1945 ein Arbeiter für den Kilopreis 7,5 Stunden arbeiten; für dieselbe Arbeitszeit würde er unter Ansetzung des Mindestlohnes heutzutage ungefähr 13 Kilo erhalten. Auch hier bleibt ungeklärt, ob dies einem fairen Preisgefüge entspricht.
Schon damals verdiente ein Arbeiter über 60% mehr als eine Arbeiterin. Ist die Forderung „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ bis heute etwa erfüllt?
Deine Geburtstagskarte suggeriert allerdings, dass Fleisch, Weizenmehl, Kartoffeln, Milch und Bier überall in ausreichendem Maße angeboten wurden. Wir wissen jedoch, dass Grundnahrungsmittel damals rationiert und nur auf Marken und mit Bargeld erhältlich waren. (Vom Schwarzen Markt wollen wir hier gar nicht reden!)
Damals gab es Kuhställe inmitten der Stadt, bettelnde Sänger auf dem Hinterhof und „Brennholz für Kartoffelschalen“. Unsere Eltern erinnerten sich an „schlechte Zeiten“ und an Hamsterfahrten.
Ernst Budraß, Dein Opa mütterlicherseits, starb 1959. Er wohnte in der Westendallee 93a. Eine Nachbarin, Frau Hilde Marggraff, schrieb damals einen bewegenden Abschiedsbrief:
„(…) Nie werde ich die Kartoffelfahrt nach Nauen vergessen. Ich hätte keine Ahnung gehabt, wo man in der überlaufenen Gegend etwas bekam, aber Du, lieber Nachbar, gingst sofort querfeldein in die Einsamkeit des Landes. Und das hatte Erfolg. Aber wo zur Nacht unterkommen? Nach Nauen wäre ich um keinen Preis gegangen, der Russen wegen. Die Leute wollten uns nicht behalten, sie hatten Angst. Die angewiesenen drei Scheunenwände mit kahlem Fußboden schienen uns nicht verlockend. Aber was Du dann für eine herrliche Möglichkeit zum Schlafen in einem großen Heuhaufen unter dem stillen Sternenhimmel für uns geschaffen hast, das habe ich nie vergessen.—Und dann der Rückmarsch, denn an Fahren war nicht zu denken. Der Bahnhof in Nauen wimmelte von Russen und wir wollten unsere Kartoffeln behalten. Ich hatte gerade am Morgen noch eine Schnitte und dann sammelten wir Fallobst. (…) Dann kam Spandau, die Havel und nun war es nicht mehr so weit bis nach Hause. (…)“
Von 1951 bis 1957 besuchtest Du die 6. Grundschule in Berlin-Neukölln. Zur Rückert’schen Familienlegende gehört auch, dass Deine Eltern dort in der 1. Klasse den Tanz- und Gesangsunterricht gaben. Anschließend bist Du auf das Albrecht-Dürer-Gymnasium übergewechselt (1957-63). Vom 02.09.1957 stammt ein Klassenaufsatz aus Deiner Hand:
Mein Schulweg
Morgens um 7.00 Uhr trete ich meinen Schulweg an. Wenn die Haustür hinter mir zufällt, komme ich zum Überlegen. Ich denke daran, was wir aufhatten. Ecke Leinestraße biege ich in die Hermannstraße ein. Dort ist schon sehr viel Betrieb. Autos rasen die Straße entlang, und viele Berufstätige steigen in die U- oder Straßenbahn ein. Ich gehe immer sehr schnell, darum macht es mir Spaß, recht viele Menschen zu überholen. An der Ecke Hermann- und Emserstraße muß ich auf die Autos aufpassen, denn dort gehe ich über den Damm. Wenn die Straße frei ist, gehe ich hinüber. Danach laufe ich die Emserstraße entlang. Auch dort ist viel Betrieb. In der Nähe der Schule laufe ich abermals über den Damm. Nach einiger Zeit bin ich an der Schule. Dort gehe ich durch das Tor, das auf den Schulhof führt. Ich laufe dann in das Schulgebäude und einige Treppen hinauf. Nach einigen Schritten bin ich im Klassenzimmer. Danach ziehe ich meine Jacke aus und gehe zu meinem Platz. Nun bin ich an meinem Ziel angelangt.
(Dieser Klassenaufsatz wurde leider nur mit „ausreichend“ bewertet, da er zu viele Wortwiederholungen enthalte.)
Du hast einen Briefentwurf aufgehoben, der vom 23.08.1957 stammt und der uns zeigt, dass Du offenbar öfter bei Deinem Opa in Westend warst:
Liebe Käthi!
„(…) Heute begann wieder die Schule. Wie ich Dir schon schrieb, war ich noch 9 Tage im Garten. In dem Häuschen meines Opas sind 6 Zimmer, eine Küche, ein Keller, ein Boden, eine Toilette und ein Badezimmer. In der Dachstube neben dem Boden schlief ich. Von dort aus habe ich eine schöne Aussicht auf das Olympia-Stadion. Ein paar Kilometer davor ist die U (Untergrund)-Bahnhaltestelle „Olympia-Stadion“. Auch die kann ich von dem Fenster aus sehen. Es macht Spaß zuzusehen, wie die U-Bahnzüge ein- und ausfahren. Mit den Kindern der Nachbarn spielte ich dort immer. (..)“
Deine Ingrid
In einem Klassenaufsatz vom 12.03.1958 hast Du über Deine damalige Lieblingsbeschäftigung berichtet – das Schlittschuhlaufen:
In meiner Freizeit laufe ich am liebsten mit meinen Schlittschuhen. Es bereitet mir viel Vergnügen und viele frohe Stunden. Die Eisbahn (Oderstraße) ist nur 5 Minuten von unserer Wohnung entfernt. Zu meinem 12. Geburtstag bekam ich Schlittschuhe. Zu Anfang fiel ich oft hin, und ich bekam viele blaue Flecke. Jedoch nach und nach lernte ich es. Bald bereitete es mir Freude, im Kreise langsam und schnell zu fahren. In diesem Jahr lerne ich schwere Figuren zu laufen. Immer, wenn ich eine neue beherrsche, freue ich mich.
Vor einem halben Jahr passierte mir ein Unglück, und das kam so. Als ich an einem sonnigen Ferientage übte, bekam ich einen Schubs und fiel mit meiner Last auf den Arm. Nach dem Aufstehen merkte ich, daß er gebrochen ist. Am Ende der Ferien war er wieder geheilt. Trotz diesem Sturz laufe ich noch heute am liebsten Schlittschuhe.
Im zweiten Absatz hast Du tüchtig geflunkert, da Du Dir meines Wissens lebenslang nie etwas gebrochen hattest. Auch Deinem damaligen Lehrer fiel der schnelle Heilungsprozess auf, was er mit der Bemerkung „dann war er nicht gebrochen!“ kundgetan hat.
Deine Lieblingsinstrumente waren von früher Jugend an die Sopran-, Alt- und Tenorblockflöte und vor allem das Klavier. Eure Mutter hatte ganz offenbar Deine musikantischen Talente erkannt und Dir als Achtjähriger heimlichen Klavierunterricht ermöglicht, so dass Du Eurem Vater schließlich mit Deinem Vorspiel ein ihn bewegendes musikalisches Weihnachtsgeschenk machen konntest. Oft habe ich Euch beide gemeinsam musizieren erlebt: Dein Papa spielte Querflöte, Du Klavier.
Später wurde Ingrid Tietsch Deine musikalische Mentorin und nahm Dich auf ihren Konzertreisen als Mitglied des Blockflötenorchesters „Praetorius“ mit. Am 29.07.1959 berichtete die Berliner Morgenpost:
Mit Flöten im Burgenland
Der Blockflötenchor „Praetorius“ der Volksmusikschule (Neukölln) unter der Leitung von Ingrid Tietsch weilt zur Zeit im österreichischen Burgenland. Dort sind in einem Heim „internationale Begegnungen“ vorgesehen. Außerdem werden die 28 jungen Neuköllner im Alter von 14 bis 20 Jahren auf der Burg Hochosterwitz in Kärnten und anläßlich einer Tagung für Musikerzieher in Salzburg Konzerte geben.
Mitzubringen waren seitens der jugendlichen Musizierenden Personalausweis, etwas Taschengeld, Instrumente, Notenpulte sowie Konzertkleidung, wobei die Mädchen, (dem Zeitgeist geschuldet) keine langen Hosen tragen sollten.
In unseren gemeinsamen Gesprächen hast Du öfter die Burg Hochosterwitz, Salzburg und eine Konzertreise nach Osnabrück (mit Deinem ersten Reitversuch) erwähnt und ebenso die Kleiderordnung am Albrecht-Dürer-Gymnasium. Eure Mädchen hatten Röcke oder Kleider zu tragen, aber bloß nicht lange Hosen!
Ich selbst erinnere mich noch an die flüsternde Empörung unserer weiblichen Lehrkräfte an der Werner-von-Siemens-Oberschule, als eine Kollegin in den frühen 70ern mit Hosen zum Unterricht erschien – ein beklagenswertes Novum, so vorteilhaft sie in meinen Augen darin auch damals aussah!
Vor mir liegt die Ausschreibung eines Steinway-Klavierspiel-Wettbewerbes für Kinder (bis zum vollendeten 16. Jahre) vom Herbst 1960. Vor einer 7köpfigen Prüfungskommission (darunter nur eine Frau!) hattest Du in der Gruppe C (14-16 Jahre) mit Deinem Vorspiel von J.S. Bachs Präludium und Fuge c-moll aus dem Wohltemperierten Klavier die Vorauswahl im Oktober bestanden. Die interne Generalprobe fand für Dich am 03.11.1960 zwischen 15.00 und 15.30 Uhr in den Geschäftsräumen von Steinway & Sons statt. Am 12.11.1960 folgte im Konzertsaal der Hochschule für Musik in der Hardenbergstraße eine Sitz- und Einzelprobe und am 13.11.60 ab vormittags 11 Uhr war es dann so weit! Und Du wurdest mit einem Preis ausgezeichnet! Es gab ein Diplom und einen Gewinn-Gutschein! Im Feuilleton der Berliner Morgenpost wurde am 15.11.60 über diesen Klavier-Wettbewerb berichtet, wobei es in der Bildunterschrift hieß:
Mit einigem Herzklopfen nahmen Berlins jüngste Virtuosen (Anm: 19 Mädchen und 12 Jungen) vor dem großen Flügel Platz: beim Klavierspiel-Wettbewerb der Firma Steinway in der Hochschule für Musik bewiesen kleine Leute ihre große Liebe zu musikalischen Meistern. Das Publikum belohnte Fleiß und Mut mit reichem Beifall.
Oft hast Du von diesem Klavierwettbewerb erzählt mit dem Bemerken, dass Du trotz des persönlichen Erfolges dort doch niemals Konzertpianistin hättest werden wollen, weil dies mit ständiger Reisetätigkeit und intensivem Üben verknüpft gewesen wäre.
Am 10.05.63 veranstaltete Ingrid Tietsch im Festsaal der Hermann-Ehlers-Schule in Steglitz einen Hausmusikabend, bei dem Du von Joh. Seb. Bach das Allegro aus dem Italienischen Konzert gespielt hast.
Eine Woche zuvor hatte ich mein externes Abitur-Zeugnis erhalten und einen Monat später lernten wir uns kennen.
Vorwort oder Vorüberlegungen?
Es war neben anderen großen Werken geistlicher Musik Ein deutsches Requiem von Johannes Brahms, das mich bereits beim ersten Hören, dann bei der Einstudierung und vor allem bei der Aufführung tief beeindruckt hat. Dessen dritter Satz beginnt mit einem Psalmwort (39,5): „Herr, lehre doch mich, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss.“
In der Wortkonkordanz kommt der Begriff „Ziel“ einige Male ohne tiefere Bedeutung vor, in der Begriffskonkordanz hingegen fehlt er. Was also könnte unser Lebensziel sein? Da tappen wir wohl im Dunkeln.
Etwas weltlicher, ein wenig abgewandelt und laxer ausgedrückt, könnten wir dazu vielleicht sagen: „Wir dürfen nie vergessen, dass wir sterben müssen und nichts mitnehmen können. In unserer letzten Lebensphase sollten wir in der Lage sein, auf ein Leben zurückblicken zu dürfen, das in einzelnen Abschnitten geplant, in Bezug auf unser Sagen und Tun beispielhaft und trotz aller Höhen und Tiefen voller Glücksmomente war.“
Wir erinnern uns an die individuellen, vielfältigen und unterschiedlichen Zukunftspläne, die wir einst schmiedeten und an die Hoffnung, dass uns die Welt offenstehe
Wir erinnern uns an unsere Schulzeit und deren Abschluss. Wir erinnern uns an unsere erste Liebe und den ersten Kuss. Wir wollten einen Beruf erlernen oder ein Studium aufnehmen oder beides, einen sicheren Arbeitsplatz finden, Frieden und Freiheit auskosten und viel erleben. Wir wollten uns an persönliche Lebensgrundsätze halten und an einen geliebten Menschen binden, ihm die Treue halten, loyal zu ihm stehen und gemeinsam alt werden.
Wir wünschten uns eigene und gesunde Kinder, die wir lieben und behüten, erziehen und respektieren würden. Sie würden uns hoffentlich mit Stolz erfüllen und sie würden sich unser hoffentlich nicht zu schämen brauchen. Nie jedoch würden wir uns über unsere Kinder oder unsere beruflichen Tätigkeiten allein definieren. Wir würden uns nicht mit einem Bett im Kornfeld begnügen, sondern wünschten uns ein bergendes Dach über dem Kopf und den Kopf wiederum voller Wissbegier und Phantasie. Wir wollten unserer Familie gewogen sein und Freundschaften pflegen. Wir wollten die nähere Umgebung und fremde Länder erkunden und deren Einwohner kennenlernen.
Mit der Zeit lernten wir, wie beruhigend es ist, nicht jeden Pfennig umdrehen zu müssen und allesamt gesund zu bleiben. Ganz allmählich registrierten wir, dass unser Leben nicht statisch verläuft, sondern dynamisch; dass es auf Veränderung angelegt ist, nie stille steht und uns gar längere Verschnaufpausen gönnt. Wir erkannten, dass unser Einfluss auf viele Abläufe nur gering ist und wir oft fremdbestimmt sind. Ein aktives und erfülltes Leben setzte voraus, dass wir uns ständig neuen Herausforderungen würden stellen und uns weiterbilden müssten. Wir waren bereit, uns für andere Menschen einzusetzen ohne uns selbst zu vergessen und ihnen zu helfen, wo Hilfe nötig war.
Wir wünschten uns, dass wir am Ende in der Lage sein würden unsere Lebensbilanz zu unserer Zufriedenheit und mit Gewinn abzuschließen, auch wenn sich unsere Einzelziele und Wünsche nicht zu dem einen großen Ziel, von dem anfangs im Psalmwort die Rede war, würden zusammenfügen lassen. Worin sollte dieses auch bestehen?
Es wurde uns allmählich klar, dass es kein flächendeckendes Glück gebe, sondern „nur“ viele einzelne Glücksmomente, die sich jedoch zu einem Mosaik mit großen Lücken würden zusammenfügen lassen.
Rückblickend waren es wohl keine biblischen Engel, sondern unsere stillen Helden in Menschengestalt, die uns begleitet und behütet haben. Sie haben uns ungefragt geholfen und sich um uns gesorgt; mit uns gelacht und uns zugehört, wenn wir Kummer hatten; unsere Last mitgetragen und getröstet; uns besucht, als wir krank waren; an ihren Tisch eingeladen und bewirtet; uns gepflegt, bis wir wieder auf die Beine kamen oder, gemäß dem Psalmwort, davon mussten.
Diese stillen Helden gehörten zu unseren Familien, waren unsere Freunde oder unser Pflegepersonal.
Uns wurde Mut gemacht und wir haben Zuspruch erfahren. Wir waren oft allein, wurden aber nie so ganz allein gelassen.
Wir haben geglaubt und wir haben gezweifelt. Wir hatten stets eine konkrete Vorstellung von unseren irdischen Nahzielen, aber der Blick ins Jenseits wollte uns nie gelingen. In Bezug auf unser Fernziel wird deshalb auf ewig Unklarheit herrschen.
Es ist keineswegs einfach, so ganz aus sich selbst heraus und ohne auf ein konkretes Glaubensbekenntnis gestützt, genügend Lebenswillen und einzelne Etappenziele zu entwickeln, die uns wann und wo immer tragen; aber es ist möglich, das Leben von einem Augenblick zum anderen fröhlich und voller Zuversicht anzupacken.
*
Wir unterscheiden zwischen Biografien und Autobiografien. Das vorliegende Buch ist eine Mischform; denn es enthält in Bezug auf Ingrid, meine verstorbene Frau, naturgemäß viele biografische Elemente, erzähle ich doch über sie. Es trägt daneben auch autobiografische Züge, weil ich doch an vielen Geschehnissen unseres gemeinsamen Lebens Anteil hatte und selbst von ihnen betroffen war.
Da, wo es neben Tatsachen auch um Gefühle geht, tritt die Objektivität leise und bescheiden in den Hintergrund. Würde jemand ausschließlich über mich berichten, so würde ich lieber an meinen Stärken als an meinen Schwächen gemessen und insgesamt gnädig beurteilt werden. Gleiches soll auch für Ingrid gelten.
Meine nun folgende Darstellung ist einerseits grob chronologisch geordnet; aber diese chronologische Ordnung wird des Öfteren durch thematische Einschübe unterbrochen.
Auch der von mir eingenommene Erzählerstandpunkt wechselt; denn teilweise berichte ich in der ersten Person, der Ich-Form, und dann wieder in der dritten Person, je nach Belieben. Hierin spiegelt sich mein gegenwärtiges Leben wider: manchmal erzähle ich nämlich Dritten gegenüber von Ingrid als meiner geliebten Frau und manchmal halte ich gleichsam Zwiesprache mit ihr, so, als würde sie noch leben und mir stillschweigend zuhören; mal vielleicht eher kopfschüttelnd, mal mit ihrem sie auszeichnenden feinen Lächeln und mir zustimmend.
Mir ist einfach keine bessere Lösung eingefallen.
Die Jahre 1963 bis 1968
Vom 24. bis zum 27. Juli 1963 fand in Dortmund ein evangelischer Kirchentag statt, zu dem ich mit Pfarrer Dr. Jürgen Boeckh aus der ev. Kirchengemeinde Alt-Schöneberg anreiste. Jürgen Boeckh war Kriegsteilnehmer gewesen und trotz vorangeschrittenen Alters als der jüngste von drei Amtsbrüdern Jugendpfarrer in meiner damaligen Kirchengemeinde. Er war mir ein väterliches Leitbild. Er prägte meinen literarischen Geschmack und führte mich ein ins theologische Denken. Er war Michaelsbruder, glühender Anhänger der Una-Sancta-Bewegung und Freund des Berneuchener Dienstes und in seiner Frömmigkeit und in seinem geistlichen Einsatz im Dienst der Gemeinde überzeugend. Wir duzten uns, obwohl ich ja sehr viel jünger war als er.
Auf dem Kirchentagsgelände standen wir eines Tages vor dem randvoll ausgefüllten Wochenplan eines Pfarrers. Bei Jürgen Boeckh fühlte ich mich in nahezu jedem Gespräch schnell auf dem Prüfstand und so wollte er nun von mir wissen, was in diesem Plan wohl neben Predigtvorbereitung und Gottesdienst und Konfirmandenunterricht und Hausbesuchen und Geschäftsführung und Redaktion des Gemeindeblattes und Beerdigungen und Tauf- sowie Hochzeitsgesprächen und…und… eigentlich fehle. „Es kann nichts fehlen; denn es ist überhaupt kein Platz mehr,“ gab ich zu bedenken. „Doch,“ sagte er bestimmt, „mindestens zwei Wochenstunden wissenschaftlicher Weiterbildung.“ Jürgen Boeckh hat damals als geschäftsführender Pfarrer in seiner Amtszeit klaglos hart gearbeitet und viel von sich verlangt und ich schätzte das hohe intellektuelle Niveau seiner Predigten, weil sie mich herausforderten und zum Denken anregten. Ob er seine braven Gemeindeglieder damit immer erreicht hat? Nie jedoch hat er mich zum Rauchen animieren können, auch wenn er mich dialektisch davon zu überzeugen versuchte, dass gemeinsames Rauchen die gegenseitige Kommunikation fördere. Mag ja sein. Ob seine Frau und seine fünf Kinder bei häuslichen Gesprächen stets zur Zigarette greifen mussten? Ich wage es zu bezweifeln.
*
Hier in Maschen bei Unna waren wir in einem Doppelzimmer eines ehemaligen Flüchtlingsheimes untergebracht worden und als es am nächsten Morgen heftig regnete, rannten wir beide nach dem gemeinsamen Frühstück (bei dem Jürgen Boeckh nahezu die ganze Kanne heißen Kaffees zerstreut und gedankenverloren selbst ausgetrunken hatte) zu einem bereit stehenden Shuttlebus, der zwar Kirchentagsgäste, aber nur nicht uns, zum Kirchentagsgelände bringen sollte. Etwa in der Wagenmitte hatten wir gerade rechts auf den beiden Doppelsitzen Platz genommen, als ein rothaariges Mädchen die mitfahrenden Kirchentagsgäste fragte, ob jemand eine Schere oder einen Brieföffner bei sich habe – sie habe nämlich von ihrem Bruder Post bekommen. Ich fand die Frage in dieser Situation etwas ungewöhnlich, während Jürgen Boeckh bemerkte, dass dies ein sehr ordentliches Mädchen sei.
Der Rotschopf entschwand bald wieder meinen Augen, war er doch durch die Nackenstützen der Sitze vor uns nicht mehr zu sehen.
Ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, ob ich sie beim Aussteigen schon wieder vergessen hatte oder ob sie flink wie ein Wiesel durch den Regen davongehuscht war. Egal, ich hätte sie bei meiner schüchternen Art wohl sowieso nicht angesprochen.
Erster Rückblick:
Hannelore, meine erste Freundin, hatte ich 1961 kennengelernt, aber sie hatte sich ungefähr anderthalb Jahre später von mir mit den überzeugenden Worten getrennt, dass man Liebe nicht erzwingen könne. Zu meiner Entschuldigung muss ich gestehen, dass ich von 1960 bis 1963 wirklich nur die Vorbereitung meines Abendabiturs bei Gabbe‘s Lehranstalten am Rüdesheimer Platz im Kopf hatte und das war schon zeitaufwendig und schwer genug! Für ausgedehnte Freundschaften mit einer Studentin der Romanistik hatte ich nur wenig Zeit zu erübrigen – und ihre nutzbringenden Korrekturen meiner französischen Anfängerübungen und kleinere Zärtlichkeiten und Bootsausflüge im Zwei-Wochen-Abstand genügten ihr wohl nicht. Das war zu verstehen– aber ich wollte studieren und die Studienratslaufbahn einschlagen, auch wenn ich es dabei als Sohn eines Handwerkers nicht ganz einfach haben würde.
Mein Vater wusste mit mir und meinen Plänen ohnehin nicht viel anzufangen. Er leistete verbalen Widerstand, konnte mich aber von meinen Berufsplänen nicht abbringen. Ich sollte Bierbrauer werden, weil Bier schließlich immer getrunken werde. Eigentlich schulde ich meinem Vater nachträglich Dank; denn er war für mich eine steile und schwer überwindbare Kletterwand, an der ich mich im Kraxeln üben konnte. Wände rühren sich nie, aber mir gelang der Aufstieg, weil ich mein Ziel vor Augen hatte. Nach Wanderungen trinke ich übrigens gern ein Bier, meist ein alkoholfreies Hefeweizen. Aber selbst brauen?
Es war also eine schwierige Gemengelage widerstreitender Interessen inmitten meiner eigenen noch völlig ungeklärten beruflichen und finanziellen Situation und mangelnden Selbständigkeit, die mir keineswegs zu einem gesunden Selbstbewusstsein verhalf, am allerwenigsten gegenüber Mädchen. Ich erinnere mich an Elke-Marie aus meiner Lehrzeit bei der Berliner Commerzbank, die mir ihre Zuneigung bekundete und an Ursula aus Wuppertal, die ich bei meinem Freund Erwin in Zeppenfeld kennengelernt hatte und mit der ich eine längere Brieffreundschaft pflegte. Aber ich war für eine engere Beziehung mit vollem Programm einfach noch nicht reif und wurde daher wiederholt schmerzhaft losgelassen.
Seit Mai 1963 war ich schließlich im Besitz meines Abiturzeugnisses, das ich einschließlich einer halbjährigen Verschnaufpause und der freiwilligen Wiederholung der dreizehnten Klasse nach insgesamt dreijähriger Vorbereitung in einer externen Prüfung am Hermann-Ehlers-Gymnasium in Steglitz erworben hatte.
Magerer Notendurchschnitt: 3,0.
Ich hatte in dieser mehrjährigen Vorbereitungsphase im Hauptgeschäft der Berliner Commerzbank AG an der Potsdamer- Ecke Bülowstraße gearbeitet, zuerst als Kreditsachbearbeiter und später als Kontoführer, und legte wochentags zwischen 17 und 18 Uhr den Fußweg von dort zu Gabbe‘s Lehranstalten am Rüdesheimer Platz zurück. Dieser Weg erfuhr einmal eine unfreiwillige Verlängerung um einige Meter, weil ich den Prostituierten in der „Leihkörperallee“, also der Potsdamer Straße, mit züchtig niedergeschlagenen Augen ausweichen musste.
Ab Herbst wollte ich mit Hilfe einiger sozialer Bonuspunkte ein Studium der Geschichte und Anglistik an der Freien Universität Berlin beginnen. Noch wusste ich glücklicherweise nicht, dass ich Latein würde nachlernen müssen, um im Fach Geschichte die Prüfungen zum Hauptseminar ablegen zu können. Französisch als eine in vier Semesterkursen neu zu erlernende Sprache bis hin zur Abiturreife war für mich bei Gabbe‘s schon Herausforderung genug gewesen.
Zweiter Rückblick:
Seit meiner Konfirmation im Jahre 1955 durch Kirchenrat Martin Perwitz (der übrigens Jahre zuvor auch Hildegard Knef konfirmiert hatte) war ich fest in der evangelischen Kirchengemeinde Alt-Schöneberg verankert, hatte dort während meiner Ausbildung zum Bankkaufmann auf Vorschlag von Gundolf Herz, meinem ersten Jugendgruppenleiter (und späterem Pfarrer), nun selbst als Leiter der Jungschargruppe Artus Heimabende geleitet und Westwanderfahrten für Jungengruppen unternommen. Ausgerüstet waren wir jedesmal mit Affen, Wimpel, Kochgeschirr, Gitarre und grauen Fahrtenhemden mit aufgenähtem Ankerkreuz. Mein Vater war dagegen gewesen und hatte in dieser Frage nicht ganz unrecht; denn ich war noch längst nicht volljährig und die Haftungsfrage im Fall der Fälle war meines Wissens nicht eindeutig geklärt. Bis 1974 sang ich als ständiges Mitglied in der Gemeindekantorei unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Johannes Günter Kraner mit und fand Gefallen am Singen geistlicher Musik verschiedenster Epochen bis hin zur Moderne, wobei ich experimentelle Musik der jüngeren Zeit eigentlich immer nur widerwillig musizierte. Ich liebe weder Zwölftonmusik noch solche, bei der man zischen, rascheln oder schnalzen soll, im Glissando Fahrstuhl fährt oder undefinierbare Laute und Silben von sich geben muss.
Hier im Kirchenchor lernte ich, was intensives Proben heißt und dass nur beharrliches und diszipliniertes Üben zum ersehnten Erfolg führt. Jedes Konzert war eine neue Herausforderung für uns und beschenkte mich mit der beglückenden Wahrnehmung gelebter Gemeinschaft und dem Wagnis gemeinsamer Unternehmungen und jedweden Risikos mit ungewissem Ausgang.
Johannes Günter Kraner hatte mich musikalisch und Jürgen Boeckh (verstorben 2011) hatte mich in seinen Predigtvorbereitungs-Kreisen geistlich gerüstet.
Dritter Rückblick:
Zum Jahreswechsel 1962/63 hatte ich meine Arbeitsstelle bei der Berliner Commerzbank AG gekündigt um mich auf die schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen vorzubereiten. In den Augen meiner Arbeitgeber tat man so etwas nicht, vor allem nicht angesichts eines solch ungewissen Studienvorhabens. Ich musste jedoch das Ruder herumreißen; denn noch stand ich sowohl in Französisch als auch in Mathematik nur ausreichend bzw. mangelhaft. Auf meinem Abiturzeugnis fand sich dann später in Mathematik glücklicherweise ein Gut und in Französisch ein Befriedigend, wobei ich heutzutage der französischen Sprache in Wort und Schrift mangels praktischer Übung leider nicht mehr mächtig bin. Ich kenne zwar jede Menge Vokabeln, kann sie aber überhaupt nicht mehr im Satzzusammenhang verwenden. Aber ich könnte auch keine Differential- oder Integralrechnungen mehr lösen. Wozu auch? Muss ich wirklich wissen, wie lang ein Langholzwagen sein darf, damit er noch um eine bestimmte Ecke kommt?
Diese persönlichen Erfahrungen bestärkten mich später in der Überzeugung, dass wir Vieles – wenn auch nicht Alles – durch Fleiß und Konzentration und eisernen Willen erreichen können, sofern wir von Talenten und Begabungen nicht völlig verlassen sind und unser Koordinierungssystem im Gehirn mitspielt. Oder soll ich es Begabung nennen? Ich habe gelernt, dass auch träges Wissen Geist und Denkvermögen schult.
Vierter Rückblick:
Meine Eltern und ich lebten seit 1959 in einer Zwei-Zimmer-Neubau- Wohnung der DeGeWo in der Heilbronner Straße 29, in W 30, dort, wo die Heilbronner Straße eine sackgassenartige Kehre mit Halteverbot zur Motzstraße hin bildet, mit wunderschönen Rotdornbäumen in der Mitte. Wir hatten einen Balkon über einer Durchfahrt zum Hof, fließendes warmes und kaltes Wasser sowie eine Küche mit Kühlschrank; aber noch fehlten uns Fernseher und Telefon.
Wir gehörten formal zur evangelischen Gemeinde Zum Heilsbronnen, wo ich mit genauer Beobachtung Pfarrer George leidenschaftlich predigen hörte und ihn dabei beobachtete, wie er es mit Hilfe verschiedener Tricks verstand, seine Gemeinde in innere Bewegung zu versetzen.
Mein Vater, gelernter Dekorateur, war nach seiner Rückkehr aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft in Paris im Jahre 1947 im zweiten Beruf Polsterer und Tapezierer geworden und arbeitete später jahrzehntelang „bei den Amerikanern“ in der Goerzallee. Meine Mutter war gelernte Verkäuferin, die in den folgenden Jahren Jobs an der Warenausgabe im KaDeWe und bei meinem Onkel in dessen Friseursalon in der Werbellinstraße 1 annahm. Ich selbst war Bankkaufmann geworden, nicht aus Leidenschaft oder Überzeugung, sondern, wie zuvor bereits berichtet, einzig und allein um mein späteres Abendabitur finanzieren zu können.
Mit meinen sozialen, theologischen und musikalischen Interessen stand ich zum Leidwesen meiner Eltern nicht in der gewohnten Familientradition und ich denke, meine Teilnahme am Kirchentag in Dortmund bereitete ihnen ebenfalls Kopfzerbrechen. Was mochte das Ganze wohl bedeuten und was sollte aus dem Jungen bloß einmal werden?
Ich hatte nun zwar mein Abitur in der Tasche, stand aber ohne Freundin da. Ohne ihr Wissen hatte Hannelore jedoch mein Selbstbewusstsein ein wenig aufgebaut und mich damit von einer unangenehmen Krankheit geheilt, einer Krankheit, die mit großer Wahrscheinlichkeit auf meinen Angstzuständen beruht hatte und auch nach ihrer Trennung von mir glücklicherweise nie wieder zurückkehrte.
***
Es war am Samstag, 27.07.1963, dem dritten Veranstaltungstag in Dortmund, als ich auf dem sonnenbeschienenen Kirchentagsgelände unterwegs zu einem Vortrag von Prälat Hanssler war. Völlig unvermutet entdeckte ich den Rotschopf aus dem Shuttlebus in etwa dreißig Metern Entfernung vor mir.
Wer mochte sie wohl sein?
Woher stammte sie?
Was hatte sie vor und wo wollte sie hin?
Sie trug ein Minikleid und hatte einen flinken und wiegenden Gang. Sie kam mir entgegen und damit schmolz der uns trennende Abstand im Nu dahin.
Ich konnte keines der gängigen Klischees aus einschlägigen Liebesfilmen bedienen:
Sie kam mir keineswegs entgegen gestolpert, so dass ich sie hätte auffangen können; denn dazu war die Entfernung anfangs noch zu groß. Wir stießen nicht versehentlich zusammen; denn der Weg war breit genug und wir waren ja nicht blind. Sie verlor auch nichts, worauf ich sie hätte aufmerksam machen und was ich hätte aufheben können; ich hatte auch keine Visitenkarte, die ich hätte hervorzaubern können. Natürlich hätte ich sie auch fragen können, ob sie das Briefkuvert vorgestern im Bus am Ende habe schadlos öffnen können - aber diese Frage fiel mir einfach nicht ein.
Vermutlich habe ich meinen Gang verlangsamt, sie fragend angeschaut und – gelächelt. Mit einem grimmigen Gesicht hätte ich bei ihr schließlich keinen Blumentopf gewinnen können und es hätte ja auch dem Anlass überhaupt nicht entsprochen!
Meine Mutter hatte mich mit einem undefinierbaren Unterton oft „Ernstchen“ genannt – sie hatte ja Recht: bis zum heutigen Tag bin ich eher von ruhiger und ernster Natur und lache über komische Situationen nie sofort, weil ich üblicherweise doch einige Zeit zum Begreifen brauche; aber ich schweife schon wieder ab und unterbreche die Handlung. Also: Hätte ich diesmal nicht etwas schneller als üblich reagiert, wäre mein Rotschopf längst vorbei gewesen.
Als wir beinahe auf gleicher Höhe waren, blieben wir wie angewurzelt stehen und ich fragte sie (später duzten wir uns ja bekanntlich) vermutlich mit meinem gewinnendsten Lächeln, ob sie in meine Richtung ginge – was sie bejahte.
Ich habe diese Begebenheit schon oft erzählt und bin bis heute von unserer damaligen gemeinsamen wortkargen Hilflosigkeit und der geringen Logik meiner Frage (und nicht minder von ihrer Antwort) immer noch innerlich berührt.
Wir gingen zum Herrn Prälaten. Wir saßen artig nebeneinander und blickten uns verstohlen von der Seite an – oder etwa nicht? Immerhin zogen mich ihr linkes Knie und ihre Sommersprossen magisch in den Bann. Der Vortrag war mir nicht mehr so wichtig, weil neben mir (m)eine Zauberfee saß, die mich unglaublich beeindruckte.
Ich weiß nicht mehr, wie es weiterging, aber wir entdeckten zur gegenseitigen Überraschung und Freude, dass wir beide aus Berlin kamen. Ingrid – und hier muss ich zum ersten Male ihren Namen einführen – erzählte mir, dass sie auf Einladung des Schauspielstudios Iserlohn als Statistin in einem für den Kirchentag konzipierten Bühnenstück Alle Tage ist kein Sonntag teilnehme.
Unlängst fiel mir ein an Ingrid gerichteter Brief vom 27.06.1963 in die Hände, in dem eine Ingeburg Heine das Folgende an sie schrieb:
Liebe Ingrid!
Von Herrn Gumpel habe ich erfahren, daß Du beim Kirchentags-Spiel mitmachen möchtest. Ich habe die Leitung der Gruppe nach Dortmund übernommen. Wir werden im Durchgangslager Maßen bei Dortmund untergebracht (2-4 Bettzimmer) und fahren mit Bussen ins Westfalenhallengelände. Über das Spiel kann ich noch nichts sagen. Ihr erhaltet alle noch einen Rüstbrief. Ich schicke Dir das Teilnehmerblatt zu; bitte laß es von Deinen Eltern unterschreiben und gehe in den ersten Juli-Tagen zum Arzt. Die Fahrt und der Aufenthalt sind kostenlos. Die 15,-- DM sollen uns bei Ausflügen in unserer Freizeit helfen. Wird das Geld nicht benötigt, so bekommst Du es ausgezahlt, wenn Du Dich von uns wieder trennst.
Damit wir uns aber schon einmal kennenlernen, wollen wir uns am 6.7. um 16,00 Uhr bei mir treffen. Zu diesem Termin bringe dann bitte das Geld und den ausgefüllten Teilnehmerschein mit.
Mit freundlichen Grüßen, Deine Ingeburg Heine
Ein heutiger Leser gerät ins Grübeln, wenn er liest, dass Ingrid als 18jährige noch eine Unterschrift Ihrer Eltern benötigte. Die Erklärung ist ganz einfach, denn in jenen Jahren wurden wir erst mit 21 volljährig.
Nun zurück zu unserer ersten Begegnung:
Vermutlich tauschten wir unsere Adressen aus. Sie kam aus Neukölln und wohnte in der Warthestraße 1-2, mit Telefonanschluss! Ich versprach ihr, am Abend, dem letzten Veranstaltungstag, zur Aufführung zu kommen.
Ich hielt mein Versprechen und in der Dämmerung gab sie mir beim Abschied vor einer gelben Telefonzelle ihren Koffer mit auf den Weg nach Berlin, da sie anschließend noch weiter in ein zweiwöchiges Zeltlager der drj, der deutschen reformjugend, nach Staffelstein wollte und der Koffer dabei nur hinderlich sein würde. Gemeinsam bemühten wir uns erfolgreich um eine private Mitfahrgelegenheit für sie.
Ich glaube, in dieser Situation gingen wir vom Sie zum Du über:
„Wenn ich schon den Botendienst mit dem Koffer übernehme, dann möchte ich aber eine Belohnung,“ erklärte ich Dir. „Sei nicht so materialistisch,“ gabst Du mir ein wenig empört zur Antwort, nicht verstehend, was ich wohl meinte. Aber ich holte mir meine Belohnung, nämlich einen ersten zarten Kuss von Dir – es war ein zarter Lippenkuss, mehr war nicht drin. Du hast später immer bereitwillig geküsst, aber das, was ich mir von einem innigen Kuss vorstellte, war Dir vermutlich eher fremd. Sehr leidenschaftlich kamst Du mir unter der Straßenlaterne jedenfalls noch nicht vor!
Der damalige Kirchentagspräsident von Thadden-Trieglaff gestaltete im Stadion Rote Erde einen Teil der Liturgie und ich erinnere mich an den kuriosen Augenblick, in dem ein Windstoß seine sämtlichen Manuskriptblätter vom Podium wehte.
Ob ich an Dich dachte? Mit Sicherheit! Es war sehr heiß und Du schliefst als ermüdete Helferin, wie Du mir später erzähltest, auf dem Rasen ein.
Üblicherweise wird auf Kirchentagen gefragt, was die Teilnehmer mit nach Hause in den Alltag nähmen. Für mich war die Antwort klar: Dich und Deinen Koffer!
In einer Notiz aus dem Jahre 2010 schriebst Du mir, ich sei damals so anders als Andere gewesen und hätte so männlich gewirkt! Ehrlich gesagt, ich wäre mir da nicht so sicher gewesen, zumal ich mich ganz anders eingeschätzt habe.
Deine Fahrt nach Staffelstein sei herrlich und abwechslungsreich gewesen. Von Ferne hättest Du den Kölner Dom gesehen und Würzburg habe es Dir angetan. Wenig später erreichte mich eine Ansichtskarte von der Nürnberger Sebalduskirche. In einem ausführlicheren Brief erfuhr ich dann Folgendes: