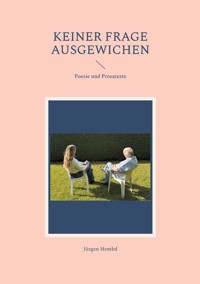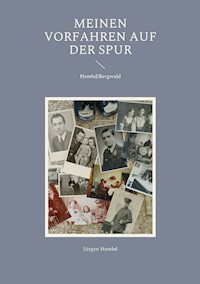Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesem Band versammelt der Autor in bunter Reihenfolge verschiedene seiner Gedichte und Prosatexte, die er beim neugierigen Stöbern mit teils großem Erstaunen in seinen Unterlagen als längst vergessene Zufallstreffer wiederentdeckt hat. Sie sind während mehrerer Jahrzehnte und zu verschiedensten Anlässen entstanden. Aus diesem Grunde stehen sie nur in Einzelfällen in einem allenfalls eher lockeren thematischen Bezug zueinander. Sie dürften aber dennoch auf das Interesse der Leserschaft stoßen, weil sie oft Fragen aufwerfen, die sich ein jeder von uns stellen könnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch
Ist
René Schütz
gewidmet.
Inhaltsverzeichnis
(Gedicht sind kursiv hervorgehoben)
Vorwort
Auch wenn ich mich wiederholen sollte, so sei die Frage nochmals gestellt:
Wie fing eigentlich alles an bei mir – ich meine die Sache mit dem Schreiben von Poesie und Prosa?
Erste außerschulische Prosatexte entstanden wohl bereits in den 50er Jahren.
Da war ich, selbst immer noch ein Jugendlicher, Jugendgruppenleiter der Gruppe Artus an der evangelischen Kirchengemeinde Alt-Schöneberg und berichtete von unseren „Westwanderfahrten“. Diese Fahrten führten meist per Bus über die zugelassenen Transitwege von Berlin-West nach „Westdeutschland“, wobei einige Jugendliche als Flüchtlingskinder damals sicherheitshalber meist bis Hannover mit dem Flugzeug hin- und zurückfliegen mussten – man konnte ja nie wissen…
Die Geburtsstunde meiner poetischen Versuche hingegen lag später.
Im Jahre 1970 wurde ich nach meinem Ersten Staatsexamen Studienreferendar an der Werner-von-Siemens-Oberschule, einem Gymnasium in Berlin-Nikolassee. Dort wurde (das genaue Jahr ist mir nicht mehr erinnerlich) der von uns allen verehrte und geliebte August Dahrendorf, Oberstudienrat und stellvertretender Schulleiter, auf eigenen Wunsch ein wenig vorzeitig in den Ruhestand verabschiedet. Er hatte nämlich aus den Lebensdaten mehrerer seiner Vorfahren die durchschnittliche Lebensdauer seiner Altvorderen errechnet, diesen Durchschnittswert auf sich selbst bezogen und entschieden, dass es nun allerhöchste Zeit sei, das berufliche Handtuch zu werfen um wenigstens noch einige Jahre genüsslich leben zu können. (Im Übrigen wurde er älter als von ihm zunächst „errechnet“ worden war.)
Er hatte Chemie und Physik unterrichtet und so baute ich ihm die „DaKi“, die „Dahrendorf´sche Kiste“, deren Funktionsweise ich dann mit Hilfe eines entliehenen weißen Kittels (einen solchen trug er nämlich stets in seinem Unterricht) vor aller Augen vorführte. Es war ein kleines trickreiches Zauberwerk, mit dem sich auf gewollt naive Weise r physikalische „Versuche“ stark verfremdet darstellen ließen, Versuche, aus denen ich dann zur Belustigung des Kollegiums vier „Dahrendorf´sche Regeln der Physik“ ableitete.
August Dahrendorf schien in seinem Herzen von unser aller Zuneigung ihm gegenüber tief bewegt und seine Dankesrede erstarb dann unter seinen Tränen. Frau Behm, unsere damals einzige und einzigartige Musiklehrerin, löste die Spannung auf, indem sie lautstark das Büffet eröffnete.
Bei weiteren Kollegiumsfeiern fertigte ich Karikaturen auf Overhead-Folien an oder verkleidete mich als Weihnachtsmann – aber bald fiel mir nichts Rechtes mehr ein.
In jenen Tagen (in den frühen 80ern) pflegte ich mittwochs nach Schulschluss mit Frau Dr. Herrmann, einer liebenswerten Kollegin aus dem naturwissenschaftlichen Fachbereich, im Musiksaal am Flügel vierhändig Diabelli zu spielen. Ich spielte immer auf der rechten, der einfacheren Seite, der Seite für Minderbegabte. Leider fehlte mir trotz aller Motivation und beharrlichen Übens zum Klavierspiel das nötige pianotechnische Talent. Vielleicht oder viel wahrscheinlicher beruhte dieses Unvermögen wohl auf der mangelnden Koordinierungsfähigkeit meines Gehirns. Es ist mir bis heute ein Rätsel, wie begabt Menschen (wie etwa meine verstorbene Frau oder sämtliche mit bekannten Kantoren) sein müssen, die unglaublicherweise mit links und zugleich mit rechts jeweils verschiedene Tasten auf einmal greifen können, wobei ihnen selbst unterschiedliche Tonlängen und verwirrende Vorzeichen wenig auszumachen scheinen.
Es kam der Tag, an dem ich gebeten wurde, bei einer größeren schulischen Veranstaltung meine inzwischen erworbenen und doch bescheidenen Tonkünste auf dem Flügel zum Besten zu geben – allein, ich weigerte mich beharrlich und hätte diesen Härtetest auch aus den oben genannten Gründen niemals bestanden. Es sollte mir überhaupt nichts ausmachen, in der vollbesetzten Aula im Quartett Bach´sche Weihnachtschoräle zu singen, weil ich mit meiner Stimme sprechend oder singend umgehen kann. Instrumental jedoch vorzuspielen, das war für mich nicht zu bewältigen.
Ein weiterer Beitrag bestand in einem Gedicht – und ich errang einen ersten Achtungserfolg. In den folgenden Jahren fand ich Gefallen an der Idee, zur Überraschung und Freude der Anderen „unerwartet“ etwas Gereimtes sozusagen „aus dem Hut“ (oder besser „aus der Jackentasche“) hervorzuzaubern. Bald jedoch war es nicht mehr unerwartet, sondern es ergab sich wie von selbst ein gewisser Zugzwang; denn ich konnte mich nun besonders bei Verabschiedungen von Kollegen in den Ruhestand schon aus Gründen der Gerechtigkeit niemandem verweigern. Aber ich möchte es nicht verhehlen, dass mir diese kleine Abstattung meines Dankes für gute Zusammenarbeit über viele Jahre stets ehrliche Freude bereitet hat; denn indem man gibt, nimmt man bekanntlich auch.
Dichten heißt seine Gedanken in verdichteter Form auszudrücken. Manchmal werden dabei die strengen Regeln der Syntax ausgehebelt und zuweilen gilt das Gesetz der dichterischen Freiheit. Es mag sein, dass wir uns in Prosaform subtiler und präziser ausdrücken können. Beim Dichten bedienen wir uns oft der „uneigentlichen“, der metaphorischen (bildhaften) Sprache und diese besondere Sprachform verfehlt selten ihre Wirkung.
Viele meiner nachfolgenden Gedichte sind in ihrer Vorbereitungsphase unterwegs entstanden: in der U-Bahn, in der S-Bahn, im Bus, im Regionalzug, mitten auf der Straße, bei Wanderungen und gelegentlich in meinen Wachträumen. Stets hatte ich kleine Zettel und etwas zum Schreiben dabei und konnte sofort festhalten, was mir gerade an Gedanken eingefallen war. Es gab Tage, da fielen mir die Reime nur so zu. Dann wieder kamen Zeiten einer dichterischen Dürreperiode.
Oft hatte ich in den achtziger Jahren nach einiger Zeit ungebetene Zuschauer, wenn ich mit meinem Skizzen- oder Malblock oder gar mit meiner Staffelei irgendwo im vermeintlich verborgenen Gelände saß oder stand. Wir Menschen sind offenbar fasziniert vom Beobachten des kreativen Schaffensprozesses der Anderen:
„Ah, da malt eena – lass ma kieken!“
Wen hingegen interessiert es schon, wenn jemand fotografiert oder dichtet?
Als ich im Jahre 2006 pensioniert wurde, erhielt ich vom Kollegium ein verfremdetes Portraitfoto, auf dem ich aussehe wie Shakespeare. Man hatte mich ehrenhalber zum „poetus laureatus“ ernannt. Danke! Ich begrüße mich selbst an jedem Morgen beim Aufstehen als das andere Ich.
Im Jahre 2007 veröffentlichte ich bei BoD unter dem Titel „Wie ein Magnet“ einen kleinen Gedichtband, den ersten, den ich meiner Frau widmete.
Seit einigen Jahren ist meine Dichterseele phasenweise verstummt und ich vermeide es, ohne Not irgendwo deklamierend in den Mittelpunkt zu treten; denn nirgendwo steht geschrieben, dass wir ein Leben lang dieselbe Rolle spielen müssen – oder?
Jürgen Hembd
Berlin, im Frühjahr 2023
Auftakt zum Fest
Gegrüßt seid Ihr, Ihr lieben Gäste, Kamt Ihr hierher von nah und fern, Bei uns zu sein zu diesem Feste. Gegrüßt seid Ihr, wir seh’n Euch gern!
Lasst speisen uns und Gläser klingen, Lasst lachen uns und fröhlich sein, Lasst reden uns und lasst uns singen Beim kunterbunten Stelldichein!
Was gibt uns Kraft zu diesem Leben, Es sei denn Lieb‘ und Zuversicht? Die feste Bindung, die wir weben, Die zeige uns den Weg zum Licht!
Auf festen Wegen woll’n wir wandeln Durch dieses Daseins weiten Raum; Bedacht und stets mit Klugheit handeln, Im Herzen tragen unsern Traum!
Seid abermals gegrüßt, Ihr Gäste, Seid unbeschwert bei Lied und Spiel! Geht froh nach Haus‘ Ihr nach dem Feste, So ist erreicht dann unser Ziel.
(J.H. 18.03.1989; b. 03/2023)
Das Hindernis
Die folgende Begebenheit spielte im Jahre 1962 am Nordwestufer der Griebnitzsees, im alten West-Berlin, gegenüber „Griebnitzsee/ Ecke“ Teltowkanal und den Bäkewiesen. Hauptdarsteller sind ein junges Paar und ein Paddelboot:
Sie lagen nebeneinander am Seeufer.
Sie im prallen Bikini, er in seinen karierten Badeshorts.
Der Sommerhimmel war wolkenlos.
Sanfte Wellen schlugen gegen die Wände des Bootes ein paar Meter unten am Ufer.
Sie hatten einander lange nicht mehr gesehen, ja fast gänzlich aus den Augen verloren.
Sie studierte Romanistik im fortgeschrittenen Semester.
Er steuerte auf sein externes Abitur und sein anschließendes Studium zu.
Sie regte sich darüber auf, dass sie so viel Energie für das Studium des Altfranzösischen aufbringen müsse, Studieninhalte ohne praktischen Nutzwert!
Drüben lag der Campingplatz.
Stimmenwirrwarr, Lachen und Rufen jenseits des flimmernden Sees.
Unmittelbar daneben verlief im rechten Winkel die Staatsgrenze mit ihrem blinkenden Metallzaun und den Hundelaufgittern.
Dahinter der gepflügte Todesstreifen.
Manchmal bellte einer der Wachhunde in die gleißende Öde.
Phonetik sei doch viel wichtiger als Altfranzösisch!
Er hörte ihr zu und dann auch wieder nicht.
Seine Gedanken wanderten hinüber, bis hinter die Grenze.
Nein, dieser Zaun war ein unüberwindliches Hindernis.
Grammatik sei wichtig für´s Korrigieren. Ohne Grammatik ginge es nicht.
Nein, natürlich nicht!
Er beobachtete das wechselnde Schattenspiel der Blätter schemenhaft auf ihrem Körper tanzen.
Es war alles wohlgeformt und da, wo es hingehörte.
Sie bräuchte noch viel, viel Zeit um die umfangreiche französische Literatur zu lesen.
Dann erhob sie sich um etwas aus dem Boot zu holen.
Da war es wieder:
Ihrem Gang fehlten die gewisse Eleganz und Leichtigkeit, ihre Bewegungen waren so wenig geschmeidig, eher ungelenk.
Das war ihm schon letztes Jahr als hinderlich aufgefallen.
In ihm kämpfte sein Verstand vergeblich gegen sein Gefühl.
Drüben konnte man die Grenzwächter auf ihrem Turm lungern und mit ihren Ferngläsern in die Weite spähen sehen.
Lauter Hindernisse heute!
Jahre danach erfuhr er, dass sie ihre Examina bestanden hatte.
Und er die seinigen.
(J.H. undatiert; b. 03/2023)
Das tapfere Schneiderlein und die Moral vom Tod der Riesen
Soweit ich mich daran erinnern kann, geht die folgende Begebenheit auf einen Theaterbesuch (vielleicht Anfang der 80er) mit unseren damals noch kleinen Kindern zurück. Wann und wo genau – ob im Theater des Westens oder im Hansaviertel - das habe ich leider vergessen.
Als Belohnung winkt ihm die Hand der Prinzessin, so steht`s im Buch, so geht´s zu auf der Theaterbühne. Aber zuvor muss das tapfere Schneiderlein noch die beiden Riesen zur Strecke bringen, die das Land verunsichern.
So will´s der König.
Und diese beiden Kerle müssen wir uns furchterregend ausmalen: Groß wie Türme und ungeschlacht, zottelig und grimmig, mit bleckenden Zähnen und Pranken zum Baumausreißen, mit Füßen wie Brückenpfeiler und Mäulern wie Scheunentore.
„Die können vor Kraft nich loofen,“ würde man in Berlin dazu sagen.
Ein großes Maul hatten sie wirklich. Wir werden es gleich hören.
Das clevere Schneiderlein hatte nämlich einen Ast genau über den schlafenden Giganten bestiegen - natürlich nicht, ohne zuvor seine Taschen mit Steinen prall gefüllt zu haben. Und einige dieser Steine schleuderte es nun dem einen der beiden Riesen auf die Birne. Der hatte allerdings eine lange Leitung und tat sich mächtig schwer herauszufinden, was Sache war.
„He, Du, was schlägst Du mich?“ dröhnte er seinem Kumpanen ins Ohr.
Der wiederum grunzte schlaftrunken: „Du träumst, ich schlage Dich nicht.“
Nach einer Weile wiederholte sich das Spiel und dann noch öfter, jeweils mit vertauschten Rollen – versteht sich, bis es unseren beiden hellen Köpfchen dann doch zu bunt wurde.
So steht´s im Buch, so geht´s zu auf der Bühne.
Sie rülpsten und röhrten und schubsten und stießen sich. Sie schäumten vor Wut und kamen so richtig in Fahrt. Sie rissen schnell mal ein paar Bäume aus, schlugen sich diese um die Ohren und schlugen sich gegenseitig mausetot.
So steht´s im Buch, so geschieht´s auf der Seitenbühne.
Meine Tochter und mein Sohn und alle anderen Kinder kommen aus dem Staunen nicht mehr raus.
Ja, und die Moral von der Geschicht´?
„Wenn zwei sich schlagen, freut sich der lachende Dritte“ oder „Lieber schlau und schmächtig als blöd und kräftig“?
Was wäre geschehen, wenn die großmäuligen Riesen bei Trost gewesen wären?
Dann hätten sie vermutlich den faulen Zauber entdeckt, hätten das tapfere Schneiderlein wie ein Eichhörnchen über die Baumwipfel gefegt, so ganz ohne Belohnung und happy ending mit der ersehnten Prinzessin.
Unsere Geschichte hätte dann kein blutrünstiges Ende und keine überzeugende Moral. Wie fade – lieber mit Moral!
Also gut, bleiben wir bei der Moral und den Riesen in unserer Welt.
Bei modernen Riesen? Bei den Riesen unserer Zeit?
Ob wir als Dritte noch zu lachen hätten, wenn die provoziert und sich schlagen würden?
Keine Bange, Leute, Das tapfere Schneiderlein ist doch nur ein Märchen!
(J.H. undatiert; b. 03/2023
Wie gut kann man mit dem Herzen sehen?
Als vor 60 Jahren der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry (1900 – 1944) von der Frau seines amerikanischen Verlegers um einen Text für Kinder gebeten wurde, schrieb er „Der kleine Prinz“.
In der Rahmenhandlung erfahren wir, dass der Erzähler als Sechsjähriger gerne Maler geworden wäre, hätten ihm die großen Leute nur Mut gemacht. War aber nicht so. Demzufolge sei er Flieger geworden. 1937 könnte es gewesen sein, da sei er mit einem Motorschaden in der Sahara notgelandet, mit Wasservorrat für acht Tage.
„Bitte…zeichne mir ein Schaf!“ Der ihn, den in der Einsamkeit Gestrandeten, mit seltsam klarer Stimme aus dem Schlaf reißt, ist – und hier tauchen wir ein in das Reich der Fantasie – der kleine Prinz, Besitzer von drei Vulkanen und einer Blume mit vier Dornen, wohnhaft auf dem Asteroiden B 612, einem hausgroßen Planeten. Er ist auf die Erde gefallen, auf der Suche nach einem Freund.
Endlich hat er einen Erzähler gefunden, der, stets allein geblieben, den Erwachsenen mit großem Abstand begegnet, weil diese doch nie das Wesentliche fragten.
Beharrlich stellt der kleine Blondschopf seine Fragen. Er kann herzlich lachen, und bitterlich weinen. Er liebt Sonnenuntergänge über alles und gibt sich mit der Zeichnung eines Schafes zufrieden, ausgeführt von der ungelenken Hand des Erzählers – ein Schaf, eher einer Kiste gleichend. Hoffentlich würde dieses Schaf die jungen Triebe des überaus schädlichen und riesenhaften Affenbrotbaumes wegknabbern und damit (umweltbewusst) den kleinen Planeten retten! Wollte es jedoch auch noch die zauberhafte Blume fressen, so bräuchte es wohl am Ende einen Maulkorb.
Der kleine Prinz nimmt uns mit auf Entdeckungsreisen in die Region von sechs Asteroiden, je bewohnt von einem König, einem Eitlen, einem Säufer, einem Geschäftsmann, einem Laternenanzünder und einem Geografen. In ihren Eigenheiten findet er sie fast sämtlich lächerlich, weil ihnen der Blick auf das wahre Leben verstellt sei. Auf den Rat des Letztgenannten macht sich der kleine Prinz auf zum Planeten Erde, der zwar einen guten Ruf habe, wo es aber nur so an Königen bis zu Laternenanzündern und erwachsenen Leuten wimmele. Auf die Erde gefallen und in Afrika gelandet, begegnet er der zischenden und mächtigen und zudem todbringenden Schlange. Er entdeckt eine einsame Wüstenblume und das hohle Echo der Berge. Er gelangt in einen Rosengarten, in dem sich fünftausend Rosen gleichen wie ein Ei dem anderen. Als ihm bewusst wird, dass er auf B 612 nur eine einzige gewöhnliche Blume besitze und drei kniehohe Vulkane, wirft er sich ob seiner Bedeutungslosigkeit weinend ins Gras.
Auf der Suche nach Menschen begegnet er einem ungezähmten Fuchs, der ihn bittet, ihn zu zähmen - jedoch nonverbal, weil die Sprache Quelle aller Missverständnisse sei. Der Fuchs möchte des kleinen Prinzen Freund werden, wissend, dass man nur Dinge wirklich kenne, die man zähme.
Und plötzlich begreift der kleine Prinz, dass seine Rose, von ihm gezogen und geschützt, gehegt und gepflegt, einzig in der Welt sei – niemals zu vergleichen mit jenem namenlosen Rosenfeld. Mit ihr habe er sich vertraut gemacht durch die Zeit, die er für sie verloren habe. Zeitlebens werde er für sie verantwortlich sein – zeitlebens.
Beim Abschied verrät ihm der Fuchs (s)ein Geheimnis: „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“
Das Herz - Sitz der Empfindungen?
Das Herz - Ausgangspunkt unserer Gedanken, prägende Kraft unseres Wesens?
Das Herz - Ort unseres Gewissens?
Bei seinen Wanderungen auf dem Planeten erfährt der kleine Prinz von der steten Unzufriedenheit der Menschen und ihrer ständigen Schaffenshast.
Am sechsten Tag nach seiner Flugzeugpanne machen sich unser Erzähler und sein Freund auf den Weg um Brunnenwasser zu finden. Der kleine Prinz bemerkt, dass Wasser auch gut sei für das Herz.
Das Herz – Zentralorgan unseres leiblichen Lebens?
Das Herz – lebensfähig erst durch Speise und Trank?
Als der kleine Prinz einschläft, trägt der Erzähler dieses zerbrechliche Wesen – anrührend in seiner Treue zu einer Blume – durch die Wüstennacht, bis er bei Tagesanbruch einen Brunnen entdeckt. Der Genuss dieses Wassers, erkämpft durch den Marsch unter Sternen, wird zum Fest, herzerfrischend wie ein weihnachtliches Geschenk. Das, was Menschen suchten, ließe sich in einer einzigen Rose finden oder in einem bisschen Wasser – sofern man mit dem Herzen suche, seien doch auch die Augen blind.
Nach Ablauf eines Jahres Erdaufenthalt deutet der kleine Prinz seine notwendige Rückkehr nach Hause an – ausgerüstet mit Schaf und Kiste und Malkorb. Sein Lachen würde nicht verstummen, vielmehr würden dem Erzähler alle Sterne entgegenlachen, da er doch auf einem von ihnen wohne. Im letzten Augenblick des Abschieds weint er, der kleine Prinz, bis etwas wie ein Blitz seinen Knöchel trifft und er sachte in den Sand fällt. Nichts von ihm wird am Ende zurückbleiben…
Der Erzähler kehrt zu seiner Truppe zurück und damit endet die Rahmenhandlung.
Antoine de Saint-Exupéry, der Autor, wird von seinem Aufklärungsflug am 31.07.1944 nicht mehr zurückkommen.
Nach der Bibel und dem Koran, so erfahren wir, sei „Der kleine Prinz“ das am häufigsten übersetzte Buch der Welt. Nichts ist von dem kleinen Prinzen zurückgeblieben. Nichts?
Wenn wir die Begriffe „Schaf“ und „Blume“, „Affenbrotbaum“ und „Schlange“, „Herz“ und “Lachen“ mit den Augen des kleinen Prinzen betrachten, dann ist er uns vertraut geworden und in uns.
Nüchtern betrachtet, ist er eine erfundene Gestalt, fiktiv, erdacht, Teil der Population der Märchen- und Fabelwelt.
Unser Leben ist jedoch mehr als Realismus pur; es wäre ärmer ohne Poesie und unwirklicher ohne Mysterium.
Was wäre unser tägliches Grau ohne die Farbe von Fantasie und Illusion?
(J.H., Mariendorfer Gemeindebrief 02/2004; bearbeitet 2021)
Licht in der Nacht und Wasser in der Wüste
Nachdem ich meinen Aufsatz über den Kleinen Prinzen beendet hatte, fiel mir ein Buch des Psychotherapeuten und Theologen Eugen Drewermann in die Hände, in dem er Saint-Exupérys Erzählung tiefenpsychologisch deutet.
Der Sternenhimmel Saint-Exupérys sei nicht gleichzusetzen mit dem Himmel der Gläubigen, setze der Kleine Prinz doch sein Leben auf einem der Planeten fort ohne in den Himmel einzugehen.
Müssen wir, Du und ich, nach unserm irdischen Tod auf dem Planeten Erde verharren oder wollen wir in den Himmel der Gläubigen eingehen?
*
Vor mir liegt der Vorsorge-Ordner eines hiesigen Bestattungsunternehmens, in dem ich für meine spätere Beerdigung angekreuzt habe, ob ich einen Pfarrer wünsche oder einen weltlichen Redner.
Stellen wir uns vor, wir wären selbst ein weltlicher Trauerredner und würden aus dieser Tätigkeit unseren Broterwerb ziehen. Eine gewisse Redegabe vorausgesetzt, würden wir als Hintergrundgerüst für unseren Nachruf sicherlich eine Minimalchronik des Zeitgeschehens bereithalten. Je nach dem Lebensalter des Verstorbenen kämen darin vermutlich Kerndaten wie 1945 (Ende des zweiten Weltkrieges), 1961 (Mauerbau), 1989 (Wende) und 2020 (Corona) vor.
Diese historischen Hintergrunddaten gehören zum Gerüst unser aller Leben, wir sind ihnen ausgeliefert gewesen ohne ihnen entrinnen oder sie beeinflussen zu können. Bei der Ausmalung einzelner Daten würden sich die Zuhörer daran erinnern, einander zunicken und bestätigend murmeln: „Ja, so war’s; so habe ich’s auch erlebt“.
Allerdings würden wir in diesen Zeitstrahl auch noch die individuellen Lebensdaten des Verstorbenen einflechten.
Wäre die Summe all dieser Daten schon eine Freikarte zum Einlass in den Himmel der Gläubigen?
*
Unsere Lebensläufe folgen irgendwie ähnlichen, weil natürlichen Mustern: Wir wurden geboren (logisch!) als Kinder zweier Eltern (biologisches Gesetz!) und (hoffentlich) gewünscht, geliebt, gehegt, (vielleicht) getauft und (vielleicht) konfirmiert.
Die Älteren haben noch in Ruinen gespielt, die Jüngeren in der Eltern-Kind-Gruppe oder im Kindergarten und dann kam die Einschulung. Wir alle haben unserer Schulpflicht genügt, indem wir Grund- und Oberschulen mindestens 10 Jahre lang besucht und Abschlüsse erlangt haben. Danach begannen Lehre oder Studium. Einige von uns mögen Zusatzqualifikationen erworben haben. Nach unterschiedlichen Formen der Berufsvorbereitung folgte dann die Zeit der Erwerbstätigkeit bis zum Rentenalter.
Im sozialen Schichtengefüge würden sich viele von uns entsprechend ihres Bildungsstandes und Einkommens vermutlich am liebsten irgendwo im Mittelfeld verorten.
Es würde mich nicht wundern, wenn insbesondere jüngere Menschen als besondere Highlights ihres Lebens Schlafen, Telefonieren, Party- oder Discobesuche, das Fitness-Studio oder Surfen im Internet nennen würden.
Wenn wir dem kollektiv erlebten Grundgeschehen ebendiese individuellen Daten hinzufügen, haben wir bereits den Rahmen einer präsentablen Biografie, die wiederum jeder Leser oder Zuhörer nachvollziehen könnte.
Es fehlt nur noch der Familienstand, aber dieser ließe sich in den Vordrucken der Einkommensteuer-Erklärung wahrheitsgemäß ankreuzen.
Wenn uns auch keine Weltumseglung gelungen ist, so sind wir sicherlich regelmäßig und gern auf Reisen gegangen.
Ob uns der Himmel der Gläubigen in neue Welten führen würde?
*
Nach dem bisher Gesagten mag es uns vorkommen, als verlaufe unser Leben in irgendwie vorgegebenen Bahnen; manchmal als banal empfunden, manchmal spannungsgeladen; teils eigengesteuert, viel öfter noch fremdbestimmt.
Vergessen haben wir noch die menschlichen Triebe und Bedürfnisse, aber können wir in diesen Bereichen auf Überraschungen zählen?
Überall entdecken wir Parallelen zu anderen Schicksalen und Lebensläufen, ein Tatbestand, der uns nur wenig originell erscheint.
Der Philosoph Eduard Spranger sprach einst von den Grundphänomen menschlichen Daseins, die für uns alle gleichermaßen gelten und unser Denken, Sagen und Handeln bestimmen und somit für die Anderen erst verstehbar machen.
Ob uns der Himmel der Gläubigen von weltlichen Fesseln befreien würde?
*
Bei der Trauerfeier für einen meiner verstorbenen früheren Klassenkameraden wurde dieser mit den Worten zitiert, er habe „ein schönes Leben“ geführt.
Was nun hebt unser Leben von dem Alltagsgrau ab und gibt ihm so viel Farbe, dass es von Tag zu Tag und im Gesamtverlauf als schön empfunden werden kann?
Ist es der Genuss von Freiheit(en)?
Ist es die Gewissheit, dass uns das soziale Netz unserer Gesellschaft schon halten wird?
Ist es der erlebte Friedenszustand ohne äußere Bedrohung?
Ist es die „Abwesenheit“ von Naturkatastrophen und Bürgerkriegen?
Haben wir mit anderen Menschen teilen können und sind dabei reicher geworden?
Haben uns Musik und schöne Künste in höhere Sphären entführt?
Waren es Tränen der Rührung und der Freude?
Konnten wir uns beweisen und nützlich machen?
Hat sich jemand über unseren Besuch gefreut, jemand, um den sich sonst keiner kümmerte?
Konnten wir uns an eine Schulter lehnen und Trost finden?
War es der langersehnte ungestörte Schlaf in der Nacht?
Haben wir unserer Krankheit die Stirn geboten und neue Hoffnung geschöpft?
War es die Gewissheit, geliebt zu werden und Liebe zu schenken?
Fragen über Fragen…
*
Sagen wir es folgendermaßen:
Unser Leben wird von Bedingungsfaktoren geprägt, die, unterschiedlich miteinander kombiniert, ein buntes Kaleidoskop ergeben und – unsere positive Grundeinstellung zum Leben vorausgesetzt - dieses als schön erscheinen lassen können.
Wir leben einfach. Leben kann sich lohnen. Wir hüten unsere guten Erfahrungen und positiven Erinnerungen wie einen Schatz und empfinden Dankbarkeit, wobei wir uns der Endlichkeit unseres Daseins hoffentlich bewusst sind.
Unser Leben endet genauso, wie der letzte Vorhang fällt – oder?
Dabei war vom Himmel der Gläubigen noch gar keine Rede.
Ob dieser Himmel einen Unterschied macht?
Ob es sich darüber nachzudenken lohnt?
Ansichtssache.
Könnte es nicht sein, dass, wenn wir nach dem Himmel der Gläubigen Ausschau halten und ihn fantasievoll in unser Leben herabholen, uns das Licht in der Nacht leuchtet und wir das Wasser in der Wüste bereits hier gefunden haben – schon jetzt?
(J.H., 03/2004 Mariendorfer Gemeindebrief; neu bearbeitet 03/2023)
Wie gut kann man mit den Augen sehen?
Irgendwann vor der Wende 1989 sagte ich zu meiner Frau, dass, wenn die Mauer eines Tages fiele, …aber ach, …sie würde ja doch nicht fallen, …aber nähmen wir einmal an, dass sie…, ja dann würde ich einmal im weiten Bogen (und ohne Passierschein) um Berlin herum wandern und gemeinsam wäre für uns eine große Deutschland-Reise in den Osten unseres Landes fällig.
Ersteren Wunsch habe ich mir in den 90er Jahren im Alleingang erfüllt und gemeinsam haben wir das Osterzgebirge, das Elbsandsteingebirge, den Osstharz die Insel Rügen und das Schlaubetal und…und…mit dem Regionalzug und mit dem Auto erkundet.
Als im Sommer 2006 im Gemeindeblatt Mariendorf die besorgte Frage gestellt wurde, wie es nach dem Weggang eines Pfarrers um den Fortbestand der Kultur- und Wandergruppe bestellt sei, habe ich mich spontan dazu bereit erklärt, nach meiner anstehenden Pensionierung beide Gruppen ab September 2006 weiterzuführen.
Unsere erste Wanderung am 07.09.2006 sollte uns eigentlich vom S-Bahnhof Griebnitzsee zum Potsdamer Hauptbahnhof führen, wo wir aber nie ankamen, weil dort eine Fliegerbombe entschärft wurde, was uns zu einer Routenänderung in Richtung Glienicker Brücke zwang.
Die erste Unternehmung unserer Kulturgruppe am 21.09.2006 war ein Stadtspaziergang auf den Spuren klassizistischer Bauelemente, die unsere Augen zwischen der Französischen Straße und dem Deutschen Museum beschäftigten.
Für unsere Wandergruppe habe ich bis heute gerne Routen in Kombination mit Wald und Wasser ausgesucht, Wegstrecken, die unsere Augen besonders erfreuen.
Wir haben über die Jahre die Umgebung sämtlicher S-Bahn-Endstationen erkundet und können auch über Flussläufe wie die Havel und die Spree, die Wuhle und die Panke, die Erpe und die Briesesowie die Nuthe und mehrere Kanäle und Seenketten mitreden. Es waren keine reißerischen oder spektakulären Reiseziele, aber es war unsere engere Umgebung in Berlin und im Bundesland Brandenburg, soweit das Auge reicht. Abgesehen von Abstechern nach Stettin und Frankfurt/Oder haben wir uns bis auf Ausflüge ins Umland meist im ABC-Tarifgebiet bewegt.
Gelegentlich sind Eintrittsgelder oder anteilige Führungsgebühren angefallen, aber am teuersten ist bisher am Ende stets die individuelle Rechnung für Speis und Trank im (vorzugsweise preiswerten) Restaurant oder Gasthof geworden.
Anfangs nahmen an unserer Kulturgruppe etwa zehn Personen teil. In der Wandergruppe waren wir ungefähr doppelt so stark. (Der Rekord lag bei einer Wanderung bei 34 Personen, aber so erfreulich diese hohe Teilnehmerzahl auch war, so ist es doch schwer, die Übersicht zu bewahren.) Unsere Veranstaltungen haben bisher stets donnerstags stattgefunden und unser Treffpunkt war in aller Regel um 09.00 Uhr am U-Bahnhof Alt-Mariendorf. Teilnehmer aus verschiedenen Teilen Berlins haben jeweils größere Anfahrtswege in Kauf genommen.
Wir versuchen als Gemeinschaft Unbekanntes zu entdecken oder Bekanntes neu zu sehen, unser Wissen zu vertiefen und neue Einsichten zu gewinnen.
Besonderes behaglich wird für gewöhnlich unser „Schluss“, wenn wir, angenehm erschöpft, am Ende einkehren, gemeinsam essen und trinken und auch hier miteinander plaudern.
Hat es je untereinander Streit gegeben?
Haben wir je über Krankheiten und Arztbesuche geklagt?
Ich glaube, wir sind achtsam miteinander umgegangen.
Es waren oft scheinbare Nebensächlichkeiten, die uns unterwegs gefallen haben: als Senioren auf einem Kinderspielplatz zu schaukeln; mit aufgekrempelten Hosenbeinen in einem der Seen zu staksen; auf Plastikstühlen im Garten des Buddhistischen Hauses in Frohnau in trauter Runde dem herannahenden Gewitter „zu trotzen“.
Wir haben gemeinsam über die herrlichsten Allerweltsdinge gelacht, uns in Gespräche vertieft, für einander Zeit gehabt, uns gegenseitig ein Stück des Weges begleitet, mit unseren Augen geschaut und - gestaunt.
Manchmal war mir ein wenig mulmig zumute, wenn ich so ganz allein unsere Waldwanderungen vorbereitet habe, weil ich gelegentlich über Baumwurzeln gestolpert bin, sobald meine anfängliche Konzentration nachließ. Als ich dies meinen beiden Kindern erzählte, schenkten sie mir ein „Notfallhandy“. Dies war (mit reichlicher Verspätung) mein persönlicher Einstieg ins moderne Digital-Zeitalter.
Während ich diesen Bericht (im März 2023) neu schreibe, können wir auf 326 durchgeführte Veranstaltungen zurückblicken, von denen immer noch keine einzige ausgefallen ist. Natürlich mussten unsere Teilnehmerlisten des Öfteren aktualisiert werden, sind wir doch von Anfang an eine Seniorengruppe. Vor einiger Zeit haben wir die durchschnittliche Dauer unserer Wanderungen auf zwei Stunden begrenzt. Corona hat uns zwar zu Zwangspausen gezwungen, aber glücklicherweise nicht bezwungen. Unsere Neugier wird uns weiterhin die Augen öffnen!
(J.H., Mariendorfer Gemeindebrief 01/2008; b. 03/2023)
Zur Geburt unseres Enkels
Ach, kleiner Patrick, sei gegrüßt! Aus Deiner Ankunft Hoffnung sprießt,
Dass es nun geh‘ bergauf Mit uns – und dass so im Verlauf
Von gar nicht allzu langer Zeit Dein Kinderlachen weit und breit
Erschalle und uns stecke an, Uns mutig mache, dann und wann,
Die Welt zu schau`n mit wachem Blick Nach vorn gerichtet – nicht zurück;
Die alten Dinge neu zu seh´n Und stets versuchen zu versteh´n,
Wie hier auf Erden, das ist klar, Gestaltet sich viel wunderbar,
Wie´s scheint, von selbst - und nicht gelenkt Von Himmels Hand, die alles schenkt.
Sie mag Dich väterlich begleiten, Mag Wege Dir zum Ziel bereiten.
Wir werden dabei mit Dir sein, Dir helfen, der Du bist so klein Brauchst Hilfe noch von starken Händen, Die Böses hin zum Guten wenden,
Die Dich erziehen, die Dich stützen, Die schützen Dich und die Dir nützen;
Die eines Tag´s Dich lassen los, Wenn Du erst stark bist und selbst groß!
Doch etwas wird nie hören auf: Die Liebe ist´s, da wett´ ich drauf!
Wir lieben Dich – Du bist geliebt, Geliebt bist Du, seit es Dich gibt.
Dein Engel mache sich bereit,