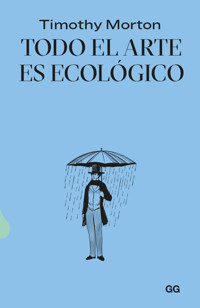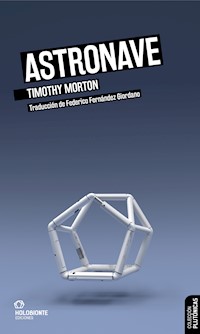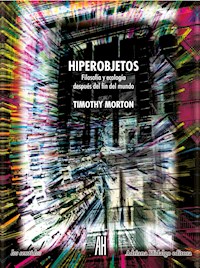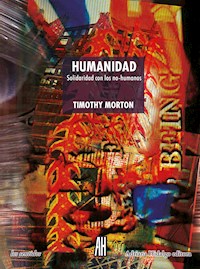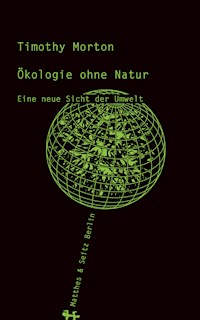
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Nur scheinbar formuliert Timothy Morton in diesem bahnbrechenden Buch des Ecocriticism ein Paradox: Das Bild, das wir uns von der Natur machen, verhindert, dass wir der Umwelt, in der wir leben, gerecht werden können, dass wir ihre Ökologie begreifen. Stets trachtet das Schreiben über die Natur danach, eine Weltsicht zu vermitteln, die die Natur bewahrt und respektiert. Kein Wunder, dass wir uns angesichts der ökologischen Katastrophe, die wir erleben, nach einer unversehrten, wilden und ›unschuldigen‹ Natur sehnen. Aber die Feier der Natur, oder der Einheit mit ihr, trübt unseren Blick. Rigoros und verstörend stellt Morton unsere ökologischen Grundannahmen auf den Prüfstand und versucht, ein neues Vokabular für das Verständnis von Natur zu entwickeln. In einem Parforceritt durch die Literatur- und Philosophiegeschichte trägt das Buch dazu bei, unseren Blick auf ökologische Zusammenhänge zu weiten und den Umweltgedanken in einen geistesgeschichtlichen Kontext zu stellen, der ihm politisch und intellektuell mehr Schlagkraft verleiht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Timothy MortonÖKOLOGIE OHNE NATUREine neue Sicht der Umwelt
Timothy Morton
ÖKOLOGIE OHNE NATUR
Eine neue Sicht der Umwelt
Aus dem amerikanischen Englischvon Dirk Höfer
Für Kate
Inhalt
Einleitung
Für eine Theorie der ökologischen Kritik
Kapitel 1
Die Kunst der Umweltsprache.
»Kaum zu glauben, dass das keine Natur ist!«
Kapitel 2
Die Romantik und das Umwelt-Subjekt
Kapitel 3
Ökologie ohne Natur denken
Anmerkungen
EinleitungFÜR EINE THEORIE DER ÖKOLOGISCHEN KRITIK
Kein Mensch hat es gerne, wenn man vom Unbewussten spricht, und kaum jemand ist heute davon angetan, wenn man über die Umwelt spricht. Man läuft Gefahr, langweilig oder rechthaberisch oder hysterisch oder wie eine Mischung aus allem zu klingen. Dafür gibt es einen tiefer liegenden Grund. Kommt das Unbewusste zur Sprache, ist man nicht etwa unangenehm berührt, weil damit etwas Obszönes angesprochen würde, das besser im Verborgenen bliebe – das wäre zumindest noch spaßig. Es kommt einfach nicht gut an, weil das Unbewusste, sobald es erwähnt wird,bewusst wird. Auf ebendiese Weise rückt auch die Umwelt, ist erst einmal von ihr die Rede, in den Vordergrund. Anders gesagt, sie hört auf, Umwelt zu sein. Sie hört auf,dieses Ding da drüben zu sein, das uns umgibt und erhält. Fängt man an, darüber nachzudenken, wohin der Müll geht, beginnt die Welt zu schrumpfen. Darin liegt die grundlegende Botschaft einer Kritik, die sich für Umweltgerechtigkeit ausspricht, und darin liegt die grundlegende Botschaft dieses Buchs.
Ökologie ohne Natur verficht die These, dass in einem »ökologischen« Stadium der menschlichen Gesellschaft der so in Ehren gehaltene Begriff »Natur« wird verkümmern müssen. So seltsam es klingen mag, der Naturbegriff kommt den eigentlich ökologischen Formen von Kultur, Philosophie, Politik und Kunst in die Quere. Das Buch geht diesem Paradox nach, indem es vor allem auf die Kunst blickt, nehmen doch unsere Fantasien über die Natur in der Kunst Gestalt an – und dort lösen sie sich auch wieder auf. Insbesondere die Literatur der Romantik, die nach allgemeinem Dafürhalten für die Ausbildung des Naturbegriffs eine entscheidende Rolle spielt und noch immer Einfluss auf das Imaginäre der Ökologie ausübt, bildet das Ziel meiner Forschungen.
Warum Ökologie ohne Natur auskommen muss
In einer Untersuchung politischer Theorien der Natur stellt John Meyer fest, dass ökologisch ambitionierte Schriftsteller dem »heiligen Gral« nacheifern, »eine neue und umfassende Weltanschauung« zu entwickeln.1 Von dieser Anschauung, gleich welchen Inhalts sie sein mag, »versprechen sie sich eine Politik und Gesellschaft verändernde Wirkung«.2 Die Tiefenökologie zum Beispiel behauptet, dass wir unsere anthropozentrische Sichtweise in eine ökozentrische transformieren müssen. Wie der BegriffWeltanschauung* ist auch die Auffassung, eine Anschauung sei in der Lage, die Welt zu verändern, tief in der Romantik verwurzelt. Eine neue Weltanschauung zu entwerfen heißt, zu thematisieren, wie Menschen ihren Ort in der Welt wahrnehmen. Die Ästhetik spielt somit eine entscheidende Rolle, denn sie erlaubt, diesen Ort zu fühlen und wahrzunehmen. Terre Slatterfield und Scott Slovic berichten in ihrer dem ökologischen Kapital gewidmeten Textsammlung über die durch Präsident Clinton vorgenommene Einweihung eines Wildnisgebiets in Utah: »Bei der Feier zur Einweihung des neuen Nationalmonuments [Grand Staircase Escalante] […] hob der Präsident [Clinton] ein Exemplar von [Terry Tempest Williams’]Testimony in die Höhe und sagte: ›Das hat den Ausschlag gegeben‹.«3 Slatterfield und Slovic möchten aufzeigen, dass die Erzählung ein wirksames politisches Instrument darstellt. In ihrer Darlegung wird die Politik aber auch zu einem Feld der Ästhetik. Die Erzählung steht aus Sicht der beiden Autoren in der Nähe des Affektiven, während die als »Bewertungsrahmen« bezeichnete Wissenschaft dieses abgeblockt oder sich ihm »verweigert« habe.4 Ökologische Autoren würden nicht nur argumentieren, sondern zudem unwiderstehlicheBilder produzieren: buchstäblichAnschauungen der Welt. Diese Bilder beruhen auf einem Gefühl fürNatur. Gerade aber die Natur gehe den Autoren immer wieder durchs Netz. Und ironischerweise verhindere sie in ihrer verwirrenden ideologischen Intensität eine echte Beziehung zur Erde und ihren Lebensformen, die selbstverständlich auch Ethik und Wissenschaft einschließen würden.Nature Writing, das Schreiben über die Natur, berichtet davon, wie die Natur uns durchs Netz geht. John Elder zum Beispiel beschreibt inReading the Mountains of Home, dass die literarische Würdigung der Natur umso komplizierter wird, je mehr wir uns der »historischen Realitäten« bewusst werden.5Ökologie ohne Natur ist der systematische Versuch, diese Komplikationentheoretisch zu erfassen.
Konventionelle Ökokritik ist stark thematisch ausgerichtet. Sie setzt sich mit ökologischen Schriftstellern auseinander. Sie erkundet Elemente der Ökologie wie Tiere, Pflanzen oder das Wetter. Sie untersucht die Spielarten ökologischer – und ökokritischer – Sprache. Auch inÖkologie ohne Natur wird über Tiere, Pflanzen und das Wetter gesprochen. Das Buch behandelt ausgewählte Texte und Schriftsteller, Komponisten und Künstler. Es befasst sich mit den Ideen des Raums und des Orts (global, lokal, kosmopolitisch, regional). Doch auch wenn solche Erkundungen belangvoll und wichtig sind, stehen sie nicht im Zentrum des Buchs. Die eigentliche Intention besteht darin, zu durchdenken, was wir unter dem WortUmwelt verstehen.
Ökologie ohne Natur entwickelt seine Argumentation in drei klar geschiedenen Stufen:beschreiben, kontextualisieren undpolitisieren. Die erste Stufe erkundet die Kunstformen, die sich auf die Umwelt beziehen. Anhand von Büchern wie Angus FletchersA New Theory of American Poetry, das mit einer Poetologie umweltbezogener Formen aufwartet, und Susan StewartsPoetry and the Fate of the Senses entwickelt das erste Kapitel ein neuartiges Vokabular zur Interpretation derEnvironmental Art, der Umweltkunst. Es geht dabei über die schlichte Erwähnung umweltbezogener Inhalte hinaus und widmet sich vor allem ihrer Form. Thematisch weitgespannt, geht es der Frage nach: Wie vermittelt Kunst ein Gefühl für Raum und Ort? Im ersten Kapitel wird untersucht, warum und auf welche Weise Umweltkunst, gleich welchen Inhalts oder Themas, von bestimmten formalen Eigenschaften der Sprache behindert wird. Dabei gehe ich davon aus, dass die Literaturkritik der Umweltliteratur selbst ein Beispiel für Umweltkunst ist.
Bei etlichen Lehrveranstaltungen über Literatur, die sich mit der Umwelt beschäftigt, hat sich ein Vokabular als nützlich erwiesen, mit dem sich Werke in verschiedenen Medien analysieren lassen. Doch bei der intensiven Lektüre eines Textes, die dessen Paradoxien und Dilemmata in den Blick nimmt, besteht immer die Gefahr, dass die speziellen oder utopischen Projekte, die bei der Textanalyse entdeckt werden, selbst Methode werden. Um dem zu entgehen, schlage ich vor, die Techniken desclose reading so einzusetzen, dass sie den ideologischen Kräften, die das ökologische Schreiben hervorbringt, immer einen Schritt voraus bleiben. Ich entwerfe eine Theorie zu einerPoetik des Ambientes, eine materialistische Form der Lektüre mit einem Blick darauf, wie in Texten der konkrete Raum ihrer Einschreibungen – wenn es ihn denn gibt – kodiert ist: der Wortabstand, die Seitenränder, die materiellen und sozialen Umgebungen des Lesers. Dies ist von Bedeutung für die Poetologie der Empfindsamkeit, aus der im späten achtzehnten Jahrhundert die Romantik hervorging. Umweltästhetik ist häufig, wenn nicht sogar immer, in einer ähnlichen Form des Materialismus gefangen.
Das zweite Kapitel untersucht die Geschichte und Ideologie von Konzepten, Überzeugungen und Gepflogenheiten, die zu jener obsessiven Beschäftigung mit der Umwelt geführt haben, die sämtliche kulturellen Sparten – angefangen bei Naturschutzkalendern bis hin zu experimenteller Noise Music – tangiert.Ökologie ohne Natur ist sicherlich eine der wenigen Abhandlungen, die im selben Atemzug von niederen und hohen Formen der Ökokultur sprechen und dabei Pfade beschreiten, die etwa von William CrononsThe Great New Wilderness Debate geebnet wurden, von Büchern, die Denker einer sogenannten Theorie und einer sogenannten Ökokritik zusammenführten. Wie ist der aktuelle Umweltgedanke entstanden, und welchen Einfluss hat er auf unsere Ideen zu Kunst und Kultur? Ein besonderes Augenmerk gilt in Kapitel 2 der Zeit der Romantik, in der der inzwischen global vorherrschende Kapitalismus erste Wirkungen zeigte. Von diesem historischen Moment ausgehend bemüht sich das Buch, die Dilemmata und Paradoxien, denen sich die Umweltbewegungen gegenübersehen, aufzuarbeiten und zu verstehen. Das Kapitel erläutert, warum postromantische Literatur von Raum- und Ortsbeschreibungen besessen ist, und geht dabei etwas synthetischer vor als David Harvey in seinem BuchJustice, Nature and the Geography of Difference. Dazu greife ich auf meine Forschungen zur Geschichte des Konsumismus zurück, die deutlich gemacht haben, dass sogar gegen den Konsumismus rebellierende Maßnahmen, wie sie etwa Umweltbewegungen propagieren, letztlich dem Konsumismus selbst zu subsumieren sind. Weil der Konsumismus auch ein Diskurs über Identität ist, enthält das Kapitel eingehende Interpretationen von Texten, in denen ein Erzähler, ein »Ich« damit ringt, sich in einer Umwelt zu verorten.
Das dritte Kapitel schließlich beschäftigt sich mit der Frage, in welcher Richtung es für die Ökologie weitergehen wird. Welche Formen politischen und gesellschaftlichen Denkens, Handelns und Tuns sind möglich? Das Buch geht hier von einer abstrakten Erörterung aus und versucht präziser zu bestimmen, in welche Beziehung wir als soziale und politische Tiere zur Umweltkunst und -kultur treten könnten. Das Kapitel untersucht die verschiedenen künstlerischen Haltungen, die Umweltthemen gegenüber eingenommen werden können, und bezieht sich dabei auf Schriftsteller wie John Clare oder William Blake, die Positionen außerhalb der Hauptströmung der Romantik bezogen haben. Kapitel 3 zeigt, dass die in Kapitel 1 entworfenePoetik des Ambientes – das »Äolische«, das die Schwingungen eines materiellen Universums aufnimmt und sie in High-Fidelity-Qualität wiedergibt – das Subjekt unweigerlich negiert, weshalb sie nicht mit einer Ökologie zurande kommt, die sich in Wesen, die zudem Personen sind, manifestiert und womöglich jene anderen von uns als Tiere bezeichneten Wesen einschließt.
In Kapitel 1 wird eine Theorie der auf die Umwelt bezogenen Künste vorgelegt, die diese erklärt und zugleich kritisch reflektiert. Kapitel 2 wiederum bietet eine kritische Reflexion über die »Idee« der Umweltkunst. Und Kapitel 3 ist eine noch weitergehende Reflexion, die eine politische »Theorie der Theorie« entwickelt. Anstatt einen höheren Gradtheoretischer Abstraktion zu erreichen – tatsächlich ist Abstraktion alles andere als theoretisch –, »erklimmt« das Buch immer höhere Ebenen derKonkretion.Ökologie ohne Natur hebt nicht in die Stratosphäre ab. Das Buch steigt auch nicht unbedingt zur Erde hinab, denn je weiter wir vorankommen, desto mehr wird sich unser Blick auf die Erde verändern.
Ökologisches Schreiben pocht darauf, dass wir in die Natur »eingebettet« sind.6 Natur ist ein uns umgebendes Medium, das unser Dasein aufrechterhält. Aufgrund der Eigenschaften jener Rhetorik aber, die erst zur Idee eines umgebenden Mediums führt, kann ökologisches Schreiben niemals deutlich machen, dass es dabei wirklich um Natur geht, und somit kein zwingendes und konsistentes ästhetisches Fundament für die neue Weltanschauung bereitstellen, die die Gesellschaft verändern soll. Es ist eine kleine, dem Antippen eines Dominosteins vergleichbare Operation. Meine Lektüren versuchen eher symptomatisch als erschöpfend zu sein. Ich hoffe, dass durch das Öffnen einiger weniger, gut ausgewählter Öffnungen der ganze widerliche Schmutz ausfließt und sich auflöst.
Wenn man das, was gemeinhin Natur genannt wird, auf ein Piedestal stellt und es von Weitem bewundert, tut man für die Umwelt, was das Patriarchat für die Figur des Weiblichen getan hat. Es handelt sich um einen paradoxen Akt sadistischer Bewunderung. Simone de Beauvoir gehörte zu den Ersten, die diese Verwandlung der leibhaftigen Frau in ein Fetischobjekt theoretisch aufgearbeitet haben.7Ökologie ohne Natur untersucht am Kleingedruckten, wie Natur zu einem transzendentalen Prinzip werden konnte. Möchte man den Wortlaut des Untertitels aufgreifen, sieht sich das vorliegende Buch dazu bestimmt, die Ästhetik der Umwelt neu zu denken. Umweltkunst in ihren niederen und hohen Ausprägungen, von ländlichem Kitsch bis zum urbanen Chic, von Henry David Thoreau bis Sonic Youth, spielt mit der Idee der Natur, verstärkt oder dekonstruiert sie. Das Buch weitet den Blick auf die Möglichkeiten der Umweltkunst und -kritik, liefert sozusagen die »Cinemascope«-Version der Ökokultur. Diese Version kennt keine Angst vor dem Unterschied, der Nichtidentität, sowohl in textlicher Hinsicht als auch im Hinblick auf Rasse, Klasse und soziales Geschlecht, wenn Textkritik überhaupt davon getrennt werden kann. In der akademischen Welt nimmt die Ökokritik, zum Teil wegen des ideologischen Ballasts, den sie mit sich schleppt, einen besonderen, isolierten Platz ein. Ich möchte sie gerne öffnen und erweitern. Auch wenn ein Shakespeare-Sonnett nicht explizit »von« Gender zu handeln scheint, fragen wir heute doch, was es mit Gender zu tun haben könnte. Die Zeit wird kommen, wo wir für jeden Text die Frage stellen: »Was sagt er über die Umwelt aus?« Für den Moment haben wir die Entscheidung getroffen, welche Texte befragt werden sollen.
Einige Leser werden mich bereits als »postmodernen Theoretiker« abgestempelt haben, an den sie keine Zeit verschwenden wollen. Ich glaube nicht, dass es so etwas wie ein Korallenriff nicht gibt. (Wie die Dinge liegen, sorgen moderne Industrieprozesse aber dafür, dass es sie bald nicht mehr gibt, ob ich an sie glaube oder nicht.) Ich glaube auch nicht, dass Umweltkunst und Ökokritik völlig aus der Luft gegriffen sind. Ich glaube allerdings, dass diese Formen kritisch behandelt werden müssen, und zwar weil wir für sie Sorge zu tragen, weil wir für die Erde und, überdies, für die Zukunft der Lebensformen auf diesem Planeten Sorge zu tragen haben, hat doch der Mensch alle nötigen Instrumente zu ihrer Zerstörung entwickelt. Wie der Musiker David Byrne einmal schrieb: »Atomwaffen können das Leben auf der Erde auslöschen; sie müssen nur richtig eingesetzt werden.«8 In allgemeineren und weiter gefassten Kategorien zu denken ist überlebenswichtig. Partikularismus kann jede Menge Leidenschaften freisetzen, aber er kann auch zur Kurzsichtigkeit führen. In Großbritannien zum Beispiel wollten reaktionäre Kräfte Umweltschützer und Befürworter von Windparks mit dem Einwand ausbremsen, Vögel würden von den Rotorblättern erschlagen. Es braucht in der Tat einen umfassenderen Blick auf die »Menschheit« und die »Natur«. Bevor ich bezichtigt werde, ein postmoderner Nihilist zu sein, lege ich meine Intentionen lieber offen. Es ist schlicht so, dass ich, wie Brecht einmal sagte, lieber mit den schlechten Nachrichten anfange, als von den guten alten Tagen zu singen. Ich möchte das ökokritische Denken nicht verhindern, sondern voranbringen. In meiner Arbeit geht es um eine »künftige Ökologie«, nicht darum, die Ökologie abzuschaffen. Man sollte das Buch als Beitrag zu einer Debatte verstehen, die von einer vom Gedanken der Umweltgerechtigkeit geleiteten Ökokritik angestoßen wurde.
Wenn man genau hinschaut, haben Postmodernisten einige unangenehme Überraschungen auf Lager. Ich glaube nicht, dass man die von mir beschriebenen Dinge in künstlerischen Medien »besser« machen kann. Ein Gutteil heutigen künstlerischen Schaffens hat sich der Idee verschrieben, die Dinge seientatsächlich besser zu machen, und umgibt sich so mit einer mondänen Aura, die andere Ansätze als weniger raffiniert abtut. Vermutlich sollten wir lieber experimentelle Noise Music hören anstatt BeethovensPastorale. Wir sollten Gilles Deleuze und Félix Guattari lesen anstatt Aldo Leopold. Doch aus Sicht des vorliegenden Buchs weisen die genannten Texte mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede auf.
Ich unterscheide zwischen der Postmoderne als kultureller und ideologischer Erscheinung und der Dekonstruktion.Ökologie ohne Natur schöpft seine Inspiration aus der schonungslosen und brillanten Intensität, mit der die Dekonstruktion Widersprüche und Unsicherheiten in Bedeutungszusammenhängen aufspürt. Wenn Ökokritik einen offeneren und ehrlicheren Umgang mit der Dekonstruktion pflegen würde, würde sie in ihr keinen Feind, sondern einen Freund sehen. Doch die Ökokritik hat die Angewohnheit, ihren potenziellen Freund anzugreifen, zu missachten oder zu diffamieren. Für Walter Benn Michaels zum Beispiel gehören Tiefenökologie und Dekonstruktion in den gleichen Stall.9 Hört, hört. Tatsächlich bestehen Verbindungen zwischen den beiden, doch anders als Michaels liegt mir daran, sie zu stärken. Wenn Derrida erklärt, dass diedifférance den Logozentrismus stützt und zugleich untergräbt, behaupte ich, dass die rhetorischen Strategien desNature Writing unterlaufen, was man Ökologozentrismus nennen könnte.
Ökologie ohne Natur möchte nicht für eine bestimmte Form ästhetischen Genusses werben; zumindest nicht vor dem Ende des Buches, wo eruiert wird, ob bestimmte Formen der Kunst dem im Buch umrissenen kritischen Anspruch überhaupt gewachsen sind. Keine Kunst ist wirklich »richtig«. Ich glaube, dass die Wissenschaft davon profitieren würde, wenn sie philosophisch besser grundiert und an den in den Geisteswissenschaften entwickelten Analysemethoden geschult wäre. Doch im Allgemeinen verdanken sich die wissenschaftlichen Versatzstücke heutiger Ideologie weniger einer von Natur aus skeptischen Wissenschaftspraxis als vielmehr jenen Vorstellungen vonNatur, die die Herzen höher schlagen und das Denken aussetzen lassen. Schlägt man eine beliebige aktuelleTime- oderNewsweek-Ausgabe auf, kann man leicht feststellen, dass das durchaus wichtige WissenschaftsjournalNature dort sogar ernster genommen wird als unter Wissenschaftlern üblich. Im Namen der Ökologie versucht das vorliegende Buch, einen Begriff kritisch zu beleuchten, der verhindert, dass wir uns sinnvoll mit dem auseinandersetzen, was Natur im Grunde genommen ist: alles, was mit uns oder unseren vorgeformten Konzepten nicht übereinstimmt. Aus ähnlichen Gründen habe ich die üblichen Diskussionen über Anthropozentrismus und Anthropomorphismus vermieden, von denen ein Gutteil des ökologischen Schrifttums durchsetzt ist. Nicht, dass diese Begriffe irrelevant wären. Aber sie erheischen die Frage, was denn genau als menschlich zu verstehen sei, was als Natur. Anstatt vorgefertigtes Gedankengut hin und herzuschieben, habe ich mich entschieden, meine Bedenken auf einer fundamentaleren Ebene geltend zu machen und meine Kritik in den Fissuren, die zwischen solchen Kategorien herrschen, anzusiedeln.
Quer durch das Buch ziehe ich Texte aus der Zeit der Romantik heran, nicht nur weil sie exemplarisch sind, sondern auch, weil sie mit den verschiedenen Syndromen und Symptomen, die sich in dieser Periode ausbildeten,nicht übereinstimmen. Zu dem Zeitpunkt, an dem die Trajektorien der modernen Ökologie auftauchten, sind auch andere Bahnungen möglich gewesen. Ich widme mich einer Reihe von Kunstformen, die mit der Vorstellung vonUmwelt hantieren, auch wenn dieser Begriff nicht unbedingt Natur im Sinne von Regenwäldern oder menschlichen Lungen beinhaltet. Dabei kann ein Buch dieser Kürze von den Tausenden verfügbaren Beispielen natürlich nur einen Bruchteil anreißen. Ich hoffe, die, die ich ausgewählt habe, sind repräsentativ und tragen erhellend zur theoretischen Erforschung des Umweltgedankens bei. Für meine Erörterungen ziehe ich nur Autoren der englischen Literatur heran, die mir vertraut sind: William Blake, Samuel T. Coleridge, Denise Levertov, William Wordsworth, Mary Shelley, Henry David Thoreau und Edward Thomas. Dass sie ökologische Autoren sind, darüber sind sich viele einig, doch ihre Haltungen sind nicht einfach und nicht immer deutlich, besonders, wenn man sie im Kontext der weiteren noch zitierten Schriftsteller betrachtet. Zur Untermauerung meiner Argumentation greife ich auf etliche Philosophen zurück. Karl Marx und Jacques Derrida schulde ich fast gleichermaßen viel, denn sie ermöglichten mir, ein Bezugssystem für meine Analysen auszubilden. Doch auch Walter Benjamin, Sigmund Freud, Martin Heidegger, Jacques Lacan, Bruno Latour und Slavoj Žižek verdanke ich viel, und insbesondere G. W. F. Hegel, dessen Idee der »schönen Seele« zum wichtigsten Einzelbegriff des Buches avanciert ist. Ich beziehe mich auf Theodor W. Adorno, dessen Schriften eine starke, häufig explizit ökologische Tönung aufweisen. Adornos Werk basiert über weite Strecken auf dem Gedanken, dass die moderne Gesellschaft einen Unterwerfungsprozess betreibt, der etwas »da draußen« begründet und ausbeutet, das Natur genannt wird. Seine Hellhörigkeit hinsichtlich der nuklearen Vernichtung zeigt viele Parallelen zu der Empfänglichkeit ökologischer Literatur für Katastrophen ähnlich totalen Ausmaßes wie etwa die globale Erwärmung. Wo die Bezüge weniger klar sind (zum Beispiel im Fall von René Descartes, Derrida oder Benjamin) vertraue ich darauf, dass mein Text erklärt, warum ein bestimmter Autor erscheint. Zudem führt die Untersuchung einige Autoren als Testfälle ökologischen Schreibens ein: unter anderen David Abram, Val Plumwood, Leslie Marmon Silko und David Toop. Hinzu kommt noch eine Reihe von Künstlern und Komponisten: Ludwig van Beethoven, Steve Reich, John Cage, Alvin Lucier, Yves Klein, Cornelius Escher. Schließlich werden wir unterwegs auf Populäres von J. R. R. Tolkien, Pink Floyd, The Orb und anderen treffen.
Untersuchungen zum Begriff der Natur sind bereits zuvor und gar nicht selten erschienen. Verschiedene Darstellungen der Umweltbewegungen und desNature Writing sind entstanden. Und namentlich die Wissenschaft hat die Ökologie wiederholt aus der Romantik abgeleitet. Systematisch und reflektiert erklärtÖkologie ohne Natur das Phänomen des Umweltgedankens in der Kultur, versenkt sich in die Details von Poesie und Prosa und tritt einen Schritt zurück, um das Bild als Ganzes zu sehen. Zugleich bietet das Buch auf verschiedenen Ebenen Kritik an der Funktionsweise von »Natur«. Es unternimmt dies, indem es sich im Wesentlichen auf einen Angriffspunkt konzentriert: auf die Idee desNature Writing oder, wie es im Buch vorzugsweise genannt wird, dieÖkomimese. So umfassend das Buch auch sein möchte, es ist zwangsläufig einseitig und unvollständig. Aber ich sehe keinen anderen Weg, all die Themen, über die ich sprechen möchte, in einem Band vernünftiger Länge zusammenzubringen. Ich vertraue darauf, dass der Leser seine eigenen Beispiele in die Diskussion einbringen wird und die Lücken ergänzt. Sicherlich haben meine Forschungsinteressen, die vor allem der Romantik, der Ernährungssoziologie sowie dem Thema Literatur und Umwelt gelten, meine Sicht der Dinge gefärbt.
Umweltreflexionen
Eine »Theorie der Ökokritik«, das meint zumindest zwei Dinge. Von Erklärungen im Stile Clintons einmal abgesehen, hängt alles davon ab, was mit dem Genitiv gemeint ist. Auf der einen Seite stellt das Buch ein theoretisches Instrumentarium für die Kritik der Ökologie zur Verfügung. Eine »Theorie der Ökokritik« ist eine ökologiekritische Theorie. Auf der anderen Seite untersucht diese Studie die Eigenschaften der existierenden Ökokritik, stellt sie in einen Kontext und erörtert ihre Paradoxien, Dilemmata und Unzulänglichkeiten. Eine »Theorie der Ökokritik« ist eine theoretische Reflexion der Ökokritik: Sie kritisiert die Ökokritik.
Somit schwankt das Buch zwischen zwei Positionen. Es hält sich innerhalb wie außerhalb der Ökokritik auf. (Aus später darzulegenden Gründen möchte ich nicht behaupten, das Buch befinde sich an zwei Orten gleichzeitig.) Es unterstützt das Studium der Literatur und der Umwelt und ist in seiner politischen und philosophischen Ausrichtung durch und durch ökologisch. Gleichwohl sieht es davon ab, für eine bestimmte ökokritische Haltung die Werbetrommel zu rühren. Es möchte der Ökokritik nicht gänzlich das Wasser abgraben. Es möchte keineswegs behaupten, »da draußen« sei nichts.Ökologie ohne Natur stellt jedoch die Grundannahmen der Ökokritik infrage – nicht mit dem Ziel, einen Strich unter die Ökokritik zu ziehen, sondern um sie zu öffnen.
Der Gedanke des Umweltschutzes kombiniert verschiedene kulturelle und politische Antworten auf eine Krise in den Beziehungen des Menschen mit seiner Umgebung. Diese Antworten können wissenschaftlich, aktivistisch, künstlerisch oder alles zusammen sein. Umweltschützer versuchen Gebiete mit intakter Wildnis oder solche von »außergewöhnlicher natürlicher Schönheit« vor fremden Einflüssen zu bewahren. Sie kämpfen gegen Umweltverschmutzung, wozu auch die Risiken der Nukleartechnologie und der Atomwaffen gehören. Mit Kampagnen gegen die Jagd und wissenschaftliche oder kommerzielle Tierexperimente treten sie für die Rechte von Tieren ein und für eine vegetarische Lebensweise. Sie widersetzen sich der Globalisierung und der Patentierung von Leben.
Die Umweltschutzbewegung ist breitgefächert und heterogen. Man kann ein kommunistischer Umweltschützer sein oder ein kapitalistischer wie dieWise Use-Republikaner in den Vereinigten Staaten. Man kann ein »sanfter« Naturschützer sein und Wohltätigkeitsorganisationen wie dem britischen Woodland Trust Geld spenden oder zu der »harten« Sorte gehören, die sich in Bäumen verschanzt, um Holzeinschlag oder Straßenbau zu verhindern. Und natürlich kann man beides zugleich sein. Man kann auch Wissenschaftsartikel über die Erderwärmung verfassen oder »ökokritische« Essays schreiben. Man kann Gedichte oder umweltbezogene Skulpturen oder Ambient Music in die Welt setzen. Man kann auch Umweltphilosophie betreiben (»Ökosophie«) und Formen des Denkens, Fühlens und Handelns entwickeln, die auf einer liebevollen Beziehung mit unserer Umwelt basieren.
Ähnlich zahlreich sind auch die Formen der Ökokritik. Ökofeministische Kritik untersucht, in welcher Weise das Patriarchat für die Schädigung und Zerstörung der Umwelt verantwortlich gewesen ist und wie es eine Sicht auf die natürliche Welt aufrechterhalten konnte, die Frauen auf die gleiche Weise unterdrückt, wie sie Tiere, das Leben allgemein und sogar die Materie unterdrückt. Eine andere Strömung der Ökokritik hat ihren Ursprung in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Romantik und zeigt sich in den Werken von Schriftstellern wie Jonathan Bate, Karl Kroeber und James McKusick.10 Hier wird daskritische Moment in provokativer und zugleich zugänglicher Art in die akademische Interpretation zurückgegeben. Diese Werke wiederum stehen beispielhaft für ein bestimmtes, in der romantischen Literatur verkörpertes Anliegen, nämlich die Welt zu verändern, indem man eine starke emotionale Reaktion und einen neuen Blick auf die Dinge erzwingt. Des Weiteren gibt es einen von dem Gedanken der Umweltgerechtigkeit bestimmten Ansatz, der den Zusammenhang von Umweltzerstörung, Luftverschmutzung und Unterdrückung bestimmter Klassen und Rassen in den Blick nimmt.11
Aus Sicht eines Umweltschützers ist die heutige Zeit keine gute Zeit. Warum also überhaupt ein Projekt beginnen, das die Ökokritik kritisiert? Warum die schlummernden ökologischen Themen nicht einfach in Ruhe lassen? Es klingt doch wie ein absurder Witz: Der Himmel fällt uns auf den Kopf, die Erde erwärmt sich, das Ozonloch ist immer noch da; Menschen sterben an Verstrahlung und anderen Giftstoffen; Arten werden ausgelöscht, zu Tausenden pro Jahr; die Korallenriffe sind fast alle verschwunden. Riesige Weltkonzerne schicken sich an, Lebensgrundlagen wie Wasser und Gesundheitsversorgung in Besitz zu nehmen. Überall auf der Welt ist die Umweltgesetzgebung am Bröckeln. Wahrhaftig, eine perfekte Gelegenheit, sich zurückzulehnen und über Raum, Subjektivität, Umwelt und Poetik nachzudenken. Und doch, der Zeitpunkt könnte nicht geeigneter sein.
Warum überhaupt sich mit solchen Gedanken plagen? Manch einer ist der Ansicht, die Ökokritik habe, was hier »Theorie« genannt wird, so nötig wie ein Loch im Kopf. Andere halten dagegen, dass Ökokritik eine Durchlüftung absolut nötig habe. Um ihretwillen muss die Wissenschaft nachdenken – im weitesten Sinne Theorie treiben. Da Ökologie und Ökopolitik anfangen, weitere Formen der Wissenschaft, der Politik und der Kultur herauszubilden, müssen wir einen Schritt zurücktreten und bestimmte ideologische Faktoren der Ökologie überprüfen. Das genaue Gegenteil also von dem, was John Daniel meint, wenn er von einer Wiederverzauberung der Welt spricht:
Der Himmel fällt uns auf den Kopf. Die Erderwärmung ist unbestreitbar. Aber man kann die Leute nicht einfach zu den Waffen rufen und vorgeben, man habe einen Plan. Die Menschen möchten sich in ihrem Leben nicht abgewertet fühlen und sie möchten nicht, dass ihnen die Verantwortung für die Welt auf den Schultern lastet. Deshalb sollte man den Kindern lieber nicht beibringen, dass der Regenwald bedroht ist. Man sollte sie an den Bach hinterm Haus führen und ihnen die Wasserläufer zeigen.12
Wer so spricht, setzt Ästhetik als Anästhetikum ein.
Ökologische Anschauungen in Theorien zu überführen, heißt auch, das Denken auf Vordermann bringen. Verschiedene romantizistische und primitivistische Strömungen haben den ökologischen Kampf häufig als Verteidigung des »Orts« gegen das Vordringen des modernen und postmodernen »Raums« gedeutet. In gesellschaftlichen Strukturen und im Denken, so das Argument, sei der Ort erbarmungslos vom Raum zersetzt worden: Alles Feste löse sich in Luft auf. Doch wenn wir uns darüber keine gründlicheren Gedanken machen, wird der Schrei nach dem »Ort« wirkungslos im leeren Raum verhallen. Die Frage lautet doch, ob die »Wiederverzauberung der Welt« schöne Bilder produzieren oder eine politische Praxis hervorbringen soll.
Revolutionäre Bewegungen wie im mexikanischen Chiapas konnten in ihrem Bemühen, einen Ort der zersetzenden Wirkung der globalen Ökonomie zu entziehen, Teilerfolge erzielen. In der »dritten Welt« zeigen sich Umweltinitiativen häufig als leidenschaftliche Versuche, das Lokale gegen die Globalisierung zu verteidigen.13 Das Lokale jedoch einfach als Abstraktion oder aus ästhetischen Motiven zu feiern – örtliche Poesie in den Himmel zu loben, nur weil sie lokal begrenzt ist, oder eine ästhetisierte Ethik im Sinne des »small is beautiful« zu proklamieren –, ist im größeren Maßstab eher Teil des Problems als der Lösung. Bei unseren Vorstellungen des Lokalen handelt es sich um im Nachhinein geschaffene Fantasiegebilde, die von der zersetzenden Wirkung der Moderne bestimmt werden. Der Ort als solcher ist nicht verloren gegangen, auch wenn wir ihn als etwas Verlorengegangenes postulieren. Und selbst wenn der Ort, als reiches Beziehungsgeflecht zwischen fühlenden Wesen, tatsächlich (noch) nicht existieren würde, stellt ergerade jetzt einen Teil unserer Weltanschauung dar – und was, wenn er diese Anschauung im Grunde stützt? Ohne ein paar Rückzugsorte, in denen wir unsere Hoffnung unterbringen können, wären wir außerstande, mit der modernen Welt zurechtzukommen.
Darin liegt dercri de guerre des Buches. Bevor ich aber solche Ideen frontal angehe, veranstalte ich eine Reihe kleiner Manöver. Wenn es darum geht, wie wir über die Umwelt schreiben, gibt es nämlich Probleme im Kleingedruckten. Einzelne Stellen darin zu unterstreichen, schafft die größeren Probleme nicht aus der Welt, aber es ist ein brauchbarer Anfang. Das erste Augenmerk gilt dem, was in den Vereinigten Staaten von der gelehrten Welt und aus Marketinggründen alsNature Writing bezeichnet wird. Unter dieses Banner stelle ich einen Gutteil der Ökokritik, die, wenn sie nicht insgesamt für das Genre steht, geeignete Beispiele bereithält. Ich möchte nicht behaupten, dassNature Writing die einzige Option darstellt. Doch wartet diese Literatur mit künstlerischen und philosophischen Lösungen auf, in denen sich die verschiedensten Themen ökologischen Schreibens in ihrer Gesamtheit kristallisiert finden. Das Buch nimmt aber noch weit mehr in Augenschein: Philosophie, Literatur, Musik, bildende Kunst und Multimedia, in einer immer weiter gehenden kritischen Analyse.
Ecocritique
Um eine Umwelt zu besitzen, muss man über einen Raum verfügen; um eineIdee von der Umwelt zu haben, braucht man Raumvorstellungen (und solche des Orts). Wenn wir die Vorstellungen, die wir von der Natur haben, einen Moment auf Eis legen und uns nicht vorschnell damit befassen, wird uns klarer werden, worin eigentlich genau die Idee der Umwelt besteht. Dies soll nicht heißen, dass übrig bleibt, was gemeinhin Umwelt genannt wird, wenn man Kaninchen, Bäume und Hochhäuser wegnimmt. Das wäre zu schnell gedacht für dieses Buch. Hier geht es nicht darum, eine Liste zusammenzuschustern, die dann als Natur bezeichnet würde, sondern es gilt, das Denken zu verlangsamen und die Liste beiseitezulegen – und sogar die Idee einer Liste infrage zu stellen. InÖkologie ohne Natur wird die Auffassung ernst genommen, echte theoretische Reflexion sei nur möglich, wenn sich das Denken entschleunigt. Das bedeutet keinesfalls, dass man taub und dumm werden muss. Es geht um das Auffinden von Anomalien, Paradoxen und Problemen in einem ansonsten ruhig fließenden Strom von Ideen.
Dieser Entschleunigungsprozess ist oft ästhetisiert worden. Nennt man ihnclose reading, wird unterstellt, dass er sich etwa so wie Meditation auf den Leser in jeder Hinsicht gesundheitsfördernd auswirkt. Wie viele andere Formen der Kritik kennt auch die Ökokritik einen Kanon von Werken, die als Medizin besser taugen als andere. InÖkologie ohne Natur mag der Blick auf die Umweltliteratur zwar an Horizont gewinnen und Texte einschließen, die in dieser Hinsicht nicht normativ sind, doch das Buch vertritt den medizinischen Ansatz womöglich auf andere Art. Man kann sich die Lektüre gleich welchen Stoffs als heilenden Balsam vorstellen. Letztendlich jedoch ist die Theorie (und so gesehen die Meditation) nicht dafür gedacht, aus dem Leser einen »besseren Menschen« zu machen. Sie ist dafür gedacht, Heuchelei bloßzustellen oder zu untersuchen, wie sich weltanschauliche Illusionen festsetzen und behaupten können.Ökologie ohne Natur versucht also nicht, in selbstgefälliger Langsamkeit die Schildkröte desclose reading zu übertreffen, um in einer Art Antiwettlauf einen ästhetischen Zustand meditativer Ruhe zu erreichen, den wir dann (fälschlich) mit »ökologischer Achtsamkeit« assoziieren könnten. Das ist vor allem deshalb von Belang, da eine ökologische Ethik auf einem meditativen ästhetischen Zustand aufbauen könnte, auf jenem »bewundernden Zuhören«, von dem Michel Serres hofft, es würde eines Tages »Herrschaft und Besitzstreben« ersetzen.14 Eine solche Ethik des Ästhetischen stand in den jüngsten Arbeiten von Autoren wie Elaine Scarry hoch im Kurs.15
Es geht nicht darum, einen besonderen geistigen Zustand zu erreichen. Es geht darum, gegen den Strom der vorherrschenden normativen Naturvorstellungen zu schwimmen, und zwar im Namen fühlender Wesen, die unter katastrophalen Umweltbedingungen leiden. Ich sage das mit allem gehörigen Respekt gegenüber den Tiefenökologen, die glauben, dass die Menschen, ohnehin nur eine Virusinfektion des Planeten, irgendwann in einer Aussterbewelle hinweggeniest werden und dass wir letztlich nichts anderes zu tun haben als uns gemütlich zurückzulehnen und gelassen zu bleiben – oder eben unseren eigenen Untergang zu beschleunigen; oder eben so zu handeln, als ob wir überhaupt keine Rolle spielen würden.
Ein echter theoretischer Ansatz verlangt, das Gebiet, das man behandelt, nicht hochnäsig von außen zu betrachten. Man muss sich intensiv auf es einlassen. Eine Haltung einzunehmen, die alle übrigen unberücksichtigt lässt, wäre allzu einfach: Es wäre eine naive negative Kritik, hinter der sich eine selbstgefällige Haltung verbirgt. Es ist ja schön, über die Begehrlichkeiten der anderen zu nörgeln, ohne sich die Determiniertheit der eigenen Wünsche einzugestehen – eine politische und intellektuelle Haltung, zu der auch das ökologische Denken neigt. Ich bezeichne sie mit Hegel alsSyndrom der schönen Seele und behandle sie in Kapitel 2. Die »schöne Seele« wäscht sich von der korrupten Welt rein und weigert sich anzuerkennen, dass sie gerade in ihrer Enthaltsamkeit und ihrem Abscheu an der Schaffung dieser Welt Teil hat. Die weltmüde Seele hält sich alle Überzeugungen und Ideen vom Leibe. Die einzige ethische Option besteht dagegen darin, anzupacken. Daher bietet das Buch nicht nur, indem es unablässig andere Auffassungen kritisiert, sondern auch aus sich selbst heraus eine eigene Sicht der Ökologie und der Ökokritik.
Stellenweise halte ich es mit Hegels Idee, dass mit der Romantik die Kunst von der Philosophie überholt wurde – oder sogar mit Oscar Wildes Gedanken, dass Kritik heutzutage das beste Vehikel ist, um uns mitzuteilen, wo wir stehen.16 Aber ich scheue davor zurück, einen absoluten Standpunkt einzunehmen, und ziehe es vor, von den Möglichkeiten des Denkens, Machens und der Praxis von Umweltkunst, -politik und -philosophie zu sprechen. Die Ökokritik ist zu sehr mit der ununterbrochen stereotype Naturvorstellungen produzierenden Ideologie verwoben, um wirklich etwas zu taugen. Tatsächlich ist sie kaum vomNature Writing, dem Gegenstand ihrer Auseinandersetzung, zu unterscheiden. Mir liegt daran, eine Vorstellung davon zu entwickeln, was »richtig kritisch« bedeuten könnte.
Timothy Luke verwendet den AusdruckEcocritique, um Formen linker Ökokritik zu beschreiben.17 Ich möchte den Ausdruck auf eine selbstreflexivere Weise als Luke verwenden.Ecocritique ist kritisch und selbstkritisch. Das ist die eigentliche Bedeutung des kritischen Denkens, eine dialektische Form der Kritik mit einem Rückbezug auf sich selbst. Es war die Frankfurter Schule, die diesen Begriff derKritik* geprägt hat. So wie das kritische Denken in hochpolitischer Form auf die Gesellschaft verweist, verweist es auf sich selbst. Man kann damit immer weiter gehen. Überlegungen, die in anderen Gebieten der Geisteswissenschaften Gemeingut sind, haben in derEcocritique Fuß gefasst: Sie geht davon aus, dass Aspekte wie Rasse, Klasse und Gender stark mit den Belangen der Umwelt verflochten sind. Ohne große Berührungsangst greift sie im Dienste der Ökologie auf Ideen der Dekonstruktion zurück, anstatt, wie es allzu häufig geschieht, auf der totgesagten »postmodernen Theorie« herumzureiten.Ecocritique ist vergleichbar mit der Queer-Theorie. Im Namen all dessen, was wir an »Natur« schätzen, ergründet sie, wie Natur als transzendentale, einheitliche und unabhängige Kategorie entstehen konnte. Sie sieht nichts Paradoxes darin, im Namen der Ökologie auszurufen: »Nieder mit der Natur!«
Die Devise derEcocritique lautet: »Keine Angst vor der Nichtidentität.« Das Denken ist im Wesentlichen eine Begegnung mit dem Nichtidentischen, um eine Formulierung Adornos, einem Mitglied der Frankfurter Schule und Leitstern dieser Untersuchung, aufzugreifen.18 Wäre es das nicht, bestünde es nur aus dem Verschieben vorgefertigter Teile auf einem Brett. Auch Hegel hat dialektisches Denken auf diese Weise von reiner Logik unterschieden.19 Es muss zumindest eine Bewegung von A nach Nicht-A stattfinden. So schlägt das Denken in jedem Moment zwangsläufig mit dem Kopf gegen das, was es nicht ist. Das Denken muss »irgendwohin gehen«, ob es jedoch einen verlässlichen Ort findet, bleibt offen. Bei ernsthafter Betrachtung hat die Begegnung mit dem Nichtidentischen weitreichende Auswirkungen auf das ökologische Denken, die ökologische Ethik und Kunst. Dieses Buch war überhaupt nur zu schreiben, weil Nichtidentität in dasNature Writing eingewoben ist. Auch Peter Fritzell deutet dies an mit seiner Unterscheidung zwischen naiv-mimetischen und selbstreflexiven Formen desNature Writing. In Letzterer gilt: »›Was Natur wirklich war‹ ist häufig nicht, was Natur wirklich war (genau besehen, was sie ist).«20
Naturgeschichtliche Lektionen
Zu den Vorstellungen, die eine Politik, Ethik, Philosophie und Kunst der Ökologie wirklich verhindern, gehört die Vorstellung der Natur selbst. Natur, ein Begriff für eine transzendente Vorstellung in einer materiellen Maske, steht am Ende einer potenziell unendlichen Reihe anderer Begriffe, die mit ihm zusammenfallen – einer metonymischen Reihe: Fisch, Gras, Bergluft, Schimpanse, Liebe, Mineralwasser, Wahlfreiheit, Heterosexualität, freier Markt … Natur. Die metonymische Reihe wird dabei schließlich zur Metapher. Das Schreiben beschwört diesen notorisch schlüpfrigen Begriff, der in seiner Schlüpfrigkeit, in seiner Weigerung, irgendeine Konsistenz beizubehalten, Ideologien aller Art dienlich ist.21 Auf einer anderen Ebene ist Natur dagegen Konsistenz in Reinform. Wenn man sagt, etwas sei unnatürlich, meint man, dass es keiner Norm entspricht, die so »normal« wäre, dass sie in das Gefüge der Dinge eingebaut ist. Daher besetzt »Natur« in der symbolischen Sprache drei Orte. Sie ist erstens ein bloßer Platzhalter für eine Anzahl anderer Konzepte. Zweitens stellt sie eine gesetzgebende Kraft dar, eine Norm, an der Abweichungen gemessen werden. Drittens ist »Natur« eine Büchse der Pandora, ein Wort, das eine potenziell unendliche Anzahl von unterschiedlichen Fantasieobjekten umschließt. Mit dieser dritten Bedeutung – Natur als Phantasma – beschäftigt sich das Buch am gründlichsten. Möchte man erkennen, wie »Natur« Gefühle und Überzeugungen erzwingt, scheint sich die »Disziplin« des Eintauchens in die dem Vergnügen Dritter entsprungenen Rorschachkleckse, die wir gemeinhin Gedichte nennen, als durchaus geeignete Methode anzubieten.
Natur schwankt zwischen dem Göttlichen und dem Materiellen. Weit davon entfernt, selbst etwas »Natürliches« zu sein, schwebt Natur über den Dingen wie ein Geist. Sie gleitet über die unendliche Aufzählung der Dinge, von denen sie heraufbeschworen wird. Somit gleicht Natur dem »Subjekt«, einem Wesen, das das gesamte Universum nach seiner Spiegelung durchsucht und keine findet. Wenn aber Natur nur ein anderes Wort für eine höchste Autorität ist, warum sie nicht einfach Gott nennen? Und wenn dieser Gott außerhalb der materiellen Welt nichts ist, warum sie dann nicht Materie nennen? Diesem politischen Dilemma sahen sich Spinoza und die Deisten des achtzehnten Jahrhunderts in Europa gegenüber.22 Im achtzehnten Jahrhundert war es gefährlich, ein offener Atheist zu sein, wie sich an Humes kryptischen Bemerkungen und dem zunehmend vorsichtigen Vorgehen von Percy Shelley ablesen lässt, der aufgrund der Veröffentlichung eines atheistischen Pamphlets aus Oxford verjagt worden war. Gott erschien oft an der Seite königlicher Autorität, und die aufstrebende Bourgeoisie und die ihr verbundenen revolutionären Klassen verlangten nach einer anderen Form autoritärer Machtausübung. »Ökologie ohne Natur« heißt auch, dass wir einige Begriffe unter die Lupe nehmen, die von der Natur verwischt werden.
Ökologische Literatur ist von der Vorstellung fasziniert, dass zwischen gegensätzlichen Begriffspaaren wie Gott und Materie, diesem und jenem, Subjekt und Objekt etwas existiert. John Lockes Kritik des Ätherbegriffs ist hier hilfreich. Lockes Kritik kam etwa zeitgleich mit der neuzeitlichen Konstruktion des Raums auf, der als ein leeres Set von Koordinaten aufgefasst wurde.23 Zahlreiche Löcher in materialistischen, atomistischen Theorien wurden durch etwas Elementares gefüllt. Newtons Schwerkraft funktionierte aufgrund eines Äthers, der analog zur Liebe eines allgegenwärtigen Gottes (oder eines ihrer Aspekte) die Eigenschaften schwerer Körper unmittelbar überträgt.24 Wenn aber der Äther eine Art »umgebende Flüssigkeit« ist, die alle Teilchen umfließt und »zwischen ihnen« existiert, was umfließt dann die Teilchen der umgebenden Flüssigkeit selbst?25 Wenn Natur zwischen Begriffe wie Gott und Materie eingeschoben ist, welches Medium hält dann die Dinge, die von Natur aus geschichtet sind, zusammen? Natur scheint sowohl Salat als auch Mayonnaise zu sein. Ökologisches Schreiben schichtet Subjekt und Objekt immer wieder um, sodass wir schließlich glauben, sie hätten sich ineinander aufgelöst, was für uns gewöhnlich auf eine Unschärfe hinausläuft, die in diesem BuchAmbiente genannt wird.
Etwas später in der Neuzeit taucht die Idee des Nationalstaats auf, um die Autorität des Monarchen zu überwinden. Der Begriff der Nation basiert häufig genug auf genau der gleichen Liste, die auch die Naturvorstellung heraufbeschwört. Natur und Nation sind eng miteinander verflochten. Ich zeige, wie dieEcocritique in Augenschein nehmen kann, dass Natur uns nicht unbedingt der Gesellschaft entfernt, sondern eigentlich das Fundament nationalistischer Begeisterung bildet. Natur, die im Mittelalter ein Synonym für das Böse darstellte, galt in der Romantik als fundamental für das soziale Wohlergehen. Für zahlreiche Autoren wie etwa Rousseau setzen die Bildner des Gesellschaftsvertrags bei dem Naturzustand an. Es ist indes nicht unbemerkt geblieben, dass sich dieser Zustand kaum von dem »Beton-Dschungel« der heutigen historischen Situation unterscheidet.
In der Aufklärung wurde Natur dazu herangezogen, sexuelle und rassische Identitäten zu definieren, was vornehmlich mit den Mitteln der Wissenschaft unternommen wurde. Das Normale wurde entlang der Koordinatenatürlich/unnatürlich vom Pathologischen abgegrenzt.26 Natur, bis dato ein wissenschaftlicher Begriff, brachte jegliche Argumentation oder rationale Beweisführung zum Erliegen: »Nun, das liegt in meiner Natur.« Er ist ideologisch, du bist voreingenommen, aber meine Ideen sind natürlich bzw. normal. Der metaphorische Gebrauch von malthusianischen Ideen im Werk Charles Darwins diente (und dient noch immer) dazu, das Funktionieren der »unsichtbaren Hand« des freien Marktes und das »survival of the fittest« – das stets als Wettbewerbskampf aller (der Besitzenden) gegen alle (die Arbeiter) aufgefasst wird – als natürlich darzustellen. Malthus führte die Natur ins Feld, um in einem für die damalige Regierung verfassten Dokument gegen die Fortsetzungen einer Frühform der öffentlichen Wohlfahrt zu plädieren. Traurig genug, dass genau dieses Denken heute von jenen vermeintlich ökologisch Gesinnten genutzt wird, die gegen »Bevölkerungswachstum« (und Immigration) vorgehen, um die Armen noch weiter niederzudrücken. Von der Metonymie zur Metapher gewendet wird Natur zu einem indirekten Begriff und kann dazu dienen, indirekt über Politik zu reden. Was als unmittelbar, unbeschädigt und über jede Anfechtung erhaben erscheint, ist jedoch verzerrt.
Eines der grundlegenden Probleme mit Natur liegt darin, dass sie entweder alsSubstanz, als eine matschige Sache, angesehen werden kann oder alsEssenz, als ein abstraktes Prinzip, das die Ebene der Materie und sogar die der Repräsentation transzendiert. In seiner Schrift über das Erhabene fasst Edmund Burke die Substanz als den Stoff der Natur auf.27 Dieser »Substanzialismus« macht geltend, dass es zumindest eine Sache geben muss, die eine erhabene Qualität zum Ausdruck bringt (Weite, Schrecken, Großartigkeit). Der Substanzialismus pflegt die monarchistische oder autoritäre Sichtweise, dass es eine äußere Sache gibt, der sich das Subjekt zu beugen habe. Der Essenzialismus wiederum hat seinen Meister in Immanuel Kant. Das Erhabene kann nicht dargestellt werden, und tatsächlich besteht laut Kant in einigen Religionen (Islam, Judentum) ein Gebot, es zu unterlassen. Dieser Essenzialismus erweist sich auf der Seite des revolutionären Republikanismus als politisch befreiend.28 Im Großen und Ganzen tendiert dasNature Writing, einschließlich seiner Vorläufer und Familienmitglieder vor allem in der phänomenologischen und/oder der romantischen Literatur, ungeachtet der ausdrücklichen Politik der jeweiligen Autoren zu einer substanzialistischen Naturanschauung: Natur ist spürbar undda. DieEcocritique sollte in Zukunft eine republikanische, nichtsubstanzialistische Gegentradition entwerfen und sich dabei mit Schriftstellern wie John Milton und Shelley befassen, denen die Natur nicht als Autorität galt, der man Autonomie und Verstand zu opfern hätte.
Ökologische Formen von Subjektivität beinhalten zwangsläufig auch Vorstellungen und Entscheidungen überGruppenidentität und -verhalten. Subjektivität ist kein individuelles Phänomen und mit Sicherheit auch kein individualistisches. Sie ist ein kollektives. Umweltbezogenes Schreiben registriert das Gefühl, von anderen, oder abstrakter, von Andersheit – von etwas, was nicht zum Selbst gehört –, umgeben zu sein. Auch wenn die eigentliche soziale Gemeinschaft ausgeblendet wird, um stattdessen über die Berge in der Umgebung zu erzählen, sagen solche Ausblendungen etwas über das gemeinschaftliche Leben aus, mit dem sich ökologische Literatur befasst. Fredric Jameson spricht davon, dass die Kritik nicht umhinkönne, sich mit Kollektivität zu befassen:
Wer aus einer linken Perspektive die ultimativen Werte der Gemeinschaft oder der Kollektivität heraufbeschwört, hat sich mit drei Problemen auseinanderzusetzen: 1) Wie diese Position radikal vom Kommunitarismus abzugrenzen ist; 2) wie das Kollektivprojekt vom Faschismus oder Nazismus zu unterscheiden ist; 3) wie die soziale und die wirtschaftliche Ebene aufeinander zu beziehen sind – das heißt, wie die marxistische Analyse des Kapitalismus einzusetzen ist, um die Lebensunfähigkeit sozialer Lösungen innerhalb dieses Systems aufzuzeigen. In einem historischen Moment, in dem individuelle, persönliche Identität als ein dezentrierter Ort vielfältiger Subjektpositionen entlarvt worden ist, ist es sicher nicht zu viel verlangt, dass entsprechende Konzepte auch für kollektive Identitäten entwickelt werden sollten.29
Sich einen Begriff über die Umwelt zu machen ist eine Art, über Gruppen und Kollektive nachzudenken: Es geht um Menschen, die von Natur umgeben sind oder mit anderen Lebewesen wie Tieren und Pflanzen in einer Reihe stehen. Eine Sache des Miteinanders. Allerdings hat Bruno Latour jüngst darauf hingewiesen, dass wir es heute weit drastischer als beschrieben mit einer Kollektivsituation zu tun haben. Alle Wesenheiten, vom Giftmüll bis zu den Meeresschnecken, kämpfen lauthals um unsere wissenschaftliche, politische und künstlerische Aufmerksamkeit und sind – zum Nachteil monolithischer Naturkonzeptionen – Teil des politischen Lebens geworden.30 Über Ökologie zu schreiben heißt, über Gesellschaft zu schreiben, und das nicht nur in dem schwachen Sinn, dass unsere ökologischen Ideen soziale Konstrukte sind. Geschichtliche Umstände haben eine dem Gesellschaftlichen äußere Natur, auf die sich Gesellschaftstheorien berufen könnten, abgeschafft und zugleich die unter diese Rubrik fallenden Wesenheiten veranlasst, immer dringlicher auf die Gesellschaft einzuwirken.
Unterschiedliche Umweltvorstellungen ziehen unterschiedliche Gesellschaftsformen nach sich. Substanzialistische Vorstellungen einer greifbaren, eindeutigen Natur, die zumindest in einem tatsächlich existierenden Phänomen zum Ausdruck kommt (einer bestimmten Art, einer bestimmten Gestalt), erzeugen autoritäre Formen kollektiver Organisation. Dazu tendiert die tiefenökologische Sicht, die Natur als konkrete Entität begreift. Vorstellungen einer Natur, die nicht als Bilder wiedergegeben werden können, die also essenzialistisch sind, unterstützen dagegen eher egalitäre Formen. Es wäre hilfreich, würde dieEcocritique realisieren, dass es auch andere Naturmodelle gibt. So übermitteln zum Beispiel sich auf Milton berufende republikanische Poetiken oder die vernachlässigte Geschichte eines radikalen Umweltbewusstseins während der Englischen Revolution ikonoklastische Figuren der Umwelt, die klar umrissene Repräsentationsformen transzendieren.31 Andere politische Formen verbieten Götzenbilder der Natur. Im Gegensatz zu einem gefühlsduseligen Organizismus, wie er einer Burke’schen, von Klasse und Tradition geprägten Weltanschauung entspringt, sollten wir Umwelt auch in einer offeneren, rationaleren und sinnlich andersgearteten Weise denken können. Mit dem Studium ikonoklastischer Darstellungen von Raum und Welt treten unverbrauchte Möglichkeiten des Denkens und Schaffens an den Tag. Zeigte man auf, dass es zumindest verschiedene Fantasievorstellungen des Natürlichen gibt, würde das dem Umweltdenken frische Luft zuführen. Aber damit endetEcocritique noch nicht.
Substanz und Essenz unterscheiden sich auf merkwürdige Weise. Ein auf beide zutreffender, übergreifender Ausdruck lässt sich nicht so leicht finden. Behaupteten wir, dass Substanz und Essenz völlig unterschiedlich sind, käme dies einer Unterstützung desSubstanzialismus gleich – Substanz und Essenz wären dann zwei völlig unterschiedliche Substanzen. Aus dieser Sicht sind Essenz und Substanz wie Kreide und Käse oder Äpfel und Orangen. Behaupteten wir andererseits, Essenz und Substanz sind voneinander so verschieden, wie sich schwarz und weiß, oben und unten unterscheiden, kämen wir deressenzialistischen Anschauung nahe – Essenz und Substanz wären dann nicht grundlegend verschieden, sondern als Gegensätze aufeinander bezogen. Die unterschiedliche Substanz der Dinge zum Beispiel besteht in dieser Sicht nur in einer Variation ihrer atomaren Struktur oder ihres DNA-Codes. Substanz ist mindestens in einer Sache verkörpert, aber nirgends sonst. Essenz kann nicht verkörpert werden. Natur aber möchte gleichzeitig Substanz und Essenz sein. Natur weitet den Unterschied zwischen den Begriffen aus und tilgt ihn zugleich. Sie ist der Wald und die Bäume – und dieIdee der Bäume selbst (Griechisch:hyle, Materie, Holz).
Je mehr wir die Natur studieren, desto mehr sehen wir, dass sie zwischen den Dingen flimmert – sie ist »sowohl als auch« und »weder noch«. Dieses Flimmern beeinflusst, wie wir über sie schreiben. Natur ist … Tiere, Bäume, Wetter … die Bioregion, das Ökosystem. Sie ist sowohl der Kasten als auch sein Inhalt. Sie ist die Welt und die Entitäten in dieser Welt. Sie erscheint wie ein Geist am Ende einer endlosen Reihe: Krabben, Wellen, Blitze, Kaninchen, Silizium … Natur. Und zu all dem sollte Natur auch noch natürlich sein, obwohl wir nicht auf sie zeigen können. Gewöhnlich sehen wir nur ein vages, irgendwo hervortretendes Ausströmen – »Des Heimstatt ist das Licht der untergehnden Sonnen – / das Weltmeer ringsumher – und die lebendge Luft – / das blaue Firmament – und in des Menschen Seele«, wie es Wordsworth so wunderbar formuliert hat.32 Natur wird übernatürlich: ein Prozess, den John Gatta in seiner maßgeblichen Abhandlung über puritanische Natur- und Wildnisvorstellungen verdeutlicht hat, obwohl er dabei die radikaleren Ausrichtungen der Diggers, des Mystikers Jakob Böhme oder des Vegetariers Thomas Tryon unerwähnt gelassen hat.33 Oder Natur löst sich auf, und wir haben es wie in der radikal materialistischen Philosophie eines Spinoza nur noch mit reiner Materie und einer mit zahlreichen Höhepunkten gespickten Abfolge von Ideen zu tun. Wenn wir hier etwas Dazwischenliegendes möchten: Wäre dies natürlich? Wäre es nicht eher übernatürlich? Wäre es übernatürlich wie ein Geist – also eher von geläuterter Essenz – oder ein Gespenst – etwas mehr Substanzielles, vielleicht aus Ektoplasma bestehend? Mit solchen Haarspaltereien könnte man endlos fortfahren. Unsere Reise zur Mitte, in den Raum »dazwischen« oder wie auch immer man es nennen möchte, würde immer weitere Paarungen bilden, und stets würden wir auf der einen oder anderen Seite landen und die exakte Mitte verfehlen. Ob es sich dabei um materialistische Spiritualität handelt oder um spirituellen Materialismus, spielt keine Rolle. Das Denken postuliert etwas »da drüben«, das einen mysteriösen Reiz bewahrt.
Seit der Romantik wurde Natur dazu herangezogen, die kapitalistische Werttheorie zugleich zu untermauern und zu unterminieren; das intrinsisch Menschliche aufzuzeigen und zugleich auszuschließen; Wohlwollen und Mitgefühl zu inspirieren und zugleich Wettbewerb und Grausamkeit zu rechtfertigen. Es ist leicht einzusehen, warum M. H. Abrams einem Buch über romantische Dichtung den TitelNatural Supernaturalism gegeben hat. Kurz, seitdem Natur erfunden worden ist, hat sie sich auf beiden Seiten der Gleichung aufgehalten. IndemÖkologie ohne Natur erkundet, wie literarisches Schreiben Natur heraufzubeschwören versucht, nimmt es die Natur aus der Gleichung heraus. Wir erfahren, wie uns Natur genau dann, wenn wir sie fassen möchten, entschlüpft. In dem Moment, in dem das Schreiben sich angesichts der packenden Realität, die es beschreibt, aufzulösen scheint, begräbt es unter sich, was es schildert, und macht es unmöglich, irgendetwas hinter seiner opaken Textur aufzuspüren. Selbst wenn das Schreiben eine mittlere Ebene »zwischen« Begriffen wie Subjekt und Objekt oder Innen und Außen einzieht, wird Natur nicht fehlgehen, bestimmte Begriffe auszuschließen und den Unterschied zwischen den Gegensätzen auf andere Weise wieder zu etablieren.34 Gerade dann, wenn uns das Schreiben dem nichtmenschlichen »Anderen« annähert, errichtet Natur eine bequeme Distanz zwischen »uns« und »ihnen«. Wer braucht noch Feinde, wenn er über ökologische Freunde wie diese verfügt?
Man wird mir vorwerfen, ein Postmodernist zu sein, und mir damit unterstellen, ich glaubte, die Welt bestünde aus Text und es gäbe nichts Wirkliches. Nichts liegt der Wahrheit ferner. Die Natur als Idee ist nur allzu real und sie hat eine allzu reale Wirkung auf allzu reale Glaubensvorstellungen, Handlungsweisen und Entscheidungen in einer allzu realen Welt. Es stimmt, ich behaupte, es gäbe nichts dergleichen wie Natur, wenn wir unter Natur etwas Singuläres, Unabhängiges und Dauerhaftes verstehen. Aber es gibt verblendete Ideen und ideologische Fixierungen. Natur ist ein Brennpunkt, der uns zwingt, bestimmte Haltungen einzunehmen. Und der gegenüber diesem faszinierenden Objekt eingenommenen Haltung wohnt Ideologie inne. Indem wir das Objekt auflösen, machen wir die ideologische Fixierung unwirksam. Das zumindest ist der Plan.
Die ökokritische Sicht auf die Postmoderne, für die »Theorie« ein Slogan ist, hat viel mit der englischen Abneigung gegenüber der Französischen Revolution gemein, ja, sie ist in vielen Punkten aus dieser Abneigung erwachsen.35 Das Argument lautet, »Theorie« sei kalt und abstrakt, wirklichkeitsfern.36 Sie zwinge organische Formen in Kästchen, die ihnen nicht gerecht werden. Sie sei übermäßig kalkulierend und rational. Die »Postmoderne« stellt allerdings lediglich das letzte Stadium dieser misslichen Situation dar. Die englische Position gegenüber der französischen resultierte allerdings ihrerseits aus einer Abstraktion, nämlich der selbstauferlegten Leugnung einer Geschichte – exemplarisch die Enthauptung Charles I. –, die bereits stattgefunden hatte.
Akademiker sind dann am intellektuellsten, wenn sie sich als Antiintellektuelle gerieren. Kein Farmer mit Selbstachtung würde sich wie Aldo Leopold oder Martin Heidegger aufführen. Was könnte postmoderner sein als ein Professor, der sich mit Bedacht die soziale oder subjektive Sichtweise eines Farmers aneignete? Was könnte postmoderner sein als eine Ökokritik, die, keineswegs naiv, bewusst ihre Ohren gegenüber den intellektuellen Entwicklungen der letzten dreißig Jahre verschließt, insbesondere (wenn auch nicht unbedingt gleichzeitig) gegenüber dem Feminismus, dem Antirassismus, der Antihomophobie, der Dekonstruktion? So wie die Reagan- und die Bush-Regierung – als hätten die sechziger Jahre nie stattgefunden – eine Wiederauflage der 1950er Jahre versuchten, versucht die Ökokritik zu einem Akademismus der Vergangenheit zurückzukehren. Sie pflegt also eine Form retrograder Postmoderne.
Das, was ich sage, kann Ökokritikern genauso wenig gefallen wie Poststrukturalisten. Der Poststrukturalismus – eine kritische Theorie, die sich aufführt, alshätten die 1960er stattgefunden – hat seine eigene Sichtweisen der Natur, benennt dies aber nicht so offen. Sie sollen lediglich etwas ausgetüftelter sein als vorhergehende. Grundlegend ist noch immer die Suche nach etwas, was »zwischen« Kategorien wie Subjekt und Objekt, Faktum und Wert liegt. Es gibt einen Klassenunterschied zwischen den Genussobjekten ökokritischer Konservativer und poststrukturalistischer Radikaler. Wo Ökokritiker Aldo Leopolds Almanach-Stil mitsamt seinen hübschen Illustrationen wertschätzen, greifen Poststrukturalisten lieber zu dem jüngsten Album eines Ambient-Techno-DJ. Es handelt sich zwar nicht um Beethoven, aber auf einer Cocktailparty oder einer Ausstellungseröffnung ist es immer noch vornehm genug. Für dieEcocritique sind Aldo Leopold und The Orb zwei Seiten derselben Medaille. Ob die Kunsterzeugnisse nun anspruchsvoller oder schlichter sind, Installation oder Pastorale, in ihnen zeigt sich, was ich Ökomimese nenne, eine rhetorische Form, die in Kapitel 1 näher beschrieben und das ganze Buch hindurch erkundet wird.
Die Postmoderne suhlt sich im Ästhetizismus. In ihr erstarrt die Ironie zu einer ästhetischen Pose. Wenn ich vorschlage, das Konzept von Natur fallenzulassen, meine ich wirklich, es fallenzulassen, und komme nicht mit hastig zusammengeschusterten »neuen und verbesserten« Lösungen, mit einer neuen Form der Werbesprache daher. Für Werbesprache wird man das »ohne« im Titel des Buches halten. Derridas gründliches Nachdenken über das »ohne«, dassans, in seiner Schrift über negative Theologie kommt hier in den Sinn. Die Dekonstruktion geht weiter als einfach nur zu behaupten, dass etwas sogar in einer hyperessenzialistischen Weise über das Sein hinaus existiere. Und sie geht weiter als die Behauptung, Dinge existierten nicht.37 »Ökologie ohne Natur«, das heißt ein unablässiges Infragestellen der Essenz und keine spezielle neue Sache. Mitunter versteigt sich die utopische Sprache einer Autorin wie Donna Haraway zu seltsamen Konstrukten wie »Naturkultur«.38 Diese Nichtnaturen sind immer noch Natur, sie beruhen auf hoffnungsvollen Interpretationen von Ideen, die quer durch Disziplinen wie Philosophie, Mathematik oder Anthropologie entstehen und sich in der Regel als ausgeprägt ästhetisch herausstellen. Kapitel 1 richtet seine Aufmerksamkeit auf naheliegende Alternativen zu herkömmlichen Naturauffassungen. In der Annahme, dass Natur heute ein zu ungeschütztes Ziel darstellt, untersuche ich unter dem Obertitel »Ambiente« Möglichkeiten, eine bereits vorhandene Idee größer, weiter oder besser zu denken.
Um über die Fallgruben der Postmoderne zu gelangen, hätte sich eine wirklich kritische Ökokritik völlig auf die Theorie einzulassen. Betrachten wir den nichttheologischen Sinn von Natur, schrumpft der Begriff aufUnbeständigkeit undGeschichte zusammen – beide Ausdrücke sagen im Grunde das gleiche. Unablässig entstehen und vergehen, mutieren und erlöschen Lebensformen. Auch Biosphären und Ökosysteme sind Aufstieg und Niedergang unterworfen. Lebewesen bilden keine feste prähistorische oder nichthistorische Grundlage, auf der die menschliche Geschichte abläuft. Doch häufig wird Natur herangezogen, um zu entscheiden, was flüchtig und was substanziell und von Dauer ist. Natur nivelliert die Unebenheiten der Geschichte und macht ihre Kämpfe und ihr Leid unleserlich. Bedenkt man, dass sich Ökokritik und Ökoliteratur meistenteils primitivistisch gerieren, ist es eine Ironie, dass ursprüngliche Gesellschaften Natur eher als einen gestaltwandlerischen Trickster sehen denn als festes Fundament. Das abschließende Wort zur Geschichte der Natur lautet, dassNatur Geschichte ist. »Das vorgeblich geschichtslos Naturschöne hat seinen geschichtlichen Kern.«39
Wozu Natur?
Ökologie ohne Natur untersucht zunächst detailliert, wie die Künste die Umwelt darstellen. Das hilft zu verstehen, dass »Natur« ein arbiträres rhetorisches Konstrukt ist, bar jeder unabhängigen, echten Existenz jenseits der über sie verfertigten Texte. Die Natur-Rhetorik beruht auf etwas, das ich alsPoetik des Ambientes bezeichne und das darin besteht, ein Gefühl für eine umgebende Atmosphäre oder Welt heraufzubeschwören. Meine Argumentation folgt dabei Angus Fletchers Arbeit über eine in den USA im Entstehen begriffene Umwelt-Poetik.40 Mit seiner Auffassung, dass die langen, schwingenden Zeilen Walt Whitmans und seiner Nachfolger Wege eröffnen, sich dem Horizont zu nähern oder über ihn hinauszugelangen und eine Idee grenzenloser Natur zu schaffen, ist ihm eine inspirierende Darstellung einer bestimmten Form der Poetik gelungen. Wie Fletcher verknüpfe ich diese Form mit einem dekonstruktivistischen Denken, bin jedoch hinsichtlich seines utopischen Gehalts weniger zuversichtlich.
In Kapitel 2 werde ich zeigen, dass diese Poetik ihre eigene Geschichte hat und dass im Laufe der Zeit verschiedene weltanschauliche Bedeutungen in sie hineingelegt wurden. Historisieren wir die Poetik des Ambientes, stellen wir schnell fest, dass es auch ihr an intrinsischer Existenz, an intrinsischem Wert mangelt. Unter den zeitgenössischen Künstlern gibt es zwar manche, die eine Poetik des Ambientes verwenden, um sich von dem, was sie in anderen Naturdarstellungen als Kitsch wahrnehmen, abzuheben. Doch sie lassen die ideologischen Gesichtspunkte dieser Rhetorik unberücksichtigt und laufen Gefahr, lediglich eine »neue und verbesserte« Version des Kitsches zu produzieren, dem sie eigentlich entkommen wollten. Die Geschichte der Poetik des Ambientes beruht auf bestimmten Formen der Identität und Subjektivität, die in Kapitel 2 selbst als geschichtliche ausgemacht werden. In Kapitel 3 schließlich stelle ich die Forderung auf, nicht mehr historisierend zu verfahren, sondern damit zu beginnen, Umweltkunst in politische Zusammenhänge zu stellen, was so viel bedeutet, wie uns über ihre Wirkungen aufzuklären. Um das Risiko zu vermeiden, selbst nur eine »neue und verbesserte« Version der Umweltkunst zu formulieren, werde ich nicht vor Paradoxien zurückscheuen. Wenn es zum Beispiel keinen Weg gibt, dem Kitsch zu entkommen, dann besteht die einzige Möglichkeit, ihn zu »schlagen«, darin, mit ihm »gemeinsame Sache« zu machen.
Das »Ding«, das wir Natur nennen, wird in der Romantik und in der Folgezeit ein Heilmittel für die Schäden, die die moderne Gesellschaft verursacht hat.41 Natur gleicht darin dem Ästhetischen, jener anderen Erfindung der Romantik. Durch die Beschädigung, so lautet die Argumentation, habe sich das Subjekt vom Objekt mit der Folge abgesondert, dass die Menschen ihrer Welt auf elende Weise entfremdet sind. Der Kontakt mit der Natur – und mit dem Ästhetischen – würde die Brücke zwischen Subjekt und Objekt reparieren. Das romantische Denken sah in der zerbrochenen Brücke einen beklagenswerten Tatbestand des philosophischen und gesellschaftlichen Lebens. Die Philosophie in der Folge Kants – Schelling in Deutschland, Coleridge in England – erhoffte sich bei vielen Gelegenheiten dieVersöhnung von Subjekt und Objekt. Begegneten diese sich unter den richtigen Umständen, würden sie sich bestens verstehen. Um sich aber zusammenschließen zu können, bedürfen Subjekt und Objekt einer bestimmten Umgebung. So sind die Bereiche von Kunst und Natur entstanden, die neuen säkularen Kirchen, in denen Subjekt und Objekt wieder verheiratet werden können.42
All dies hängt vor allem davon ab, ob Subjekt und Objekt je in einer Beziehung standen; und tatsächlich auch, ob es so etwas wie Subjekt und Objekt überhaupt gibt, was uns zu einer zentralen, von bestimmten Formen utopischer Umweltkunst aufgeworfenen Frage führt. Wenn Subjekt und Objekt nicht wirklich existieren, warum sollte man dann versuchen, sie wieder zusammenzubringen? Und falls sie doch existieren, warum sollte eine Wiedervereinigung des Paars besser sein als der Status quo? Würde diese Vereinigung anders aussehen als der Subjekt-Objekt-Dualismus, der uns so beschäftigt? Wenn die Lösung für den Subjekt-Objekt-Dualismus ähnlich leicht fällt wie eine Meinungsänderung, warum haben dann zahllose Texte, die dergleichen versuchten, nicht bereits zu einer Lösung gefunden? Wenn die Lösung in einer Art Umweltgefühl besteht, um was genau soll es sich dann handeln, wenn es nicht um etwas »herum« ist? Wird dieses Umweltgefühl nicht auch dazu tendieren, entweder einem Subjekt oder einem Objekt zuzufallen?
Es gibt zumindest zwei Arten, diese lästigen Fragen zu betrachten. Die erste prüft die Auffassung, dass wir »unsere Meinung zu ändern« hätten. Anstatt nach einer Lösung für das Subjekt-Objekt-Problem zu suchen, kommt hier eher eine paradoxe Strategie zum Zug. Sie hinterfragt, was an dem Problem selbst problematisch ist. Wenn es genau besehenkein Problem gibt, wenn Realität tatsächlich bar jeder verdinglichten, starren oder konzeptionellen Objekt-Subjekt-Auffassungen ist und wir in einem endlosen Netz wechselseitiger Abhängigkeiten existieren, in dem es keine Begrenzung und kein Zentrum gibt – warum dann das ganze ökokritische Getue? Deshalb wohl, weil dieses Getue ein nicht existentes Jucken durch Kratzen lindert – und es so erst entstehen lässt. In diesem Fall müsste eine echte Kritik auf die (öko-)kritischen Sprachen selbst abzielen – auf die endlose Elegie über einen verlorenen unentfremdeten Zustand, den Rückgriff auf die ästhetische Dimension (empirisch/perzeptiv) anstatt auf eine ethisch-politische Praxis, auf den Ruf nach (häufig antiintellektuellen) »Lösungen« und so fort –, Sprachen, die das Jucken auf subtile Art aufrechterhalten. Der zweite Ansatz besteht in der Frage, ob das Problem vielleicht weniger »in unseren Köpfen« als vielmehr »da draußen«, in der gesellschaftlichen Wirklichkeit, vorliegt. Was, wenn bestimmte Merkmale des gefürchteten Dualismus fest in unserer Welt verdrahtet wären? Hier nimmt dieEcocritique den Dualismus zumindest halb ernst. Sie fasst ihn als Symptom einer Krankheit auf, die nicht nur unseren Köpfen entsprungen wäre, sondern ein weltanschauliches Moment im Funktionieren unserer Welt ist.
Ecocritique