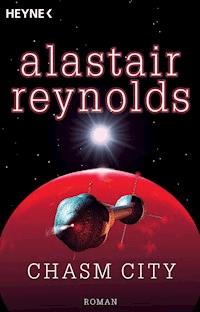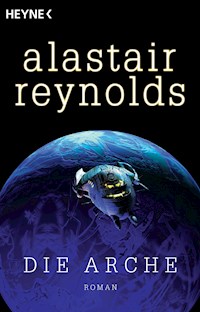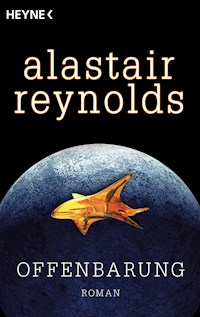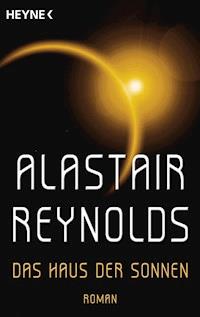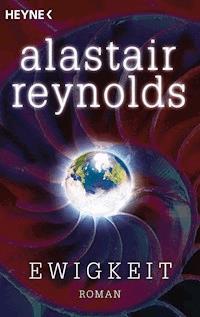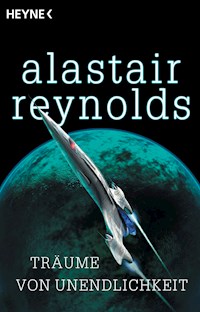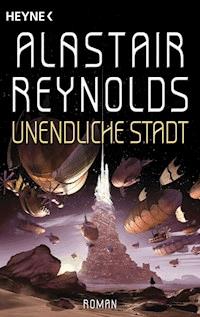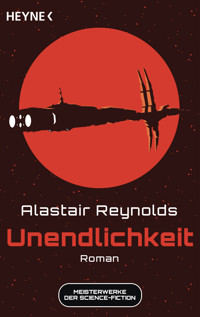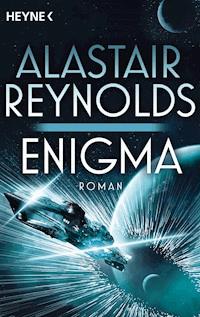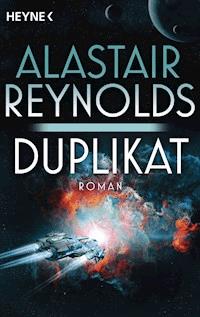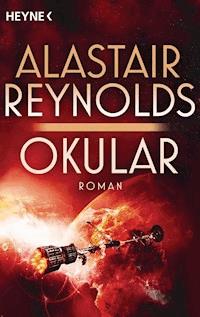
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Poseidons Kinder
- Sprache: Deutsch
Geheimnisvolles Erbe
Zu Beginn des 22. Jahrhunderts sind der Mond und der Mars kolonisiert, und auf der Erde gibt es dank eines engmaschigen Überwachungssystems keine Kriminalität, keinen Krieg und keine Armut mehr – und keine Geheimnisse. So glaubt man zumindest. Doch als Eunice Akinya, eine berühmte Raumfahrerin und die Matriarchin eines mächtigen Familienclans, im Alter von hundertdreißig Jahren stirbt, finden ihre Enkel auf dem Mond einen rätselhaften Safe, dessen Inhalt das Schicksal der gesamten Menschheit für immer verändern wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1056
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Die Erde in der Zukunft: Afrika ist zur Supermacht Nummer eins geworden – ein geradezu paradiesischer Ort, an dem Krieg, Kriminalität und Hungersnöte der Vergangenheit angehören. Es ist die Welt von Geoffrey Akinya, dem Spross eines gewaltigen Familienimperiums, der eigentlich nichts lieber möchte, als in Ruhe im Amboseli-Becken Elefanten zu beobachten. Doch als Geoffreys Großmutter Eunice, eine legendäre Astronautin und Weltraumforscherin, stirbt, hinterlässt sie ihrer Familie ein geheimnisvolles Artefakt auf dem Mond. Ein Artefakt, das den guten Namen der Familie Akinya auf ewig zerstören könnte. Noch während Eunice’ Asche am Fuße des Kilimandscharo verstreut wird, macht sich Geoffrey auf den Weg zum Mond, um das mysteriöse Erbe seiner Großmutter zu bergen. Dort angekommen begreift er, dass seine Großmutter Geheimnisse mit ins Grab genommen hat, die nicht nur die Zukunft Afrikas, sondern die der ganzen Menschheit für immer verändern könnten.
Okular ist der atemberaubende Auftakt einer neuen Trilogie, in der Alastair Reynolds die Geschichte der Familie Akinya erzählt – eine Geschichte, die Hunderttausende von Jahren in die Zukunft und in die Weiten unserer Galaxis hineinreicht.
Der Autor
Alastair Reynolds wurde 1966 im walisischen Barry geboren. Er studierte Astronomie in Newcastle und St. Andrews und arbeitete viele Jahre als Astrophysiker für die Europäische Raumfahrt Agentur ESA, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Er lebt in der Nähe von Leiden in den Niederlanden. Von Alastair Reynolds sind unter anderem im Heyne Verlag erschienen: Unendlichkeit, Himmelssturz und Aurora. Gemeinsam mit Stephen Baxter schreibt Alastair Reynolds gerade an den Medusa-Chroniken.
Mehr über Alastair Reynolds und seine Romane erfahren Sie auf:
Alastair Reynolds
Okular
Roman
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Titel der englischen Originalausgabe
BLUE REMEMBERED EARTH
Deutsche Übersetzung von Irene Holicki
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Übersetzung Zitat: Leonhard Olschner in Moderne englische Lyrik, Englisch/Deutsch, ed. Willi Erzgräber and Ute Knoedgen (Stuttgart: Reclam 1976) S. 325
Deutsche Erstausgabe 10/2016
Redaktion: Ralf Dürr
Copyright © 2012 by Alastair Reynolds
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
Umschlagillustration: Carr Design Studio
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-18522-0V001
www.diezukunft.de
Für Stephen Baxter und Paul McAuley:
Freunde, Kollegen und Hüter der Flamme
»Und ich vermag nicht, einem Wetterwind zu sagen,
wie die Zeit einen Himmel tickte um die Sterne.«
– Dylan Thomas
Es ist unerlässlich, von den Anfängen zu sprechen. Zuvor sei jedoch eines klargestellt. Was immer uns hierhergebracht und zu dieser Schilderung veranlasst hat, ließe sich niemals auf eine einzige Ursache zurückführen. Wenn wir etwas daraus gelernt haben, dann dies, dass das Leben niemals so einfach, niemals so schematisch abläuft.
Man könnte sagen, alles habe in dem Augenblick begonnen, als unsere Großmutter den Entschluss zu ihrer letzten großen Tat fasste. Oder als »Ocular« etwas entdeckte, was Arethusas Aufmerksamkeit erregte, einen rätselhaften Fleck auf einem Planeten, der um einen anderen Stern kreiste. Oder als sich Arethusa ihrerseits moralisch verpflichtet fühlte, unserer Großmutter diese Entdeckung mitzuteilen.
Vielleicht gab auch den Ausschlag, dass Hector und Lucas in der Buchführung der Familie keinen einzigen offenen Posten dulden wollten, auch wenn es sich damals nur um ein belangloses Detail zu handeln schien. Oder dass Geoffrey mit der Nachricht vom Tod unserer Großmutter vom Himmel geholt wurde und sich gezwungen sah, seine Arbeit mit den Elefanten zu unterbrechen und zum Stammsitz der Familie zurückzukehren. Oder sein Entschluss, Sunday alles zu gestehen, und ihre Entscheidung, ihren Bruder nicht mit Verachtung zu strafen, sondern lieber den Weg der Vergebung zu gehen.
Man könnte sogar sagen, alles hätte in dem Moment vor anderthalb Jahrhunderten begonnen, als ein Baby namens Eunice Akinya im ehemaligen Tansania seinen ersten mühsamen Atemzug tat. Oder als sie einen Herzschlag danach mit ihrem ersten lauten Schrei ein Leben voller Ungeduld ankündigte. Für unsere Großmutter drehte sich die Welt niemals schnell genug. Sie schaute so lange über die Schulter und forderte sie auf, sich zu beeilen, bis die Welt sie eines Tages beim Wort nahm.
Doch auch Eunice wurde geprägt. Mag sein, dass sie mit ihrem Zorn geboren wurde, doch erst als ihre Mutter sie in der Stille einer Serengeti-Nacht unter dem wolkenlosen Himmel im Schein der Milchstraße in den Armen hielt, fing sie an, nach etwas zu greifen, was für immer unerreichbar war.
Alle diese Sterne, Eunice. Diese winzigen Diamantenlichter. Du kannst sie haben, du musst es bloß stark genug wollen. Doch anfangs musst du geduldig und später musst du weise sein.
Und das war sie. Unendlich geduldig und unendlich weise. Doch wenn die Mutter Eunice prägte, wer prägte die Mutter? Soya kam vor zweihundert Jahren in einem Flüchtlingslager zur Welt, zu einer Zeit, als es noch Hungersnöte und Kriege gab, Dürren und Völkermorde. Woher nahm sie die Kraft, der Welt diese Naturgewalt zu schenken, dieses Kind, das unsere Großmutter werden sollte?
Damals wussten wir davon natürlich nichts. Eunice war, wenn wir überhaupt an sie dachten, eine kalte, unnahbare Gestalt. Keiner von uns hatte sie je berührt oder persönlich mit ihr gesprochen. Sie lebte ganz allein in ihrem selbst errichteten Metallgefängnis voller Dschungelpflanzen, das in eisiger Kälte den Mond umkreiste. Wenn sie von dort auf uns herabschaute, schien sie in ein anderes Jahrhundert zu gehören. Sie hatte Großartiges geleistet – hatte ihre eigene Welt verändert und auf anderen Welten unauslöschliche menschliche Spuren hinterlassen –, doch all das waren die Taten einer viel jüngeren Frau gewesen, die nur entfernt mit unserer fernen, immer gereizten und gleichgültigen Großmutter verwandt war. Als wir geboren wurden, hatte sie ihre glänzendsten und besten Zeiten längst hinter sich.
Jedenfalls dachten wir das.
Prolog
Es war Ende Mai, die lange Regenzeit ging zu Ende. Die Erde hatte sich Wasser von den Wolken geliehen, nun trieb der Himmel mit endlosen Tagen voller Hitze und Trockenheit die Schulden ein. Für die Kinder war es eine Erlösung. Nachdem sie sich wochenlang im Haus gelangweilt hatten, durften sie endlich wieder ins Freie und konnten außerhalb der Gärten und jenseits der Mauern durch die Wildnis streifen.
Dort stießen sie auf die Todesmaschine.
»Ich höre immer noch nichts«, sagte Geoffrey.
Sunday seufzte und legte ihrem Bruder eine Hand auf die Schulter. Sie war zwei Jahre älter als Geoffrey und ziemlich groß für ihr Alter. Die beiden standen auf einem rechteckigen Felsen, mehrere Schritte vom Fluss entfernt, der immer noch viel schlammiges Wasser führte.
»Da«, rief sie. »Jetzt musst du ihn doch hören!«
Geoffrey umklammerte das hölzerne Flugzeug, das er mitgebracht hatte.
»Nein«, sagte er. Er hörte nur den Fluss und das leise, schläfrige Rauschen der Akazien, die unter der Ofenhitze schmachteten.
»Er steckt in Schwierigkeiten«, sagte Sunday entschlossen. »Wir müssen ihn suchen, dann sagen wir Memphis Bescheid.«
»Vielleicht sollten wir zuerst Memphis Bescheid geben und erst dann nach ihm suchen.«
»Und wenn er inzwischen ertrinkt?«
Das hielt Geoffrey für unwahrscheinlich. Das Wasser stand nicht mehr so hoch wie noch vor einer Woche, die Regenzeit näherte sich dem Ende. Noch drängten sich dunkle Wolken am Horizont, manchmal rollte der Donner über die Ebenen, doch über ihnen war der Himmel klar.
Außerdem waren sie diesen Weg schon oft gegangen. Hier gab es keine Häuser und erst recht keine Dörfer oder Städte. Die Pfade, denen sie folgten, waren eher von Elefanten als von Menschen ausgetreten worden. Und sollten zufällig doch Massai in der Nähe sein, dann wäre bestimmt keiner von deren Jungen in Bedrängnis geraten.
»Könnten es die Dinger in deinem Kopf sein?«, fragte Geoffrey.
»An die habe ich mich inzwischen gewöhnt.« Sunday hüpfte von dem Stein und deutete auf die Bäume. »Ich glaube, es kommt von dort.« Sie marschierte los, dann drehte sie sich zu Geoffrey um. »Du brauchst nicht mitzukommen, wenn du Angst hast.«
»Ich habe keine Angst.«
Vorsichtig überquerten sie das Gelände. Der Boden trocknete bereits, aber es gab noch sumpfige Stellen. Zum Schutz vor Schlangen trugen sie hohe Stiefel und dicke lange Hosen, dazu Hemden mit kurzen Ärmeln und Hüte mit breiter Krempe. Obwohl sie durch den Schlamm stapften und sich durchs Unterholz kämpften, blieben ihre Kleider so leuchtend bunt, wie sie sie am Morgen angezogen hatten. Von Geoffreys Armen konnte man das nicht behaupten. Sie waren voller Schlammflecken, und die Büsche mit den spitzen Dornen hatten feine, schmerzhafte Kratzer hinterlassen. Er hatte nicht vergessen, wie Memphis ihn einmal gelobt hatte, als er nach einem Sturz auf den harten Marmorboden des Familiensitzes nicht geweint hatte, und deshalb bewusst darauf verzichtet, mit einem Befehl an sein Armband den Schmerz zu unterdrücken.
Sunday verschwand zielstrebig zwischen den Akazien, und Geoffrey eilte hastig hinterher. Sie kamen am schmutzig weißen Sockel einer alten Windmühle vorbei.
»Gleich sind wir da«, rief Sunday und sah sich nach ihm um. Ihr Hut hüpfte, von der Kinnschnur gehalten, auf ihrem Rücken munter auf und ab. Geoffrey drückte sich seinen eigenen Hut fester auf die krausen Locken.
»Uns kann nichts passieren«, sagte er, mehr zu sich selbst. »Der Mechanismus passt auf uns auf.«
Was sich hinter den Bäumen befand, wusste er nicht. Sie waren zwar schon oft in dieser Gegend gewesen, aber deshalb kannten sie noch lange nicht jeden Busch, jeden Hügel und jede Senke.
»Hier ist etwas!«, rief Sunday. Geoffrey konnte sie nicht mehr sehen. »Der Regen hat den ganzen Hang weggespült, eine richtige Schlammlawine! Jetzt ragt etwas aus der Erde!«
»Sei vorsichtig!«, rief Geoffrey.
»Es ist eine Maschine«, rief sie zurück. »Ich glaube, der Junge ist darin eingeklemmt.«
Geoffrey nahm seinen ganzen Mut zusammen und stapfte weiter. Die träge schwankenden Äste bildeten ein Gitter vor dem Himmel, der mit eisvogelblauen Splittern die Lücken füllte. Einen oder zwei Meter links von ihm raschelte etwas im trockenen Laub. Das dichter werdende Gestrüpp krallte sich in seine Hosenbeine. Ein Riss entstand, und Geoffrey beobachtete mit mattem Staunen, wie sich die Stoffränder wieder zusammenfügten.
»Hier«, rief Sunday. »Komm schnell, Bruder!«
Nun konnte er sie sehen. Sie waren am Rand einer schüsselförmigen Senke herausgekommen, die von dichten Bäumen umstanden war. Ein Stück der Schüsselwand war weggebrochen und hatte eine steile Rinne hinterlassen.
Dort ragte etwas aus der gelblich-braunen Erde, ein Kasten aus Metall, etwa so groß wie ein Airpod.
Geoffrey warf abermals einen Blick zum Himmel.
»Was ist das?«, fragte er, obwohl er bereits eine schreckliche Vorahnung hatte. Er hatte solch ein Ding in einem seiner Bücher gesehen. Er erkannte es an den vielen kleinen Rädern an der frei liegenden Seite, viel zu viele für einen Personen- oder Lastwagen. Und die Räder liefen in Raupenketten aus Metallplatten, die durch Gelenke miteinander verbunden waren wie die Segmente eines Wurms.
»Willst du behaupten, du weißt das nicht?«, fragte Sunday.
»Es ist ein Panzer«, antwortete er. Das Wort war ihm plötzlich wieder eingefallen. Trotz seiner Angst und obwohl er lieber irgendwo anders gewesen wäre, fand er es faszinierend, was die Erde da ausgespuckt hatte.
»Was sollte es wohl sonst sein? Der kleine Junge ist wohl irgendwie hineingeklettert, und nun kommt er nicht mehr heraus.«
»Es gibt keine Tür.«
»Der Panzer muss sich bewegt haben«, überlegte Sunday. »Deshalb kann er nicht heraus – die Tür ist wieder im Schlamm versunken.« Sie ging jetzt dicht an der Kante entlang, aber noch auf dem Gras auf die Stelle zu, wo der Hang nachgegeben hatte. Dort kauerte sie sich nieder und stützte sich mit den Fingerspitzen auf den Boden. Ihr Hut hüpfte zwischen ihren Schultern hin und her.
»Wie kannst du ihn hören, wenn er drinnen ist?«, fragte Geoffrey. »Wir sind jetzt ganz nahe, und ich höre immer noch nichts! Die Stimme muss in deinem Kopf sein, und sie muss mit den Maschinen zu tun haben.«
»So ist das nicht, Bruder. Man hört nicht einfach Stimmen.« Sunday hatte sich umgedreht, sodass sie mit dem Gesicht zum Hang schaute, setzte die Füße in den Schlamm und hielt sich mit den Händen fest. Dann machte sie sich an den Abstieg.
Geoffrey wusste nicht, was er tun sollte, und schickte sich an, ihr zu folgen.
»Wir müssen jemanden zu Hilfe rufen. Es heißt doch immer, wir sollen keine alten Sachen anfassen.«
»Wir sollen so vieles nicht tun«, gab Sunday zurück.
Sie setzte den Abstieg fort. Einmal rutschte sie aus, fing sich aber wieder. Ihre Stiefel gruben tiefe Furchen in das freiliegende Erdreich. Ihre Hände waren voller Lehm. Sie drehte den Kopf, um über die linke Schulter zu schauen. Ihr Gesichtsausdruck verriet äußerste Konzentration.
»Das geht nicht gut«, klagte Geoffrey. Er ließ sich an der gleichen Stelle hinunter und versuchte, möglichst ihren Hand- und Fußspuren zu folgen.
»Wir sind hier!«, rief Sunday mit einem Mal und setzte einen Fuß auf die schräge Seitenwand des Panzers. »Wir wollen dich retten!«
»Was sagt er?«
Zum ersten Mal nahm sie ihn ernst. »Du kannst ihn immer noch nicht hören?«
»Ich mache dir nichts vor, Schwester.«
»Er sagt: ›Bitte beeilt euch. Ich brauche eure Hilfe.‹«
»Auf Suaheli?« Eine durchaus vernünftige Frage.
»Ja«, antwortete Sunday prompt. Dann überlegte sie. »Ich denke schon. Warum sollte er nicht Suaheli sprechen?«
Sie stand nun mit beiden Füßen auf dem Panzer und machte, achtsam wie ein Seiltänzer, einen Schritt nach rechts. Geoffrey hielt inne. Er wagte kaum zu atmen, um keine Erschütterung auszulösen. Wenn der Panzer im Schlamm weiterrutschte, würden sie beide mit auf den Grund des Lochs gerissen werden.
»Sagt er es immer noch?«
»Ja«, antwortete Sunday.
»Du bist ihm so nahe, eigentlich müsste er dich inzwischen gehört haben.«
Sunday breitete beide Arme aus und ging in die Knie. Dann klopfte sie einmal, zweimal an die Wand des Panzers. Geoffrey holte tief Luft und setzte den Abstieg zaghaft fort. Das Holzflugzeug hielt er auch weiterhin mit einer Hand hoch über dem Kopf.
»Er antwortet nicht. Wiederholt nur immer das Gleiche.« Sunday griff mit einer Hand über die Schulter und setzte sich den Hut wieder auf. »Ich habe Kopfschmerzen. Es ist zu heiß.« Sie schlug ein weiteres Mal gegen die Panzerwand, diesmal stärker. »Hallo!«
»Sieh nur«, sagte Geoffrey.
Etwas Merkwürdiges war geschehen. Rings um die Stelle, wo Sunday auf den Panzer geschlagen hatte, rasten farbige Wellen nach außen: rosa und grün, blau und golden. Die Wellen verschwanden im Erdreich und kehrten als feste Farbblöcke zurück, die sich wie Tintenkleckse ausbreiteten, ohne sich zu vermischen. Die Farben flackerten und pulsierten und passten sich schließlich der Farbe des rötlichen Schlamms an.
»Wir sollten jetzt gehen«, mahnte Geoffrey.
»Wir können ihn nicht im Stich lassen.« Dennoch stand Sunday auf. Geoffrey kletterte nicht mehr weiter. Ein Glück, dass seine Schwester endlich Vernunft annahm. Er unternahm den wackeren Versuch, sich vorzubeugen, um ihr die Hand zu reichen, wenn sie nahe genug heran war.
Doch Sunday benahm sich auf einmal sehr merkwürdig. »Tut weh«, nuschelte sie und fasste sich an die Stirn.
»Komm hier rauf«, drängte Geoffrey. »Lass uns nach Hause gehen.«
Sunday balancierte immer noch auf der schrägen Seitenwand des Panzers und sah ihn an. Kleine, aber rasend schnelle Bewegungen schüttelten ihren Körper. Sie versuchte vergeblich, etwas zu sagen.
»Sunday!«
Sie kippte nach hinten, fiel hangabwärts auf die Erde und rollte mit Armen und Beinen strampelnd nach unten. Ihr Hut hüpfte wild auf und ab. Auf dem Grund des Loches, wo das Wasser stand, kam sie, Arme und Beine weit von sich gestreckt, mit dem Gesicht im Schlamm zu liegen.
Zunächst war Geoffrey starr vor Schreck. Dann überlegte er, ob sie sich wohl etwas gebrochen hätte. Und schließlich kam ihm die vage Erkenntnis, dass seine Schwester womöglich nicht atmen konnte.
Er kroch zur Seite über den Rand des Erdrutsches und tastete sich bis dahin, wo der Boden noch fest und mit Gras und Büschen bewachsen war. Dort brachte er so viel Geistesgegenwart auf, dass er sich sein Armband an den Mund hielt und auf den dicken Knopf drückte, um mit dem Familiensitz zu sprechen.
»Bitte!«
Memphis meldete sich rasch. Der Junge hörte seine tiefe, klangvolle, bedächtige Stimme. »Was gibt es, Geoffrey?«
Die Worte sprudelten nur so aus ihm heraus. »Bitte, Memphis. Sunday und ich waren draußen unterwegs und haben dieses Loch im Boden gefunden. Der Regen hat die Erde abrutschen lassen. Da ragt ein Panzer heraus.« Er hielt inne, um Atem zu holen. »Sunday wollte dem Jungen helfen, der in dem Panzer war. Aber dann hat sie Kopfschmerzen bekommen und ist hinuntergefallen. Jetzt liegt sie auf dem Boden, und ich kann ihr Gesicht nicht sehen.«
»Einen Moment, Geoffrey.« Memphis hörte sich unglaublich ruhig an. Er schien so wenig überrascht, als hätte er etwas Derartiges am heutigen Tag mehr oder weniger erwartet. »Ja, ich sehe, wo ihr seid. Geh zu deiner Schwester und drehe sie so, dass sie nicht mehr auf dem Gesicht, sondern auf der Seite liegt. Aber pass beim Hinunterklettern sehr gut auf. Ich bin gleich bei euch.«
Memphis’ nüchterne Anweisungen nahmen Geoffrey viel von seiner Angst. Zwar kam es ihm vor wie eine Ewigkeit, doch schließlich berührten seine Stiefel den nassen Grund des Loches, und er konnte mit schmatzenden Schritten auf seine Schwester zugehen.
Ihr Gesicht lag nicht im Wasser, sondern hatte sich in einen etwas erhöhten Flecken trockener Erde eingedrückt. Mund und Nase waren frei, doch sie zitterte immer noch, und zwischen ihren Lippen quoll blasiger Schaum hervor.
Über Geoffrey schwirrte etwas durch die Luft. Er klappte die Krempe seines Huts hoch. Das Summen kam von einer Maschine nicht größer als die Spitze seines Daumens.
»Ich habe euch gefunden«, ließ sich Memphis aus Geoffreys Armband vernehmen. »Du tust jetzt genau, was ich dir sage. Drehe deine Schwester auf den Rücken. Du musst sehr stark sein.«
Geoffrey kniete nieder. Solange Sunday zitterte und Schaum vor dem Mund hatte, wollte er sie lieber nicht allzu genau ansehen.
»Sei ein tapferer Junge, Geoffrey. Deine Schwester hat einen Krampfanfall. Du musst ihr helfen.«
Er stellte das rote Holzflugzeug auf den Boden, ohne Rücksicht darauf, dass es Schlammflecken bekam. Dann schob er die Hände unter Sundays Körper und versuchte sie anzuheben. Ihre heftigen Zuckungen machten ihm Angst.
»Nimm deine ganze Kraft zusammen, Geoffrey. Ich kann dir erst helfen, wenn ich bei euch bin.«
Geoffrey ächzte vor Anstrengung. Vielleicht kamen ihm Sundays Krämpfe zu Hilfe, jedenfalls löste sie sich endlich mit einem Ruck aus dem Schlamm und lag nicht mehr mit dem Gesicht nach unten.
»Geoffrey, hör mir genau zu. Ich weiß nicht, warum, aber mit Sundays Kopf stimmt irgendetwas nicht, und ihr Armband funktioniert nicht richtig. Du musst ihm sagen, was es tun soll. Hörst du mich?«
»Ja.«
»Siehst du die zwei roten Knöpfe, einer auf jeder Seite? Du musst sie beide gleichzeitig drücken.«
Sein Armband sah genauso aus wie das ihre, nur die roten Knöpfe fehlten. Sunday hatte diese Knöpfe erst nach ihrem zehnten Geburtstag bekommen, sie hatten also wohl etwas mit den Maschinen zu tun, die ihr die Neuropraktiker in den Kopf eingesetzt hatten. Er hatte solche Maschinen noch nicht.
Er hob ihren Arm an, konnte ihn aber nur mit Mühe ruhig halten. Nun versuchte er, mit Daumen und Zeigefinger das Armband zu umfassen. Es fiel ihm schwer. Seine Hand war nicht groß genug.
»Was passiert jetzt, Memphis?«
»Nichts Schlimmes.«
Die blauen Knöpfe an seinem Armband waren viel leichter zu drücken als diese roten. Er geriet in Panik, bis er erkannte, dass er beide Hände einsetzen musste. Auch dann gelang es nicht gleich. Er hatte wohl nicht fest genug gedrückt, denn es geschah nichts. Er versuchte es noch einmal mit aller Kraft, und plötzlich, es war wie ein Wunder, hörte Sunday zu zucken auf.
Nun lag sie regungslos da.
Geoffrey setzte sich neben sie und wartete. Er konnte sehen, dass sie atmete. Ihre Augen waren jetzt geschlossen. Sie wirkte nicht so lebendig wie vorhin, als sie auf dem Panzer gestanden und ihn angesehen hatte, dennoch hatte er das unweigerliche Gefühl, seine Schwester sei zurückgekehrt.
Er legte ihr die Hand auf die Stirn. Sie war glühend heiß. Er richtete den Blick zum Himmel.
Wenig später war Memphis zur Stelle. Er schwebte mit dem Airpod über der Senke und schaute herab, dann flog er eine Kurve und verschwand hinter den Bäumen, die die Senke umstanden. Das Airpod war so leise, dass Geoffrey die Ohren spitzen musste, um sein schwächer werdendes Motorengeräusch zu hören, als es nach unten sank.
Etwa eine Minute später erschien Memphis leibhaftig am oberen Rand der Mulde. Nach kurzem Zögern kam er, halb rutschend, halb laufend und mit weit ausgebreiteten Armen, um das Gleichgewicht zu halten, den Hang herab. Als er Sunday erreichte, legte er ihr die Hand auf die Stirn und nahm sich dann ihr Armband vor.
Geoffrey beobachtete ihn ängstlich. »Wird sie wieder gesund?«
»Ich denke schon, Geoffrey. Das hast du sehr gut gemacht.« Memphis schaute zum Panzer zurück, als sähe er ihn zum ersten Mal. »Wie nahe ist sie ihm gekommen?«
»Sie hat darauf gestanden.«
»Es ist eine böse Maschine«, erklärte Memphis. »Hier hat einmal ein Krieg stattgefunden, einer der letzten in Afrika.«
»Sunday hat gesagt, in dem Panzer wäre ein kleiner Junge.«
Memphis hob das Mädchen vom Boden auf und wiegte es in seinen Armen. »Schaffst du es, allein hinaufzuklettern, Geoffrey?«
»Ich glaube schon.«
»Wir müssen Sunday zum Familiensitz zurückbringen. Es wird alles gut, aber je schneller sie zu einem Neuropraktiker kommt, desto besser.«
Geoffrey eilte voraus, fest entschlossen, Memphis zu beweisen, dass er selbst auf sich aufpassen konnte. »Und was ist mit dem kleinen Jungen?«
»Den gibt es nicht. In dem Panzer sind nur Maschinen, und einige davon sind sehr klug.«
»Das ist nicht der erste Panzer, den du siehst?«
»Nein«, sagte Memphis zurückhaltend. »Der erste ist es nicht. Aber als ich das letzte Mal einen fahren sah, war ich noch sehr klein.« Geoffrey schaute zurück und sah Memphis’ Lächeln aufblitzen. Offensichtlich wollte er verhindern, dass Geoffrey Albträume von Tötungsmaschinen bekam, die die Erde unsicher machten. »Inzwischen gibt es nur noch ganz wenige, und die sind wie der hier in der Erde vergraben.«
Jetzt waren sie beide auf dem Weg nach oben. »Wie konnte er entkommen?«
Memphis blieb stehen, um Atem zu holen. Es war sicher nicht leicht, mit Sunday auf den Armen das Gleichgewicht nicht zu verlieren. »Das Artilekt hat die Maschinen in Sundays Kopf entdeckt. Dann hat es herausgefunden, wie es mit ihnen sprechen und wie es Sunday vorgaukeln konnte, dass jemand nach ihr rief.«
Die Vorstellung, dass eine Maschine seine Schwester getäuscht hatte – und zwar so geschickt, dass sie beinahe auch ihn selbst überzeugt hätte –, jagte Geoffrey kalte Schauer über den Rücken, obwohl er sich schwitzend bergan kämpfte.
»Was wäre passiert, wenn sie nicht gestürzt wäre?«
»Vielleicht hätte sich der Panzer bemüht, sie zu überreden, dass sie ihm half. Oder er hätte versucht, eine verborgene Schwäche auszunützen. Wie auch immer, er war schuld daran, dass deine Schwester in Krämpfe fiel.«
»Aber der Panzer ist sehr alt, und Sundays Maschinen sind noch ganz neu. Wie konnte er sie täuschen?«
»Sehr alte Dinge sind manchmal klüger als sehr neue Dinge. Oder zumindest gerissener.« Während sie miteinander sprachen, waren sie unentwegt weiter hinaufgestiegen und hatten die Oberkante des Hangs beinahe erreicht. »Deshalb sind sie verboten oder werden zumindest sehr sorgfältig kontrolliert.«
Geoffrey schaute sich nach dem halb vergrabenen Koloss um. Der Anblick erfüllte ihn mit einer seltsamen Mischung aus Angst und Mitleid. »Was wird nun aus dem Panzer?«
»Jemand wird sich darum kümmern«, sagte Memphis freundlich. »Für uns hat deine Schwester jetzt Vorrang vor allem anderen.«
Sie waren auf festem Boden angelangt. Ein schmaler Pfad schlängelte sich durch die Bäume. Geoffrey hatte ihn auf dem Weg hierher nicht bemerkt, aber aus der Luft war er wohl deutlich zu erkennen gewesen. An seinem Ende wartete, noch außer Sicht, das Airpod.
»Wird sie wieder gesund?«
»Ich glaube nicht, dass ein größerer Schaden entstanden ist. Es war gut, dass du da warst und die Maschinen abschalten konntest. Ach je.« Memphis war unvermittelt stehen geblieben.
Geoffrey trat neben ihn. »Ist etwas mit Sunday?«
»Nein«, sagte der dünne Mann, immer noch ohne die Stimme zu erheben. »Es ist Mephisto. Er ist vor uns auf dem Pfad. Kannst du ihn sehen?«
Im Halbdunkel unter den Baumkronen versperrte ihnen eine riesige, mit Sonnenflecken gesprenkelte Gestalt den Weg. Der Elefant wühlte mit seinem Rüssel im Staub. Er hatte nur einen Stoßzahn, der andere war abgebrochen. Seine Streitlust war an seiner Haltung deutlich abzulesen. Die Stirn war zum Rammbock gesenkt.
»Mephisto ist ein alter Bulle«, sagte Memphis. »Er ist sehr aggressiv und hütet eifersüchtig sein Revier. Ich hatte ihn schon aus der Luft bemerkt, aber es sah so aus, als wäre er in die andere Richtung unterwegs, und deshalb hoffte ich, heute nicht mit ihm zusammenzutreffen.«
Geoffrey war verwirrt und erschrocken. Er war schon oft Elefanten begegnet, aber diese Unsicherheit bei seinem Mentor war ihm neu.
»Wir könnten um ihn herumgehen«, schlug er vor.
»Das wird Mephisto nicht zulassen. Er kennt die Gegend viel besser als wir, und er ist schneller, vor allem, wenn ich Sunday tragen muss.«
»Warum will er uns nicht vorbeilassen?«
»Er ist nicht ganz richtig im Kopf.« Memphis hielt inne. »Geoffrey, bitte sieh jetzt nicht hin. Ich muss etwas tun, was ich gern vermieden hätte.«
»Was hast du vor?«
»Schau weg und schließ die Augen.«
Das war ein strenger Befehl, und Geoffrey gehorchte. Nur das Rascheln des Laubs unterbrach die Stille. Dann gab es einen dumpfen Schlag, Staub wirbelte auf, und brechende Äste und umknickende Baumstämme erzeugten eine Salve von trockenen Knacklauten.
»Halte dich an meiner Jacke fest und folge mir«, wies ihn Memphis an. »Du darfst die Augen erst wieder aufmachen, wenn ich es dir sage. Versprichst du mir das?«
»Ja«, sagte Geoffrey.
Doch er hielt sein Wort nicht. Als sie in den kühlen Schatten der Bäume traten, schlug Memphis einen Bogen um ein Hindernis und zog Geoffrey mit sich. Der Junge öffnete die Augen und spähte durch den Staub, der noch in der Luft hing. Mephisto lag auf der Seite, ein Auge war zu sehen. Es stand offen, aber es war kein Leben darin. Die riesige graue Gestalt mit der runzligen Haut war vollkommen reglos. Der Bulle war tot.
»Hast du Mephisto getötet?«, fragte Geoffrey, als sie das Airpod erreicht hatten.
Memphis öffnete schweigend die hintere Tür und legte Sunday vorsichtig auf den gepolsterten Sitz. Er schwieg auch weiter, als sie aufstiegen und zum Familiensitz zurückflogen. Memphis weiß Bescheid, dachte Geoffrey. Memphis wusste, dass Geoffrey hingesehen hatte und dass zwischen ihnen nichts mehr so sein würde wie früher.
Erst später fiel ihm ein, dass er das rote Holzflugzeug unten im Loch gelassen hatte.
ERSTER TEIL
1
Als der Anruf einging, war er auf dem Weg vom Rand des Beobachtungsgebiets zurück zur Forschungsstation. Er flog allein in der Cessna durch den weiten Himmel über dem Amboseli-Becken und war in so gelöster Stimmung wie seit Wochen nicht mehr.
»Geoffrey«, sagte eine Stimme in seinem Kopf. »Du musst sofort zum Familiensitz kommen.«
Geoffrey seufzte. Er hätte wissen müssen, dass diese Unbeschwertheit nicht von Dauer sein konnte.
Zehn Minuten später war er über dem Anwesen und suchte die Gebäude mit den weißen Mauern und den blauen Fliesen nach verdächtigen Spuren ab. Ihm fiel nichts Ungewöhnliches auf. Die A-förmige Anlage präsentierte sich von den lauschigen Innenhöfen und Gärten bis hin zu den Schwimmbecken, den Tennisplätzen und dem Polofeld so sauber und ordentlich wie ein Architektenmodell.
Geoffrey schwenkte auf die Piste ein, die ihm als Start- und Landebahn diente, und setzte die Cessna auf. Es holperte ein paarmal, die dicken Reifen wirbelten Staub und Erde auf. Er bremste hart und rollte zu einem freien Platz am Ende der Reihe von Airpods, die zum Familiensitz und seinen Gästen gehörten.
Nachdem er den Motor abgeschaltet hatte, blieb er ein paar Minuten im Cockpit sitzen, um seine Gedanken zu sammeln.
Tief im Inneren wusste er bereits, was geschehen war. Dieser Tag stand schon so lange bevor, dass er zu einem festen Bestandteil seiner Zukunftslandschaft geworden war. Was ihn überraschte, war nur, dass er nun endlich da war.
Beim Aussteigen schlug ihm die morgendliche Hitze entgegen. Das Flugzeug summte beim Abkühlen leise vor sich hin. Geoffrey nahm die verblichene alte Basecap mit der Aufschrift Cessna ab und fächelte sich damit das Gesicht.
Eine Gestalt trat aus dem Pförtnerhaus hinter dem Torbogen in der Mauer und kam mit hängenden Schultern und ernster Miene gemessenen Schrittes auf Geoffrey zu.
»Es tut mir sehr leid.« Der Mann hatte erst gesprochen, als sie einander so nahe waren, dass er die Stimme kaum noch zu erheben brauchte.
»Es ist Eunice, nicht wahr?«
»Sie ist leider von uns gegangen.«
Geoffrey suchte krampfhaft nach Worten. »Wann ist es geschehen?«
»Dem medizinischen Bericht zufolge vor sechs Stunden. Aber die Meldung kam erst vor einer Stunde. Seither bin ich damit beschäftigt, mir Gewissheit zu verschaffen und die nächsten Angehörigen zu benachrichtigen.«
»Und wie ist es passiert?«
»Sie ist friedlich eingeschlafen.«
»Ich finde, hundertdreißig ist ein ehrwürdiges Alter.«
»Hunderteinunddreißig seit dem letzten Geburtstag«, verbesserte Memphis ohne Vorwurf in der Stimme. »Du hast recht, es ist ein ehrwürdiges Alter. Vielleicht hätte sie sogar noch länger gelebt, wenn sie zur Erde zurückgekehrt wäre. Sie hatte jedoch andere Vorstellungen. Ganz alleine da oben, nur mit ihren Maschinen zur Gesellschaft … ein Wunder, dass sie so lange durchgehalten hat. Aber ihr Akinyas seid wie die Löwen, wie sie zu sagen pflegte.«
Oder wie die Geier, dachte Geoffrey. Laut fragte er: »Was geschieht jetzt?«
Memphis legte ihm einen Arm um die Schultern und schob ihn auf das Pförtnerhaus zu. »Du bist der Erste, der auf dem Familiensitz eintrifft. Ein paar von den anderen werden in Kürze chingen. Im Laufe des Tages werden einige leibhaftig anreisen. Bei denen, die sich im Weltraum aufhalten … wird es viel länger dauern, falls sie überhaupt kommen können. Das wird nicht bei allen möglich sein.«
Sie traten in den Schutz des Torbogens. Die weiß getünchten Wände des Pförtnerhauses warfen kühle indigoblaue Schatten.
»Ich finde es merkwürdig, dass wir hier zusammenkommen, obwohl das nicht der Ort ist, an dem sie gestorben ist.«
»Eunice hat entsprechende Anweisungen hinterlassen.«
»Davon hat mir niemand etwas erzählt.«
»Ich habe selbst eben erst davon erfahren, Geoffrey. Hätte ich es früher gewusst, hätte ich es dir mitgeteilt.«
Hinter dem Pförtnerhaus plätscherten die Fontänen in den Zierteichen. Geoffrey scheuchte einen Gartenroboter von der Größe eines Gürteltiers beiseite. »Ich weiß, dass dieser Todesfall für dich nicht weniger schmerzlich ist wie für die Angehörigen, Memphis.«
»Der Übergang könnte schwierig werden. Die Familie … das Unternehmen … man wird sich daran gewöhnen müssen, dass die Leitfigur nicht mehr da ist.«
»Mich betrifft das zum Glück nicht weiter.«
»Das glaubst du vielleicht. Doch du bist und bleibst ein Akinya, auch wenn du etwas abseits stehst. Das gilt übrigens auch für deine Schwester.«
Geoffrey sagte nichts mehr, bis sie in der großzügigen Empfangshalle im linken Flügel des Familiensitzes standen. Hier war es so still wie in einer Krypta und so ungemütlich wie in einem Museum. Im schräg einfallenden Sonnenlicht hüteten Glasvitrinen die Vergangenheit seiner berühmten Großmutter wie kleine Altäre zu ihren Ehren. Teile von Raumanzügen, Gesteins- und Eisproben aus dem ganzen Sonnensystem, sogar ein antiquierter Computer, ein ehemals aufklappbarer grauer Kasten, der jetzt mit schwarz-gelbem Klebeband zusammengehalten wurde. Gedruckte Bücher mit verstaubten, verblichenen Einbänden. Ein trauriges Sortiment von lieblos entsorgtem Kinderspielzeug.
»Dir ist wahrscheinlich nicht klar, wie wenig sich für Sunday und mich dadurch ändern wird«, nahm Geoffrey den Faden wieder auf. »Nachdem wir einmal vom rechten Weg abgewichen waren, hatte Eunice kein größeres Interesse mehr an uns beiden.«
»Was Sunday betrifft, irrst du dich sehr. Eunice hat ihr viel bedeutet.«
Geoffrey verzichtete darauf, Memphis mit weiteren Fragen dazu zu bedrängen. »Wissen meine Mutter und mein Vater Bescheid?«
»Sie sind noch auf Titan, zu Besuch bei deinem Onkel Edison.«
Geoffreys Miene hellte sich auf. »Wie könnte ich das vergessen?«
»Wir können erst in zwei Stunden damit rechnen, von ihnen zu hören. Wahrscheinlich noch später, wenn sie beschäftigt sind.«
Sie hatten das Büro im Erdgeschoss erreicht, wo Memphis sich fast immer aufhielt. Von diesem Raum aus, der nicht viel größer war als eine halbwegs geräumige Besenkammer, verwaltete er das Anwesen der Familie – und damit auch ein Firmenimperium mit Niederlassungen im gesamten Sonnensystem.
»Kann ich irgendetwas tun?«, fragte Geoffrey. Er hatte das unbehagliche Gefühl, irgendeine Rolle übernehmen zu müssen, von der ihm niemand etwas gesagt hatte.
»Im Augenblick nicht. Zu gegebener Zeit werde ich zum Winterpalast hinauffliegen, aber darum werde ich mich alleine kümmern.«
»Um ihren Leichnam zu holen?«
Memphis nickte kurz. »Sie wollte, dass ihre sterblichen Überreste in Afrika verstreut werden.«
»Ich könnte dich begleiten.«
»Das ist gut gemeint, Geoffrey, aber noch bin ich nicht zu alt für einen Weltraumflug. Und du hast mit deinen Elefanten sicher viel zu tun.« Er blieb vor der Tür zu seinem Büro stehen, und Geoffrey merkte ihm an, dass er es kaum erwarten konnte, an seine Arbeit zurückzukehren. »Es ist schön, dass du gekommen bist. Wenn du einen Tag bleiben könntest, wäre das noch besser.«
»Ich fühle mich wie das fünfte Rad am Wagen.«
»Sei einfach für den Rest der Familie da. Jeder sollte sich bemühen, den anderen Kraft zu geben.«
Geoffrey lächelte skeptisch. »Gilt das auch für Hector und Lucas?«
»O ja«, bestätigte Memphis. »Ich weiß, ihr versteht euch nicht besonders, aber vielleicht entdeckt ihr jetzt ein paar Gemeinsamkeiten. Die beiden sind keine schlechten Menschen, Geoffrey. Für dich mag es lange zurückliegen, ich kann mich jedoch erinnern, dass ihr als Kinder recht gut miteinander ausgekommen seid.«
»Die Zeiten ändern sich«, sagte Geoffrey. »Aber ich werde mir Mühe geben.«
In seinem Zimmer, das er in den letzten Jahren kaum noch benutzt hatte, setzte er sich auf die Kante des frisch bezogenen Bettes. In den Händen hielt er den größten der sechs Holzelefanten, die Eunice ihm zum Geburtstag geschenkt hatte. Es war der Bulle, die fünf anderen wurden bis hinunter zum Kalb zusehends kleiner. Sie standen noch genauso auf dem Regal, wie er sie hingestellt hatte, nachdem er sie zum letzten Mal in Händen gehalten hatte. Alle hatten schwarze Sockel aus einem harten Material, das an Kohle erinnerte.
Er wusste nicht mehr, wie alt er gewesen war, als die Elefanten in einer stabilen Holzkiste, in Seidenpapier verpackt, bei ihm eintrafen. Fünf oder sechs Jahre wahrscheinlich. Er hatte sich noch in der Obhut des Kindermädchens aus Dschibuti befunden. Vielleicht war es das Jahr gewesen, in dem er auf den Skorpion getreten war?
Es hatte eine Weile gedauert, bis er begriffen hatte, dass seine Großmutter in einer Umlaufbahn um den Mond lebte, weder auf noch in dem Trabanten, und noch später war ihm klar geworden, dass ihre seltenen Geschenke nicht wirklich aus dem Weltall kamen, sondern irgendwo auf der Erde hergestellt wurden; sie veranlasste lediglich, dass sie zu ihm geschickt wurden. Später war ihm sogar der Verdacht gekommen, dass jemand anderer in der Familie – das Kindermädchen oder vielleicht Memphis – sie in ihrem Auftrag aussuchte.
Er war enttäuscht gewesen, als er die Kiste öffnete, und noch zu klein, um diese Enttäuschung zu verbergen. Die Elefanten waren Holzfiguren, mit denen man nichts anfangen konnte. Er hatte sich ein Flugzeug gewünscht. Erst auf sanften Druck hin hatte er sich bewegen lassen, sich bei Eunice’ Projektion zu bedanken. Sie hatte aus dem grünen Dschungel im Inneren des Winterpalasts mit ihm gesprochen.
Bis heute wusste er nicht, wie aufrichtig er sich angehört hatte.
Gerade als er den Bullen auf das Regal zurückstellen wollte, begann die Anfrage mit sanfter Beharrlichkeit in seinem Gesichtsfeld zu pulsieren.
>Öffne: quantenverschlüsselte Adresse
>via: Maiduguri-Nyala-Linie
>Träger: Lufthansa Telepresence
>Beginn: 23/12/2161 13:44:11 UTC
>Ausgangsort: Lagos, Nigeria WAF
>Anrufer: Jumai Lule
>Ching annehmen/ablehnen?
Er stellte den Bullen wieder an die Spitze seiner Familie, kehrte zum Bett zurück und nahm mit einem einzigen Subvokalbefehl Jumais Anruf an. Die Verbindung baute sich auf. Geoffrey zog es vor, in seinem lokalen Sensorium angechingt zu werden, und das hatte Jumai sicher gewusst. Er beorderte die Projektion neben die Tür und ließ ihr einen Augenblick Zeit, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden.
»Hallo, Jumai«, sagte er dann leise. »Ich glaube, ich weiß, warum du anrufst.«
»Ich habe es eben erst erfahren. Es tut mir aufrichtig leid, Geoffrey. Das muss ein schwerer Schlag für die Familie sein.«
»Wir werden ihn überstehen«, sagte er. »Es kommt nicht völlig unerwartet.«
Jumai Lule trug einen braunen Overall, das wirre Haar hatte sie zum Schutz vor Staub unter eine Netzkappe geschoben, die Schutzbrille und die Atemmaske, die ihr nun um den Hals hingen, hatten Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen. Sie arbeitete in Lagos in der hochriskanten Datenarchäologie und durchwühlte die unterirdischen, jahrhundertealten Katakomben der Stadt nach Goldkörnern wirtschaftlich nutzbarer Information. Es war eine gefährliche und anspruchsvolle Tätigkeit – genau das, wobei sie aufblühte und was er ihr nicht hatte bieten können.
»Ich weiß, dass sie dir nicht sehr nahegestanden hat …«, begann Jumai.
»Immerhin war sie meine Großmutter«, wehrte Geoffrey so heftig ab, als hätte sie ihm vorgehalten, Eunice’ Tod sei ihm gleichgültig.
»So war es nicht gemeint, und das weißt du genau.«
»Was macht die Arbeit?« Geoffrey bemühte sich, aufrichtiges Interesse vorzutäuschen.
»Die Arbeit ist … in Ordnung. Immer mehr, als wir bewältigen können. Meistens neue Herausforderungen. Wahrscheinlich werde ich nicht ewig dabei bleiben, aber …« Jumai ließ den Satz unvollendet.
»Sag bloß nicht, dass es dir schon wieder langweilig wird.«
»Lagos ist nahezu ausgeschöpft. Ich dachte an Brasilia oder noch weiter weg. Vielleicht sogar ins All. Im System fliegt immer noch jede Menge Militärschrott herum, übles Zeug, das Leute wie ich aufbrechen und entschärfen könnten. Und nach allem, was man hört, zahlen die KI-Jäger recht gut.«
»Weil es gefährlich ist.«
Jumai richtete die Handfläche zur Decke. »Und was ich jetzt mache, ist nicht gefährlich? Letzte Woche sind wir auf Sarin gestoßen, das Nervengas. Plombierte Auslöser, gekoppelt an ein System, das wir für die kryogene Kühlung eines Großrechners hielten.« Sie lächelte verschmitzt. »Solche Fehler macht man besser nicht zweimal.«
»Wurde jemand verletzt?«
»Nichts, was man nicht beheben könnte, und im Anschluss hat man uns den Risikozuschlag erhöht.« Wieder sah sie sich so prüfend im Zimmer um, als würde sie unter den straffen Laken oder auf den ordentlichen weißen Regalen Sprengfallen vermuten. »Aber genug von mir – wie geht es dir?«
»Das wird schon wieder. Entschuldige – ich hätte dich nicht anschnauzen sollen. Du hast recht – Eunice und ich standen uns nie allzu nahe. Trotzdem mag ich es nicht, wenn man mir das unter die Nase reibt.«
»Was ist mit deiner Schwester?«
»Sie denkt da sicher genauso.«
»Du hast mich nie zu Sunday mit hinauf genommen. Dabei wollte ich sie immer schon kennenlernen. Ich meine, richtig, von Angesicht zu Angesicht.«
Er rutschte unruhig hin und her. »Ich bin der Mann der nicht gehaltenen Versprechen.«
»Du kannst eben nicht aus deiner Haut.«
»Mag sein. Aber das hält die Leute nicht davon ab, mir immer wieder zu erklären, ich müsse meinen Horizont erweitern.«
»Das ist ganz allein deine Sache. Hör zu, wir sind doch immer noch Freunde. Sonst würden wir den Kontakt nicht aufrechterhalten.«
Wobei seit dem letzten Anruf Monate vergangen waren, dachte er. Aber er wollte nicht den Eindruck vermitteln, verbittert zu sein. »Alles ist gut«, bestätigte er. »Und es war sehr aufmerksam von dir, mich anzurufen.«
»Ich konnte gar nicht anders. Alle Welt weiß davon – die Nachricht war nicht so leicht zu übersehen.« Jumai griff nach ihrer Schutzbrille. »Hör zu, ich bin in der Pause – ich muss zurück an die Front, sonst brüllt sich meine Extraktionsleiterin die Seele aus dem Leib – ich wollte dir nur noch sagen, wenn du jemanden zum Reden brauchst, ich bin hier.«
»Danke.«
»Weißt du, wir könnten immer noch irgendwann zum Mond fliegen. Einfach als Freunde. Ich würde mich freuen.«
»Irgendwann«, betonte er. Er wusste, dass auch sie es nicht wirklich ernst meinte, und das gab ihm Sicherheit.
»Lass es mich wissen, wenn ein Termin für die Trauerfeier gefunden ist. Falls ich es einrichten kann und nicht bloß die nächsten Angehörigen teilnehmen …« Sie verstummte.
»Ich melde mich«, versprach Geoffrey.
Jumai zog sich die Schutzbrille über die Augen und rückte die Atemmaske zurecht. Über die Pläne zur Trauerfeier würde er sie wohl informieren – aber er bezweifelte, dass sie kommen würde, selbst wenn zu der Feier auch Freunde der Akinyas eingeladen werden sollten und nicht nur die unmittelbare Verwandtschaft. Dieser Anruf war schon peinlich genug gewesen. Er würde einen Grund finden, eine plausible Ausrede, um sie fernzuhalten. Das wäre sicher das Beste für beide Seiten.
Jumai winkte ihm noch einmal zu und chingte aus seinem Leben. Geoffrey hielt es für sehr wahrscheinlich, dass er sie nie mehr wiedersehen würde.
Obwohl Eunice’ Tod die Familie schwer getroffen hatte, dauerte es nicht lange, bis er durch andere Ereignisse aus den Schlagzeilen verdrängt wurde. Ein schwelender Sexskandal verbunden mit Wahlfälschungen im Panafrikanischen Parlament, ein Streit zwischen der Ostafrikanischen Föderation und der Afrikanischen Union wegen Kostenüberschreitungen bei einem Programm zur biologischen Sanierung des Grundwassers im ehemaligen Uganda, ein festgefahrener Konflikt zwischen chinesischen Tekto-Ingenieuren und türkischen Regierungsfunktionären bezüglich des genauen Termins für ein Erdbeben zur Druckentlastung entlang der Nordanatolischen Verwerfung. Auf globaler Ebene anhaltende Spannungen zwischen den Vereinigten Land-Nationen und den Vereinigten Wasser-Nationen die Auslieferungsregelungen, den Umfang der ER-Zugangsberechtigungen und der interregionalen Zuständigkeit des Mechanismus betreffend. Eine mögliche Ausweitung des Umfangs der Obligatorischen Implantate. Ein Mordversuch in Finnland. Streikdrohungen am Weltraumaufzug von Pontianak in West-Borneo. Jemand, der in Tasmanien an einer äußerst seltenen Krebsart starb, was heutzutage einer Heldentat gleichkam.
Nur auf dem Familiensitz, nur in diesem Teil der Ostafrikanischen Föderation standen die Uhren still. Ein Monat war vergangen, seit man Geoffrey mit der Nachricht vom Tod seiner Großmutter vom Himmel geholt hatte. Eunice’ Asche sollte erst am 29. Januar verstreut werden, das verschaffte den meisten Angehörigen genügend Zeit, ihre Reise zurück zur Erde zu organisieren. Wie durch ein Wunder waren alle Beteiligten mit der Verlegung einverstanden gewesen.
»Mach kein so finsteres Gesicht, Bruder«, mahnte Sunday leise, während sie neben ihm herging. »Wenn man dich nicht kennt, könnte man meinen, du wärst lieber anderswo.«
»Und damit hätte man vollkommen recht.«
»Wir tun das immerhin zu ihren Ehren«, gab Sunday mit der üblichen Zeitverzögerung zwischen Erde und Mond zu bedenken.
»Wozu der Aufwand? Sie hat sich zu ihren Lebzeiten doch auch nie bemüht, andere in irgendeiner Form zu ehren.«
»Diese Feier können wir ihr schon zugestehen.« Sunday trug einen langen Rock und eine Bluse mit langen Ärmeln, beides aus schwarzem Samt mit eingewirkten Leuchtfäden. »Mag sein, dass sie uns nie viel Liebe und Zuneigung gezeigt hat, aber ohne sie wären wir nicht so stinkreich, wie wir es sind.«
»Stinkreich ist der richtige Ausdruck. Sieh doch nur, sie umkreisen uns alle wie die Fliegen.«
»Du meinst vermutlich Hector und Lucas.« Sunday hielt die Stimme auch weiterhin gesenkt. Die beiden Cousins gingen nicht weit von ihnen entfernt im Trauerzug.
»Seit ihrem Tod verfolgen sie uns wie die Vampire.«
»Man könnte auch sagen, sie wollen die Last auf sich nehmen, damit wir anderen sie nicht tragen müssen.«
»Dann wünschte ich nur, sie würden sich damit beeilen.«
Die beiden Cousins waren auf Titan zur Welt gekommen. Ihr Vater war Edison Akinya, eines der drei Kinder von Eunice und Jonathan Beza. Bis vor einigen Jahren hatten die beiden nicht viel Zeit auf der Erde verbracht, doch als Edison keine Anstalten machte, seine spezielle Nische des Firmenimperiums zu verlassen, hatten Hector und Lucas sich sonnenwärts orientiert. Geoffrey blieb es nicht erspart, sich bei ihren häufigen Besuchen auf dem Familiensitz mit ihnen auseinanderzusetzen. Die Cousins hatten großen Einfluss darauf, wie die verfügbaren Gelder der Familie verteilt wurden.
»Harter Tag im Büro?«
»Meine Arbeit leidet. Sie haben die Mittelzuweisungen gesperrt, bis sie sich in Eunice’ Finanzen zurechtgefunden haben. Das erschwert meine Planungen, was mich wiederum nicht gerade mit Begeisterung erfüllt.« Er ging ein paar Schritte weiter. »Ich weiß, für dich ist das schwer zu verstehen.«
Sunday sah ihn scharf an. »Soll das heißen, Planung und Verantwortung sind Fremdwörter für mich, weil ich nicht in der Überwachten Welt lebe? Bruder, du hast wirklich keine Ahnung. Ich bin doch nicht in die Zone gezogen, um mich vor der Verantwortung zu drücken. Ich wollte vielmehr herausfinden, wie es sich anfühlt, eine gewisse Verantwortung zu haben.«
»Schön. Du glaubst also, der Mech behandelt uns alle wie hilflose Säuglinge.« Er schloss gelangweilt die Augen – sie drehten sich im Kreis, dieses Gespräch hatten sie schon hundertmal geführt, ohne je zu einem Ergebnis zu kommen. »Aber das ist so nicht richtig.«
»Wenn du meinst.« Sie stieß einen langen Seufzer aus. Offenbar hatte sie solche Streitgespräche ebenso satt wie er. »Vielleicht werden deine Mittel ja bald wieder freigegeben. Ich weiß von Memphis, dass es nicht mehr viel zu tun gibt. Wie er von den Cousins gehört hat, sind lediglich noch ein paar offene Posten abzuklären.«
Hoffentlich hatte sie recht, dachte Geoffrey. Dieses Verstreuen der Asche mochte nur ein symbolischer Akt sein – Eunice war zwar als Kind christlicher Eltern geboren worden, jedoch ihr Leben lang Atheistin gewesen –, aber es müsste dem Stillstand der letzten Wochen ein Ende machen. Die riesige Akinya-Maschinerie würde anlaufen, und von der Erde bis zum Mond und bis hinaus in die automatischen Bergbauanlagen in den Asteroiden und im Kuiper-Gürtel würden sich die Räder wieder drehen. (Natürlich waren die Arbeiten nie eingestellt worden, aber die Vorstellung, dass die Roboter Habachtstellung eingenommen und respektvoll die Köpfe gesenkt hatten, war verlockend.)
Alle konnten ihr unerhört glanzvolles Leben wieder aufnehmen, und Geoffrey konnte zu seinen langweiligen grauen Elefanten zurückkehren.
»Ich hatte überlegt, persönlich zu kommen«, sagte Sunday.
»Ich dachte, du wärst es wirklich, zumindest im ersten Moment.«
»Die Zeitverzögerung kann selbst dir nicht entgangen sein, Bruder.« Sie fuhr sich mit der Hand über die Brust. »Dies ist ein Prototyp, eine Knetanimation, so etwas wie ein Claybot – ich teste ihn im Einsatz.«
»Für … wie heißt dein Freund noch gleich?«
»Oh, für Jitendra ist das eine Nummer zu groß. Ein Freund von ihm befasst sich damit, jemand, der von Berufs wegen mit Robotertechnik zu tun hat. Leider habe ich strikte Anweisung, die betreffende Firma nicht zu nennen, aber wenn ich sage, sie reimt sich auf Sexus …«
»Aha.«
Sunday griff nach seiner Hand, bevor er sie zurückziehen konnte. »Sag mir, wie sich das anfühlt.«
Sie umschloss seine Hand mit den Fingern.
»Gruselig.«
Ihre Hand war unnatürlich kalt, doch davon abgesehen war die Wirkung überzeugend. Ihr Gesicht war kaum weniger realistisch. Erst als sie sich die Sonnenbrille ins Haar schob, war der Bann gebrochen. Die Augen waren von einer Leblosigkeit, die an den Unterschied zwischen Modeschmuck und echten Steinen erinnerte.
»Sieht ziemlich gut aus.«
»Besser als gut. Dabei hast du noch nicht einmal die Hälfte gesehen. Pass auf.«
Von einem Atemzug zum anderen war Sunday nicht mehr da. Vor ihm stand eine alte Frau, das graue Haar zu einem straffen Knoten zusammengenommen, die Haut gezeichnet von den Spuren ihres hundertdreißigjährigen Lebens.
Bevor Geoffrey reagieren konnte, war Eunice verschwunden und Sunday zurückgekehrt.
»Unter den gegebenen Umständen«, sagte er, »war das eine grobe Respektlosigkeit.«
»Sie hätte mir verziehen. Das ist die eigentlich bahnbrechende Erfindung, deshalb wurde der Prototyp entwickelt. Das schnell verformende Material kommt vom Evolvarium auf dem Mars – ursprünglich wurde es zur adaptiven Tarnung verwendet. Plexus … ist mir das jetzt rausgerutscht? Plexus hat die Exklusivrechte daran. Sie nennen es ›Mercurial‹, abgeleitet vom englischen Wort für Quecksilber. Schneller und realistischer als alles andere, was da draußen unterwegs ist.«
»Du glaubst also, dass es dafür einen großen Markt gibt?«
»Wer weiß? Ich habe mich nur als Probandin zur Verfügung gestellt. Die Testdaten gehen an jemand anderen.« Sunday ließ Geoffreys Hand los und klopfte sich mit dem Finger auf den Wangenknochen. »Wir zeichnen ständig auf. Jedes Mal, wenn mich jemand sieht, werden die Reaktionen registriert – Mikromimik, Augenbewegungen und so weiter – und später ins System eingespeist, um damit die Konfigurationsalgorithmen zu optimieren.«
»Und wo bleibt der Anstand? Es gehört sich nicht, die Menschen glauben zu machen, sie würden mit einer echten Person sprechen.«
»Selbst schuld, wenn sie sich nicht die richtigen Overlays aktivieren lassen«, gab Sunday zurück. »Außerdem bin ich nicht allein. Im Moment laufen zwanzig von uns herum, alle von der Zone eingechingt. Wir testen nicht allein, wie realistisch die Konfigurationen sind. Wir wollen auch sehen, wie gut sich dieser Realismus aufrechterhalten lässt, wenn die Zeitverzögerung zwischen Erde und Mond dazukommt.«
»Du konntest also einen Körper herunterschicken, aber persönlich zu kommen war dir zu mühsam?«
Sie warf ihm einen spöttischen Blick zu. »Immerhin bin ich aufgekreuzt, nicht wahr? Eunice wäre es schließlich nicht darauf angekommen, ob jemand von uns körperlich anwesend ist oder nicht.«
»Ich weiß nicht, ob ich sie gut genug kannte, um das mit Sicherheit sagen zu können.«
»Ich glaube, ihr wäre es piepegal gewesen, wer leibhaftig hier ist und wer nicht. Und sie hätte das ganze Theater verabscheut. Aber Memphis hatte sich in den Kopf gesetzt, dass wir alle miteinander vom Familiensitz aufbrechen.«
»Das ist mir nicht entgangen. Ich nehme an, Eunice hat gewisse Anweisungen hinterlassen, und er hält sich lediglich an das Drehbuch.«
Sunday schwieg einen Moment, dann sagte sie leise: »Er ist sehr gealtert.«
»Sag so etwas nicht.«
»Warum nicht?«
»Weil ich eben genau das Gleiche gedacht habe.«
Memphis führte den Trauerzug an. Er ging mit einem Tongefäß in den Händen vor der Hauptgruppe her. Seit sie das Haus verlassen hatten, gingen sie nach Westen auf ein Akazienwäldchen an der verfallenen Grenzmauer zu.
»Aber den alten Anzug trägt er immer noch«, sagte Geoffrey.
»Ich glaube, er hatte immer nur den einen.«
»Oder er hat Hunderte, die alle genau gleich aussehen.«
Memphis’ heiß geliebter schwarzer Businessanzug war immer noch untadelig, aber er schlotterte um seinen mageren Körper, als wäre er für einen anderen, kräftigeren Mann geschneidert worden. Dieselben Hände, die Sunday vor all den Jahren aus dem Loch getragen hatten, hielten jetzt das Tongefäß, obwohl man das kaum glauben wollte. Hatte Memphis einst mit jedem Schritt Selbstbewusstsein und Autorität ausgestrahlt, so ging er nun so langsam und gemessen, als fürchte er jedes Mal eine Blamage, wenn er den Fuß aufsetzte.
»Immerhin ist er dem Anlass entsprechend gekleidet«, bemerkte Sunday.
»Unter meinen Kleidern schlägt immerhin ein Herz.«
»Auch wenn sie leicht nach Elefantendung riechen.«
»Ich dachte, ich könnte noch zur Forschungsstation zurückfliegen und mich umziehen, aber dann habe ich die Zeit vergessen …«
»Du bist hier, Bruder. Niemand hat mehr von dir erwartet.«
Zusammen mit ihnen waren etwa dreißig Personen anwesend. Geoffrey hatte sich alle Mühe gegeben, die Verwandten aus verschiedenen Zweigen der Familie und die dazugehörigen Partner zu identifizieren, aber es war noch nie seine Stärke gewesen, den Überblick über die feineren Verästelungen des Akinya-Stammbaums zu behalten. Elefanten hatten immerhin so viel Anstand, nach fünfzig oder sechzig Jahren tot umzufallen, anstatt bis ins zweite Jahrhundert herumzuhängen und sich fortzupflanzen. Im Amboseli-Becken lebten knapp tausend Einzeltiere. Mindestens hundert davon konnte Geoffrey mit einem Blick unterscheiden. Er registrierte ohne bewusste Anstrengung Gestalt, Größe und Haltung und vermochte das Tier sofort nach Alter, Abstammung, Verwandtschaftsbeziehungen, Stellung innerhalb der Familie, der Gruppe und des Clans einzuordnen. Im Vergleich dazu hätte es kinderleicht sein müssen, sich die Familienstruktur der Akinyas einzuprägen. Es gab sogar eine Matriarchin, Bullen und eine Wasserstelle.
Sowie Raubtiere und Aasfresser.
Was wollten sie bloß alle hier?, fragte sich Geoffrey. Was erwarteten sie sich davon? Wichtiger noch: Was erwartete er sich von dieser Zeremonie?
ENDE DER LESEPROBE