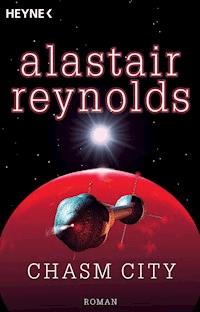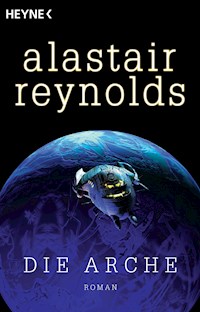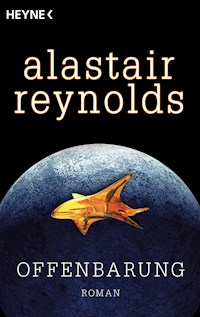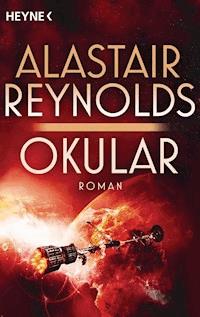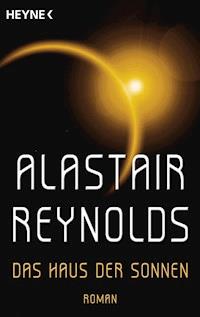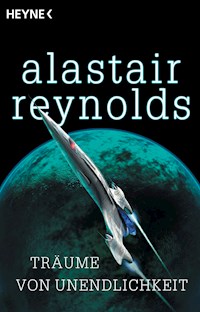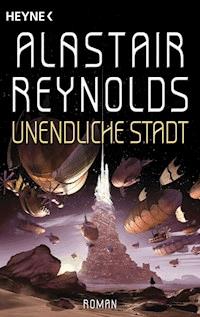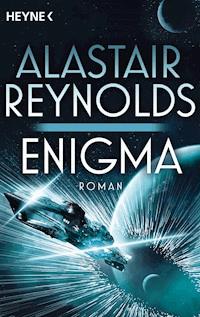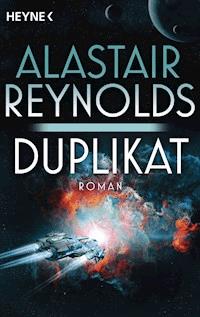
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Poseidons Kinder
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Auf der Suche
Wir schreiben das Jahr 2365: Eine gewaltige Flotte Holoschiffe macht sich auf den Weg zu einem Planeten, der Dutzende Lichtjahre von der Erde entfernt ist. An Bord eines dieser Schiffe befindet sich Chiku Akinya, die Urenkelin der legendären Raumfahrerin Eunice Akinya. Doch Chiko hofft auf diesem fernen Planeten nicht nur eine neue Heimat zu entdecken, sondern auch ein geheimnisvolles Artefakt – ein Artefakt, das nicht nur ihr künftiges Schicksal bestimmen wird, sondern auch das ihrer beiden Klone …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1019
Ähnliche
Das Buch
Wir schreiben das Jahr 2365. Eine gewaltige Flotte von Holoschiffen mit Millionen von Menschen an Bord macht sich auf den Weg zu dem Planeten Crucible, der achtundzwanzig Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Chiku Akinya, die Urenkelin der legendären Raumfahrerin Eunice Akinya, befindet sich an Bord von einem dieser Schiffe. Allerdings gibt es inzwischen drei Chikus – geklonte Kopien, die an unterschiedlichen Orten die vielen Rätsel zu lösen versuchen, die Eunice Akinya der Menschheit aufgegeben hat. Chiku Gelb ist auf der Erde geblieben. Chiku Rot ist aufgebrochen, um Urgroßmutter Eunice’s letzte Reise zu erforschen. Und Chiku Grün ist auf dem Holoschiff, unterwegs in eine ungewisse Zukunft auf einem neuen Planeten. Einem Ort, der für die Holoschiffe bereits ein tödliches Geheimnis bereithält …
Mit Duplikat setzt Alastair Reynolds seine atemberaubende Trilogie fort, in der er die Geschichte der Familie Akinya im 24. Jahrhundert erzählt – eine Geschichte, die hunderttausende Jahre in die Zukunft und in die Weiten unserer Galaxis hineinreicht.
Erster Roman: Okular
Zweiter Roman: Duplikat
Dritter Roman: Enigma
Der Autor
Alastair Reynolds wurde 1966 im walisischen Barry geboren. Er studierte Astronomie in Newcastle und St. Andrews und arbeitete viele Jahre als Astrophysiker für die Europäische Weltraumorganisation ESA, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Er lebt in der Nähe von Leiden in den Niederlanden. Von Alastair Reynolds sind unter anderem im Heyne Verlag erschienen: Unendlichkeit, Himmelsturz, Aurora und Okular. Gemeinsam mit Stephen Baxter schreibt Alastair Reynolds gerade an den Medusa-Chroniken.
Mehr über Alastair Reynolds und seine Romane erfahren Sie auf:
Alastair Reynolds
Duplikat
Roman
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Titel der englischen OriginalausgabeON THE STEEL BREEZE
Deutsche Übersetzung von Irene Holicki
Redaktion: Ralf Dürr
Copyright © 2013 by Alastair Reynolds
Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von shutterstock (Festa, Inga Nielsen, tsuncomp)
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-18616-6V002
www.diezukunft.de
www.penguin.de
Für Louise Kleba, mit der alles anfing.
A starlit or a moonlit dome disdains
All that man is,
All mere complexities,
The fury and the mire of human veins.
Im Stern- und Mondenscheine schätzt die Kuppel
gering des Menschen Art,
Die schnöde Vielfalt, die ihm eigen,
Die Hitze, den Morast in seinen Adern.
– W. B. Yeats, Byzantium
Prolog
Zu Anfang gab es nur eine von uns, und nun könnte es – wenn man den Nachrichten von Crucible glauben kann – bald wieder nur noch eine geben.
In letzter Zeit verbringe ich mehr Zeit als früher an der Küste und sehe dem Kommen und Gehen der Segelschiffe zu. Ich liebe das Knarren der Takelage im Wind und die Matrosen, Landratten wie Meerleute, die so flink und geschickt auf und ab huschen und von ihrer Furchtlosigkeit und ihrer besonderen Sprache zu einer Einheit zusammengeschweißt werden. Ich sehe den Seemöwen zu, die sich um das Futter balgen, und lausche ihrem schrillen Gezeter. Manchmal bilde ich mir ein, sie beinahe verstehen zu können. Nur ganz selten müssen sie sich den Himmel mit einem Luftschiff oder einem anderen Flugkörper teilen.
Lange Zeit fiel es mir schwer, an diesen Ort zurückzukehren. Nicht dass ich mich in Lissabon jemals unwohl gefühlt hätte, auch nach den Veränderungen nicht. Gewiss, man musste manches entbehren. Aber die Stadt hat schon Schlimmeres erlebt und wird, wenn sie genügend Zeit bekommt, auch wieder Schlimmeres ertragen müssen. Ich habe hier viele Freunde, und dank der Kurse, die ich organisiere und in denen ich Kindern und Erwachsenen dabei helfe, Portugiesisch zu lernen, verlassen sich inzwischen überraschend viele Menschen auf mich.
Nein, die Stadt selbst war nicht das Problem, und ich kann auch nicht behaupten, sie hätte mich nicht gut behandelt. Ich glaubte jedoch jahrelang, bestimmte Orte meiden zu müssen, weil sie mit unerfreulichen Assoziationen belastet waren. Die Baixa und der Elevador de Santa Justa, das traditionsreiche Café auf dem Dach des Aufzugs, der Turm von Belém und das Denkmal der Entdeckungengehören dazu. Das soll nicht heißen, dass überall dort schlimme Dinge geschehen wären, aber es waren Punkte, an denen ein bis dahin geregeltes Leben jäh eine unerwartete Wendung nahm, die (das muss gesagt werden) nicht immer zum Besseren war. Doch ohne diese Wendungen wäre ich vermutlich nicht hier und hätte weder Mund noch Stimme. Wenn ich heute zurückblicke auf die Verkettung von Ereignissen, die mich nach Lissabon führte, kann ich mit einiger Überzeugung sagen, dass es nichts gibt, was ausschließlich gut oder schlecht gewesen wäre. Ich glaube, die Stadt würde mir beipflichten. Ich bin durch ihre breiten Straßen geschlendert und habe den wohltuenden Schatten ihrer prächtigen majestätischen Gebäude genossen. Doch bevor Lissabon in dieser Schönheit neu erstehen konnte, musste es einst an einem einzigen schrecklichen Morgen in Wasser und Feuer untergehen. An einem anderen Tag machte meine Schwester der Welt ein Ende, um dieser Welt das Weiterleben zu ermöglichen.
Ich fasse nach dem Amulett, das sie mir an jenem Morgen übergab, eine einfache Holzscheibe, die ich an einem ebenso schlichten Lederband um den Hals trage. Wer diesen Talisman sieht, mag nicht sonderlich beeindruckt sein, und einerseits hätte er damit nicht unrecht. Das Stück ist von geringem Wert und besitzt sicherlich keine besonderen Kräfte. Ich glaube an solche Dinge ohnehin nicht, auch wenn jetzt mehr Aberglauben in der Welt unterwegs ist als in meiner Jugend. Viele Menschen klammern sich wieder an Götter und Geister, aber ich gehöre nicht zu ihnen. Dennoch ist die Tatsache, dass das Amulett immer noch existiert, an sich schon ein kleines Wunder. Es hat eine erstaunlich lange Zeit überdauert und sich durch die Geschichte bis zu mir getunnelt. Einst gehörte es meiner Urgroßmutter, und weiter denken die meisten Menschen ohnehin nicht zurück. Ich vermute allerdings, dass es selbst meiner Urgroßmutter unendlich alt vorgekommen ist und dass es ihrer Urgroßmutter, wer sie auch gewesen sein mag, ebenso alt erschien. Gewiss stand der Talisman unzählige Male dicht davor, verloren zu gehen oder zerstört zu werden, aber irgendwie hat er alle Gefahren überstanden und wie ein Gruß aus der Vergangenheit den Weg in die Gegenwart gefunden.
Auch ich kann mich glücklich preisen. Von Rechts wegen dürfte ich gar nicht hier stehen, sondern wäre schon vor Jahrhunderten im All ums Leben gekommen. In einem gewissen Sinn ist genau das auch geschehen. Ich bin eine Wette gegen Zeit und Raum eingegangen und habe verloren. Natürlich kann ich mich kaum daran erinnern, wie ich vor dem Unfall war. Was ich heute weiß oder zu wissen glaube, wurde mir fast alles von meiner Schwester erzählt. Sie sprach von einem Treffen unter einem Kandelaberbaum, bei dem wir mit farbigen Losen die einzelnen Schicksale bestimmten und über unser weiteres Leben entschieden. Damals war sie neidisch auf mich, weil sie den mir zugefallenen Weg für ruhmreicher hielt als ihren eigenen.
Auf ihre Weise hatte sie recht, doch dann geschahen Dinge, die alle unsere Pläne und Wünsche zum Gespött werden ließen. Chiku Grün stand tatsächlich auf Crucible und atmete die Luft einer fremden Welt. Chiku Rot erreichte tatsächlich jenes winzige, im All treibende Raumschiff und brachte etwas über seinen Inhalt in Erfahrung. Chiku Gelb blieb tatsächlich zurück und würde (so hoffte man) ein ruhiges, sicheres, von Abenteuern freies Leben führen.
Eine Weile blieb es auch so. Wie bereits gesagt, in jenen aufgeklärten Zeiten glaubten die Menschen in der Regel nicht an Geister. Aber es gibt Geister der einen und Geister der anderen Art. Wäre dieser Spuk nicht gewesen, dann hätten sich die Meerleute niemals für Chiku Gelb interessiert, und hätte sie deren Aufmerksamkeit nicht auf sich gezogen, dann wäre meine spätere Rolle in der Ereigniskette zumindest sehr viel kleiner ausgefallen.
Das Erscheinen des Gespensts bedauere ich also nicht. Alles andere jedoch schon. Ich bin froh, dass das Phantom meine Schwester aus ihrem selbstzufriedenen Dasein riss. Sie wusste damals gar nicht, was für ein gutes Leben sie hatte.
Doch das ging auch allen anderen so.
1
Chiku war auf dem Weg zum Elevador Santa Justa, als sie das Gespenst wiedersah.
Es war unten in der Baixa, nicht weit vom Fluss entfernt. Ein Straßengaukler hatte Zuschauer um sich geschart, eine Touristengruppe mit bunten Sonnenschirmen. Als sich in der Menge eine Lücke auftat, kam das Gespenst zum Vorschein und streckte die Arme nach ihr aus. Es war schwarz gekleidet und trug einen schwarzen Hut mit breiter Krempe, und es versuchte ihr etwas zu sagen. Sein Gesichtsausdruck wurde immer gequälter, und schließlich versperrten die Touristen wieder die Sicht. Der Gaukler gab noch ein paar Kunststücke zum Besten. Dann machte er den Fehler, um Geld zu bitten. Die Gruppe war verärgert und zerstreute sich. Chiku wartete noch einen Moment, doch das Gespenst tauchte nicht wieder auf.
Im Aufzug überlegte sie, was sie wegen der Erscheinungen unternehmen sollte. In letzter Zeit traten sie häufiger auf. Sie wusste, dass ihr das Gespenst nichts anhaben konnte, doch das hieß noch lange nicht, dass sie sich mit seiner Gegenwart so einfach abgefunden hätte.
»Sie sehen besorgt aus«, sagte eine Stimme. »Warum müssen Sie sich an diesem wunderschönen Nachmittag mit trüben Gedanken quälen?«
Der Sprecher war einer von drei Meerleuten, die sich neben ihr an den Aufzugtüren zusammendrängten. Im letzten Moment hatten sie sich in die Kabine gezwängt und belästigten sie nun mit ihrem Salzgeruch und den harten Kanten ihrer Exoskelette. Sie hatte sich schon gefragt, wohin sie wohl wollten. Es hieß, Meerleute hassten enge Räume und große Höhen und entfernten sich nicht gern allzu weit vom Ozean.
»Wie bitte?«
»Ich hätte Sie nicht ansprechen sollen.«
»Ganz recht.«
»Es ist aber doch ein wunderschöner Nachmittag, nicht wahr? Wir lieben den Regen. Wir bewundern das Reflexionsvermögen von nassen Flächen. Die Art, wie das Sonnenlicht darauf zersplittert und gebrochen wird. Den Glanz von vormals matten Dingen. Die Schwere des Himmels.«
»Ich habe nicht vor, mich Ihnen anzuschließen. Versuchen Sie anderswo Ihr Glück.«
»Oh, wir wollen niemanden anwerben. Das haben wir inzwischen nicht mehr nötig. Wollen Sie ins Café?«
»Was für ein Café?«
»Oben auf dem Dach.«
Das war tatsächlich ihre Absicht gewesen, doch die Frage hatte sie wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen. Woher kannte der Meermann ihre Gewohnheiten? Nicht alle Fahrgäste wollten ins Café, nicht einmal die Mehrheit. Manche machten auf dem Rückweg vom Carmo-Kloster dort Station, doch das Café war nur selten das erste Ziel für Leute, die von der Rua do Ouro nach oben fuhren.
»Wer sind Sie?«, fragte sie.
»Ein Freund der Familie.«
»Lassen Sie mich in Ruhe.«
Die Türen gingen auf. Chiku schlenderte mit den anderen Touristen hinaus, steuerte geradewegs das Café an und nahm ihren gewohnten Platz am Fenster ein. Die Seemöwen vollführten mit heiserem Kreischen auf einer Warmluftsäule halsbrecherische Sturzflüge. Die Wolken rissen allmählich auf, Sonnenlicht spiegelte sich auf den roten Ziegeldächern, über die ihr Blick hinunter zum Platinband des Tajo wanderte.
Sie bestellte Kaffee. Zunächst hatte sie auch an Kuchen gedacht, aber das Gespenst und das seltsame Gespräch im Aufzug hatten ihr den Appetit verdorben. War sie womöglich gerade dabei, eine Abneigung gegen Lissabon zu entwickeln?
Sie hatte ihr Buch mitgebracht. Es hatte einen marmorierten Einband und sah sehr alt aus. Viele Seiten waren bereits mit handgeschriebenen Zeilen gefüllt. Die Buchstaben neigten sich alle nach rechts wie Bäume im Sturm. Chiku entdeckte, dass sie auf einer Seite etwas ausgelassen hatte, und berührte dort das Pergament mit der Spitze ihres Füllfederhalters. Die Tintenschrift rückte zusammen und ließ eine Lücke entstehen, in die sie das fehlende Wort einsetzen konnte. An anderer Stelle strich sie zwei überflüssige Zeilen, worauf der Text zu beiden Seiten der Löschung von selbst zusammenrückte.
Sie spürte, dass jemand sie ansah, und schaute auf.
Die Meerleute hatten das Café betreten und den Besitzer genötigt, Tische und Stühle beiseitezurücken, um Platz für ihre Exos zu schaffen. Nun saßen sie in einem lockeren Dreieck um ein niedriges rundes Tischchen, auf dem eine große Kanne mit dampfendem Tee stand.
Einer der Meerleute erwiderte ihren Blick. Vielleicht war es derselbe, der sie im Aufzug angesprochen hatte. Der Wasserbewohner – sie war inzwischen fast überzeugt, dass es ein Mann war – hielt eine Teetasse in seinen feisten grauen Fingern und führte sie nun an seine lippenlose Mundspalte. Seine Augen waren wie schwarze Löcher, er blinzelte nicht. Er nippte an der wässrigen Flüssigkeit, stellte die Tasse auf den Tisch und wischte sich mit dem Handrücken einen grünlichen Schleimstreifen vom Mund. Seine Haut glänzte wie nasse Steine. Meerleute rieben sich ständig mit Öl und Parfum ein, wenn sie an Land waren.
Der Wasserbewohner hielt den Blick unverwandt auf sie gerichtet.
Chiku hatte genug. Sie bezahlte mit einem subvokalen Befehl und schickte sich an zu gehen. Zuerst hatte ihr das Gespenst den Nachmittag verdorben, nun verdarben ihr die Meerleute auch noch den Rest des Tages. Eigentlich sollte sie den Raum verlassen, ohne ein Wort zu sagen. Das wäre ein würdevoller Abgang gewesen.
»Ich habe keinerlei Interesse an Ihnen und Ihren Seesiedlungen, Ihre törichten Pläne zur Kolonisierung des Universums lassen mich vollkommen kalt, und Sie kennen weder mich noch meine Familie.«
»Sind Sie da ganz sicher?« Es war eindeutig derselbe, der sie vorher angesprochen hatte. »Wenn Sie ehrlich sind, haben Sie sogar ein lebhaftes Interesse an uns – den Vereinigten Wasser-Nationen und der Panspermischen Initiative. Und deshalb interessieren auch wir uns für Sie. Ob es Ihnen gefällt oder nicht.«
Blitzend wie ein nagelneues Schmuckstück, war durch ein Fenster hinter den Meerleuten die Hängebrücke zu sehen. Eine Reparaturmaschine in Form einer Silberkugel schob sich seit Wochen über die altehrwürdige Konstruktion, verdaute Metallteile, die fast so alt waren wie der Elevador Santa Justa, und erneuerte sie. Zwei heuschreckenähnliche Versorger auf absurden Stelzenbeinen überragten die Brücke und überwachten die diffizilen Arbeiten.
»Ob es mir gefällt oder nicht? Verdammt, wer sind Sie eigentlich?«
»Mein Name ist Mecufi. Sie haben sich sehr gründlich mit unserer öffentlichen und privaten Geschichte befasst – woher dieses brennende Interesse an der Vergangenheit?«
»Das geht Sie nichts an.«
»Wir leben hier in der Überwachten Welt«, sagte Mecufi so streng, als wollte er einem Kind einen einfachen Sachverhalt erklären. »In der Überwachten Welt geht jeden alles an. Das ist der Sinn der Sache.«
In der Ferne wanderten Touristen über die zinnenbewehrten Mauern der Burg. Cyberklipper, die den Atlantik überquert hatten, legten an den Ufern des Tajo an. Die eleganten, schnittigen Segel blähten sich in der steifen Brise über dem Fluss. Luftschiffe und Airpods glitten, bunt wie Luftballons, unter den Wolken dahin.
»Was verstehen Sie schon von der Überwachten Welt? Sie gehören nicht einmal dazu.«
»Ihr Einfluss erstreckt sich weiter in unsere Sphäre, als uns lieb ist. Und Datenabfragen, besonders wenn sie uns betreffen, entgehen uns nicht so leicht.«
Der ungewöhnliche Wortwechsel erregte allmählich die Aufmerksamkeit der anderen Café-Besucher. Chiku bekam eine Gänsehaut. Sie war gerne hier, und sie genoss es, ungestört zu sein.
»Ich bin Historikerin. Das ist alles.«
»Und Sie schreiben eine private Geschichte der Akinya-Sippe? Eunice Akinya und so weiter? Geoffrey und die Elefanten? Die verstaubten Geschehnisse von vor zweihundert Jahren? Ist es das, wovon Ihr Buch handelt?«
»Wie gesagt, selbst wenn es so wäre, es geht Sie nichts an.«
»Das nenne ich ein überzeugendes Dementi.«
Die beiden anderen glucksten wie die Frösche.
»Das ist Schikane«, empörte sich Chiku. »Als freie Bürgerin kann ich so viele Nachforschungen anstellen, wie ich will. Wenn Sie dagegen etwas einzuwenden haben, müssen Sie sich an den Mechanismus wenden.«
Mecufi hob beschwichtigend die Hand. »Wir könnten Ihnen vielleicht behilflich sein. Aber dafür wäre ein … sagen wir, ein gewisses Entgegenkommen Ihrerseits erforderlich.«
»Wozu sollte ich Ihre Hilfe brauchen?«
»Zum Beispiel dieses Gespenst – dabei können wir Ihnen auf jeden Fall helfen. Aber zuerst benötigen wir etwas von Ihnen.« Mecufi griff in einen Beutel an seinem Exo und brachte ein schmales Holzkästchen zum Vorschein, wie man es zur Aufbewahrung von Bleistiften oder Zeichenzirkeln verwenden mochte. Er bewegte einen kleinen Riegel und ließ eine Schublade herausgleiten. Sie war mit Filz ausgekleidet und mit Trennwänden in zwölf kleinere Fächer unterteilt. In jedem dieser Fächer lag eine farbige Kugel von der Größe eines Glasauges. Zögernd näherte er seine Hand den Kugeln. Sie waren in verschiedenen schillernden Pastellfarben gehalten. Nur eine Kugel ganz hinten war entweder von einem sehr dunklen Violett oder völlig schwarz.
Schließlich entschied er sich für eine bernsteinfarbene Kugel mit feuerroten Flecken. Er hielt sie zwischen den Fingern und schloss für ein paar Sekunden die Augen. Dann hatte er eine eindeutige Formulierung gefunden und die erforderliche Zuweisung vorgenommen.
»Ich möchte Ihnen meine Motio überreichen«, sagte Mecufi.
»Ich weiß nicht …«, begann Chiku.
»Nehmen Sie die Motio.« Mecufi drückte ihr die Bernsteinkugel in die Hand und schloss ihre Finger darum. »Wenn es ihr gelingt, Sie von meinen guten Absichten zu überzeugen, dann kommen Sie morgen Vormittag bis spätestens zehn Uhr zum Denkmal der Entdeckungen. Danach werden wir die atlantischen Seesiedlungen besuchen. Nur ein kleiner Ausflug – zum Tee sind Sie wieder zurück.«
Pedro Braga säuberte seine Pinsel und summte dabei leise vor sich hin. Ein beißender Geruch nach Farbe und Lack hing in seinem Atelier, unterlegt mit dem Duft von Hobelspänen, Sägemehl und kostspieligen traditionellen Harzen.
»Mir ist heute etwas Komisches passiert«, erzählte Chiku.
»Inwiefern komisch?«
»Es hing mit dem Gespenst zusammen. Aber damit nicht genug. Ich bin einem Meermann begegnet. Er heißt Mecufi.«
An den offenen Dachbalken waren Gitarren in unterschiedlichen Stadien der Fertigstellung an den Hälsen aufgehängt. Einige befanden sich noch ganz am Anfang ihrer Entstehung und waren mit viertelnotenförmigen Umrissen markiert. Andere waren fast fertig, nur die Saiten und die letzten Verzierungen fehlten noch. Der Aufwand war hoch, die Arbeit schwer zu durchschauen, aber die Instrumente verkauften sich gut. In einer Welt, in der Montageprogramme und Versorgerso gut wie jeden Artikel nahezu kostenlos liefern konnten, galt Unvollkommenheit als Vorzug.
»Ich hätte nicht gedacht, dass du mit denen etwas zu tun haben wolltest.«
»Das wollte ich auch nicht. Dieser Mecufi hat mich angesprochen – im Aufzug, auf dem Weg zum Café. Sie waren zu dritt, und sie wussten, wer ich bin. Sie wussten auch von dem Gespenst.«
»Das ist wirklich sonderbar.« Pedro war mit dem Reinigen der Pinsel fertig und steckte sie zum Trocknen in ein Holzgestell. »Können sie etwas dagegen tun?«
»Ich weiß es nicht. Ich soll die Seesiedlungen besuchen.«
»Du Glückspilz. Millionen von Menschen würden für eine solche Einladung einen Mord begehen.«
»Meinetwegen. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen.«
Pedro öffnete eine Flasche Wein und füllte zwei Gläser. Nach einem flüchtigen Kuss traten sie auf den Balkon hinaus und setzten sich zu beiden Seiten eines vor sich hin rostenden Tisches, von dem die weiße Farbe abblätterte. Um das Meer zu sehen, mussten sie sich am Ende des Balkons weit hinauslehnen. Dann zeigte es sich verschämt in einer Lücke zwischen zwei benachbarten Mietshäusern. Bei Nacht, wenn der Lichtschein aus den Fenstern und von den Straßenlaternen die Stadt in buttriges Gelb tauchte, hatte Chiku den Meerblick noch nie vermisst.
»Du kannst sie wirklich nicht leiden, wie?«
»Sie haben sich meinen Sohn geschnappt. Ist das nicht Grund genug?«
Sie hatten kaum jemals über ihr Leben vor dem Tag gesprochen, an dem sie sich in Belém kennengelernt hatten. Das war so vereinbart, ihre Beziehung gründete auf einer soliden Basis beiderseitigen Nichtwissens. Pedro wusste von Chikus Schwestern, und er wusste, dass sie einen Sohn hatte, der sich den Seesiedlern angeschlossen hatte – und damit faktisch zum Angehörigen einer neuen Art geworden war. Chiku wiederum wusste, dass Pedro weit herumgekommen war, bevor er sich in Lissabon niederließ, und dass er nicht immer Gitarrenbauer gewesen war. Die finanziellen Mittel, über die er verfügte, waren mit den bescheidenen Einkünften aus seinem Gewerbe nicht zu vereinbaren – allein die Miete für das Atelier hätte seine Verhältnisse übersteigen müssen. Aber sie hatte kein Verlangen, ihn deshalb mit Fragen zu behelligen.
»Vielleicht solltest du irgendwann darüber hinwegkommen.«
»Darüber hinwegkommen?« In jäher Gereiztheit beugte sich Chiku so heftig über den Tisch, dass er auf seinen ungleich langen Metallbeinen schaukelte. »Über so etwas kommt man nicht hinweg. Außerdem war das bloß der Anfang – die mischen sich schon viel zu lange in unser Familienunternehmen ein.«
»Aber wenn sie das Gespenst vertreiben können …«
»Er sagte, er könne mir ›dabei helfen‹. Das könnte auch heißen, mit dem Gespenst zu sprechen. Herauszufinden, was Chiku Grün will.«
»Würdest du das wollen?«
»Die Möglichkeit hätte ich schon gerne. Ich glaube …« Chiku vollendete den Satz nicht, sondern trank einen Schluck Wein. Durch die offene Tür einer Bar unten an der Straße schallte die Stimme einer Frau, die immer wieder die gleichen drei Fado-Zeilen schmetterte – sie übte für einen abendlichen Auftritt. »Ich weiß nicht, ob ich ihnen trauen kann. Das hat mir dieser Mecufi gegeben.«
Sie legte die Kugel auf den Tisch.
Pedro nahm sie mit Daumen und Zeigefinger und betrachtete sie mit leicht angewidertem Gesichtsausdruck. Chiku wusste, dass er von Motien nichts hielt. In seinen Augen schalteten sie ein wesentliches Element der menschlichen Kommunikation einfach aus.
»Die sind nicht unbedingt zuverlässig.«
Sie nahm die Bernsteinkugel wieder an sich. Bei Pedro würde sie ohnehin nicht funktionieren. Motien waren immer für einen bestimmten Empfänger chiffriert.
»Ich weiß, trotzdem bin ich bereit, es zu versuchen.«
Chiku zerdrückte die Motio. Der Glaskörper zerbrach, die Scherben lösten sich selbsttätig auf, und der Inhalt – die Emotionsfracht – entfaltete sich in ihrem Kopf wie eine Blüte. Stimmen sprachen von vorsichtiger Zurückhaltung, von Hoffnung und dem starken Wunsch, ihr Vertrauen zu gewinnen. Bedrohliche Töne waren in dem Chor nicht enthalten.
»Ich hatte recht, Mecufi ist ein Er«, entschied Chiku. »Das kam ganz deutlich durch.«
»Was hast du sonst noch gespürt?«
»Es ist ihm sehr wichtig, dass ich die Seesiedlungen aufsuche. Sie brauchen mich mindestens so dringend wie ich sie. Und es geht nicht allein um das Gespenst. Da ist noch etwas anderes.«
Die Fado-Sängerin wiederholte ein weiteres Mal die gleichen drei Zeilen. Bei der letzten Silbe schnappte ihr die Stimme über. Die Frau lachte.
2
Bald nach ihrer Ankunft in Lissabon hatte sie Pedro in Belém kennengelernt. Sie hatten sich beide am selben Stand ein Eis gekauft und lachend zugesehen, wie die Seemöwen wild entschlossen herabstießen, um ihnen das Erworbene wegzuschnappen.
Nun stieg Chiku auf das Dach des Denkmals der Entdeckungenmit seinen steinernen Seefahrern, die über das Meer blickten. Es war der einzige Ort, von dem aus man eine passable Aussicht auf die Windrose hatte, eine Karte der antiken Welt, die sich in rotem und blauem Marmor über eine weitläufige Terrasse ausbreitete. Galeonen und Seeungeheuer bewachten die tiefen Meere und Ozeane. Ein Krake zerrte mit seinen Fangarmen ein Schiff in die Tiefe. Außerhalb der Karte zeigten Pfeile die Himmelsrichtungen an.
»Wie schön, dass Sie gekommen sind.«
Sie drehte sich abrupt um. Bei ihrem Eintreffen hatten sich auf der Aussichtsplattform des Denkmals keine Meerleute aufgehalten, zumindest hatte sie keine entdeckt. Es war kurz nach zehn Uhr, und sie war davon ausgegangen, dass die Verabredung durch ihre Verspätung gegenstandslos geworden war. Doch nun stand Mecufi, in ein Exoskelett gezwängt, aufrecht vor ihr.
»Sie hatten das Gespenst erwähnt. Heute Morgen habe ich es schon wieder in der Straßenbahn gesehen.«
»Es wird schlimmer, nicht wahr? Doch dazu kommen wir später. Vorher stehen noch ein paar andere Punkte auf dem Programm. Wollen wir fliegen?«
»Fliegen?«
Mecufi schaute nach oben. Chiku folgte seinem Blick und spähte mit zusammengekniffenen Augen durch den Dunst. Aus dem weißen Möwenschwarm löste sich ein Gebilde, sank herab und wurde dabei immer größer. Es war ein Flieger, etwa so breit wie das Dach des Denkmals.
»Wir haben eine Sondergenehmigung«, erklärte Mecufi. »In Lissabon sind wir sehr beliebt, seit wir die Tsunamibrecher eingebaut haben. Man hat hier ein langes Gedächtnis – 1755 war erst gestern.« Aus dem grünen Bauch des Fliegers strömte warme Luft. Eine Rampe schob sich herunter, und Mecufi ermunterte Chiku, an Bord zu gehen. »Warum zögern Sie? Sie können uns getrost vertrauen. Ich habe Ihnen doch die Motio gegeben.«
»Motien lassen sich fälschen.«
»Alles lässt sich fälschen. Sie müssen sich eben darauf verlassen, dass die meine nicht gefälscht war.«
»Dann stehen wir also wieder am Anfang? Ich muss darauf vertrauen, dass Sie vertrauenswürdig sind?«
»Vertrauen ist gut und paradox zugleich. Ich habe Ihnen versprochen, Sie noch vor dem Abend nach Hause zurückzubringen – nehmen Sie mich einfach beim Wort.«
»Wir fliegen nur zu den Seesiedlungen?«
»Und nicht weiter. Was für ein wunderschöner Tag. Das Licht auf dem Wasser ist so rastlos wie die See! Ist es nicht eine Freude zu leben?«
Chiku gab sich geschlagen. Sie gingen an Bord und nahmen in der geräumigen Kabine auf bequemen Sesseln Platz. Der Zugang wurde geschlossen, der Flieger stieg auf und beschleunigte. In wenigen Atemzügen hatten sie die Küste hinter sich gelassen. Unter ihnen schillerte das Meer in verschiedenen Schattierungen, als hätten sich Seen aus indigo- und ultramarinblauer Tinte darauf verteilt.
»Es ist schön auf der Erde, finden Sie nicht?« Von seinem Exo war Mecufi wie ein großes Stofftier auf den Sitz geladen worden, dann hatte sich die Prothese für die Dauer des Flugs zusammengeklappt.
»Bisher war ich hier ganz zufrieden.«
»Warum haben Sie sich ausgerechnet in das marode alte Lissabon verkrochen, um die Geschichte Ihrer Familie zu studieren?«
»Ich hatte gehofft, hier ein wenig Ruhe und Frieden zu finden. Aber das war offenbar ein Irrtum.«
Der Flieger blieb tief über dem Wasser. Gelegentlich sahen sie unter sich einen Cyberklipper, eine Vergnügungsjacht oder ein kleines, bunt bemaltes Fischerboot. Die Maschine war so schnell, dass Chiku nur einen kurzen Blick auf die Fischer werfen konnte, die an Deck mit Netzen und Seilwinden hantierten. Die Männer sahen nicht einmal auf. Das Flugzeug löste den selbst erzeugten Mach’schen Kegel hinter sich auf, sodass kein Überschallknall entstand.
Der Rumpf hatte sich gewiss der Farbe des Himmels angepasst.
»Dürfte ich Sie nach Ihren anderen Ichs fragen?«
»Darüber möchte ich lieber nicht sprechen.«
»Leider muss es sein. Beginnen wir am Anfang. Ihre Eltern Sunday Akinya und Jitendra Gupta sind beide noch am Leben. Sie selbst wurden vor etwa zweihundert Jahren in der ehemals Überwachungsfreien Zone auf dem Mond geboren. Wollen Sie das bestreiten?«
»Warum sollte ich?«
Mecufi salbte sich mit einem nach Lavendel duftenden Öl aus einem kleinen Spender, bevor er fortfuhr: »Sie hatten eine sorgenfreie Kindheit und lebten in wohlhabenden Verhältnissen, in einer Zeit, die geprägt war von weltweitem Frieden und positivem gesellschaftlichem und technologischem Wandel. Es gab keine Kriege, keine Armut und so gut wie keine Krankheiten. Sie konnten sich überaus glücklich preisen – Milliarden von Toten hätten jederzeit mit Ihnen getauscht. Dennoch stellten Sie beim Eintritt ins Erwachsenenalter eine innere Leere bei sich fest. Es fehlte Ihnen an Orientierung, an festen moralischen Richtwerten. Mit diesem Namen aufzuwachsen war nicht leicht. Ihre Eltern, Großeltern und Urgroßeltern hatten Berge versetzt. Eunice hatte das Sonnensystem für die Besiedlung und die kommerzielle Nutzung erschlossen. Sunday und Ihre anderen Verwandten eröffneten den Weg zu den Sternen! Was blieb für Sie an Vergleichbarem zu tun?«
Chiku verschränkte die Arme. »Sind Sie fertig?«
»Noch lange nicht. Das ist das Problem mit unserer Langlebigkeit – es gibt so unglaublich viel zu berichten.«
»Vielleicht sollten Sie allmählich doch zum Punkt kommen.«
»Als Sie fünfzig Jahre alt waren, gelangte eine neue Technologie zur Reife, und Sie trafen eine folgenschwere Entscheidung. Sie beauftragten die Firma Quorum Binding, mit dem Verfahren der beschleunigten Phänotypisierung zwei Klone von Ihnen herzustellen. Die Klone waren nach wenigen Monaten physisch vollkommen ausgeformt, dämmerten aber nur als leere Leinwände vor sich hin. Sie hatten zwar Ihr Gesicht, aber weder Ihre Erinnerungen noch Ihre Narben. Sie waren nicht von den Spuren Ihres Lebens gezeichnet, Ihre persönliche Entwicklungs- und Immungeschichte war nicht vorhanden. Doch das war Teil des Plans.
Während die Klone heranreiften, wurde Ihr eigener Körper einer Strukturanpassung unterzogen. Medizinische Nanomaschinen fraßen sich bis in den Kern Ihrer Weiblichkeit in Sie hinein. Sie nahmen Ihre Knochen, Ihre Muskeln und Ihr Nervensystem auseinander und setzten alles neu zusammen, bis Sie genetisch und funktional nicht mehr von Ihren Klonschwestern zu unterscheiden waren. Eine Front von Neuralmaschinen fegte wie ein Buschfeuer durch Ihr Gehirn und zeichnete Ihr idiosynkratisches Konnektom auf – ein detailliertes Abbild Ihrer mentalen Verkabelung. Gleichzeitig prägten ähnliche Maschinen – sogenannte Skriptoren – genau dieses Abbild dem Bewusstsein Ihrer Schwestern auf. Deren Geist war dem Ihren von jeher ähnlich gewesen, doch nun waren sie identisch – bis hinunter zur Gedächtnisebene. Woran Sie sich erinnerten, das wussten auch die beiden anderen. Der Prozess war eine Art von stochastischer Mittelung. Einige der natürlichen Strukturen Ihrer Schwestern wurden sogar in Ihren Kopf zurücktranskribiert. Als am Ende alle drei aus den Immersionsbehältern geholt wurden, konnte man sie tatsächlich nicht mehr unterscheiden. Sie sahen gleich aus und dachten gleich. Die telomere Uhr in Ihren Zellen war auf null gestellt worden. Epigenetische Faktoren hatte man korrigiert und zurückgesetzt. Da Sie alle Zugriff auf dieselben Erinnerungen hatten, konnten Sie nicht einmal mehr selbst sagen, wer von Ihnen das Original war. Genau das war beabsichtigt: Keine Schwester sollte bevorzugt werden. Nicht einmal in der Firma Quorum Binding, die den Auftrag ausgeführt hatte, wusste man noch, wer von Ihnen authentisch war. Es war ein rigoroses Blindverfahren. Die Kunden erwarteten nichts anderes.«
»Und was haben Sie nun damit zu tun …?«
»Wir haben uns immer mit Ihnen beschäftigt, Chiku, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Erzählen Sie mir, wie die Einzelschicksale ausgewählt wurden.«
»Warum?«
»Weil das der einzige Teil der Geschichte ist, auf den ich keinen Zugriff habe.«
Sechs Monate nach Abschluss des Klon-Verfahrens hatten sich die drei in Äquatorial-Ostafrika wiedergetroffen. Es war ein warmer Tag gewesen, und sie hatten beschlossen, mit drei Airpods zu einem Picknick aufzubrechen. Nach einem schnellen Flug dicht über dem Boden hatten sie einen geeigneten Platz ausfindig gemacht. Noch jetzt sah Chiku im Geiste die Airpods auf dem Boden und den gedeckten Tisch im schwülen Schatten eines Kandelaberbaums. Aus einer Laune heraus hatten sich die drei darauf geeinigt, ihre Schicksale durch Brotbrechen zu bestimmen. Die Brotlaibe enthielten farbige Papierlose, über deren Bedeutung sie sich im Vorhinein verständigt hatten. Zwei der Schwestern sollten sich getrennt voneinander auf Reisen begeben, die mit gewissen Risiken verbunden waren. Die dritte Schwester sollte als eine Art Rückversicherung im Sonnensystem bleiben. Von ihr wurde lediglich verlangt, dass sie ein halbwegs behütetes Leben führte. Da die Erträge des Familienunternehmens immer noch exponentiell anwuchsen, würde diese dritte Schwester nur zu arbeiten brauchen, wenn sie das selbst wollte.
Insgeheim wünschte sich jede, diese dritte Schwester zu sein. Es wäre keine Schande gewesen.
In der Erinnerung hatte Chiku das Brot gleichzeitig dreimal gebrochen, aus der Sicht jeder der Frauen. Danach hatten sie alle immer wieder ihre Erinnerungen miteinander geteilt, und natürlich war darin aus unterschiedlichen Blickwinkeln auch die Erinnerung an jenen Tag unter dem Baum enthalten. Die jeweiligen Emotionen waren so deutlich ausgeprägt, als hätte man drei gleiche Fotografien verschieden eingefärbt.
Die Schwester, die in ihrem Brot ein hellgrünes Los fand, sollte an der Expedition nach Crucible teilnehmen. Der Gedanke erfüllte sie mit einer schwindelerregenden Mischung aus Begeisterung und Furcht, ähnlich wie vor dem ersten Anstieg einer Achterbahn. Sie würde die Erde hinter sich lassen und einhundertfünfzig Jahre im steinernen Bauch eines Holoschiffs verbringen. Die Gefahren waren schwer abzuschätzen: Holoschiffe waren neu und unerprobt, noch niemand hatte bis dahin eine solche Reise gewagt. Doch an ihrem Ende winkte unermesslicher Lohn – das Recht, eine neue Welt zu betreten, die um eine neue Sonne kreiste.
Die Schwester, die sich auf die Suche nach der steuerlos im All treibenden Winterkönigin begeben sollte – ihr Los war rosarot – hatte klarer umrissene Bedenken, die mit oboenähnlichen Untertönen von Angst unterlegt waren. Bei dieser Expedition lagen die Risiken offener zutage. Sie würde allein aufbrechen und ihrem kleinen Raumschiff das Äußerste abverlangen. Wenn sie allerdings als Siegerin zurückkehrte, wäre die Schuld an die Nachwelt beglichen. Das Risiko war hoch, aber der Lohn noch höher. Während die Schwester auf dem Holoschiff ihren Erfolg mit Millionen von anderen Menschen teilen müsste, könnte sie den Triumph für sich allein verbuchen.
Die Schwester, die das gelbe Los zog und zu Hause bleiben sollte, atmete zunächst auf. Ihr war die einfachste Aufgabe zugefallen. Doch zugleich durchzuckte sie der Neid wie ein Messerstich. Sie würde sich weder mit dem Betreten Crucibles noch mit dem Erreichen der Winterkönigin schmücken können. So lautete die Vereinbarung. Sie hatte keinen Grund, sich zu grämen. Jede von den dreien hätte dieses Los ziehen können.
Auf dem Tisch stand ein Holzkästchen. Alle drei streckten zugleich die Hand danach aus. Die Reaktion verriet, wie festgelegt sie in ihrem Verhalten waren. Es war so peinlich, dass sie lachen mussten. Dann legten wie auf ein Stichwort zwei von ihnen die Hände in den Schoß zurück und überließen es der dritten – Chiku Gelb –, den Deckel anzuheben.
Das Kästchen enthielt eine Reihe von Erbstücken der Akinya-Familie. Viele waren es nicht. Die Bleistifte und die zerkratzte Ray-Ban-Sonnenbrille hatten Onkel Geoffrey gehört. Der Papierabzug eines Digitalfotos zeigte Eunice als kleines Mädchen. Ihre Mutter Soya hatte die Aufnahme in einem Durchgangslager gemacht, wo sie beide als Klimaflüchtlinge gelebt hatten. Eine Rarität war das Mobiltelefon der Marke Samsung, außerdem waren ein Schweizer Offiziersmesser, ein Kompass und ein daumengroßes digitales Speichermedium in Form eines Schlüsselrings vorhanden. In dem zerlesenen Exemplar von Gullivers Reisen fehlten einige Seiten. Sechs Holzelefanten standen auf kohlschwarzen Sockeln – ein Bulle, eine Matriarchin, zwei Jungtiere und zwei Kälber. Die Elefanten wurden zwischen den beiden Schwestern aufgeteilt, die ins All fliegen sollten. So war es abgemacht.
Nachdem auch alle anderen Gegenstände gerecht verteilt worden waren, blieb nur noch ein einfaches hölzernes Amulett an einem dünnen Lederriemen übrig. Ein kreisrunder Talisman unbestimmbaren Alters. Alle wussten, dass er einst ihrer Urgroßmutter gehört hatte und von Eunice auf Soya übergegangen war: nicht die Soya, die Eunice’ Mutter gewesen war, sondern die Tochter von Eunice’ früherem Ehemann Jonathan Beza. Soya wiederum hatte das Amulett an Sunday verschenkt, als die den Mars besucht hatte, und Sunday hatte es ihrer Tochter Chiku Akinya weitergegeben.
Nun gab es drei Chikus.
»Es sollte hierbleiben«, sagte Chiku Grün, die Version von Chiku, die nach Crucible reisen sollte.
»Einverstanden«, erklärte Chiku Rot, die Version von Chiku, die nach der Winterkönigin suchen sollte.
»Wir könnten es in drei Teile zerschneiden«, überlegte Chiku Gelb, doch dieser Vorschlag war bereits ein Dutzend Mal gemacht und wieder verworfen worden. Das Amulett gehörte auf die Erde oder in ihre Nähe, daran war nicht zu rütteln. Es sollte das Sonnensystem nicht verlassen.
Chiku Gelb nahm die hölzerne Scheibe und hängte sie sich um den Hals. Nun waren alle auf die Schienen gesetzt, die Schicksalsbahn konnte anrollen, und sie hatte zum ersten Mal, seit sie die Lose gezogen hatten, eine greifbare Vorstellung von den Einschränkungen ihrer eigenen Zukunft. Sie würde nicht ins All reisen.
»Es fing gut an«, sagte Mecufi.
»Das ist meistens so.«
Mecufi steckte den Ölspender zurück in den Beutel neben seinem Sitz und setzte seine gedrängte Zusammenfassung von Chikus Leben fort. »Das Konzept sah vor, dass Sie alle drei verschiedene Erfahrungen machen und dabei im Grunde ein und dasselbe Individuum bleiben sollten. Jede würde in ein unabhängiges Leben aufbrechen, aber die Leser und Skriptoren in Ihren Köpfen sollten Ihre Erinnerungen streng deckungsgleich halten wie Buchhalter, die mehrere identische Bücher führten. Was eine von Ihnen erlebte, sollten auch die beiden anderen erfahren, nicht durch kontinuierliche Synchronisierung, sondern eher durch regelmäßige Neuorientierung. Doch aus irgendwelchen Gründen entfernten Sie sich allmählich voneinander. Sie blieben zwar in Kontakt, aber die Beziehungen erkalteten, und Spannungen traten auf. Sie hatten nicht länger das Gefühl, vieles gemeinsam zu haben. Natürlich gab es ein Ereignis, das diesen Vorgang katalysierte …«
»Ich dachte, Sie hätten mir etwas zu sagen«, unterbrach ihn Chiku. Sie sah sich nicht als Chiku Gelb, sondern einfach als Chiku. Die Farben dienten dazu, ihre Schwestern im Blick zu behalten, aber nicht sie selbst. »Wenn das alles ist«, fuhr sie fort, »dann können wir auch gleich nach Lissabon zurückfliegen.«
»Wir sind noch nicht bis zu dem Gespenst vorgedrungen.«
»Was ist damit?«
»Eine von Ihnen versucht, den Kontakt wiederherzustellen. Sie haben Ihre Erinnerungen gegen die Leser und Skriptoren abgeschottet, deshalb versucht Ihre Schwester, Sie auf anderem Weg zu erreichen. Wir wissen natürlich, welche von Ihnen es sein muss.«
»Das ist keine große Kunst – wir sind nur noch zu zweit.«
»Ich kann verstehen, wie es zur Entfremdung von Chiku Grün gekommen ist. Je weiter sie sich entfernte, desto größer wurde der Zeitunterschied. Wochen und Monate waren gerade noch zu bewältigen. Aber Jahre? Jahrzehnte? Darauf sind wir nicht eingerichtet. Es ist uns nicht möglich, mit jemandem, der so weit von zu Hause fort ist, eine empathische Beziehung aufrechtzuerhalten. Besonders, wenn einem der andere mit der Zeit wie ein Konkurrent erscheint, der ein besseres und aufregenderes Leben führt. Ein Leben, das einen Sinn hat. Als Sie beide Kinder bekamen, spürten Sie eine Verwandtschaft – Sie hatten etwas vollbracht, und das verband sie. Chiku Grün bekam Ndege und Mposi. Sie bekamen Kanu. Doch als Ihr Sohn sich von Ihnen abwandte …«
»Nicht er hat sich abgewandt. Sie haben ihn dazu verführt, allem untreu zu werden, was er kannte und liebte – seiner Familie, seiner Welt, sogar seiner Art.«
»Wie auch immer, seine Wahl hat Ihnen Kummer bereitet. Danach konnten Sie es nicht mehr ertragen, Chiku Grüns Existenz zu teilen. Sie hassten sie nicht etwa – wie könnten Sie denn auch? Das wäre ja, als würden Sie sich selbst hassen. Aber Sie verabscheuten die Vorstellung, dass eine Version von Ihnen ein besseres Leben haben könnte. Was Ihren Sohn betrifft – da muss ich Sie bitten, nicht uns für Kanus Entscheidungen verantwortlich zu machen.«
»Ich lasse mir nicht vorschreiben, wofür ich Sie verantwortlich mache.«
Mecufi drehte sich auf seinem Sessel um wie ein hyperaktives Kind. Er war offenbar leicht abzulenken. »Sehen Sie, da sind schon unsere Inseln!«
Sie waren in der Nähe der Azoren. Doch die Inselkette vor ihnen war nicht natürlich entstanden. Riesige schwimmende Platten, sechseckig, zehn Kilometer breit, waren so zu Flößen und Archipelen zusammengefügt, dass wiederum größere Inseln mit eigenen gezackten Küstenlinien, Halbinseln, Atollen und Buchten entstanden.
In den Vereinigten Wasser-Nationen gab es Hunderte von einzelnen Insel-Aggregationen. Die kleinsten waren frei bewegliche Mikrostaaten aus einigen wenigen miteinander verbundenen Platten. Daneben gab es Superkolonien aus Tausenden oder Zehntausenden von Bestandteilen, die sich aber in ständigem Wandel befanden – einzelne Platten lösten sich, suchten sich andere Standorte und fügten sich zu neuen Gemeinwesen, Föderationen und Allianzen zusammen. Es gab auch abtrünnige Staaten, selbstständige Einheiten oder krisenanfällige Bündnisse zwischen unabhängigen Seesiedlern und den Landmächten. Für diese instabilen Territorien existierten keine Karten.
»Wo lebt er denn jetzt?«, fragte sie. »Das können Sie mir doch sagen, nicht wahr? Auch wenn Kanu nicht mit mir sprechen will?«
»Ihr Sohn ist noch auf der Erde, aber auf der anderen Seite von Afrika. Er arbeitet im Indischen Ozean mit Kraken.«
»Sie kennen ihn also?«
»Nicht persönlich, nein. Ich weiß jedoch aus sicherer Quelle, dass er ein sehr glückliches und erfülltes Leben führt. Es wäre nicht zum Bruch gekommen, Chiku, hätten Sie nicht versucht, ihn uns abspenstig zu machen. Wenn er Sie seither meidet, können Sie ihm das nicht verdenken.«
»Und mir können Sie nicht verdenken, wenn ich wissen will, wie es meinem Sohn geht.«
»Dann haben Sie sich ja gegenseitig nichts vorzuwerfen.«
Das Flugzeug war tiefer gegangen und langsamer geworden. Es gab keine zwei Platten, die vollkommen gleich gewesen wären. Einige wurden landwirtschaftlich genutzt, dort ragten senkrechte Farmen bis in die Wolken hinein. Auf anderen klebten wie Froschlaich versiegelte Biome, die spezifische terrestrische Ökosysteme kopierten. Wieder andere waren dicht besiedelt. Sie waren von Luftatmern bewohnt, die in stufenförmig übereinander angeordneten Arkologien hausten, blühenden Städten, die einem Ballungsraum auf dem Festland in nichts nachstanden und eigene kleine Wettersysteme mitführten. Andere waren gitterförmig mit eleganten Spiegelflächen überzogen, die der Sonne folgten. Ein paar waren zu Vergnügungszentren voller Spielcasinos und Ferienanlagen geworden. Chiku wusste, dass nahe am Äquator etliche solcher Inseln als Ankerpunkte für Weltraumaufzüge dienten. Doch diese Technologie war bereits von der Entwicklung überholt worden. Inzwischen errichteten die Meerleute über ihren Seesiedlungen einschüchternde schornsteinähnliche Konstruktionen, die über die Atmosphäre hinausragten und eine Vakuumsäule umschlossen. Einer dieser Türme kam jetzt in Sicht, er war aus Glas, und sie konnte ihn nur erkennen, wenn sie ihn direkt ansah. Er strebte zum Zenit empor und schien kein Ende zu nehmen. In seinem Inneren schwebte lautlos wie ein winziger sonnenheller Funke ein Schiff nach oben.
»Erzählen Sie mir, was Sie über das Gespenst wissen.«
»Chiku Grün hat es geschickt, nachdem der normale Kommunikationsweg blockiert war. Es ist ein Datenschwarm, der den Globus umkreist und nach einem Ort zum Landen sucht. Solche Phänomene erregen unsere Aufmerksamkeit. Bedauern Sie, was Sie mit der Blockade angerichtet haben?«
»Ich ging davon aus, dass sie rückgängig zu machen wäre.«
»Und jetzt?«
»Was geschehen ist, ist geschehen.«
Sie hatte bei Quorum Binding den Antrag gestellt, sie von den Gedächtnis-Synchronisationen auszuschließen, und sich damit effektiv von ihren Schwestern abgeschnitten. Doch beim Zusammenbruch der Überwachungsfreien Zone hatte Quorum Binding Konkurs angemeldet, und als die Gläubiger kamen und die Unterlagen prüften, fand sich kein Verfahren mehr, um den Ausschluss wieder aufzuheben. Ein entscheidender Zahlencode war verschwunden.
»Sie hatten die letzte mentale Brücke hinter sich abgebrochen.«
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Es besteht eine Chance, die Brücke wieder instand zu setzen – Sie könnten abermals Erinnerungen empfangen und senden, und Sie könnten die Verbindung zu Chiku Grün wiederherstellen. Um herauszufinden, was sie Ihnen so verzweifelt mitteilen möchte.«
»Definieren Sie ›Chance‹.«
»Sagen wir, die Vorzeichen sind günstig. Aber Sie müssten eine Gegenleistung erbringen. Wir haben den Kontakt zu einer alten Freundin verloren und glauben, dass Sie uns helfen könnten, sie wiederzufinden.«
3
Eine Insel ragte auf wie ein künstlicher Berg mit einer Schneehaube aus terrassenförmig angelegten und mit Balkonen versehenen weißen Gebäuden, die sich über den Rand des Gipfelkraters ergossen – Hotels und Transformationskliniken für all jene, die sich den Meerleuten anschließen wollten. Zwischen den Gebäuden wucherte üppiger Regenwald gleich einer Art Industrieschaum aus allen Ritzen und Spalten. Schwärme von zinnoberroten Vögeln – Papageien oder Sittichen – fegten hektisch durch das dichte Blätterdach. Unterhalb der Hotels stürzten sich schillernde Wasserfälle in die Tiefe, prasselten auf Felssimse mit Seen und Lagunen nieder, die das Fundament für weitere Hotels und Kliniken im Inneren des hohlen Berges bildeten. Langsam um seine Achse rotierend, sank der Flieger in den künstlichen Berg hinab. Den größten Teil der Strecke war es gleißend hell. Sonnenlicht wurde von Spiegel zu Spiegel reflektiert und dahin gelenkt, wo es gebraucht wurde. Vom Fuß der Wasserfälle stiegen Nebelschleier auf.
»Es heißt immer wieder, irgendwann würde die Nachfrage nach unseren Diensten ihren Höchststand erreichen«, bemerkte Mecufi. »Doch tatsächlich ist kein Ende abzusehen. Die Rückkehr ins Meer ist die älteste Sehnsucht der Menschheit – viel älter und viel schwerer zu befriedigen als der einfache und ziemlich kindliche Wunsch, fliegen zu können. Wir waren nie zum Fliegen bestimmt – das ist einer anderen Spezies vorbehalten. Aber wir kamen ursprünglich alle aus dem Meer.«
»Wenn Sie noch ein wenig weiter zurückgehen«, entgegnete Chiku, »kamen wir alle aus dem Urschleim.«
»Wie man hört, legte Ihre Urgroßmutter gegenüber unserer Gründerin den gleichen Zynismus an den Tag. Lin Wei hatte eine visionäre Vorstellung von den Möglichkeiten des Menschen, sie träumte vom Panspermianismus und vom Grünen Frühling. Für Eunice gab es dagegen kein höheres Ziel, als überall ihre Fahne aufzupflanzen.«
»Und was wollen Sie damit sagen?«
»Lassen Sie mich noch einen anderen Namen in die Debatte werfen. June Wing war eine alte Freundin Ihrer Familie, nicht wahr?«
»Nicht dass ich wüsste.«
»Dann sind Sie keine sehr kundige Historikerin. June Wing war – ist – eine Freundin Ihres Vaters Jitendra. Die beiden haben gemeinsam an kybernetischen Problemen gearbeitet. Ebenso wie Ihr Vater ist auch June Wing noch am Leben. Sie ist eifrig im Sonnensystem unterwegs, um altes Zeug für ein Museum zu sammeln.«
»Und inwiefern ist das von Bedeutung?«
»Wir glauben, dass zwischen June Wing und Lin Wei – oder Arethusa, wie sie sich inzwischen nennt – eine Verbindung besteht. Wir möchten sehr gerne mit Arethusa, unserer Gründerin, sprechen. Aber Arethusa antwortet nicht auf unsere Anrufe, und auch June Wing ist nicht unbedingt erpicht darauf, mit uns zu reden. Immerhin wissen wir von June Wing zumindest, wo sie ist und was sie gerade treibt. Wir brauchen bloß noch jemanden, der ihr Vertrauen genießt und in unserem Namen an sie herantreten kann. Und damit kommen Sie ins Spiel.«
»Ich hätte auf Geoffrey hören sollen.«
»Was hat er gesagt?«
»Lass dich niemals mit den Meerleuten ein.«
»Kanu gegenüber haben Sie sich ähnlich geäußert, und was dabei herausgekommen ist, wissen Sie selbst am besten. Aber wenn Sie so viele Gespräche mit Geoffrey geführt haben, dann können Sie mir sicher sagen, was er von Arethusa hielt.«
»Wir hatten viele andere wichtige Themen – Ihre Gründerin stand nicht für jedermann an oberster Stelle.«
Sie dachte an Geoffrey, dem sie nur ein paarmal begegnet war. Natürlich hatten sie miteinander gesprochen, und natürlich hatten sie auch von Arethusa gesprochen, die einmal Lin Wei geheißen, sich aber sehr weit von einer menschlichen Frau entfernt hatte. Doch das waren alte Geschichten.
Sie hatten den Grund des Schachts erreicht. Der Flieger tauchte übergangslos unter. Wasser schlug gegen die Fenster. Die Kliniken, Hotels und Geschäfte setzten sich auch unter der Oberfläche fort, nur waren sie jetzt luftdicht und erstrahlten in hellem Neonlicht. Andere Fahrzeuge und Schwimmer glitten, in Leuchtfarben konturiert, durch das Wasser. Zwischen den Netzen und Schirmen der Wasserpflanzen entdeckte Chiku Schwärme von glitzerblauen Fischen und Korallengebilde in unglaublichen Pastellfarben. Von Schwimmern beaufsichtigt, half ein riesiges biomechanisches Ungeheuer, das aussah wie eine Kreuzung zwischen Hummer und Tintenfisch, vorgefertigte Bauteile einzupassen. Chiku stellte sich vor, welchen Schaden es mit seinen Klauen und Tentakeln anrichten könnte, und beobachtete es mit Unbehagen, aber die Schwimmer schienen sich von ihrem braven Helfer nicht bedroht zu fühlen.
»Ein Bau-Krake«, bemerkte Mecufi, als wäre das Ungeheuer eine ganz alltägliche Erscheinung. »Kanu arbeitet mit den gleichen Tieren. Sie sind eigentlich sehr gutmütig, wenn man sie erst näher kennenlernt.«
Durch einen beleuchteten horizontalen Tunnel glitten sie in die riesigen Gewölbe des künstlichen Berges.
»Wie wir feststellen konnten, ist das Gespenst eine Botschaft von Ihrer Schwester auf dem Holoschiff«, sagte Mecufi. »Erzählen Sie mir von der anderen Chiku – von Chiku Rot, die nicht zurückkehrte.«
»Was gibt es da zu erzählen?«
»Tun Sie mir den Gefallen.«
Chiku seufzte. »Eunice hatte ein Schiff mit Namen Winterkönigin. Sie hatte es auf all ihren Expeditionen im Sonnensystem benutzt. Bevor irgendjemand vom Chibesa-Prinzip auch nur gehört hatte, rüstete sie das Triebwerk der Winterkönigin auf, startete das Schiff und flog damit in den interstellaren Raum. Ein bestimmtes Ziel hatte sie nicht – es war eine Herausforderung, ein hingeworfener Fehdehandschuh. Mit der Zeit fand man heraus, wie weit sie sich entfernt hatte. Aber niemand hielt es irgendwie für möglich, sie einzuholen.«
»Bis auf Chiku Rot.«
»Es hatte gewisse Verbesserungen in der Triebwerkskonstruktion gegeben, die es einem Schiff gestatteten, Eunice zu erreichen und auch wieder zurückzukommen, aber das erforderte immer noch radikale Beschränkungen – nicht mehr als ein Passagier, ein absolutes Minimum an Redundanzsystemen, kein Back-up, wenn irgendetwas ausfiel. Man rechnete mit sechzig Jahren, um Eunice zu erreichen, noch mehr als das war nötig, um abzubremsen, zu wenden und zurückzukehren.«
»Was genau war das Ziel der Mission? Die Winterkönigin zurückzuholen – oder Ihre Urgroßmutter?«
»Es ging nicht darum, sie nach Hause zu bringen. Ihren Körper vielleicht. Und die Geheimnisse, die sie womöglich mitgenommen hatte.«
»Sie hätte vermutlich nicht gewollt, dass diese Geheimnisse zur Erde zurückfänden.«
»Da kannten Sie meine Urgroßmutter schlecht. Noch von jenseits des Grabes hat sie ihre Familie auf eine Art kosmische Schnitzeljagd geschickt. Vielleicht war auch dies eine solche Aufgabe. Wir hofften einfach auf irgendetwas.«
»Eine neue Physik, die noch über das Chibesa-Prinzip hinausging?«
»Wer weiß?« Chiku zuckte die Achseln. Das Verhör begann sie zu langweilen. »Es gab nur eine Möglichkeit, es herauszufinden. Man musste hinterherfliegen und nachsehen.«
»Und was wurde aus Chiku Rot?«
»Sie kehrte nicht zurück. Ihr Schiff – die Memphis – schickte eine Nachricht, es befinde sich im Anflug auf die Winterkönigin und hätte den Aufwachprozess für Chiku Rot eingeleitet. Danach kam nichts mehr. Es war das Letzte, was man von ihr gehört hat.«
»Sie gehen also davon aus, dass sie da draußen ums Leben gekommen ist?«
»Im Alter war meine Urgroßmutter sehr argwöhnisch geworden. Sie hatte bereits auf ihrer Raumstation und einem Eis-Asteroiden Verteidigungsanlagen installiert, um Eindringlinge im Vorfeld abzuwehren. Etwas in dieser Art ist wohl auch dem Schiff von Chiku Rot zum Verhängnis geworden.«
»Vielleicht ist auch nur die Kommunikation abgerissen.«
Die Maschine tauchte in einer kuppelförmigen, zur Hälfte mit Wasser gefüllten Höhle wieder auf. Sie war zuerst ein Flieger, dann ein Unterseeboot gewesen, nun wechselte sie mühelos in die Rolle des Bootes. Als sie sich einer Anlegestelle näherte, öffnete sich eine weitere Tür in ihrem Rumpf, diesmal allerdings nicht im Bauch, sondern an der Seite. Mecufis Exoskelett kehrte zurück, hob seinen Schützling sanft aus dem Sessel und nahm ihn in seine Obhut.
»Chiku Rot ist nie nach Hause gekommen.«
»Selbst wenn … was hätte das geändert?«
Sie stiegen aus. Feuchtwarme Luft empfing sie. Um die Kuppel zogen sich bis zum Scheitelpunkt konzentrische Kreise von Fenstern und Balkonen. Über dem Flieger hing an unsichtbaren Drähten, von Scheinwerfern angestrahlt, das mächtige Skelett eines Plesiosauriers. Seine Flossen waren in der Paddelbewegung erstarrt.
»Schluss mit den Spielchen«, protestierte Chiku. »Ich bin eine Akinya. Wir lassen uns nicht gern zum Narren halten.«
»Früher einmal«, entgegnete Mecufi, während ihn sein Exo an den Rand des Bootsstegs trug, »hätte diese Aussage vielleicht noch ein Körnchen Wahrheit enthalten.«
Neben dem Bootssteg schaukelte ein durchsichtig eisblaues Boot auf den Wellen, die der Flieger erzeugt hatte. Sein Bug war wie der Hals und der Kopf eines Schwans geformt. Mecufi ließ sich aus dem Exo ins Wasser gleiten und verschwand unter der Oberfläche. Sekunden später tauchte er blinzelnd wieder auf, rieb sich lächelnd das Wasser aus den großen dunklen Augen und schwamm auf dem Rücken wie ein Seeotter. Sein Körper wirkte mit einem Mal elegant und athletisch.
»Was soll ich jetzt tun?«
»Sie können schwimmen, wenn Sie möchten – es ist nicht weit –, aber vielleicht nehmen Sie doch lieber das Boot.«
Chiku ging auf den Vorschlag ein. Das Boot war ein Zweisitzer mit sehr rudimentärer Steuerung – ähnliche Fahrzeuge konnte man anderswo stundenweise mieten, um auf einem See herumzuschippern. Mecufi schwamm voraus, das Boot folgte ihm. Vom Bootssteg führte ein Kanal aus der Höhle und durch Korridore mit leuchtend grünen Wänden, die sich immer wieder verzweigten. Einmal kam ihnen ein Schwimmer entgegen, ein älterer Wasserbewohner, doch Chikus Boot war weit und breit das einzige. Das wurde ihr mit der Zeit sogar peinlich, so als hätte man ihretwegen besondere Umstände gemacht, weil sie zum Schwimmen zu ungeschickt war.
Nach einer Weile gelangten sie in eine weitere Höhle, und Mecufi zog sich auf ein Sims mit Geländer, das auf Höhe des Wasserspiegels an der Wand entlangführte. Chikus Boot kam zum Stillstand und nickte mit seinem Schwanenkopf, als sie hinauskletterte. Von der Decke hing senkrecht ein Raumschiff wie ein mit Verzierungen überladener Kronleuchter.
Chiku blieb der Mund offen stehen, als sie erkannte, was sie da vor sich sah, doch Mecufi kam ihr zuvor.
»Chiku Rot istdoch nach Hause gekommen – das ist ihr Schiff, die Memphis. Wie Sie sehen, ist es ziemlich schwer beschädigt.«
Chiku sprach zunächst einmal kein Wort. Es war zu viel, um es zu begreifen, die Auswirkungen einzuschätzen und zu bedenken. Nichts in ihrem langen Leben hatte sie auf diesen Anblick vorbereitet.
Endlich sagte sie langsam und ruhig: »Das ist entweder ein schlechter Scherz oder ein Skandal.«
»Wir entdeckten das Schiff auf seinem Weg durch das System und konnten berechnen, dass es zu schnell unterwegs war, um vom Schwerkraftfeld der Sonne eingefangen zu werden. Daraufhin haben wir Ihnen einen Gefallen getan und es geborgen.«
»Sie hatten kein Recht, so etwas vor meiner Familie geheim zu halten.« Chiku umfasste das Geländer fester. Sie zitterte vor Empörung. »Woher wissen Sie überhaupt, dass das Schiff echt ist?«
»Eine ausgezeichnete Frage – anfangs hielten wir es für möglich, dass jemand uns einen Streich spielen wollte. Wir brachten das Schiff hierher zurück, untersuchten es Stück für Stück, führten alle erdenklichen Tests durch und kamen schließlich zu dem Ergebnis, dass es sich tatsächlich um die Memphis handelt und sie aus dem All zurückgekehrt ist. Das hat viel Zeit in Anspruch genommen, und wir sahen auch keinen Grund zur Eile.«
»Wie lange ist es schon hier?«
»Nicht allzu lange. Ein paar Jahre.«
Mecufi glitt ins Wasser zurück und schwamm im Becken umher. Chiku folgte ihm vorsichtig auf dem Sims.
»Wie lange genau?«
»Zwölf, seit wir sie zur Erde zurückbrachten. Entdeckt haben wir sie vor fünfzehn Jahren. Kaum der Rede wert verglichen mit den einhundertzweiundzwanzig Jahren, die sie da draußen unterwegs war.«
»Das werden Sie noch büßen.«
»Wohl kaum, wenn Sie erst den Rest gehört haben. Leider war Chiku Rot mit den Mitteln der Medizin nicht mehr wiederzubeleben – aber dass diese Reise ein Vabanquespiel war, wussten Sie ja von vornherein.«
Chiku betrachtete das hängende Schiff und fragte sich, ob es möglich war, dass Mecufi die Wahrheit sagte. Es hatte die richtige Form, und vom Äußeren her wirkte es auch angemessen antiquiert. Die Memphis war das beste Schiff, das man zur Zeit des Starts mit Geld hatte kaufen können – sie hatte das hochwertigste Triebwerk und die modernsten und sparsamsten Steuerungs-, Navigations- und Lebenserhaltungssysteme gehabt. Man hatte alles so lange radikal auf das Wesentliche reduziert, bis das Schiff bloß noch aus Muskeln und Nerven bestand und nirgendwo ein einziges überflüssiges Molekül zu finden war. Das Lebenserhaltungsmodul war winzig wie ein verkümmertes Organ, während Triebwerk und Treibstofftanks überdimensioniert, ja geradezu aufgebläht wirkten.
Auch Schäden waren zu erkennen. Einzelne Teile waren weggeschossen oder abgesprengt worden. Überall gähnten faustgroße Löcher. Es gab Brandspuren und Beulen. Es hatte nicht nur die üblichen Strapazen des Weltraumflugs hinter sich, sondern ordentlich Prügel bezogen.
»Was ist mit meiner Urgroßmutter?«
»Von ihr gibt es keine Spur. Ich erstelle Ihnen eine Motio, wenn ich Sie damit leichter überzeugen kann.«
»Wie ist es möglich, dass von ihr nichts mehr vorhanden war?«
»Wir fanden zwei Truhen an Bord der Memphis – in der einen lag Chiku Rot, die andere war vermutlich für Eunice bestimmt, falls Chiku sie gefunden hätte. Doch als wir das Schiff bargen, war die zweite Truhe nie benützt worden.«
Wieder schwirrte Chiku der Kopf. Zuerst das Schiff ihrer Schwester, nun die Nachricht, dass ihre Urgroßmutter aus dem Schiff verschwunden war, das Chiku Rot hatte suchen sollen.
»Wo ist sie dann?«
»Keine Ahnung. Nach den Schäden an der Memphis sind wir ziemlich sicher, dass sie bis in die Nähe der Winterkönigin gekommen ist – die Löcher und Brandspuren lassen auf Antikollisions-Systeme schließen, die zu empfindlich eingestellt waren. Alles Weitere ist Spekulation. Die Kommunikationssysteme waren beschädigt, und es gab weder Back-ups noch Ersatzteile an Bord – als bei dem Angriff die Antenne zerstört wurde, konnte Chiku sie nicht ersetzen.«
»Sie können also nicht mit Sicherheit sagen, dass die Memphis jemals an der Winterkönigin angedockt hat. Vielleicht hat sie sich zurückgezogen, als sie angegriffen wurde, und kam deshalb nie dazu, einen Blick ins Innere zu werfen.«
»Das können wir natürlich nicht ausschließen«, räumte Mecufi ein. »Aber wäre es nicht sehr untypisch für eine Akinya – auf den letzten Metern aufzugeben, nachdem sie so weit gekommen war? Wenn Sie ehrlich sind, müssen Sie das zugeben.«
»Ich weiß nicht, was ich denken soll, davon abgesehen, dass ich Ihre Einmischung in Akinya-Belange empörend finde. Und was hat das alles mit der Begründung zu tun, mit der Sie mich überhaupt hierhergelockt haben? Das Gespenst wurde von Chiku Grün geschickt, nicht von Chiku Rot.«
»Nach meiner Erfahrung«, entgegnete Mecufi, »stellt sich letztlich fast immer heraus, dass alles miteinander in Zusammenhang steht.«
Nicht weit vom Schiff entfernt befand sich eine Höhle mit weißen Wänden, hell erleuchtet und von einer aggressiven Sterilität, die Chiku an einen Operationssaal oder an ein Leichenschauhaus erinnerte. Eine Handvoll Techniker, Meerleute in Exoskeletten, bedienten eine Reihe von senkrechten Konsolen, die eine Kälteschlaftruhe umstanden wie ein Ring von Menhiren. Der Form nach stammte der eckige Sarg aus den Anfängen des dreiundzwanzigsten Jahrhunderts. Er stand auf einem Sockel und war über ein Gewirr von Röhren und Kabeln mit einem provisorischen Versorgungssystem verbunden. Auf den schräg stehenden Konsolenflächen waren Bildschirme und altmodische Bedienungselemente zu sehen, die wie die Knöpfe eines Akkordeons angeordnet waren. In dieser Hinsicht waren die Meerleute wie die Kinder, sie wollten immer irgendwelche Dinge, auf die sie drücken konnten.
Chiku sah Graphen und Bilder, begleitet von Analysewerten, über die Schirme huschen. Temperaturprofile, chemische Gradienten, neuronale Querschnitte, Großaufnahmen der Hirnanatomie bis hinunter zur Synapsenebene.
Unter dem Rauchglasdeckel der Truhe lag eine schlafende Gestalt.
Sie trug ein Gesicht, das Chiku so gut kannte wie ihr eigenes.
»Sie sagten doch, sie sei tot.«
»Ich sagte, sie könne nicht wiederbelebt werden«, verbesserte Mecufi bedächtig. »Das ist nicht ganz dasselbe. Die Truhe hat sie auf der gesamten Rückreise in diesem Zustand erhalten. Sie schwebt am Rande des Todes oder am Rande des Lebens, je nachdem, wie man es sehen will.«
»Warum haben Sie sie nicht aufgeweckt?«
»Dafür ist sie nicht stabil genug. Diese neuronalen Scans … die Auflösung ist nicht höher, als es die in die Truhe integrierten Instrumente zulassen, und von denen sind die meisten ohnehin defekt. Wir können nicht weiter in ihren Kopf eindringen, ohne irreversible Schäden zu riskieren.«
»Dann öffnen Sie die Truhe. Schleusen Sie Nanos in ihr Gehirn ein. Leser und Skriptoren. Stabilisieren Sie die Hirnstruktur, und leiten Sie die Wiederbelebung ein. Das ist ein Kinderspiel, Mecufi. Mein Kopf wurde schon einmal von Maschinen in seine Bestandteile zerlegt – um aus mir drei zu machen.«
»Unter kontrollierten Bedingungen und ausgehend von einem intakten Bewusstsein. Das ist hier nicht der Fall. Sie ist eine Eisskulptur, Chiku – der kleinste Eingriff wäre so verheerend, als würde man mit einem Schweißbrenner auf sie losgehen.«
»Sie gehört mir – sie ist ich. Ich will sie zurückhaben. Ich will über mich selbst verfügen.«
»Natürlich gehört sie Ihnen, das war immer so. Sie können sie auf ewig in diesem Zustand erhalten, wenn Sie Glück haben. Oder wenn sie Glück hat. Oder Sie können das Risiko eingehen und sie ins Leben zurückholen, wenn Sie sich das zutrauen.«
»Das hat die Familie zu entscheiden. Sie sind bereits viel zu weit gegangen – sie so lange hier liegen zu lassen, ohne jemanden von uns zu informieren … nach irgendeinem Gesetz muss das ein Verbrechen sein.«
»Dann sollten Sie sich fragen, wieso wir Ihnen jetzt von ihr erzählen, auf die Gefahr hin, dass wir uns damit juristische Schwierigkeiten einhandeln. Es muss doch einen Grund dafür geben.«
»Dies wäre ein sehr guter Zeitpunkt, ihn mir zu nennen.«
»Sie hat ein Implantat im Kopf, ein Implantat, das von Quorum Binding eingesetzt wurde und die Leser und Skriptoren steuert. Es ist identisch mit dem, das man Ihnen eingesetzt hat, nur ist der numerische Schlüssel bei ihr noch vorhanden. Sie hat nicht beschlossen, ihn zu vergessen.«
Allmählich dämmerte Chiku, was das bedeutete, und sie erschauerte.
»Es müsste derselbe Schlüssel sein wie bei mir.«
»Sie nehmen mir das Wort aus dem Mund. Das Gespenst ist eine Botschaft von Chiku Grün, aber Sie können nicht mit ihr sprechen. Chiku Rot könnte es – aber sie ist eingefroren. Ein Eingriff könnte sie töten … wenn wir allerdings ihren Schädel öffnen und das Implantat entnehmen könnten – es müsste sehr schnell gehen –, dann hätten wir gute Chancen, den numerischen Schlüssel zu isolieren. Anschließend könnten wir ihn auf Ihr Implantat übertragen, und Sie könnten mit dem Gespenst von Chiku Grün in Verbindung treten. Das Gespenst muss eine sehr wichtige Nachricht für Sie haben – möchten Sie nicht wissen, worum es sich handelt?«
Chiku wandte sich wieder der schlafenden Gestalt zu. »Auf ihre Kosten?«
»Sie ist nicht am Leben. Sie würden ihr nichts wegnehmen.«
»Außer der Möglichkeit, jemals wieder leben zu können.«
»Sie hatte ein Leben. Niemand hat sie gezwungen, es aufs Spiel zu setzen.«
Chiku kniff die Augen zusammen. »Warten Sie – Sie sagten eben, es müsste sehr schnell gehen. Warum hat es solche Eile?«
»Die Implantate – das ihre wie Ihr eigenes – sind gegen unbefugte Eingriffe gesichert. Wenn die Implantate registrieren