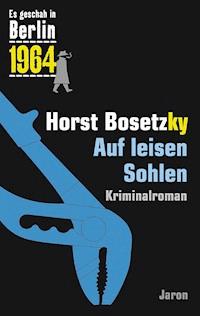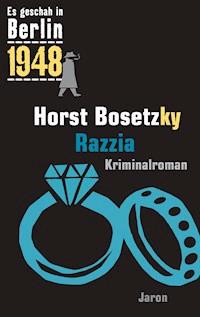Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jaron Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tapfere Ritter, blutige Kreuzzüge und erotische Minnegeschichten – mit viel Ironie nimmt Altmeister Horst Bosetzky den Leser mit auf eine Reise in ein längst vergangenes Zeitalter. In seinen Mittelalter-Geschichten lässt er die Anfänge der Mark Brandenburg und der Stadt Berlin wiederaufleben und gibt eine Geschichtsstunde der besonderen Art. Vor dem Hintergrund herausragender historischer Ereignisse – wie dem Kampf Ottos IV. gegen die Magdeburger 1280 oder der Ernennung des Hohenzollern-Fürsten Friedrich VI. zum Verwalter der Mark-Brandenburg im Jahr 1415 – entfaltet der Bestsellerautor spannende Abenteuer um phantastische Helden. Diese Helden stammen aus den unterschiedlichsten Ständen und unterhalten den Leser mit ihrer gewieften und gerissenen Art. Sie greifen mit ihrem Handeln entscheidend in die geschichtlichen Ereignisse ein und tragen nicht selten zum Umschwung der Geschehnisse bei. Horst Bosetzkys Mittelalter-Geschichten, teils bereits in Einzelbänden erschienen, teils noch unveröffentlicht, garantieren nicht nur ein kurzweiliges, sondern auch ein lehrreiches Lesevergnügen. Wer erfahren möchte, warum die Hohenzollern für Jahrhunderte das Sagen hatten in der Region oder warum die Berliner schon immer ein aufmüpfiges Völkchen waren – der Autor erklärt es mit Witz und Phantasie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 750
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horst Bosetzky
Otto mit dem Pfeil im Kopf
Phantastische Geschichten um die Entstehung von Berlin und Brandenburg
Jaron Verlag
1. Auflage 2015
© 2015 Jaron Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.
www.jaron-verlag.de
Umschlaggestaltung: Bauer+Möhring, Berlin, unter Verwendung einer historischen Abbildung der Universitätsbibliothek Heidelberg
(Markgraf OttoIV. von Brandenburg, Manessische Handschrift, um 1300)
Satz und Layout: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2015
ISBN 978-3-95552-214-8
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Zu diesem Buch
Anno 1157
Die Eroberung der Brandenburg
Anno 1190
Mord im Kloster Lehnin
Anno 1245
Kampf um den Teltow
Anno 1280
Otto mit dem Pfeil im Kopf
Anno 1325
Als die Berliner den Propst erschlugen
Anno 1348
Der falsche Waldemar
Anno 1415
Triumph der Hohenzollern
Anno 1448
Der Berliner Unwille
Zu diesem Buch
Die fabelhaften – teilweise auch weiblichen – Helden unserer Mittelalter-Novellen sind klassische Abenteurer: stark, intelligent, einfallsreich, witzig und schön. Sie kommen aus allen Ständen und Schichten Europas und erfreuen uns in den unterschiedlichsten Rollen, sind sich aber von ihrem grundsätzlichen Fühlen und Denken her immer sehr ähnlich: edel, hilfreich und gut, aber auch listig, humorvoll und mit einer gehörigen Chuzpe ausgestattet. Sie betreten immer dann die Szene, wenn in unseren Breiten ein besonderes historisches Ereignis stattfindet.
Jeder Novelle liegt eine wichtige geschichtliche Begebenheit zugrunde, womit die vergnügten und kurzweiligen Erzählungen um unsere fabelhaften Figuren zu einer lehrreichen und packenden Geschichtsstunde werden. So manches historische Detail, das bis heute unerforscht ist, wird erst durch sie anschaulich. In der Regel entschärfen und lösen die Helden Konflikte, fördern das Gute, bekämpfen das Böse und greifen mit ihren Taten entscheidend in die geschichtsträchtigen Geschehnisse ein. Mit ihnen an der Hand werden die Ursprünge der Mark Brandenburg und der Stadt Berlin auf höchst vergnügliche Weise wieder lebendig. Die Fakten stimmen, und alle Großen der Welt, mit denen sich unsere Protagonisten auseinandersetzen, haben wirklich gelebt, das übrige Personal aber ist frei erfunden.
Zur besseren Orientierung gibt es am Anfang einer jeden Geschichte einen kurzen historischen Überblick und am Schluss eine »Besetzungsliste«.
Die hier versammelten acht Mittelalter-Novellen erschienen zum größeren Teil bereits in Einzelbänden. Das Interesse unserer geschätzten Leserschaft ermunterte uns, sie in bearbeiteter Form neu herauszubringen und durch zwei noch unveröffentlichte Geschichten zu ergänzen.
Horst Bosetzky, im Sommer 2015
Anno 1157
Die Eroberung der Brandenburg
Im Jahre 1157 wird Ritter Ulric von Huysburg in die Nordmark geschickt, das Land zwischen Elbe und Oder, das die Germanen in den Zeiten der Völkerwanderung verlassen haben und in dem sich verschiedene Stämme der Slawen angesiedelt haben: an der Havel die Heveller und an der Spree die Sprewanen. Es gibt nur wenige Burgen und Dörfer, alles ist noch die berühmte unberührte Wildnis. Markgraf der Nordmark ist zwar formell Albrecht der Bär, ein Fürst aus dem Hause Askanien, aber viele wollen ihm die Herrschaft streitig machen, vor allem der Sprewanenfürst Jaxa von Cöpenick, ein Vasall der polnischen Piasten.
Eine Entscheidungsschlacht steht an, für Ulric von Huysburg gibt es viel zu tun, und die Liebe kommt ihm auch noch dazwischen.
Eins
Ulric von Huysburg kam aus dem Harzvorland, wo er auf der Burg Falkenstein einige Tage bei einem Freund zu Gast gewesen war. An einem schönen Frühlingsmorgen ritt er mit seinen beiden Knappen Cuntz und Bogdan-Otto an der Nuthe entlang, meist auf schmalen Pfaden am westlichen Ufer, manchmal auch im seichten Wasser des Flüsschens. Ihr Ziel war Spandow, wo die Askanier dabei waren, auf dem Gelände älterer slawischer Wälle eine feste Burg anzulegen und damit ein Gegengewicht zu Cöpenick zu schaffen, wo der Sprewanenfürst Jaxa residierte. Die Sonne wärmte alle mit ihren schon kraftvollen Strahlen, doch es spross noch kein Grün an den Zweigen, und der Boden war aufgeweicht vom gerade weggetauten Schnee.
Cuntz, der eine Weile in Italien gelebt hatte, fluchte vor sich hin: »Ach, Varus, warum hat die kultivierte Welt aus deiner Niederlage nichts gelernt und sich damals nicht geschworen, ein für alle Mal auf dieses Dreckland aus Morast und Urwald zu verzichten!«
Bogdan-Otto protestierte: »Ich sage dich, die Weiterrrkeit von die Askanierrr tut lügen zwischen die Fluxe Elbe und Odra!« Er war ein Heveller, ein Slawe also, der zum Christentum übergetreten war, und glaubte, der Segen für sein Land komme ausschließlich von Papst und Kaiser. Mit der deutschen Sprache hatte er noch immer seine Schwierigkeiten.
Ulric stimmte ihm zu, denn seinem Geschichtsbild zufolge hatten nur jene Königreiche und Herzogtümer, die auf Expansion angelegt waren, eine Chance, auf Dauer zu bestehen. Andere Länder erobern, andere Völker für sich arbeiten lassen – das war das gängige Rezept. Und die Askanier, die Welfen und die Wettiner hatten das begriffen.
Seine Knappen wollten dieses Thema nicht vertiefen, sie redeten lieber von den schönen Frauen, die es auf den Burgen gab, und Cuntz, der ein begabter Minnesänger war, ließ sich animieren, ein paar Verse zu singen:
Ich wirbe umbe allez, daz ein man
ze wereltlichen fröiden iemer haben sol:
daz ist ein wîp, der ich enkan
nâch ir vil grôzem werdekeit gesprechen wol.
Bogdan-Otto winkte ab. »Immerrr, wenn ich eine Frau belegen will, schlägt sie mirrr ab. Eine Hevellerrr wille ich nücht, trrrompetet die Weiber. Von wegen Frrröiden!«
Cuntz riet ihm, es einmal in den großen Städten zu versuchen, wo man sich die körperliche Liebe kaufen konnte, und schwärmte von den Flötenmädchen, die es im alten Griechenland gegeben hatte. »Das waren die aulétides, von aulos, die Flöte. Sie unterhielten die Männer zuerst mit ihrem Flötenspiel, bevor sie mit deren Flöte spielten.«
Er wollte das gerade sich und Bogdan-Otto weiter ausmalen, als von jenseits der Nuthe ein Pfeil herangeflogen kam, seinen Rücken durchbohrte und ihm im Herzen steckenblieb. Er schrie auf, stürzte vom Pferd und verstarb noch im selben Augenblick.
Ulric von Huysburg, der seinen Knappen vorangeritten war, fuhr herum, begriff, was geschehen war, und hatte nur noch einen Gedanken: den feigen Todesschützen zu fassen und seiner gerechten Strafe zuzuführen. »Los, Bogdan-Otto, mir nach!«
Damit gab er seinem Pferd die Sporen, sprengte in die flachen Wasser der Nuthe und jagte zum anderen Ufer hinüber. Was anfangs wie ein Kinderspiel erschien, wurde schnell zu einem schwer lösbaren Problem, denn bald verfingen sich die Hufe ihrer Tiere im dick verfilzten Unterholz, und sie mussten absitzen, um sich mit ihren Schwertern einen Weg zu bahnen. Der Schütze, der mit Sicherheit zu Fuß gekommen war, hatte es da wesentlich leichter. Ulric glaubte aber, dass er sich noch immer in der Nähe versteckt hielt, um seine nächsten Pfeile abzuschießen. Gute Zielscheiben boten sie ja.
»Vorsicht!«, rief Ulric von Huysburg. »Nicht auf die Lichtung!«
Bogdan-Otto zügelte sein Pferd. »Eherrr wir wünschen zu finden eine Haarrrnadel im Haufen Mist wie den Pfeilscheißerrr hierrr in die Dickicht.«
»Eine Stecknadel im Heuhaufen«, korrigierte ihn Ulric, der wusste, dass eine Integration der Slawen ins Heilige Römische Reich nur gelingen konnte, wenn sie die deutsche Sprache perfekt beherrschten. »Aber du hast recht, es ist vergebene Liebesmüh. Doch …« Er stockte und sah nach links und rechts. »Dies hier scheint eine Art Straße zu sein.«
»Eherrr was, wo sich Wild verrrwechselt«, befand Bogdan-Otto.
»Wo ist da der Unterschied?«, brummte Ulric von Huysburg. »Östlich der Elbe gibt es keine Straßen. Euer Pech, dass es die Römer nicht bis hierher geschafft haben.«
»Ritterrrn wir auf dieses Pfad hoch nach Spandow?«, wollte Bogdan-Otto wissen.
»Nein«, entschied Ulric, »wir müssen Cuntz ordentlich begraben.«
Der Slawe hob den Kopf, um besser hören zu können. »Was hat sich da verwieherrrt vor uns? Eine Pfärrrde?«
»Das wird der Gaul sein, auf dem Cuntz geritten ist.«
»Nein, hierrr auf unsrrrige Seite von die Flux.«
»Dann los, lass uns nachsehen, wer da unterwegs ist.« Ulric lenkte seinen Rappen in die angegebene Richtung. »Aber aufgepasst, vielleicht haben wir es mit einem ganzen Trupp von Sprewanen zu tun.«
Nach knapp drei Minuten trafen sie auf eine Kolonne, bestehend aus einem Frachtwagen und drei Packtieren. Ein paar Männer sprangen sofort ins Gebüsch, als sie den askanischen Ritter mit seinem Knappen hinter sich bemerkten, nur der Händler selbst, der auf dem Kutschbock des Frachtwagens saß, entschloss sich standzuhalten. Wahrscheinlich hätte er sich bei seinem Alter auch den Knöchel gebrochen, wäre er auf die Erde gesprungen.
»Bande Mörderrr ihrrriges!«, schrie Bogdan-Otto den Fliehenden hinterher.
Ulric von Huysburg hielt auf Höhe des Händlers und fragte ihn nach seinem Namen und woher er käme.
»Nebojša aus Jutribuc.«
»Aha, Jüterbog.« Ulric erinnerte sich daran, dass der Magdeburger Erzbischof Wichmann gerade ansetzte, die Stadt zu erobern, um von dort aus die Kreise der Askanier nachhaltig zu stören. Von Jüterbog aus konnte man den Fernhandel kontrollieren und hatte damit viele Trümpfe in der Hand. »Und wohin willst du?«
»Nach Poztupimi, Herr.«
»Potsdam, hm. Und auf dem Wege dorthin schwärmen deine Leute aus und schießen mit ihren Pfeilen auf askanische Ritter!«
»Nein, Herr«, beteuerte Nebojša, »wir sind friedliche Leute.«
»Und was sehe ich da an dem Lastpferd hängen? Einen Bogen! Wahrscheinlich ist es der, von dessen Sehne der Pfeil geschnellt ist, der meinen Knappen getötet hat.«
»Ich weiß von nichts«, versicherte der Händler.
»Lüge nicht so frech!« Ulric zog sein Schwert und drückte dessen Spitze so fest auf den Adamsapfel des Slawen, dass es blutete. »Wer war es? Hast du den Auftrag dazu gegeben?«
»Nein, Herr!«
Ulric mochte den Slawen, ohne sagen zu können, warum. Auch war er keiner, der jemanden ohne Gerichtsverhandlung und Schuldanerkenntnis dem Henker übergeben hätte. Hier allerdings war weit und breit kein Richter.
»Mach kurrrzes Prrrotest mit dieses Mann!«, drängte Bogdan-Otto.
»Sonst trrrifft dich nächste Feile von seine Knächte.«
»Nein«, entschied Ulric. »Ich, Ulric von Huysburg, schenke dir das Leben, Nebojša, was auch immer hier geschehen ist! Ziehe dahin und siehe zu, dass die Deinen ehrliche Menschen werden!« Damit riss er sein Pferd herum und ritt zurück in Richtung Nuthe.
Bogdan-Otto folgte ihm schimpfend. »Wie sagen du immerrr? Jede gütige Handlung gäht sich nach hinten los.«
Ulric stöhnte auf. »Jede gute Tat rächt sich einmal! Das ist aber totaler Unsinn, denn im Lukas-Evangelium steht geschrieben: Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, also tut ihnen auch. Tue ich Gutes, wird auch mir Gutes getan.«
»Wenn ich das ins Ohrrr nehme, hätte ich lieberrrs bleiben sollen eine Heide«, murmelte Bogdan-Otto.
Nach einigem Hin und Her fanden sie ihre eigene Fährte wieder und auf ihr zur Nuthe zurück. Jetzt galt es, Cuntz auf angemessene Art und Weise zu begraben. Ulric hieß den Knappen Bogdan-Otto, sein Schwert zu nehmen und es als Spaten zu benutzen.
»Das entehrrrt meine Schwerrrt«, reimte Bogdan-Otto.
Ulric lachte. »Dann nimm meines!«
So versuchte es also der Knappe mit dem Schwert seines Herrn, während Ulric selbst seine Lanze benutzte, um eine Grube auszuheben, die tief genug war, um Cuntz’ Leichnam davor zu bewahren, von Bären, Wölfen und Luchsen gefressen zu werden. Sie schufteten im Schweiße ihres Angesichts, immer in Gefahr, vom nächsten Pfeil erwischt zu werden. Aber Ulric hatte ihre beiden Pferde so angebunden, dass sie einen lebenden Wall zwischen dem Grab und der Nuthe bildeten. Nachdem sie ihre Hände als Schaufeln eingesetzt hatten, war es endlich so weit, dass sie den armen Cuntz in die Grube hinablassen konnten.
Sie sahen auf den Toten hinab und falteten die Hände.
Ulric von Huysburg sprach die letzten Worte: »Dein Leben war kurz, und du wärst ein gefeierter Sänger geworden, aber wer sein Leben erhalten will, der wird’s verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird’s finden. So steht es bei Markus. Und du, lieber Cuntz, bist gestorben, weil du die Worte des Herrn ins Land zwischen Elbe und Oder tragen wolltest. Der Herr segne und behüte dich, Friede deiner Asche!«
Während nun Bogdan-Otto die aufgeworfene Erde in die Grube schob und einen Grabhügel aufhäufte, zimmerte Ulric mit Hilfe seines Schwertes und seines Dolches ein Kreuz und schnitzte den Namen Cuntz und die beiden Jahreszahlen ins weiche Holz: * 1134 † 1157.
Als das erledigt war, setzten sie schweigend und in gedrückter Stimmung ihren Ritt nach Spandow fort.
Im Refektorium des Benediktinerklosters zu Ballenstedt saß im Frühjahr 1157 Albrecht der Bär mit seinen Söhnen und Töchtern beisammen, um Rat zu halten.
»Wir sind umgeben von Feinden«, klagte er. »In Magdeburg hat der Erzbischof großen Hunger auf neue Ländereien, in Braunschweig ist es Heinrich der Löwe, in Meißen der Markgraf, in Thüringen der Landgraf, in Polen sind es die Piasten und in Böhmen die Přemysliden …«
»Was höre ich da?«, rief Gertrud, die seit 1153 mit einem Přemysliden verheiratet war. »Mein Mann wird die Kreise seines Schwiegervaters ganz sicher nicht stören. Und außerdem will er im nächsten Jahr mit dem Barbarossa nach Italien ziehen.«
»Ja, auf deine Töchter kannst du bauen!«, stimmte Hedwig ihr bei. Sie hatte mit fünfzehn Jahren Otto den Reichen aus dem Geschlecht der Wettiner zum Manne genommen. »Wenn Otto Markgraf wird, und das ist in Kürze der Fall, dann werde ich ihn schon davon abzuhalten wissen, einem Askanier in die Quere zu kommen.«
Albrechts Sohn Otto mischte sich ein: »Schön wär’s! Die Wettiner drängen zur Ostsee, und daran kann sie auch keine Hedwig von Ballenstedt hindern. Unser Vater möge noch lange leben, aber eines Tages werde ich seine Lasten zu tragen haben, und da weiß ich schon, was auf mich zukommen wird.«
Sein Bruder Siegfried, der vor zehn Jahren ins Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg eingetreten war und seine Zukunft als Geistlicher sah, ging beschwichtigend dazwischen. »Alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr es glaubet, werdet ihr’s empfangen.«
»Na fein«, murmelte Albrecht, »dann bete ich nachher, dass sich meine Nordmark in den nächsten Jahren von ihrer Größe her mindestens verdoppelt, wenn nicht gar verdreifacht.«
»Wie schön, dass sie uns wenigstens noch die magerste Sau im kaiserlichen Stall gegönnt haben«, sagte Otto.
Bernhard war noch zu jung, als dass er sich zu Wort gemeldet hätte, und Dietrich wie Adalbert hatten sich längst damit abgefunden, über die Region hinaus keine Bedeutung zu haben. Sie sollten Graf von Werben beziehungsweise von Ballenstedt werden.
Im Weiteren drehte sich das Gespräch um Familiäres, vor allem darum, wann die beiden Töchter wohl ihr erstes Kind zur Welt bringen würden. Alle hätten darauf schwören können, dass es im Jahre 1158 sein würde.
»Auf alle Fälle sollte sich vor dem nächsten Kreuzzug Nachwuchs einstellen«, lästerte Siegfried. »Denn wenn eure Männer da mit nach Süden ziehen, dann …«
»Morgen brechen wir nach Spandow auf«, verkündete Albrecht. Es sei an der Zeit, sich mehr um den östlichsten Außenposten der Askanier zu kümmern.
Im 4. Jahrtausend v. Chr. hatten sich im Gebiet um Spree und Havel Kulturen mit Ackerbau und Viehzucht herausgebildet, seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. siedelten sich verstärkt Germanen an, nach alten Quellen waren es die Semnonen, die zu den Sueben gehörten, und die Burgunden. Im 4. und 5. Jahrhundert n. Chr. verließen sie – bis auf einige Restgruppen – das Land der späteren Mark Brandenburg und wanderten Richtung Oberrhein und Schwaben. Ab dem 6. Jahrhundert strömten dann Slawenstämme in die Gegend um die Lausitz und um das Jahr 720 auch in den Berliner Raum. Sie übernahmen die alten germanischen Standorte, siedelten sich aber auch in noch unbewohnten Landstrichen an. Etwa seit dem 7. Jahrhundert wurde das Havelland von den slawischen Hevellern besiedelt. Einer ihrer wichtigsten Orte war Spandow, wo sie am Zusammenfluss von Havel und Spree einen Burgwall errichteten. Aus dieser Anlage war bis Ende des 10. Jahrhunderts eine befestigte Burganlage entstanden, die nun zu einem wichtigen Stützpunkt der Askanier ausgebaut werden sollte.
Ulric von Huysburg und Bogdan-Otto hatten sich mühsam ihren Weg durch Sumpf und Heide gebahnt und hofften, noch im Laufe des Nachmittags in Spandow anzukommen.
»Wenn sie wenigstens schon einen Kirchturm hätten, an dem man sich orientieren könnte«, klagte Ulric von Huysburg.
»Na szczęście, na dłuższą metę tylko w stanie«, sagte Bogdan-Otto. Ulric musste nur kurz überlegen, dann hatte er es übersetzt: »Glück hat auf Dauer nur der Tüchtige.«
Und Glück hatten sie in der Tat, denn als sie am Spreeufer angekommen waren, fanden sie ein Floß aus Kiefernstämmen, das tragfähig genug war, sie und ihre beiden Pferde zum Zeltlager der Askanier zu bringen. Das Wappen des Grafen von Ballenstedt grüßte herüber.
Als sie auf der Burgwallinsel an Land gegangen waren und ihre Pferde am Zügel führten, kam ihnen ein Mann entgegen, der Ulric auf den ersten Blick herzlich unsympathisch war. Alle Ritter, die nichts weiter waren als ein aufgeblasenes Etwas, die hasste er.
»Was wollt Ihr hier?«, herrschte der Mann Ulric von Huysburg an.
»Den Markgrafen sprechen.«
»Und wer seid Ihr?«
»Ulric von Huysburg. Vom Himmel geschickt, die Nordmark sichern zu helfen. Und mit wem habe ich die Ehre?«
»Du kennst mich nicht?«
Diese Arroganz reizte Ulric nun doch. »Nein. Etwa Gottfried von Bouillon?« Das war eine Beleidigung, denn der große Heerführer des Ersten Kreuzzugs war schon im Jahre 1100 in Jerusalem verstorben.
Der askanische Verwalter Spandows riss seinen Dolch aus dem Gürtel. »Du wagst es?«
»Ja.« Im Nu hatte Ulric mit einem Tritt seines rechten Fußes dem anderen die Waffe aus der Hand geschlagen und sie wieder aufgefangen, nachdem sie in hohem Bogen durch die Luft gesegelt war. »Wenn ich dir nicht deinen fetten Bauch aufschlitzen soll, dann nenne mir doch bitte deinen Namen, damit ich dich höflich anreden kann.«
»Wiprecht von Wandsleben«, presste der andere hervor.
Ulric dachte an Wanze, unterdrückte aber eine entsprechende Äußerung, um Wiprecht nicht weiter gegen sich aufzubringen. Schließlich waren sie Waffenbrüder und sollten alle Kraft einsetzen, ihr gemeinsames Ziel zu erreichen: In den Staub mit allen Feinden Albrechts!
Wiprecht wies ihnen ein kleines Zelt zu, und sie versuchten, es sich so bequem wie möglich zu machen.
Kaum hatten sie sich auf ihren notdürftig zusammengezimmerten Feldbetten ausgestreckt, erhob sich draußen im Lager ein solcher Lärm, dass sie sofort wieder hochfuhren.
»Wirrrd sicher sein diese Jaxa!«, rief Bogdan-Otto. »Errr attackierrrt uns an.«
Ulric von Huysburg steckte seinen Kopf aus dem Zelt. »Nein, Albrecht kommt mit seinem Tross.«
Der Knappe lachte. »Und … hat seine Beerrren dabei?«
»Nein, weder Erd- noch Himbären, sondern nur Speisenträger, Kämmerer, Mundschenk, Marschall und Koch.« Auch Ulric wusste nicht, warum man Albrecht den Beinamen Bär gegeben hatte. In seinem Wappen gab es keinen Bären, und bärenstark schien er auch nicht gerade zu sein. Vielleicht hatte man ein Gegenstück zu Heinrich dem Löwen gebraucht. Und besser noch Albrecht der Bär als Karl der Dicke oder gar Arnulf der Böse, wie zwei andere Herrscher hießen.
Ulric wartete ab, bis sich die Aufregung nach Albrechts Erscheinen etwas gelegt hatte, dann trat er aus dem Zelt, um sich dem Markgrafen der Nordmark vorzustellen.
»Ulric von Huysburg. Der Himmel schickt mich, Euch zu dienen«, begann er und berichtete dann kurz von seinem Leben und seinen Taten.
»Sei mir willkommen unter meinem Banner!«, rief Albrecht und hieß ihn, Platz zu nehmen an der Tafel, die gerade ins Zelt getragen wurde. Während man mit Freuden aß und trank, wurde reihum von dem erzählt, was man in den letzten Jahren erlebt hatte. So lernte Ulric von Huysburg sie alle kennen: Hancz von Crüchern, Eberlin von Mölz, Ottin von Strenznau und viele mehr.
Als sie mit ihren Berichten am Ende waren, ging der Blick des Markgrafen zu Ulric hinüber. »Nun, Ulric von Huysburg, was hast du an Berichtenswertem erlebt?«
Ulric erzählte aus den Jahren, als er in den Diensten von Roger II. gestanden hatte, einem Normannen, der sich Weihnachten 1130 in Palermo zum König von Sizilien erhoben hatte. »1146 war ich dabei, wie Roger Tunis eroberte und damit die Herrschaft über das zentrale Mittelmeer errang. Es gab wunderbare Leute an seinem Hof, so den arabischen Kartographen Al-Idrisi, der für ihn eine silberne Weltkarte erschuf. Das Schönste aber war sein großer Harem …«
Diese Mitteilung wurde mit großem Jubel begrüßt und von vielen neiderfüllten Kommentaren begleitet.
Nachdem alle etwas zur Unterhaltung der Runde beigetragen hatten, kam Albrecht auf den Grund seines Besuchs in Spandow zu sprechen. »Dass das Haus Askanien ringsum nicht gerade von Freunden umgeben ist, dürfte euch allen bekannt sein«, begann er. »Über die Rolle von Kaiser Friedrich I. rätseln wir noch. Als Markgraf der Nordmark hat mich Barbarossa noch nicht in Frage gestellt, aber wer weiß …«
»Könnt Ihr nicht Erzbischof Wichmann von Magdeburg für uns gewinnen?«, fragte einer der Ritter.
»Ich werde es versuchen, er hängt aber eng mit Barbarossa zusammen.« Albrecht stieß einen tiefen Seufzer aus. »Sorgen bereiten mir auch die Piasten. Ob sie nicht diesen Jaxa von Cöpenick in Marsch setzen, die Brandenburg zurückzuerobern? Ich habe keinerlei Kunde von ihren Absichten.«
Ulric hob den Arm. »Ich beherrsche die slawischen Sprachen und erkläre hiermit meine Bereitschaft, mich, getarnt als Obotrit, in die Burg Cöpenick zu begeben, um etwas von Jaxas Plänen zu erfahren.«
»Sich als Kundschafter in Jaxas Lager zu schleichen hat bis jetzt jeden das Leben gekostet!«, rief Wiprecht von Wandsleben. Ihm war unschwer anzusehen, dass er sich dieses Schicksal auch für Ulric von Huysburg erhoffte.
Ulric lachte. »Ich fürchte mich nicht.«
»So etwas höre ich gerne«, erklärte Albrecht der Bär. »Und wenn du für mich nach Cöpenick reitest, wäre ich dir ewig zu großem Dank verpflichtet.«
Zwei
Auf der Halbinsel Cöpenick hatte es schon in der Bronzezeit eine Burg gegeben, und in der Mitte des 12. Jahrhunderts befand sich hier die Hauptburg und größte Ansiedlung des slawischen Stammes der Sprewanen unter ihrem Fürsten Jaxa von Cöpenick. Die Sprewanen hatten im Zuge der Völkerwanderung um 720 den Berliner Raum erreicht und sich im dünnbesiedelten Gebiet an der Spree niedergelassen. Die wenigen verbliebenen Germanen waren mehr oder minder in der slawischen Bevölkerung aufgegangen. Ulric von Huysburg wollte sich in Cöpenick als Stammesmitglied der Obotriten ausgeben, die im westlichen Mecklenburg siedelten und 955 den Krieg gegen Otto I. verloren hatten, aber knapp dreißig Jahre später die deutsche Herrschaft wieder hatten abschütteln können. Seitdem hatten im Obotritenland mal christliche, mal heidnische Fürsten geherrscht, und seit 1131 war Niklot König der Obotriten. Aber Heinrich der Löwe, der Sachsenherzog, war im Begriff, in einem neuen Wendenkreuzzug das Land der Obotriten zu erobern.
Dies alles und noch mehr hatte sich Ulric eingeprägt, und er hatte auch die Sprache der Obotriten so weit erlernt, dass er sich als ein Sohn des Königs Niklot ausgeben konnte, als Wertislaw. Wollte er als Obotrit gelten, gebot es die Logik, dass er sich Cöpenick in weitem Bogen von Norden her näherte. Er war allein unterwegs, denn Bogdan-Otto hatte ein unbekanntes Fieber außer Gefecht gesetzt – abgesehen davon, dass sein Begleiter seine Mission wohl eher gefährdet denn gefördert hätte.
Auf dem Plateau des Barnims war Ulric auf ein Flüsschen gestoßen, dessen Wasser nach Süden hin flossen und von dem er vermutete, dass es irgendwo in der Nähe Cöpenicks in die Spree mündete. Dass es den Namen Wuhle trug, wusste er nicht. Den Dörfern, die am Wege lagen, wich er ein jedes Mal aus, wenngleich er den Frauen, die er aus der Ferne sah, gern etwas näher gekommen wäre, denn schon zu lange hatte er keine mehr besessen. So sang er denn auch voller Sehnsucht ein Minnelied, das er bei den Askaniern gehört hatte:
Dû bist mîn, ich bin dîn:
des solt dû gewis sîn.
dû bist beslozzen
in mînem herzen:
verlorn ist daz slüzzelîn:
dû muost ouch immer drinne sîn.
Endlich konnte er die Cöpenicker Burg am Horizont entdecken. Sie lag auf einer Insel in der Dahme, und zwar kurz vor deren Einmündung in die Spree. Eine schmale hölzerne Brücke stellte die Verbindung mit der Siedlung Cöpenick dar, die auf einer weiteren Insel angelegt war, während es am Ostufer der Dahme eine alte slawische Fischersiedlung gab, vicus Kytz, in der auch viele Bedienstete der Burg untergebracht waren.
Ulric von Huysburg wurde auf seinem Weg zur Burg nur wenig bestaunt. Offenbar hielt man ihn für einen polnischen Ritter, und die waren in dieser Gegend nicht gerade selten. Er hielt auf die Burgwache zu und zügelte sein Pferd, um mit den Posten zu verhandeln, deren über Kreuz gehaltene Lanzen den Schlagbaum ersetzten. Beide waren auffällige Burschen. Der eine hatte eine Hasenscharte, der andere eine schiefe Nase.
»Wer bist du? Was willst du?«, scholl es Ulric wenig freundlich entgegen.
Er gab sich hochmütig, denn Hochmut schien ihm die beste Strategie zu sein. »Was fragt ihr, seht ihr nicht, wer ich bin? Wertislaw, der Sohn von Niklot, dem König der Obotriten! Mein Vater schickt mich, mit Jaxa wegen eines Bündnisses zu verhandeln.«
Die beiden Posten berieten sich erst einmal. »Können wir das glauben, Bohuměr?«, fragte der mit der schiefen Nase.
»Ich weiß nicht so recht«, antwortete der mit der Hasenscharte.
Die beiden Posten musterten ihn mit dem größtmöglichen Misstrauen. Ulric von Huysburg erschrak. Hatte sein bestes Slawisch in ihren Ohren nur geklungen wie eine Ansammlung von Phantasielauten? Sollte er vergeblich tagelang mit Bogdan-Otto geübt haben?
Nein, die beiden Sprewanen hatten ihn wohl verstanden. Aber dass ein Königssohn ohne Tross durch die Lande zog, das erschien ihnen verwunderlich.
Ulric stöhnte auf, als er ihre Bedenken vernommen hatte. »Meine Begleiter sind alle ums Leben gekommen, als wir beim Übergang über den Rhin von einer Gruppe der Zamzizi angegriffen wurden. Ich bin der Einzige, der entkommen konnte.«
Das war mit derartig großer Schauspielkunst vorgetragen worden, dass ihm die beiden Posten Glauben schenkten und ihn in die Burg führten, wo sie einen Knecht anwiesen, sein Pferd zu versorgen und ihn zu Jaxa zu führen.
Er möge warten, hieß es vor dessen »Palast«. Ulric von Huysburg nutzte die Zeit, sich unauffällig umzusehen. Auf dem Rand des Brunnens lag eine Münze. Sie zeigte Jaxa mit Palmenzweig und Doppelkreuz, also mit christlichen Symbolen. Ulric machte sich noch einmal klar, dass Jaxa erstens Christ war und zweitens polnischer Fürst, ein Vasall der Piasten. Deren Königreich befand sich zwar in der Krise, man war aber noch immer darauf aus, nach Westen zu expandieren.
Ulric setzte sich auf den Brunnenrand, schloss die Augen und genoss die Frühlingssonne. Als er Stimmen hörte, öffnete er sie wieder. Zwei Frauen kamen aus einem der Nebengebäude, hölzerne Eimer in der Hand. Offenbar wollten sie Wasser holen, schreckten aber zurück, als sie ihn, einen Fremden, sahen.
Er sprang auf, schnellte ein paar Meter zurück und machte eine einladende Handbewegung. »Bitte sehr, die Damen, tretet doch näher, vor mir braucht niemand Angst zu haben.«
Die beiden Frauen berieten sich kurz.
»Miluša, geh du voran«, hörte er die Ältere flüstern.
Ulric von Huysburg war im Nu entflammt. Es erschien ihm, als würde das Blut heiß durch seinen Körper strömen, und wäre sein Gemächt nicht so eng eingeschnürt gewesen, hätte er seine Erektion nicht verbergen können. Miluša. Eine Schönheit wie sie in einem Sprewanennest zu finden, hätte er nicht für möglich gehalten. Sie tat zwar schüchtern, doch als sich ihre Blicke trafen, zögerte sie eine Sekunde zu lange, den ihren zu senken. Ulric wusste, das konnte was werden, aber hier in der engen Burg gab es mit Sicherheit kein Plätzchen, wo man ungestört der Minne frönen konnte. Wenn er sie nun auf sein Pferd hob und mit ihr davonsprengte? Sein Pflichtbewusstsein verbot es ihm. Aber vielleicht gab es doch noch eine Möglichkeit?
»Du bist die Tochter des Fürsten?«, fragte er.
Sie lächelte. »Weiß man’s?«
Die Ältere verbot ihr, so zu reden. »Das lass nicht deinen guten Vater hören.« Sie fixierte Ulric von Huysburg. »Wer seid Ihr eigentlich, wo kommt Ihr her?«
Ulric verbeugte sich. »Ich bin Wertislaw, ein Sohn Niklots.«
Miluša staunte. »Du bist von den Obotriten zu uns an die Spree gekommen?«
Er nickte. »So ist es.«
In diesem Augenblick kam ein grimmig dreinschauender Slawe aus der Waffenkammer und herrschte Miluša und ihre Begleiterin an, sie mögen hier nicht müßig herumstehen, sondern endlich Wasser holen und sich wieder in die Küche begeben.
»Ja, Radogost, ja!«
Ulric von Huysburg hatte einen sicheren Instinkt in solchen Angelegenheiten und wusste sofort, dass er in diesem Radogost keinen Freund fürs Leben finden würde. Offenbar sah der Miluša als seine Beute an und wollte sie sich von keinem entreißen lassen.
Endlich wurde er zu Jaxa geführt. Dessen Residenz war ein großer Blockbau, über dessen Tür eine Art Banner angebracht war, das einen Palmzweig und ein Doppelkreuz zeigte.
Der Sprewanenfürst empfing ihn freundlich und mit ausgesuchter Höflichkeit. »Sei mir herzlich willkommen! Wenn dein Vater an ein Bündnis aller Slawenstämme gegen Heinrich den Löwen und Albrecht den Bären, aber auch die Wettiner denkt, dann hat er Großes im Sinne. Bolesław IV. wird uns jede Unterstützung zuteilwerden lassen.«
»Der Kraushaarige«, murmelte Ulric von Huysburg. Wenn der Fürst so genannt wurde, hatte er es weit besser als sein Vater, denn Bolesław III. hatte den Beinamen Schiefmund getragen.
Jaxa bat Ulric von Huysburg, von dem zu berichten, was sich oben im Obotritenland in letzter Zeit ereignet hatte.
»Da hätten wir vor allem die Auseinandersetzungen mit den Wagriern, gefürchteten Piraten, die unter anderem die dänischen Inseln drangsaliert haben. Und nun erwartet mein Vater einen Angriff der Dänen und der Sachsen auf unser Reich.«
Dann kam er auf Heinrich den Löwen zu sprechen. Ulric von Huysburg wusste genau, dass der Welfe und Albrecht der Bär alles daransetzen würden, ihre Herrschaftsgebiete auszudehnen und sich weite slawische Gebiete anzueignen. Hatte Jaxa das Format, den beiden Männern standzuhalten?
Immer wieder musterte Ulric den Sprewanenfürsten. Sein Gesicht war lang und asketisch. Ein sauber gestutzter dunkler Bart umrahmte den Mund und bedeckte das Kinn. Die dunkelbraunen Augen blickten ernst. An diesem Mann war nichts Weichliches zu entdecken. War er wirklich ein geborener Sprewane? Oder war er, wie manche munkelten, vielmehr ein gewisser Jaxa von Miechow, ein Pole, den die Piasten nach Cöpenick geschickt hatten, um die Burg gegen Askanier und Wettiner zu halten? Ulric wagte es, dem anderen diese Frage zu stellen.
Jaxa lächelte. »Nehmt an, was Ihr annehmen wollt. Geben wir den späteren Geschichtsschreibern eine harte Nuss zu knacken.«
Nun, listig schien dieser Mann auch noch zu sein. Und damit doppelt gefährlich. War er wirklich dieser Jaxa von Miechow, hatte er sicher den geheimen Auftrag, nach Westen zu ziehen. Doch auch wenn er ein autochthoner Sprewane war, blieb ihm nichts anderes übrig. Aber hatte dieser Mann wirklich Mut, Kraft und Feuer genug, die Brandenburg anzugreifen und die Askanier in ihre Stammlande zurückzutreiben? Da war sich Ulric nicht sicher. Zu neugierig durfte er nicht wirken, das wäre verräterisch gewesen, dennoch kam er auf die Nachfolge Pribislaw-Heinrichs zu sprechen.
»Ihr seid verwandt mit ihm, und da …«
Wieder hielt sich Jaxa bedeckt. »Heute ist heute, und morgen ist morgen, warten wir’s ab.«
»Und wann erfahre ich, ob Ihr an eine Unterstützung meines Vaters denkt?« Das war eine Frage, mit der er hoffte, Jaxa aufs Glatteis zu führen. Denn für beide Unternehmungen, die Obotriten zu unterstützen und den Askaniern die Brandenburg zu entreißen, fehlten ihm vermutlich die Kräfte.
Aber Jaxa ließ sich nicht aus der Reserve locken. »Wir werden sehen, ich muss alles erst mit meinen Beratern besprechen.« Damit erhob er sich, um Ulric von Huysburg anzuzeigen, dass er ihr Gespräch für beendet hielt. »Ihr werdet ja einige Tage bei uns bleiben und rechtzeitig erfahren, was wir beschlossen haben.« Dann winkte er einen Knappen herbei. »Führe unseren Gast zu seiner Lagerstatt!«
Die befand sich in einer Art Gästehaus im hinteren Bereich der Burg. Ulric streckte sich auf seinen Fellen aus und sang Verse des provenzalischen Troubadours Bernart de Ventadorn: »Non es meravelhas’eu chan/Chantars no pot gaire valer …« Dabei träumte er von Miluša.
Der Gedanke an sie ließ ihn aufspringen. Vielleicht ergab sich eine Gelegenheit, sie allein in einem verborgenen Winkel zu treffen … Er verließ das Gästehaus und schlenderte an den Wällen entlang. Nein, das Glück war nicht auf seiner Seite, er bekam sie nicht zu Gesicht. Gelangweilt ging er auf die hölzerne Brücke zu, die Burg und Siedlung miteinander verband.
In Cöpenick gab es überwiegend sogenannte Flechtwandhäuser, deren Dächer mit Reisig gedeckt waren. Oben hatte man Öffnungen für den Dunstabzug gelassen, Fenster konnte Ulric keine entdecken. Daneben hatte man Blockbauten errichtet, deren Grundriss erheblich größer angelegt war und die jeweils Platz für zwei Zimmer boten. Einige wiesen auch Fenster auf. Ein paar Handwerker saßen im Freien und brachten Beile, Scheren und Schlüssel in Ordnung.
Vor einem Lehmofen sah er Miluša stehen, wie sie ein hölzernes Brett mit dampfenden Brotlaiben aus der Öffnung zog und ihm dabei ihr Gesäß entgegenstreckte.
»Herr«, murmelte Ulric von Huysburg, »ich will ein Jahr meines Lebens drangeben, wenn ich der auch nur einmal beiwohnen darf.«
Sich ihr zu nähern, wagte er nicht, denn sofort wäre dieser Armleuchter von Radogost zur Stelle gewesen. Zwar hätte er den mit einem einzigen Fausthieb für mindestens zehn Minuten ins Land der Träume schicken können, doch dann wäre es mit seiner Mission zu Ende gewesen. Also entfernte er sich und tat, als interessierten ihn Miluša wie auch Radogost nicht im Allergeringsten. Am besten, er sah sich ein wenig in der Gegend um, teils aus Interesse, teils um im Falle eines Falles schnell den besten Fluchtweg zu finden.
Die Posten nahmen keine Notiz von ihm. Von der Brücke ging eine Leiter zu einem kleinen Steg hinunter, an dem ein klobig gebautes Ruderboot festgebunden war, kein Einbaum mehr, wie ihn die Slawen früher gebaut hatten, sondern ein geklinkerter Kahn. Ulric fragte die Sprewanen, ob er ihn für eine kleine Fahrt benutzen könne. Man hatte nichts dagegen. So stieg er ein und ruderte ein Stückchen die Dahme hinab, um dann in die Spree einzubiegen. Das war ziemlich anstrengend, denn sein Boot hatte keinen Kiel, sondern unten eine mächtige Sohle aus Eichenholz. Ein paar Fischer hockten in ihren Kähnen und waren zu träge, den Kopf zu heben und ihm hinterherzublicken. Ulric fehlte jemand, mit dem er sich unterhalten konnte. Er wünschte sich an den Hof der Staufer. Barbarossa war ja nicht nur deutscher König, sondern seit 1155 auch Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und plante große Feldzüge. In Rom, Mailand und Besançon hatte er sich aufgehalten, und das waren schon Orte von anderem Format als Cöpenick.
Langsam brach die Dämmerung herein, Ulric beendete seinen Ausflug mit dem Ruderboot und warf sich wieder auf seine Felle, noch missmutiger als zuvor. Es drängte ihn, endlich etwas zu unternehmen. Die Sache war klar: Wenn Jaxa ihm nicht verraten würde, ob er gegen Albrecht Front machen wollte oder nicht, dann blieb ihm nur, ihn zu belauschen, wenn er mit seinem Gefolge alles besprach.
Ulric erhob sich, warf sich das sackartige graubraune Gewand über die Schultern, wie es die Slawen für modisch hielten, steckte sich einen kurzen Dolch in den Gürtel und öffnete vorsichtig die Tür seiner … nun ja, seiner Hütte. Draußen war es mehr als finster. Wer sich nach Sonnenuntergang im Innern der Burg bewegte, tat dies nicht ohne Fackel. Ulric schloss die Augen, damit sie sich an die Dunkelheit gewöhnten und er die Umrisse der einzelnen Gebäude erkennen konnte. Nachdem dies geschehen war, schlich er sich zu Jaxas »Palast«, dem mächtigsten der Blockbauten. Laute Stimmen drangen nach draußen, man war bei dem, was landläufig als Palaver bezeichnet wurde. Ulric konnte es recht sein. Das Fenster stand offen, ein Vorhang verhinderte aber, dass er erkennen konnte, wer was sagte. Nur ab und an sah er einen Schatten auf dem Vorhangstoff, aber eine Gestalt oder ein Profil war nicht zu erkennen, dazu war das Licht, das die brennenden Öllampen und Kienspäne spendeten, viel zu schwach. Ulric lauschte. Jetzt hatte ganz offenbar Jaxa das Wort ergriffen, dessen Stimme und Tonfall kannte er ja.
»Die Brandenburg muss wieder unser werden! Das Hevellerland ist altes Slawenland. Zurück mit Albrecht hinter die Elbe!«
Es kam ein Einwand. »So recht du hast, so müssen wir doch anerkennen, dass wir die Askanier in der Burg niemals mit unseren geringen Kräften in die Knie zwingen können.«
»Das wohl nicht«, entgegnete Jaxa. »Aber wir haben Geld aus Polen zur Verfügung, viel Geld, und damit werden sich etliche von Albrechts Gefolgsleuten sicherlich umstimmen lassen. Außerdem haben wir, sind wir erst Herren des Landes, das Pribislaw gehörte, viele Lehen zu vergeben, Pfründe, und auch damit wird sich mancher locken lassen.«
»Wen willst du also zur Brandenburg schicken?«, fragte jemand.
»Einen gut getarnten Mann, vielleicht kommt er als Mönch, vielleicht als Händler. Da müssen wir sehen, wer sich findet.«
Jetzt wurden Rufe laut, man solle aufhören zu debattieren, denn es sei schon längst Zeit für das Abendessen.
Ulric von Huysburg hatte genug gehört, und er machte, dass er schnell wieder zu seinem Lager kam, denn es war fest damit zu rechnen, dass man ihn zur Tafel bat. Auf halbem Weg zu seiner Hütte glaubte er, Schritte hinter sich zu hören. Er blieb stehen, zog seinen Dolch aus dem Gürtel und lauschte. Nichts. Er musste sich getäuscht haben. Sekunden später lag er wieder auf seinen Fellen und dachte nach. Eigentlich hätte er jetzt aufbrechen und zur Brandenburg reiten können, denn er hatte ja herausgebracht, was er hatte herausbringen wollen, doch mit seinem Verschwinden hätte er Jaxa nur gewarnt und dazu gebracht, seine Pläne zu ändern. Nein, er musste sich ganz offiziell von ihm verabschieden. Außerdem wäre es selbstmörderisch gewesen, in dieser sumpfigen Gegend ohne Weg und Steg durch die Nacht zu reiten. Also streckte er sich aus und suchte sich zu entspannen. Bald war er in leichten Schlummer gefallen.
Eine knappe Stunde mochte vergangen sein, als ein Knappe ihn weckte. Fürst Jaxa habe den Wunsch geäußert, er, Wertislaw, möge neben ihm sitzen und speisen.
Ulric richtete sich auf, sagte, dies sei eine hohe Ehre für ihn, und folgte dem jungen Slawen. An Jaxas Tafel hatte sich dessen gesamter Hofstaat versammelt. Ulric schätzte, dass es fast zwei Dutzend Männer waren. Er begrüßte den Sprewanenfürsten höflich und mit allem nötigen Respekt, doch als er dann neben ihm saß und in die Runde schaute, hätte er vor Schrecken fast aufgeschrien, denn der ältere Mann schräg gegenüber war kein anderer als Nebojša, der Händler, dem er an der Nuthe das Leben geschenkt hatte. Wenn der jetzt aufsprang, zu ihm lief, ihn umarmte und rief, dass er diesem großmütigen Manne hier so viel verdanke, dann …
»Ein Hoch auf Ulric von Huysburg!«
Ulric wusste nicht, ob Nebojša es wirklich schon ausgerufen hatte oder ob er sich nur einbildete, es gehört zu haben, er straffte sich jedoch, um im Ernstfall in den nächsten Sekunden gegen alle Gefolgsleute Jaxas kämpfen zu können. Blitzschnell hatte er einen Plan gefasst: Ich reiße mein Messer vom Tisch, halte es Jaxa an die Kehle und fordere ein Pferd und freien Abzug. Das mochte gelingen, aber …
Doch Nebojša schwieg, als sich ihre Blicke getroffen hatten. Entweder der Händler hatte ihn nicht als Ulric von Huysburg erkannt – oder aber er war klug genug zu schweigen.
Ulric fiel es schwer, jetzt leichthin mit Jaxa zu plaudern, zumal ihm Radogost Blicke sandte, die mit feindselig viel zu schwach beschrieben waren. Sie waren wie Pfeile.
Jaxa kam auf die Wettiner zu sprechen, von denen Ulric nur wenig wusste. »Gegen die vor allem will ich mich in Zukunft wenden, nicht gegen die Askanier, die erscheinen mir harmloser zu sein, zumal Heinrich der Löwe diesem Albrecht dem Bären in allem überlegen ist.«
»Ja«, sprang Radogost ihm bei, »wenn ich mir vorstelle, dass in einem Zwinger ein Bär und ein Löwe miteinander kämpfen, dann würde ich meinen Kopf auf den Sieg des Löwen verwetten.«
»Was haben denn die Wettiner für ein Tier in ihrem Wappen?«, fragte einer.
»Kein Tier, nur grüne Blätter!«, lachte ein anderer.
Ulric war froh, dass sie nun auf Dinge zu sprechen kamen, die weniger verfänglich waren, zum Beispiel, ob es noch einen dritten Kreuzzug nach Palästina geben würde und ob bestimmten Edelsteinen, die Hildegard von Bingen in ihrer medizinischen Schrift Physica aufgeführt hatte, wirkliche Heilkraft zugeschrieben werden könne.
»Ihre Wirkung ist ganz unzweifelhaft«, sagte Ulric. »Wenn ich schwermütig bin, weil ich kein Geld habe und mir der Schuldturm droht, dann bekomme ich sofort ein sonniges Gemüt, sobald mir jemand einen Haufen Diamanten schenkt.«
»Darin erkennt man den Mann des Nordens!«, rief Jaxa. »Ich hebe meinen Becher auf das Wohl des Sohnes Niklots!«
Doch auf Ulric von Huysburgs Platz stand gar kein Becher, den er seinerseits ergreifen konnte.
»Los, schafft einen köstlichen Trunk herbei!«, rief Jaxa.
Ein Knappe brachte ihn.
»Auf das Wohl des Herrschers über alle Sprewanen! Auf dass er eines Tages alle Slawenstämme einigen werde und Albrecht, Heinrich und die Wettiner allesamt zum Teufel jage!«
Dies wurde mit großem Beifall aufgenommen, und Ulric von Huysburg leerte seinen Becher in einem einzigen Zug, so wie es Sitte war.
Ein paar Atemzüge später wurde ihm schwindlig und schwarz vor Augen. Er konnte gerade noch die Tischkante fassen, um Halt zu finden. Doch es nutzte nichts, er verlor das Bewusstsein und schlug lang hin.
Irgendwann in dieser Nacht kam er wieder zu sich und nahm wahr, dass er an Händen und Füßen gefesselt in einem Kellerloch lag.
Drei
Die Heveller hatten auf der Brandenburger Dominsel ihre zentrale Burg angelegt. 928/29 war sie von König Heinrich I. erobert worden, und Otto I. hatte 948 das Bistum Brandenburg errichtet. Im Slawenaufstand 983 war die Burg von den Hevellern zurückerobert worden, und Anfang des 12. Jahrhunderts war sie in den Fokus des Römischen Reiches geraten, des sacrum Romanum imperium, das darauf aus war, das Gebiet zwischen Elbe und Oder seinem imperialen Machtbereich einzugliedern. Wie bei allen Großreichen gab es an den Außengrenzen abgestufte politische Beziehungen zu den fremden Völkern und Stämmen sowie »Durchmischungen« der Ethnien und Kulturen. Im Bereich der Nordmark hatte man es mit drei slawischen Größen zu tun: mit Wirikind von Havelberg, Pribislaw-Heinrich von Brandenburg und Jaxa von Cöpenick – alle drei Christen. Wirikind konnte seine Erbfolge nicht regeln und spielte in den Jahren ab 1150 keine Rolle mehr, und Jaxa hatte sich auf die Seite der Polen geschlagen.
Anders Pribislaw-Heinrich, der um 1075 auf die Welt gekommen war und sich den Deutschen verbunden fühlte. Schon Meinfried, sein Vater, war Christ gewesen, und Pribislaw-Heinrich hatte als Kind die christliche Taufe empfangen. Seinem Volk aber passte das alles nicht so recht, es hielt mehrheitlich lieber an seinen »heidnischen Bräuchen« fest und sah es gar nicht gern, dass ihr Fürst Unterkönig und Vasall des Heiligen Römischen Reiches geworden war. Er war kinderlos geblieben, und um sicherzugehen, dass nach seinem Tode nicht wieder ein heidnischer Fürst das Land regierte, setzte er Markgraf Albrecht als seinen Erben ein und wurde Taufpate Ottos, dem er bei dieser Gelegenheit den Landstrich schenkte, den man die Zauche nannte. Als er 1150 an Altersschwäche gestorben war, hielt Petrissa, seine Gattin, die Nachricht seines Todes so lange zurück, bis Albrecht auf die Brandenburg geeilt war, um sie gleichsam in erblicher Thronfolge in Besitz zu nehmen.
In der Stadt und auf der Burg Brandenburg lebten Deutsche – in der Hauptsache Anhaltiner und Sachsen – und Slawen vergleichsweise friedlich zusammen. Die Besatzung der Burg war auf einen Angriff der Sprewanen gut vorbereitet, denn Lynhardt von Schleibnitz herrschte hier mit harter Hand und ließ seine Leute nahezu täglich üben, so auch die Bogenschützen auf den Mauern und Wällen.
»Die Sehne spannen! Zielen! Und Schuss!«
Auf dem Vorfeld waren Strohballen zu Rittern und Lanzenträgern geformt worden, und in diese Zielscheiben bohrten sich nun die Pfeile – zum Teil jedenfalls.
Der Ritter Ottin von Strenznau hatte in einiger Entfernung Posten bezogen und kam nun herangeritten, um die Trefferzahl nach oben zu melden. »Nur knapp die Hälfte aller Pfeile hat ihr Ziel gefunden.«
»Zu wenig!«, befand Lynhardt von Schleibnitz. »Auf ein Neues!«
»Ruhe!«, schrie Mertin von Freckleben, einer der Kämmerer Albrechts. »Aua!« Er war gerade dabei, sich von einem Bedienten die Läuse aus dem Haar kämmen zu lassen. »Wenn ich so viele Brakteaten im Säckel hätte wie Läuse auf dem Kopf, dann könnte ich jubeln.« Brakteaten waren neumodische, aus dünnem Blech einseitig geprägte Münzen, die unter dem Bild des Fürsten oder Königs das Jahr zeigten, in dem sie in Umlauf gebracht worden waren. Mertin von Freckleben galt als geldgieriger Mann, wurde aber von Albrecht geschätzt, weil er das askanische Vermögen nicht verschwendete.
Während Lynhardt von Schleibnitz sich mühte, die Kampfkraft der Burgbesatzung zu erhöhen, hatte sich seine holde Gattin einen gewissen Mickel ins Bett geholt, einen Jäger aus der Umgebung, der die Küche mit Hase, Wildschwein, Hirsch und Reh belieferte. Alle, bis auf ihren Mann, wussten von ihren nymphomanen Anwandlungen, und man nannte sie überall nur »Adelhayt von Leibschlitz«.
Einmal schon hatte Mickel sein Bestes gegeben, doch Adelhayt war immer noch heiß und knetete sein Glied, um es wiederauferstehen zu lassen.
Diese Bemühungen beobachtete heimlich Zlata. Sie war als Beiköchin auf der Burg beschäftigt und hatte gesehen, wie Mickel ein am Morgen erlegtes Reh angeschleppt hatte. Bei jedem seiner Besuche machte sie ihm schöne Augen, und er hatte ihr auch schon zu verstehen gegeben, dass sie sich Hoffnungen machen könne. Und nun das! Tief verletzt schlich sich Zlata weg vom Fenster und überlegte, wie sie sich für Mickels Untreue rächen konnte. Was sie ihm gönnte, war eine gehörige Tracht Prügel, und die bekam er bestimmt verabreicht, wenn Lynhardt von Schleibnitz ihn bei seinem Tun erwischte. Also schlich sie sich zum Burgverwalter und flüsterte ihm ins Ohr, dass er doch schnell mal ins Schlafgemach seiner Gattin schauen möge.
Lynhardt von Schleibnitz lief sofort los, um sein Weib in flagranti zu erwischen, und stürzte genau in dem Augenblick in ihr Schlafgemach, als Mickel stöhnend und keuchend auf den nächsten Höhepunkt seiner Geliebten hinarbeitete und mit seinen Gedanken bei der Bärenjagd war, um seinen Erguss hinauszuzögern. So hörte er den Ritter nicht kommen und fiel aus allen Wolken, als der furchtbar schrie und ihn grob an der Schulter packte, um ihn von seiner Frau zu reißen.
»Was machst du da?«
Mickel sprang auf und hatte keine Zeit für eine Antwort – er musste zugleich seine Blöße bedecken und seine Hände nach oben reißen, um seinen Kopf zu schützen, denn Lynhardt von Schleibnitz war drauf und dran, ihn mit einem schnell gegriffenen hölzernen Hocker zu erschlagen.
»Tu es nicht!«, schrie seine Frau. »Du machst uns alle unglücklich.«
Mickel konnte den ersten Schlag abwehren und verschaffte sich etwas Luft, indem er Schleibnitz in die Hoden trat. Der war auf diese wenig ritterliche Art des Zweikampfes nicht vorbereitet und sank jammernd zu Boden. Der Jäger nutzte die Gelegenheit, sprang über den Gehörnten hinweg und rannte in Richtung Tor.
Überraschend schnell hatte sich Lynhardt von Schleibnitz wieder aufgerafft. Er stürzte zum Fenster und schrie, man möge Mickel festhalten, er sei ein Dieb und Mörder. Das tat seine Wirkung, und Mickel war schnell eingekreist. Er war sich sicher, dass sie ihn hängen würden, wenn sie ihn zu fassen bekamen. In seiner Not schlüpfte er in die offene Tür zum Weinkeller und schaffte es gerade noch, von innen den Riegel vorzuschieben und die Treppe hinunterzulaufen.
Es würde ein paar Minuten dauern, bis sie die Tür mit einer Axt aufgebrochen hatten. Er war allein, es brannten aber ein paar Kienspäne an der Wand. Der Kellermeister musste gerade noch im Keller zu tun gehabt haben.
Mickel betete zu Triglaw. Und der alte Slawengott ließ den Seinen nicht im Stich. Denn er ließ ihn an das denken, was sein Vater, der lange auf der Brandenburg gedient hatte, ihm des Öfteren erzählt hatte: dass nämlich vom Weinkeller aus ein geheimer Gang zum Ufer der Havel hinunterführte. Mickel begann die Wände abzuklopfen, ob es wohl irgendwo hohl klang.
Wer von Cöpenick aus zur Brandenburg reisen wollte, brauchte im Jahre 1157 mehrere Tage dafür, man hatte unberührte märkische Urwälder und Sümpfe zu durchqueren, wie sie nur ein Urstromtal zu bieten hatte. Jedenfalls kam Jaxa äußerst langsam voran, denn sein kleines Heer bestand nur zum geringeren Teil aus Reitern, in der Mehrzahl aber aus polnischen Bogenschützen und Lanzenträgern, die zu Fuß unterwegs waren.
Jaxa und Radogost ritten an der Spitze des Zuges und waren nicht bei allerbester Laune, da es seit Stunden regnete.
»Wenn es so weitergeht, versinken wir alle noch im Schlamm«, sagte Radogost.
Jaxa reagierte unwirsch. »Du weißt doch selber, dass wir nicht länger warten konnten. Die Welfen, die Askanier, die Sachsen, die Wettiner – alle sind sie gierig, neues Land in Besitz zu nehmen, unser Land, Slawenland.«
Radogost drehte sich nach hinten. »Mit diesem Haufen, mit dem wir gen Westen ziehen, wirst du ihnen keine Angst einjagen. Mit dem können wir die Brandenburg nie und nimmer zurückerobern.«
»Damit könntest du recht haben – aber warten wir’s ab. Die Erinnerung an 983 sollte uns zuversichtlich stimmen.«
In diesem Jahre hatte es den sogenannten Slawenaufstand gegeben. Heinrich I. und Otto I. hatten mit ihren Kriegszügen bis 955 die Elb- und Ostsee-Slawen unterworfen und von Magdeburg aus christianisiert. Als aber ein Streit um die Nachfolge des Kaisers und des Magdeburger Erzbischofs entbrannt war, hatten die Liutizen und Obotriten die Schwächung des Reiches genutzt und dessen politische und kirchliche Vertreter vertrieben. Die Bischofssitze Brandenburg und Havelberg waren besetzt, das Kloster Kalbe geplündert worden. Für die nächsten 150 Jahre hatte die Expansion des Heiligen Römischen Reiches nach Osten ein Ende gefunden.
»Hast du schon einen Plan?«, fragte Radogost den Fürsten.
Jaxa lachte. »Nein, denn mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht! Und mach dann noch ’nen zweiten Plan, geh’n tun sie beide nicht.«
Wortlos ritten sie weiter, mit Rücksicht auf ihre Fußtruppen nur im Schritt. Um den Burgwall von Poztupimi machten sie einen weiten Bogen, denn den Hevellern trauten sie nicht. Die Landkarte, die sie in den Händen hielten, war die Kohlezeichnung eines Mönchs, und auf der war die Seenkette südlich Potsdams nur als ein etwas größerer Teich eingezeichnet, so dass sie lange brauchten, um auf Höhe des heutigen Ferch wieder Richtung Westen reiten zu können. Jetzt ging es weithin über trockenes Gelände, und erst die Sümpfe um den Rietzer See machten ihnen wieder zu schaffen. Als sie auch dieses Hindernis glücklich überwunden hatten, kamen sie auf eine höher gelegene Waldfläche und rasteten dort, wo heute auf den Karten der Galgenberg verzeichnet ist. Von hier aus waren Burg und Siedlung Brandenburg zwar noch nicht zu sehen, aber schon zu erahnen.
Sie hatten sich gerade auf dem Boden ausgestreckt und sich über ihre kargen Vorräte hergemacht, da waren in ihrer Nähe Schritte zu vernehmen.
Radogost sprang auf und griff sich eine der herumliegenden Lanzen. »Halt! Wer da?«
Aus dem Gebüsch trat ein Slawe, der erklärte, er sei der Jäger Mickel aus einem der Dörfer nebenan und aus der Brandenburg geflohen, weil man dort gedroht habe, ihn aufzuhängen. »Und hätte ich den geheimen Gang nicht gefunden, der vom Weinkeller der Burg bis ans Havelufer führt, dann würde ich jetzt am Galgen baumeln.«
Jaxa begriff schnell, dass dieser Mann ein Geschenk des Himmels war. »Bei mir bist du gut aufgehoben«, versicherte er dem Bedrohten. »Und du sollst der oberste Jäger meines Hofes werden, wenn ich erst Herr über die neue Mark geworden bin, die es geben wird, die Mark Brandenburg.«
Mickel fiel ihm zu Füßen und dankte ihm.
»Nichts zu danken.« Jaxa hob Mickel vom Boden auf und ließ den Mundschenk zwei Becher seines besten Weines holen. »Komm, labe dich und erzähle uns, was es auf der Brandenburg an Neuigkeiten gibt.«
»Albrechts Verwalter ist jetzt der Ritter Lynhardt von Schleibnitz, ein Fettsack, der so dumm ist, dass ihn die Schweine beißen.«
Jaxa hörte das gern. »Also werden wir auf wenig Gegenwehr stoßen, wenn wir die Brandenburg erstürmen?«
»Das wohl nicht, denn es gibt wackere Kämpfer. Unter den Rittern ist einer, der Hayntz von Helsungen, der wird sich nicht ergeben, bis dass der letzte Pfeil verschossen ist. Und die Askanier haben wesentlich mehr Männer auf der Burg, als ich hier in Eurem Lager sehe.« Da fiel Mickel noch etwas ein, das er bis jetzt vergessen hatte. »Ah ja, und außerdem hat Albrecht einen Ritter zu Euch nach Cöpenick geschickt, den Ulric von Huysburg. Der sollte sich als Sohn des Obotritenfürsten Niklot ausgeben und bei Euch einschleichen, um von Euren Plänen zu erfahren.« Er sah sich um. »Wo steckt er denn?«
Jaxa lachte. »Bei uns in Cöpenick im Verlies.«
»Das ist gut so.«
Nachdem er von Mickel alles erfahren hatte, was ihm wichtig schien, setzte sich der Sprewanenfürst mit Radogost zusammen, um ihm mitzuteilen, dass er nun doch einen Plan entwickelt habe. »Du kleidest dich um und reitest als Askanier durch die Tore der Brandenburg, als der Ritter Ulric von Huysburg.« Er gab weiter, was er von Mickel erfahren hatte. »Du erzählst vom Leben in Cöpenick, wiegst diesen Lynhardt von Schleibnitz, der ein Schwachkopf sein soll, in Sicherheit und machst ihm klar, dass die Sprewanen nicht daran denken, die Brandenburg anzugreifen. Ich sei mit den Meinen gerade nach Norden zu den Obotriten aufgebrochen, um Niklot gegen Heinrich den Löwen beizustehen.« Dann zog er einen Beutel mit Goldstücken aus seinem Wams. »Und hiermit versuchst du, so viele Askanier wie möglich zu kaufen.«
Radogost grinste. »Gut. Und wer mir widersteht, der bekommt denselben Trunk aufgetischt wie dieser komische Ulric von Huysburg.«
Jaxa nickte. »Wenn das erledigt ist, dann lässt du vom Wall oben eine Fanfare ertönen. Das ist für mich das Zeichen loszuschlagen. Eine kleine Schar lasse ich das Tor stürmen. Aber das nur zum Schein, um die zu binden, die vielleicht nichts von deinem Schlaftrunk genossen haben, aus welchem Grund auch immer. Während des Gefechts am Burgtor komme ich mit meiner Schar durch den geheimen Gang, dessen Eingang uns dieser Mickel zeigen wird, und besetze die Burg. Kein Tropfen Blut wird fließen, denn die Christen haben uns ja gelehrt: Du sollst nicht töten.«
Ulric von Huysburg versuchte, den Ratten, die um ihn herumwuselten, klarzumachen, dass er noch am Leben war. Dazu schnellte er mit seinem Körper, sofern es die Hände, die hinter seinem Rücken zusammengebunden waren, und die ebenfalls gefesselten Füße zuließen, mal nach links, mal nach rechts. »Wartet doch, ihr verdammten Viecher, bis ich tot bin und in Verwesung übergehe, dann schmecke ich euch viel besser!«
Dass er in seinem Cöpenicker Gefängnis ein jämmerliches Bild abgab, wie er da nicht gegen edle Ritter kämpfte, sondern gegen abgemagerte Ratten, war ihm schon bewusst. Aber sosehr Ulric auch an seinen Fesseln zog und zerrte, sie hielten ihm stand.
So ergab er sich auch an diesem Tage wieder in sein Schicksal und schloss die Augen, um seine Gabe zu nutzen, große Ereignisse der Weltgeschichte in Gedanken so zu erleben, als wäre er selbst dabei gewesen.
Da wurde der Deckel über seinem Kellerloch angehoben, und ein Knecht kam die Leiter heruntergestiegen, um ihn mit einem ekligen Hirsebrei zu füttern und ihm schales Wasser einzuflößen.
»Was soll mit mir geschehen?«, brachte Ulric hervor, als alles seine Speiseröhre passiert hatte.
»Ihr werdet aufgehoben.«
Ulric kniff die Augen zusammen. »Um eurem Triglaw geopfert zu werden?«
»Nein, wir sind Christen wie ihr.«
»Was dann?«
»Ganz einfach: Wenn Albrecht beim Kampf um die Brandenburg einen von unseren Leuten gefangen nehmen sollte, dann sollt Ihr gegen den ausgetauscht werden.«
Damit war ihr Dialog beendet, und der Sprewane kletterte wieder nach oben. Dass Jaxa auf dem Weg zur Brandenburg war, hatte sich Ulric denken können. Albrecht aber war auf diesen Angriff in keinster Weise vorbereitet. Er würde ganz sicher seine, Ulrics, Rückkehr aus Cöpenick abwarten, ehe er eine ausreichend große Heerschar um sich sammelte, um die Brandenburg gegen Jaxa zu verteidigen. Die vorhandene Besatzung reichte bestenfalls aus, einem etwaigen Angriff einiger aufständischer Heveller standzuhalten.
Diese Überlegungen brachten Ulric dahin, seine Bemühungen zu verdoppeln. Nach einer Viertelstunde hatte er es geschafft, sich aufzurichten und auf dem Gesäß Millimeter um Millimeter nach hinten zu rutschen, bis er an der Wand seines Verlieses angekommen war. Bald hatte er einen etwas hervorstehenden scharfkantigen Stein ertastet, und an dem rieb er nun die Stricke, die seine Hände zusammenhielten. Es war mehr als mühsam, aber es gelang ihm dennoch, Faser für Faser zu durchtrennen. Endlich hatte er die Hände frei! In Fetzen hing ihm die Haut an den Knöcheln herab, und es dauerte eine Weile, bis er alles Blut abgeleckt hatte. Die Füße freizubekommen war dagegen ein Kinderspiel, denn in seiner Hose hatte er ein kleines Messer eingenäht. Bald waren auch die Fußfesseln zerschnitten. Er wollte sich erheben, aber die Beine knickten ihm weg, und er musste sich an der Leiter festhalten. Es dauerte eine Weile, bis das Blut wieder durch die Adern strömte.
Was nun? Sollte er warten, bis der Knecht wieder zu ihm herabstieg, um ihn zu füttern, und ihn dann überwältigen? Oder sollte er nach oben steigen und zusehen, ob es eine Gelegenheit gab, sein Pferd aus dem Stall zu holen und davonzusprengen? Er schwankte lange, entschied sich dann aber für die zweite Möglichkeit.
Sprosse für Sprosse stieg er die Leiter nach oben, bis sein Kopf gegen die hölzerne Klappe stieß, die sein Verlies abdeckte. Er drückte sie ein wenig nach oben. Alles war dunkel, es schien später Abend oder Nacht zu sein. Nirgendwo brannte ein Kienspan. Ulric hob den Deckel vollends an und legte ihn nach hinten ab. Nun war es ein Leichtes, aus dem Verlies zu steigen. Er sah nicht das Allergeringste, aber sein Geruchssinn sagte ihm, dass er sich in einem Kornspeicher befand. Er wartete einen Augenblick und hoffte auf eine Eingebung. Die kam nicht, dafür aber ging knarrend eine Tür auf, und in der erschien der Knecht, der ihn bisher »betreut« hatte, einen Krug in der einen und eine Art Fackel in der anderen Hand. Ulric von Huysburg bückte sich und schlüpfte hinter ein paar aufgestapelte Säcke. Der Knecht kam vorbei, und mit einem wohlgezielten Faustschlag gegen die Schläfe hatte Ulric dieses Problem gelöst. Ehe der Mann wieder zu sich kam, war er schon längst über alle Berge. Der Krug fiel zwar auf den Boden und zerschellte, aber es war offenbar niemand da, der es gehört hätte. Ulric stülpte sich die Kappe des Slawen über den Kopf und warf sich seinen Umhang über die Schultern, dann nahm er den noch brennenden Kienspan vom Boden auf und schlich sich Richtung Tür.
Als Ulric von Huysburg im Freien angekommen war, bemerkte er, dass es doch noch nicht so spät war, wie er angenommen hatte. Noch nicht alle waren schlafen gegangen. Eine Magd kam ihm entgegen.
»Na, Vuk, hast du deinen Ritter gut versorgt?«
»Tak, przestać robić swój obowiązek«, brummte er, das Gesicht zur Seite gewendet.
Es funktionierte, und er machte sich auf die Suche nach dem Stall, in den man sein Pferd gebracht hatte. Eine Minute später hätte er auf dessen Rücken gesessen, wenn er nicht gegen eine junge Frau geprallt wäre.
»Miluša!«
Er umfing sie, und sie ließ es geschehen. Bald hatte er ihren Mund gefunden und mit seiner Zunge ihre Lippen geöffnet. Er war so entflammt, dass er vergaß, wo er war.
»Ich will dich ganz und für immer!«, flüsterte er und biss ihr ins Ohrläppchen. »Du bist die große Liebe meines Lebens!«
Schreie rissen ihn in die Wirklichkeit zurück. Irgendjemand musste diesen Vuk gefunden haben.
»Flieh, Liebster, flieh!«, hauchte Miluša.
Ulric von Huysburg riss sich los von ihr und rannte in die Richtung, in der er sein Pferd vermutete. Sein Instinkt ließ ihn nicht im Stich. Hinzu kam, dass in diesem Augenblick der Mond durch die Wolken brach. Die Stalltür stand offen, sein Hengst begrüßte ihn mit freudigem Wiehern. Schnell hatte er ihn losgebunden und sich auf seinen Rücken geschwungen.
Im Jahre 1157 dauerte es in den östlichen Grenzregionen des Heiligen Römischen Reiches sehr lange, bis die Menschen im Orte A das erfuhren, was sich in B und C ereignet hatte, und so hatte Albrecht der Bär, als er auf dem Weg nach Althaldensleben war, nicht die geringste Ahnung davon, was sich in Cöpenick und auf der Brandenburg ereignet hatte. Im Prinzip wusste er, dass seine Zukunft im Osten lag, jenseits der Linie, die von der Havel und der Nuthe gebildet wurde, und er hätte sich mehr um die Brandenburg kümmern müssen. Doch sein Gefühl stand ihm dabei im Wege, sein Hass auf alle Welfen und insbesondere auf Heinrich den Löwen. Der hatte ihm Sachsen genommen, das Gebiet, das Jahrhunderte später als Niedersachsen bezeichnet wurde.
»Dieser Mistkerl möge alsbald verrecken!«, rief Albrecht, als ihm im Gespräch mit Hancz von Crüchern die ganze Geschichte noch einmal bewusst geworden war.
Seit fünf, sechs Jahren gab es zwischen ihm und Heinrich dem Löwen immer wieder kleinere Waffengänge und Gefechte, und man zog regelmäßig aus, Siedlungen und Burgen der anderen Seite zu verwüsten. Diesmal sollte es die Burgwartfeste Althaldensleben sein.
Sie erreichten die Ohre am späten Vormittag und beschlossen, hier noch ein wenig zu lagern und Kraft zu schöpfen, bevor sie sich zum Angriff formierten.
»Wenn wir den Fluss hier aufstauen, können wir die ganze Stadt Haldensleben unter Wasser setzen und im Nu erobern«, sagte Hancz von Crüchern.
Albrecht lachte. »Eine gute Idee – aber das Wasser würde wohl nur dann bis zur Burg ansteigen, wenn es wieder mal eine Sintflut gibt, diesmal hier bei uns und nicht am Berge Ararat.«