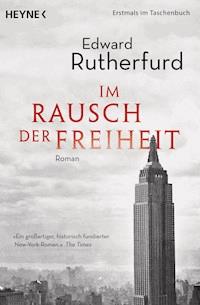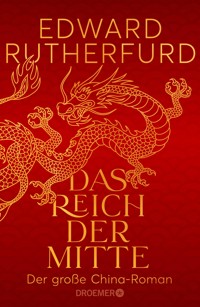11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Der Meister des Monumental-Epos entdeckt Paris neu
Fünf Familien, deren Schicksale sich mit der großen Historie dieser Stadt über Jahrhunderte verweben: Die adligen Le Cygnes sind mit den armen Le Sourds seit der Niederschlagung der Pariser Kommune in einer Rachegeschichte unheilvoll verbunden. Die Brüder Gascon, die in den Hinterhöfen von Montmartre zu Hause sind, erleben bei der Errichtung des Eiffelturms Glanz und Elend – und, was den älteren der beiden Gascons betrifft, die große Liebe. Und schließlich sind da die Blanchards, die im Napoleonischen Zeitalter im Kunsthandel ihr Glück machten, ebenso wie Kunsthändlerfamilie Jacob, die aber 1940 im Zuge der deutschen Besatzung alles zu verlieren drohen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1545
Sammlungen
Ähnliche
DASBUCH
Edward Rutherfurd erzählt von sechs Familien, deren Schicksale sich über Jahrhunderte mit der großen Historie von Paris verweben: Da sind die adligen Le Cygnes, deren monarchistisches Weltbild in der Französischen Revolution ins Wanken gerät und die im 20. Jahrhundert die Résistance unterstützen. Da sind die Brüder Thomas und Luc Gascon, die in den Hinterhöfen von Montmartre aufwachsen. Im Zuge der Errichtung des Eiffelturms erleben sie, wie schmal die Grenze zwischen Glück und Tragik sein kann. So unterschiedlich die beiden Brüder Gascon charakterlich auch sind, so halten der ehrbare Handwerker (Thomas) und der Kellner im Moulin Rouge (Luc) doch zusammen, bis sie als alte Männer, zur Zeit der deutschen Besatzung, zu Feinden wider Willen werden.
Und schließlich sind da die Blanchards, die im Napoleonischen Zeitalter im Handel ihr Glück machen und später profitabel die großen Kaufhäuser und Konsumtempel der Stadt leiten. Aber auch Kunsthändler (Jacob), Kurtisanen (La Belle Helène, Louise) und eine Familie (Le Sourd), die immer auf Seiten der Revolutionäre mitwirkt und mit der Familie Le Cygne in eine lange Rachegeschichte verwickelt ist, spielen eine tragende Rolle in diesem
gewaltigen Epos.
DERAUTOR
Edward Rutherfurd, 1948 in Salisbury geboren, studierte in Cambridge und Stanford und lebt heute in New York. Seine Romane »Sarum« (1990), »London« (1998), »Der Wald der Könige« (Blessing, 2000), »Die Prinzen von Irland« (Blessing, 2005) und sein großer New-York-Roman »Im Rausch der Freiheit« (Blessing, 2012) wurden internationale Bestseller.
EDWARD
RUTHERFURD
PARIS
ROMAN EINER STADT
Aus dem Englischen von
Dietlind Falk und Lisa Kögeböhn
Karl Blessing Verlag
Originaltitel: Paris. The Epic Novel of the City of Lights
Originalverlag Hodder & Stoughton, London
1. Auflage 2014
Copyright 2013 by Edward Rutherfurd
Copyright der Übersetzung 2014 Karl Blessing Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Geviert Grafik & Typografie, München
Umschlagmotiv: Corbis/Bettmann
Vorsatz: Getty Images/Bridgeman Images/Hilaire Guesnu
Nachsatz: Corbis/Chris Hellier
Bildredaktion: Annette Mayer
Satz: Leingärtner, Nabburg
ePub-ISBN: 978-3-641-13787-8
www.blessing-verlag.de
Zum Gedenken an meinen Cousin,
Jean Louis Brizard,
Kinderarzt im Hôpital Beaujon,
im Britischen Krankenhaus und
im Amerikanischen Krankenhaus in Paris
Stammbaum
Inhalt
Stammbaum
Kapitel l 1875
Kapitel ll 1883
Kapitel lll 1261
Kapitel lV 1885
Kapitel V 1887
Kapitel Vl 1307
Kapitel Vll 1887
Kapitel Vlll 1462
Kapitel lX 1897
Kapitel X 1572
Kapitel Xl 1604
Kapitel Xll 1898
Kapitel Xlll 1898
Kapitel XlV 1903
Kapitel XV 1907
Kapitel XVl 1911
Kapitel XVll 1637
Kapitel XVlll 1914
Kapitel XlX 1917
Kapitel XX 1918
Kapitel l
1875
Paris. Stadt der Liebe. Stadt der Träume. Stadt des Glanzes.
Stadt der Heiligen und Gelehrten. Stadt der Freude.
Schmelztiegel des Lasters.
In zweitausend Jahren hatte Paris schon alles gesehen.
Als Erster hatte Julius Cäsar die Entwicklungsmöglichkeiten des Ortes erkannt, in dem der bescheidene Stamm der Parisii beheimatet war. Zu der Zeitwaren die mediterranen Landstriche Südgalliens bereits seit Generationen römische Provinzen. Cäsar entschied, das Reich bis zu den Territorien der lästigen Keltenstämme Nordgalliens auszudehnen.
Die Römer hatten schnell gewusst, dass dies die richtige Stelle für eine Stadt war. Nicht nur wurden hierher die Erträge der riesigen, fruchtbaren Felder Nordgalliens gebracht; das Pariser Gebiet lag obendrein an der gut schiffbaren Seine, die wiederum weiter südlich durch Wasserwege mit der Rhône verbunden war, die als breiter Strom hinunter zu den geschäftigen Häfen des Mittelmeeres floss. In Richtung Norden mündete die Seine in die schmale Meeresstraße, hinter der die Insel Britannien lag. Durch dieses riesige Flusssystem wurden die südliche und die nördliche Welt miteinander verbunden. Bereits vor der Geburt des römischen Reiches hatten griechische und phönizische Händler die Flüsse genutzt.
Paris war auch in anderer Hinsicht ein besonderer Ort. Er lag in einem weiten, niedrigen Tal, durch das sich die Seine mit ihrer Reihe eleganter Schleifen wand. Im Zentrum des Tals weitete sich der Fluss in einer hübschen Ost-West-Biegung, und mitten im Strom lagen einige große Wattgebiete und Inseln wie Schiffe vor Anker. Am nördlichen Ufer erstreckten sich weitläufige Wiesen und Sumpfland bis zu der Hügelkette, die das Tal einschloss, und aus der ein paar kleine Hügel und Vorsprünge herausstachen, die teilweise mit Weinstöcken übersät waren.
Doch am südlichen Ufer – dem linken flussabwärts – erhob sich die Erde nahe dem Fluss sanft zu einer niedrigen, flachen Anhöhe, wie ein Tisch, von dem aus man aufs Wasser blickte. Genau hier erbauten die Römer ihre Stadt: Ein großes Forum und ein Haupttempel erstreckten sich über die Tischplatte, umgeben von einem Straßennetz und einer Nord-Süd-Straße, die mitten durch die Stadt führte, übers Wasser zur größten Insel. Diese verwandelte sich bald in eine Vorstadt mit hübschem Jupitertempel und mit einer Brücke zum nördlichen Ufer hin. Die Römer nannten diese Stadt Lutetia. Doch man kannte sie auch unter einem imposanteren Namen: Stadt der Parisii.
Im finstersten Frühmittelalter, nachdem das Römische Reich zerfallen war, eroberte der germanische Frankenstamm die Gebiete im Land der Franken, das man nun auch einfach Frankreich nannte. Zwar fielen Hunnen und Wikinger in die fruchtbaren Ländereien ein, doch mit ihrem Bollwerk aus Holz überlebte die Insel im Fluss wie ein abgetakeltes altes Schiff. Im Verlauf des Mittelalters entwickelte Lutetia oder Paris sich zu einer prächtigen Stadt. Das Labyrinth aus gotischen Kirchen, hohen Holzhäusern, gefährlichen Gassen und stinkenden Kellern erstreckte sich über beide Seine-Ufer, umgeben von einem steinernen Wall. 1345 wurde Notre-Dame vollendet und schmückte als stattliche Kathedrale die Insel. Die Pariser Universität wurde in ganz Europa geschätzt. Dann fielen die Engländer in Frankreich ein. Und Paris könnte heute noch zu England gehören, wenn nicht Jeanne d’Arc, die sagenumwobene Jungfrau von Orléans, erschienen wäre, um die Besatzer aus den Burgen südlich der Loire zu vertreiben.
Das alte Paris war eine Stadt der bunten Farben und engen Gassen, des Karnevals und der Pest.
Und dann gab es da noch das neue Paris.
Die Veränderung kam schleichend. Seit der Renaissance tauchten leichtere, klassischere Formen im dunklen, mittelalterlichen Durcheinander der Stadt auf. Königliche Paläste und weiträumige Plätze brachten neuen Glanz. Breite Boulevards bahnten sich ihren Weg durch das verrottende alte Häusermeer. Ehrgeizige Herrscher erschufen Panoramen, die dem antiken Rom in nichts nachstanden.
Paris putzte sich für den Prunk unter Ludwig XIV. und die Eleganz unter Ludwig XV. heraus. Im Zeitalter der Aufklärung und während der neuen Republik nach der Französischen Revolution kam klassische Schlichtheit in Mode, die Ära Napoleons dagegen brachte kaiserliche Erhabenheit.
In den folgenden Jahrzehnten trieb ein neuer Städteplaner große Veränderungen voran: Baron Haussmann schuf ein breites Netz von Boulevards und schnurgeraden Straßen, die von eleganten Bürogebäuden und Wohnblöcken gesäumt wurden. In manchen Pariser Vierteln blieb von dem mittelalterlichen Gewirr der Gassen kaum noch eine Spur.
Doch das alte Paris war noch immer da, lauerte hinter mancher Ecke, voller Erinnerungen an vergangene Jahrhunderte. Erinnerungen, so eindringlich wie eine alte, halb vergessene Melodie, die in jedem Zeitalter, in jeder Tonlage, ob auf einer Harfe oder auf einem Leierkasten, doch immer dieselbe war. Dies war ihre unvergängliche Anmut.
Hatte die Stadt nun ihren Frieden gefunden? Sie hatte gelitten und überlebt, hatte Königreiche entstehen und vergehen sehen. Chaos und Diktatur, Monarchie und Republik: Paris hatte alles ausprobiert. Was ihr am besten gefallen hatte? Gute Frage … Trotz ihres Alters und ihrer Anmut schien sie es nicht zu wissen.
1871 durchlitt Paris eine besonders schreckliche Krise: Die Einwohner mussten Ratten essen. Erst kam der Hunger, dann die Scham. Und schließlich fielen die Bewohner von Paris übereinander her.
Vier Jahre später, 1875, schien sich die Stadt erholt zu haben. Doch noch immer gab es viele dringliche Angelegenheiten, die einer Lösung bedurften. Es war noch nicht lange her, dass man die Echos der Erschießungskommandos vernommen, dass man die Leichen vergraben und dass der Wind den Geruch des Todes verweht hatte.
Der kleine Junge war gerade einmal vier Jahre alt. Ein Kind mit blonden Haaren und blauen Augen. Einige Dinge wusste er bereits. Andere noch nicht. Und dann waren da noch die Geheimnisse.
Pater Xavier betrachtete ihn. Wie sehr er seiner Mutter glich. Pater Xavier war Priester, doch er war verliebt in eine Frau, die Mutter dieses Kindes. Zwar gestand er sich selbst seine Leidenschaft ein, aber seine Selbstbeherrschung war vollkommen. Niemand hätte ihm seine Gefühle angesehen. Und was den kleinen Jungen betraf: Gott hatte sicher einen Plan für ihn vorgesehen.
Vielleicht war er dazu bestimmt, geopfert zu werden.
Es war ein sonniger Tag im beliebten Jardin des Tuileries vor dem Louvre, wo Kindermädchen ihren Zöglingen beim Spielen zusahen und Pater Xavier mit ihm einen Spaziergang machte. Pater Xavier: Beichtvater der Familie, Freund in der Not, Priester.
»Wie lauten deine Namen?«
»Roland, d’Artagnan, Dieudonné de Cygne.« Er kannte alle auswendig.
»Bravo, junger Mann.« Pater Xavier Parle-Doux war ein kleiner, drahtiger Mann in den Vierzigern. Vor langer Zeit war er einmal Soldat gewesen. Seit einem Sturz vom Pferd litt er fortwährend an stechenden Schmerzen im Rücken – nur eine Handvoll Menschen wusste davon.
Doch seine Zeit als Soldat hatte noch andere Spuren hinterlassen. Er hatte seine Pflicht getan und das Töten miterlebt. Und noch Schlimmeres. Am Ende hatte er gedacht, es müsse etwas Besseres geben, etwas Heiliges, eine nicht zu löschende Flamme des Lichts und der Liebe in der furchtbaren Finsternis dieser Welt. Er hatte sie im Herzen der Heiligen Kirche gefunden.
Außerdem war er Monarchist.
Er kannte die Familie des Jungen schon ein Leben lang und blickte voller Zuneigung, aber auch voller Mitleid auf Roland hinunter. Der Junge hatte weder Brüder noch Schwestern. Seine Mutter, diese wundervolle Seele, die der Pater selbst gern zur Frau genommen hätte, wäre er nicht einer anderen Berufung gefolgt, war von schwacher Gesundheit. Vielleicht würde die Zukunft der Familie allein auf Rolands Schultern ruhen: eine schwere Last für einen kleinen Jungen.
Doch als Priester musste er die Gesamtsituation betrachten. Wie sagten die Jesuiten noch? »Gebt uns einen Jungen bis zum siebten Jahr, und er wird uns ein Leben lang angehören.« Was auch immer Gott mit diesem Kind vorhatte, ganz gleich, ob er dabei glücklich wurde oder nicht, Pater Xavier würde ihn auf den Weg seiner Vorsehung lenken.
»Und wer war Roland?«
»Roland war ein Held.« Der kleine Junge blickte auf, um zu sehen, ob er richtiglag. »Mutter hat mir die Geschichte vorgelesen. Er war mein Vorfahr«, fügte er ehrfürchtig hinzu.
Der Priester lächelte. Das berühmte Rolandslied war eine packende, achthundert Jahre alte, romantische Sage darüber, wie ein Freund Karls des Großen beim Weg über die Berge von den Truppen getrennt wurde. Wie er auf seinem Horn vergebens um Hilfe blies. Wie die Sarazenen ihn abschlachteten und der Kaiser um den verlorenen Freund weinte. Der Anspruch auf Verwandtschaft der Familie de Cygne mit Roland war zwar etwas abenteuerlich, aber durchaus charmant.
»Zu deinen Vorfahren gehörten auch einige Ritter aus den Kreuzzügen«, sagte Pater Xavier und nickte ermutigend. »Doch das ist nichts Außergewöhnliches. Schließlich bist du von adeliger Herkunft.« Er hielt kurz inne. »Und wer war d’Artagnan?«
»Ein berühmter Musketier. Und auch mein Vorfahr.«
Tatsächlich basierte das Schicksal des Helden des vor dreißig Jahren erschienenen Romans Die drei Musketiere auf dem Leben eines Mannes, der wirklich gelebt hatte. Und zur Zeit von Ludwig XIV. hatte ein Mitglied von Rolands Familie eine Adelige geheiratet, die ebenfalls d’Artagnan hieß – wobei der Priester bezweifelte, dass sie sich großartig dafür interessiert hatten, bevor der Roman diesen Namen berühmt gemacht hatte.
»Das Blut der d’Artagnans fließt in deinen Adern. Sie waren Soldaten, die dem König gedient haben.«
»Und Dieudonné?«
Kaum waren diese Worte ausgesprochen, machte Pater Xavier sich Vorwürfe. War er zu weit gegangen? Ahnte das Kind etwas von den Schrecken der Guillotine, die sich hinter seinem letzten Namen verbargen?
»Weißt du, der Name deines Großvaters ist wunderschön.« Dann sagte er: »Er bedeutet ›von Gott gegeben‹.« Für einen Moment dachte er nach. »Die Geburt deines Großvaters war – ich will nicht sagen, ein Wunder –, aber ein Zeichen. Eines musst du noch wissen, Roland«, sagte der Priester. »Kennst du den Leitspruch deiner Familie? Er ist sehr wichtig. ›Selon la volonté de Dieu‹ – Gottes Willen gemäß.«
Pater Xavier hob den Blick, um die Landschaft zu betrachten. Im Norden erhob sich der Hügel von Montmartre, auf dem der heilige Bischof Dionysius vor sechzehn Jahrhunderten den Märtyrertod durch die heidnischen Römer gefunden hatte. Im Südwesten, hinter den Türmen von Notre-Dame, lag jene Anhöhe über dem linken Ufer, auf der die heilige Genoveva Gott unaufhörlich darum gebeten hatte, die Stadt vor Attila und seinen Hunnen zu verschonen – und ihre Gebete waren erhört worden.
Immer und immer wieder hatte Gott Frankreich in Zeiten der Not beschützt, dachte der Priester. Hatte Er nicht, als die Moslems von Afrika und Spanien aus nach Norden strebten und kurz davor standen, ganz Europa zu überrennen, einen starken General geschickt, den Großvater Karls des Großen, um sie zurückzuschlagen? Und als die Engländer in ihrem langen Ringen mit den französischen Königen sich zu den Herrschern des Festlands aufgeschwungen hatten, war es da nicht der gute Gott gewesen, der Frankreich Jeanne d’Arc, die Jungfrau von Orléans, schickte, um den Feind zu vertreiben?
Doch vor allem hatte Gott Frankreich seine Königsfamilie gegeben, deren Häuser Capet, Bourbon und Valois dieses heilige Land seit dreißig Generationen regierten, einten und ihm Ruhm brachten.
Und in all diesen Jahrhunderten hatten die de Cygnes diesen von Gott gesandten Königen treu gedient.
Dies war das Erbe des kleinen Jungen. Im Laufe der Jahre würde er verstehen.
Jetzt war es Zeit, nach Hause zu gehen. Hinter ihnen, am Ende der Tuilerien, erstreckte sich die Place de la Concorde. Und dahinter führten die wunderbaren Champs-Élysées drei Kilometer weit bis zum Arc de Triomphe.
Der Junge war noch zu klein, um zu wissen, welche Rolle die Place de la Concorde in seiner Geschichte gespielt hatte. Und was den Arc de Triomphe anging: Er mochte prachtvoll sein, doch für republikanische Denkmäler hatte Pater Xavier nichts übrig.
Stattdessen ließ er den Blick noch einmal zum Montmartre schweifen – dem Hügel, auf dem einst ein heidnischer Tempel gestanden hatte, auf dem der heilige Dionysius um das Jahr 272 gemartert worden war und auf dem sich während der jüngsten Aufstände in der Stadt so schreckliche Szenen abgespielt hatten. Wie passend, dass sich dort bei den Windmühlen genau in diesem Jahr eine neue Kirche erheben würde, eine Kirche fürs katholische Frankreich, deren reine, weiße Kuppel wie eine Taube über der Stadt erstrahlen würde. Die Basilika Sacré-Cœur, die Herz-Jesu-Basilika.
Dies war die Kirche, in der der kleine Junge dienen sollte. Denn Gott hatte die Familie de Cygne nicht grundlos gerettet. Es galt, Schande zu überwinden und Glauben zu erneuern.
»Kannst du noch ein wenig selber laufen?«, fragte er. Roland nickte. Dankbar setzte der Priester ihn ab und streckte seinen Rücken. »Sollen wir ein Lied singen?«, fragte er. »Vielleicht Frère Jacques?«
Und so verließen der Priester und der Junge singend und Hand in Hand unter den Blicken einiger Kinder und Kindermädchen den Park.
Als Jules Blanchard das Ende der Champs-Élysées Richtung Louvre erreichte und auf die Kirche La Madeleine zuging, hatte er allen Grund, glücklich zu sein. Er hatte bereits zwei Söhne, beides gute Jungen. Doch er hatte sich immer eine Tochter gewünscht. Und um acht Uhr an diesem Morgen hatte seine Frau ihm ein kleines Mädchen geschenkt.
Es gab lediglich ein Problem, und dieses zu lösen, erforderte ein gewisses Maß an Fingerspitzengefühl – aus diesem Grund war er zu einem Rendezvous mit einer Dame unterwegs, die nicht seine Ehefrau war.
Jules Blanchard war ein kräftig gebauter, energischer Mann mit nicht unerheblichem Familienvermögen. Einer seiner Vorfahren war im vorangegangenen Jahrhundert, als die Rokoko-Monarchie Ludwigs XV. sich mit den großen Ideen der Aufklärung konfrontiert sah und die Französische Revolution die Welt auf den Kopf stellte, ein Buchhändler mit radikalen Ansichten gewesen. Doch dessen Sohn, Jules’ Großvater, ein Arzt, hatte während der Revolution die Aufmerksamkeit des aufstrebenden Generals Napoleon Bonaparte erlangt und nie mehr zurückgeblickt. Unter Napoleons Herrschaft sowie der anschließend wiederhergestellten Bourbonenmonarchie hatte er als angesehener Arzt praktiziert, der sich schließlich in einem stattlichen Haus in Fontainebleau zur Ruhe setzen konnte, das sich auch heute noch im Familienbesitz befand. Seine Frau stammte aus einer Händlerfamilie, und eine Generation später war Jules’ Vater ebenfalls Geschäftsmann geworden. Er hatte sich auf den Getreidegroßhandel spezialisiert und Mitte des neunzehnten Jahrhunderts bereits ein beträchtliches Vermögen erwirtschaftet. Jules war mit ins Geschäft eingestiegen und nun, im Alter von fünfunddreißig Jahren, bereit, es von seinem Vater zu übernehmen, sobald jener angesehene Herr sich endgültig für den Ruhestand entschied.
An der Madeleine-Kirche hielt Jules sich halb rechts. Er mochte diesen Boulevard, der an dem gewaltigen neu errichteten Opernhaus vorbeiführte. Die von Garnier entworfene Pariser Opéra war erst Anfang des Jahres vollendet worden, doch bereits jetzt ein Wahrzeichen. Abgesehen von ihren vielen versteckten Besonderheiten – zu denen ein raffinierter künstlicher See im Keller zählte, um den Grundwasserspiegel zu kontrollieren – war die Opéra, die Jules mit ihrem großen, runden Dach an eine riesige, garnierte Torte erinnerte, schlichtweg ein imposantes Bauwerk: Prunkvoll und pompös entsprach sie ganz dem Zeitgeist.
Inzwischen war der Treffpunkt für sein Rendezvous in Sichtweite. Unweit der Opéra befand sich in einem Eckhaus das Café Anglais. Von außen eher schlicht, war die Inneneinrichtung so nobel, dass sie königlichen Ansprüchen genügte. Einige Jahre zuvor hatten die Herrscher von Russland und Deutschland dort ein legendäres, acht Stunden währendes Festmahl eingenommen.
Wo sonst hätte Jules sich mit einer Frau wie Joséphine zum Mittagessen treffen sollen?
Der große vertäfelte Saal, unter dem Namen Le Grand Seize bekannt, war auch in der Mittagszeit geöffnet. Als er den Raum betrat, vorbei an sich verbeugenden Kellnern, vergoldeten Spiegeln und Topfpflanzen, erblickte er sie sofort.
Joséphine Tessier war eine jener modernen Frauen, die von Oberkellnern gern in der Mitte des Raumes platziert wurden – es sei denn, die Dame äußerte murmelnd den Wunsch nach Diskretion. Sie trug ein ebenso teures wie elegantes blassgraues Seidenkleid mit Spitzenkragen und dazu ein keckes Federhütchen.
Raschelnde Seide und ein betörender Duft begrüßten ihn. Er hauchte ihr einen Kuss auf die Hand, setzte sich und bestellte beim Kellner Champagner.
»Was gibt es zu feiern?«, erkundigte sich die Dame. »Hast du gute Neuigkeiten?«
»Es ist ein Mädchen.«
»Glückwunsch.« Sie lächelte. »Ich freue mich sehr für dich, mein lieber Jules. Genau, wie du es dir gewünscht hast.«
Jules wusste, dass er sich überaus glücklich schätzen konnte, Joséphines Liebhaber gewesen zu sein, als sie beide noch jung waren. Inzwischen hätte er sie sich vermutlich nicht mehr leisten können, so wohlhabend er auch war. Tatsächlich wurde sie dieser Tage von einem überaus reichen Bankier ausgehalten. Dennoch zählte ihre Freundschaft für ihn zu einer der besten, die ein Mann sich nur wünschen kann. Sie war seine ehemalige Geliebte, seine Vertraute und seine Freundin.
Als der Champagner serviert wurde, stießen sie auf das Baby an. Dann gaben sie die Bestellung auf und plauderten über dies und jenes. Erst als eine leichte, klare Suppe serviert wurde, schnitt Blanchard das Thema an, das er auf dem Herzen hatte.
»Es gibt da ein Problem«, sagte er. Joséphine wartete ab. Seine Miene verdüsterte sich. »Meine Frau will sie Marie nennen«, sagte er schließlich.
»Marie.« Seine Freundin dachte nach. »Kein schlechter Name.«
»Ich habe dir immer versprochen, meine Tochter nach dir zu benennen.«
Sie blickte überrascht zu ihm auf.
»Das ist lange her, chéri, und das ist nicht so wichtig.«
»Doch, es ist mir wichtig. Ich möchte sie Joséphine nennen.«
»Und was, wenn deine Frau den Namen mit mir in Verbindung bringt?«
»Sie weiß nichts von uns, da bin ich mir sicher. Ich werde darauf bestehen.« Verdrossen nippte er an seinem Champagner. »Glaubst du wirklich, es wäre riskant?«
»Ich werde ihr nichts verraten, da kannst du dir sicher sein«, entgegnete Joséphine. »Aber wer weiß schon, was andere tun …« Sie schüttelte den Kopf. »Du spielst mit dem Feuer.«
»Ich dachte, ich sage ihr, dass ich sie nach Kaiserin Joséphine benennen will«, beharrte er.
Die wunderschöne Ehefrau Napoleons, die große Liebe des Feldherrn. Eine legendäre Romanze – mit traurigem Ende.
»Aber sie war dem Kaiser notorisch untreu«, wandte Joséphine ein. »Nicht gerade das beste Vorbild für deine Tochter.«
»Ich hatte gehofft, dir fiele etwas Besseres ein.«
»Nein.« Joséphine schüttelte den Kopf. »Mein lieber Freund, dies ist keine gute Idee. Nenn deine Tochter Marie und mach deine Frau glücklich. Mehr kann ich dazu nicht sagen.«
Der nächste Gang war eine weitere Spezialität des Hauses: Hummerscheibchen in Aspik. Sie unterhielten sich über alte Bekannte und das Opernprogramm. Erst beim Dessert, einem Obstsalat, kam Joséphine erneut auf Jules’ Ehe zu sprechen, nachdem sie ihn einen Augenblick lang nachdenklich gemustert hatte.
»Willst du deine Frau unglücklich machen, chéri? Hat sie dir etwas getan?«
»Nein, natürlich nicht.«
»Bist du ihr untreu?«
»Nein.«
»Macht sie dich glücklich?«
Er zuckte mit den Schultern. »Es ist alles in Ordnung«, sagte er schließlich.
»Du musst lernen, glücklich zu sein, Jules«, seufzte sie. »Du hast alles, was du brauchst, einschließlich deiner Frau.«
Joséphine war weder schockiert noch überrascht gewesen, als Jules Blanchard seine Heirat angekündigt hatte. Seine Wahl war auf eine Cousine mütterlicherseits gefallen, die eine große Mitgift in die Ehe brachte. Wie Jules es damals ausgedrückt hatte: »Nun sind die beiden Hälften des Familienvermögens wiedervereint.«
Jules blickte noch immer finster drein.
Joséphine Tessier hatte in ihrem Leben viele Männer studiert. Das war schließlich ihr Beruf. Ihrer Meinung nach waren Männer häufig unzufrieden, weil sie sich die falsche Tätigkeit ausgesucht hatten. Bei anderen konnte man sogar meinen, sie lebten in der falschen Zeit – ein geborener Ritter beispielsweise, gefangen im modernen Geschäftsleben. Doch Jules Blanchard war wie geschaffen für das Frankreich des 19. Jahrhunderts.
Als die Französische Revolution die Herrschaft des Königs und der Aristokratie – des Ancien Régime – gebrochen hatte, war die Bahn frei geworden für die Reichen, die Haute Bourgeoisie. Napoleon hatte mit seinen Triumphbögen und seinem Streben nach Ruhm seine ganz persönliche Version des Römischen Reiches geschaffen, doch gleichzeitig hatte er darauf geachtet, der breiten Mittelschicht zu gefallen. Und so war es auch nach seinem Sturz geblieben.
Sicher, einige Konservative wünschten sich das Ancien Régime zurück, doch als die wiederhergestellte Bourbonenmonarchie 1830 einen einzigen dementsprechenden Versuch wagte, hatten die Pariser den Bourbonenkönig abgesetzt und Louis-Philippe, einen Cousin des Königs aus der Orléans-Linie, als konstitutionellen und ausnehmend bürgerlichen Monarchen eingesetzt.
Ihm gegenüber standen die Radikalen und Sozialisten, die das neue bürgerliche Frankreich hassten und eine erneute Revolution anstrebten. Doch als sie 1848 auf die Straße gingen, in der Hoffnung, ihre Zeit sei gekommen, war es kein sozialistischer Staat, sondern eine konservative Republik, die aus diesen Kämpfen hervorging, gefolgt von dem überaus bürgerlichen Kaiserreich unter Napoleon III. – dem Neffen des großen Herrschers –, das wiederum die Bankiers und Börsenhändler, die Grundbesitzer und Großhändler begünstigte. Männer wie Jules Blanchard.
Diese Männer waren es, die mit ihren wunderschön gekleideten Frauen im Bois de Boulogne am westlichen Stadtrand ausritten oder sich zu eleganten Abenden in dem neuen riesigen Opernhaus mit seiner Marmortreppe, seinem Grand Foyer und dem acht Tonnen schweren Kristalllüster versammelten, wo sich auch Jules und seine Frau gern sehen ließen. Es bestand kein Zweifel, dachte Joséphine, dass Jules Blanchard es in diesem Jahrhundert wahrlich gut hatte.
Noch dazu hatte er sie.
»Was ist los, mein Lieber?«, fragte sie sanft.
Jules dachte nach. Es war nicht so, dass er sein Glück nicht zu schätzen wusste. Dazu liebte er viel zu sehr das alte Familienanwesen in Fontainebleau, mit seinem ummauerten Hof, den Premier-Empire-Möbeln und den ledergebundenen Büchern seines Großvaters. Und auch das elegante königliche Château in der Stadt, das älter und bescheidener war. Sonntags ging er gern im nahe gelegenen Wald von Fontainebleau spazieren oder unternahm einen Ausritt in das Dorf Barbizon, wo der große Corot, der Anfang dieses Jahres gestorben war, Landschaften gemalt hatte, die in das schummrige Licht der Seine getaucht waren. In Paris schätzte Jules sich glücklich, auf dem mittelalterlichen Großmarkt Les Halles handeln zu dürfen, mit seinen leuchtend bunten Ständen, dem geschäftigen Treiben und dem Duft nach Käse, Kräutern und Früchten aus allen Regionen Frankreichs. Er war stolz auf seine detaillierte Kenntnis der historischen Kirchen und Gasthäuser mit ihren tiefen Weinkellern.
Und doch reichte es ihm nicht.
»Ich langweile mich«, sagte er. »Ich will geschäftlich einen neuen Weg einschlagen.«
»Wohin soll der führen, mein lieber Jules?«
»Ich habe einen Plan«, vertraute er ihr an. »Einen Plan, der dich beeindrucken wird.« Er machte eine ausladende Geste. »Ein neues Geschäft für das neue Paris.«
Wenn Jules Blanchard vom neuen Paris sprach, meinte er nicht nur Baron Haussmanns breite Boulevards. Bereits zur Zeit der großen gotischen Kathedralen Frankreichs hatte sich Paris – zumindest innerhalb Nordeuropas – nur zu gern für die Modehauptstadt gehalten. Den Parisern hatte es ganz und gar nicht geschmeckt, als London ein Vierteljahrhundert zuvor mit seiner Industrieausstellung die internationalen Schlagzeilen beherrschte: In einem eigens zu diesem Zweck erbauten, enormen Glaspalast wurde alles ausgestellt, was neu und aufregend in der Welt war. New York hatte kurze Zeit später nachgezogen. Doch im Jahr 1855 war Paris bereit gewesen, zurückzuschlagen, und ihr neuer Kaiser, Napoleon III., hatte in einer gewaltigen Halle aus Stahl, Glas und Stein auf den Champs-Élysées zur Weltausstellung der Industrie und der schönen Künste geladen. Zwölf Jahre später war Paris erneut Schauplatz, diesmal auf dem riesigen Exerzierplatz an der Rive Gauche, bekannt als Champ de Mars. Diese Ausstellung im Jahr 1867 war die größte, die die Welt je gesehen hatte, und umfasste unterschiedlichste Wunderwerke wie etwa den ersten elektrischen Dynamo von Siemens.
»Ich möchte ein Kaufhaus eröffnen«, sagte Jules. In New York gab es Kaufhäuser: allen voran das florierende Macy’s. London hatte bis auf Whiteleys in der Vorstadt und einigen Konsumgenossenschaften noch nichts zu bieten, was von Belang war. Paris führte das Feld, was Stil und Größe betraf, bereits mit Bon Marché und Printemps an. »Darin liegt die Zukunft«, verkündete Jules. Er beschrieb das Kaufhaus, das ihm vorschwebte, einen großen Palast, in dem einem breiten Publikum alle erdenklichen Waren feilgeboten wurden. »Stil, wohlkalkulierte Preise und das Ganze mitten in der Stadt«, erklärte er mit zunehmender Begeisterung, während Joséphine ihn fasziniert beäugte.
»Ich wusste gar nicht, dass du so leidenschaftlich sein kannst«, sagte sie.
»Oh.«
»Ich meine natürlich im Geiste.« Sie lächelte.
»Ach so.«
»Und was hält dein Vater davon?«
»Er will nichts davon wissen.«
»Was hast du vor?«
»Abwarten.« Er seufzte. »Was bleibt mir anderes übrig?«
»Du willst es nicht auf eigene Faust versuchen?«
»Schwierig. Ihm obliegen die Finanzen. Und ein Familienzerwürfnis zu provozieren …«
»Du liebst deinen Vater, nicht wahr?«
»Natürlich.«
»Sei nett zu deinem Vater und zu deiner Frau, mein lieber Jules. Hab Geduld.«
»Das muss ich wohl.« Er schwieg einen Moment lang. Dann hellte sich seine Miene auf. »Aber ich will meine Tochter trotzdem Joséphine nennen.«
Mit der Ankündigung, er müsse zurück zu seiner Frau, machte er sich zum Gehen bereit. Sie legte ihm mahnend die Hand auf den Arm.
»Tu es nicht, mein Lieber. Auch mir zuliebe. Tu es nicht.«
Ohne darauf verbindlich zu antworten, bezahlte er die Rechnung beim Kellner und entfernte sich.
Joséphine hing noch eine Weile ihren Gedanken nach. War er tatsächlich entschlossen, seine Tochter Joséphine zu nennen? Oder hatte er sich lediglich daran erinnert, dass er ihr vor langer Zeit ein albernes Versprechen gegeben hatte, und spielte ihr etwas vor, damit sie ihn davon freisprach? Sie lächelte in sich hinein. Es war gleichgültig. Selbst wenn Letzteres zutraf, war es ein aufmerksamer und kluger Schachzug.
Sie mochte kluge Männer. Und es amüsierte sie, dass er ihr mit seinem Tun noch immer Rätsel aufgab.
Die große, hagere Frau hielt inne. Neben ihr stand ein dunkelhaariger Junge von neun Jahren mit kurzen Haaren und weit auseinanderstehenden Augen. Er sah intelligent aus.
Die Witwe Le Sourd war vierzig, doch vielleicht lag es an den graubraunen Kleidern, die lose von ihrem knochigen Körper hingen, oder an ihren langen, verfilzten grauen Haaren oder an ihrem versteinerten Gesicht, dass sie viel älter wirkte. Und wenn sie grimmig aussah, dann hatte dies seinen Grund.
Am Vorabend hatte ihr Sohn wieder einmal eine Frage gestellt. Und heute hatte sie beschlossen, dass es Zeit wurde, ihm die Wahrheit zu sagen.
»Gehen wir rein«, sagte sie.
Der große Friedhof Père Lachaise erstreckte sich über die Hänge der Hügel etwa drei Meilen östlich der Tuilerien, die Pater Xavier und der kleine Roland etwa eine Stunde zuvor verlassen hatten. Es handelte sich um eine uralte Grabstätte, auf der unzählige große Männer ihre letzte Ruhe fanden – Staatsmänner, Soldaten, Künstler und Komponisten –, und oft kamen Besucher, um sich deren Gräber anzusehen. Doch die Witwe Le Sourd hatte ihren Sohn aus einem bestimmten Grunde hierhergebracht.
Sie betraten den Friedhof durch das der Stadt zugewandte Tor am Fuß des Hügels. Zwischen den Grabstätten vor ihnen erstreckten sich gepflasterte und mit Bäumen gesäumte Wege wie kleine römische Straßen. Alles war still. Mit Ausnahme des Wachmanns am Tor waren sie beinahe allein. Die Witwe wusste ganz genau, wohin sie gehen mussten. Der Junge nicht.
Zunächst nahmen sie sich einen Augenblick Zeit, um sich das rechts vom Eingang gelegene Monument anzusehen, das diesen Ort berühmt gemacht hatte, den hohen Schrein der mittelalterlichen Liebenden Abaelard und Heloïse. Doch sie blieben nicht lang. Die Witwe hielt sich mit keinem der Gräber von Napoleons berühmten Feldmarschällen auf, auch nicht mit dem kürzlich angelegten Grab von Corot, dem Maler, noch nicht einmal mit dem würdevollen Grab des Komponisten Chopin. Das wären nur Ablenkungen gewesen. Sie musste ihren Sohn darauf vorbereiten, die Wahrheit zu erfahren.
»Jean Le Sourd war ein mutiger Mann.«
»Ich weiß, Maman.« Sein Vater war ein Held gewesen. Jeden Abend vor dem Schlafengehen rief er sich alles von diesem großen, gutmütigen Mann ins Gedächtnis, woran er sich noch erinnern konnte, wie er ihm Geschichten erzählt und mit ihm Ball gespielt hatte. Der Mann, der immer Brot auf den Tisch gebracht hatte, selbst wenn Paris hungerte. Und wenn seine Erinnerungen unscharf wurden, gab es da immer noch dieses Foto, das einen gut aussehenden Mann zeigte, dunkelhaarig und mit weit auseinanderstehenden Augen, wie er selbst sie hatte. Manchmal träumte er von ihm. Sie erlebten Abenteuer zusammen. Einmal kämpften sie sogar in einer Straßenschlacht, Seite an Seite.
Minutenlang führte seine Mutter ihn schweigend den Hügel hinauf, bevor sie kurz vor der Spitze nach rechts in einen langen Weg abbogen. Nun sprach sie wieder.
»Dein Vater hatte eine noble Seele.« Sie blickte herunter zu ihrem Sohn. »Was, glaubst du, bedeutet es, nobel zu sein, Jacques?«
»Ich glaube …«, der Junge dachte nach, »mutig zu sein wie ein Ritter, der um seine Ehre kämpft.«
»Nein«, sagte sie barsch. »Diese Ritter in ihren Rüstungen waren ganz und gar nicht nobel. Sie waren Diebe, Tyrannen, die so viel Macht und Reichtümer an sich rissen, wie sie nur konnten. Sie nannten sich selbst nobel, um sich als ehrenhaft aufzuplustern und so zu tun, als wäre ihr Blut kostbarer als unseres, damit sie tun konnten, was sie wollten. Aristokraten!« Sie verzog das Gesicht. »Erlogene Ehrenhaftigkeit. Und der Schlimmste von allen war der König. Eine jahrhundertelange, abscheuliche Verschwörung.«
Der junge Jacques wusste natürlich, dass seine Mutter den Geist der Französischen Revolution bewunderte. Doch nach dem Tod seines Vaters hatte sie es immer vermieden, über derlei Dinge zu sprechen, als gehörten sie an irgendeinen dunklen Ort, den sie nicht mehr betreten mochte.
»Wie konnten sie so lange regieren, Maman?«
»Weil es eine kriminelle Organisation gab, die noch machtvoller und grausamer war als der König. Kennst du sie?«
»Nein, Maman.«
»Es war die Kirche, Jacques. Der König und seine Adeligen haben die Kirche unterstützt, und die Priester haben den Menschen eingeredet, sie müssten ihnen gehorchen. Das war der Pakt des Ancien Régime. Eine riesige Lüge.«
»Ich dachte, die Revolution hätte das verändert.«
»Das Jahr 1789 war mehr als eine Revolution. Es war die Geburt der Freiheit selbst. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit: Dies sind die nobelsten Ideen, die ein Mensch verfolgen kann. Das Ancien Régime hat gegen sie angekämpft, also hat ihnen die Revolution die Köpfe abgeschlagen. Es war absolut notwendig. Doch das war nicht alles. Die Revolution hat uns aus dem Gefängnis befreit, in das uns die Kirche eingeschlossen hatte. Die Macht der Priester war zerschlagen. Es stand den Menschen nun frei, Gott zu leugnen, frei von Aberglauben zu sein und ihrem Verstand zu folgen. Es war ein großer Schritt nach vorn für die Menschheit.«
»Und was ist mit den Priestern passiert, Maman? Hat man sie auch umgebracht?«
»Einige.« Sie zuckte mit den Schultern. »Nicht genug.«
»Es gibt heute auch noch Priester.«
»Leider.«
»Also waren alle Revolutionäre Atheisten?«
»Nicht alle. Aber die Besten unter ihnen.«
»Glaubst du nicht an Gott, Maman?«, fragte Jacques. Seine Mutter schüttelte den Kopf. »Und mein Vater?«, insistierte er, »hat er geglaubt?«
»Nein.«
Einen Moment lang dachte der Junge nach.
»Dann werde ich es auch nicht tun«, sagte er.
Der Weg machte eine Biegung nach Westen, sie näherten sich dem Rand des Friedhofs.
»Was ist mit der Revolution passiert, Maman? Warum hat sie sich nicht durchgesetzt?«
Wieder zuckte seine Mutter mit den Schultern.
»Alles stand Kopf. Napoleon kam an die Macht. Er war halb Revolutionär und halb römischer Kaiser. Vor seinem Sturz hätte er beinahe ganz Europa erobert.«
»War er auch Atheist?«
»Wer weiß. Die Kirche hat den Großteil ihrer Macht eingebüßt, doch auch Napoleon fand die Priester nützlich – wie die meisten Herrscher.«
»Und nach ihm ging es dann einfach so weiter wie früher?«
»Nicht ganz. Sämtliche europäische Herrscher hatten furchtbare Angst vor einer neuen Revolution. Dreißig Jahre gelang es ihnen, diese Kräfte in Schach zu halten. All die konservativen Kreise Frankreichs – die alten Monarchisten, die reichen Bürger, jeder, der Veränderung fürchtete –, sie alle unterstützten die konservativen Regierungen. Das Volk hatte keine Macht, die Armen wurden ärmer. Doch der Geist der Freiheit überlebte. 1848 kam es überall in Europa zu Revolutionen, auch hier. Der dicke alte Louis-Philippe, der König der Bourgeoisie, bekam eine solche Angst, dass er mit der nächstbesten Kutsche nach England verschwand. Wir wurden wieder zu einer Republik. Und wir wählten Napoleons Neffen, um sie zu regieren.
»Aber er hat sich zum Kaiser ernannt.«
»Er wollte sein wie sein Onkel. Nachdem er die Republik zwei Jahre lang regiert hatte, ernannte er sich selbst zum Kaiser – und weil der große Napoleon einen Sohn gehabt hatte, der gestorben war, nannte er sich Napoleon III.« Sie schüttelte den Kopf. »Tja, seine Aufschneiderqualitäten muss man ihm lassen. Baron Haussmann hat Paris umgebaut. Eine glanzvolle neue Oper. Riesige Ausstellungen, zu denen die halbe Welt anreiste. Aber den Armen ging es immer noch nicht besser. Und dann, nach zehn Jahren, machte Napoleon III. einen dummen Fehler. Er zog gegen Deutschland in den Krieg. Doch er war kein General, und er verlor.«
»Ich erinnere mich, wie die Deutschen nach Paris gekommen sind.«
»Sie zerschlugen unsere Armeen und umstellten Paris. Monate ging das so. Wir wären beinahe verhungert. Das wusstest du noch gar nicht, aber am Ende war Rattenfleisch in den kleinen Eintöpfen, die ich dir damals zu essen gab. Du warst erst fünf, doch zum Glück warst du kräftig. Als sie uns am Ende mit schwerer Artillerie bombardierten, konnten wir nichts mehr tun. Paris ergab sich.« Wieder ein Schulterzucken. »Die Deutschen gingen zurück nach Deutschland, doch sie zwangen uns, Elsass-Lothringen abzugeben – diese schönen Gebiete auf unserer Seite des Rheins mit ihren Weinstöcken und Bergen. Frankreich war gedemütigt.«
»Und danach wurde mein Vater getötet. Du hast mir immer gesagt, dass er im Kampf gestorben ist. Aber ich habe es nie wirklich verstanden. Meine Lehrer in der Schule sagen …«
»Vergiss, was sie sagen«, unterbrach ihn seine Mutter. »Ich werde dir erzählen, was passiert ist.«
Sie hielt einen Moment inne, und der Hauch eines zärtlichen Lächelns huschte kurz über ihr Gesicht.
»Weißt du«, fuhr sie fort, »als ich heiraten wollte, war meine Familie nicht sehr glücklich darüber. Wir waren recht arm, doch mein Vater war Lehrer und wollte, dass ich einen gebildeten Mann heirate. Jean Le Sourd war Sohn eines Arbeiters und kaum zur Schule gegangen. Er arbeitete als Setzer in einer Druckerei, doch er war ausgesprochen neugierig.«
»Und was geschah dann?«
»Mein Vater beschloss, meinen zukünftigen Ehemann zu bilden. Und dein Vater hatte nichts dagegen. Tatsächlich war er ein ausgezeichneter Schüler und las schon bald darauf alles, was er in die Finger bekam. Am Ende hatte er, denke ich, mehr gelesen als jeder andere Mensch, den ich kenne. Und durch seine Studien fand er zu den Überzeugungen, für die er gestorben ist.«
»Er hat an die Revolution geglaubt.«
»Dein Vater hatte verstanden, dass selbst die Französische Revolution noch nicht genug gewesen war. Zum Zeitpunkt deiner Geburt wusste er, dass der einzige Weg die absolute Herrschaft des Volkes und die Abschaffung allen Privateigentums wäre. Und viele andere mutige Männer dachten das Gleiche.«
Nun konnten sie zu ihrer Rechten hinter einigen Bäumen die Friedhofsmauer sehen. Sie waren fast an ihrem Ziel angelangt.
»Vor vier Jahren«, fuhr seine Mutter fort, »schien es so, als wäre der Augenblick gekommen. Napoleon III. war geschlagen. Die Regierungsmacht, oder vielmehr was noch von ihr übrig geblieben war, ruhte in den Händen der Nationalversammlung, unten im königlichen Landsitz von Versailles. Ihre Delegierten waren so konservativ, dass wir fürchteten, sie könnten sich für eine neuerliche Monarchie entscheiden. Die Versammlung hatte Angst vor Paris, weißt du, weil wir unsere eigene Miliz und viele Kanonen oben auf dem Montmartre hatten. Sie schickten Truppen, um uns die Kanonen zu nehmen. Doch die Truppen liefen zu uns über. Und dann geschah es plötzlich: Paris beschloss, sich selbst zu regieren. Das war die Kommune.«
»Meine Lehrer sagen, dass es nicht gut ging.«
»Sie lügen. Dieser Frühlingsanfang war eine wunderbare Zeit. Alles funktionierte. Die Kommune übernahm den Besitz der Kirche. Sie gab Frauen gleiche Rechte. Die rote Flagge des Volkes wehte. Männer wie dein Vater organisierten ganze Viertel wie Arbeiterstaaten. Die Versammlung in Versailles zitterte vor Angst.«
»Und dann griff die Versammlung Paris an?«
»Zu dem Zeitpunkt waren sie bereits stärker. Sie hatten Armeetruppen. Die Deutschen gaben der Armee von Versailles sogar ihre Kriegsgefangenen zurück, um sie gegen ihr eigenes Volk zu stärken. Es war ekelhaft. Wir verteidigten die Tore von Paris. Wir bauten Barrikaden in den Straßen. Die Armen der Stadt kämpften wie Helden. Doch am Ende waren sie zu stark für uns. Die letzte Maiwoche – die semaine sanglante – war die schlimmste und blutigste …«
Nun schwieg die Witwe Le Sourd für einige Zeit. Sie hatten die südöstliche Ecke des Friedhofs erreicht, wo der Weg nach links abbog und steiler wurde, den zentralen Hügel hinauf. Rechts neben dem gepflasterten Weg den Hang hinab lag die blanke Steinfassade der äußeren Friedhofsmauer, vor der ein kleines, dreieckiges Stück Erdboden lag. Es handelte sich um eine nicht ausgewiesene Ecke des Friedhofs, der man weder einen Namen noch ein wenig Würde gegeben hatte.
»Am Ende«, fuhr die Witwe leise fort, »hielt nur noch ein letzter Rest im nahe gelegenen Armenviertel Belleville stand. Einige unserer Leute kämpften dort oben.« Sie deutete zu den Gräbern auf der Spitze des Hügels hinter ihnen. »Schließlich war es vorbei. Die letzten hundert Kommunarden wurden festgenommen. Einer von ihnen war dein Vater.«
»Du meinst, er kam ins Gefängnis?«
»Nein. Es gab da einen Offizier, der die Truppen anführte. Er befahl ihnen, die Gefangenen dort unten hinzubringen. Dann stellte er seine Truppe in einer Reihe auf und gab den Befehl, die Gefangenen zu erschießen. Einfach so. Dies ist also der Ort, an dem dein Vater gestorben ist, und nun weißt du, wie.«
Und dann fing die große, hagere Witwe Le Sourd plötzlich an zu schluchzen. Ihr Sohn beobachtete sie. Doch sie fing sich schnell und blickte für einige Minuten versteinert auf die Mauer, an der ihre Ehe zu Ende gegangen war.
»Gehen wir«, sagte sie schließlich. Und sie machten sich auf den Rückweg.
Sie konnten schon beinahe den Friedhofseingang sehen, als Jacques sie aus ihren Gedanken riss.
»Was ist mit dem Offizier passiert, der sie einfach so hat erschießen lassen?«, fragte er.
»Nichts.«
»Ist das sicher? Weißt du, wer er war?«
»Ich habe es herausgefunden. Er war Aristokrat, wie man sich denken kann. In der Armee gibt es noch viele von ihnen. Der Vicomte de Cygne. Er hat einen Sohn, jünger als du, mit Namen Roland.«
Eine Minute lang war Jacques Le Sourd still. Sein Gesicht verfinsterte sich.
»Eines Tages werde ich seinen Sohn töten.« Er sagte es leise, doch seine Worte klangen ernst und endgültig.
Seine Mutter antwortete nicht. Sie ging weiter. Sollte sie ihm seine Rachefantasien ausreden? Nein. Ihre Liebe war leidenschaftlich gewesen, und Leidenschaft kennt keine Gnade. Die Rechtschaffenen bringen ihre Feinde zu Fall. Dies ist ihr Schicksal.
»Hab Geduld, Jacques«, antwortete sie. »Warte auf den richtigen Moment.«
»Ich werde warten«, sagte der Junge. »Doch Roland de Cygne wird sterben.«
Kapitel ll
1883
Der Tag fing schlecht an. Sein kleiner Bruder Luc war verschwunden.
Thomas Gascon liebte seine Familie. Seine ältere Schwester Adèle hatte geheiratet und war weggezogen; seine jüngere Schwester Nicole war ständig mit ihrer besten Freundin Yvette zusammen, und ihre Unterhaltungen langweilten ihn. Doch Luc war etwas Besonderes. Er war der Jüngste in der Familie, der lustige, kleine Junge, den alle vergötterten. Thomas war schon fast zehn, als Luc geboren wurde, und war auch ein Ratgeber, Philosoph und Freund für ihn.
Luc war bereits am Vorabend nicht im Haus gewesen. Doch da sein Vater versichert hatte, der Junge sei bei seinen Cousins, die kaum einen Kilometer entfernt wohnten, hatte sich niemand Sorgen gemacht. Als Thomas jedoch zur Arbeit aufbrechen wollte, hörte er seine Mutter rufen: »Wie, du weißt gar nicht sicher, dass er bei deiner Schwester ist?«
»Natürlich ist er dort«, ertönte die Stimme seines Vaters aus dem Bett. »Er ist gestern Nachmittag dorthin aufgebrochen. Wo sollte er denn sonst sein?«
Monsieur Gascon war ein unbekümmerter Mann. Er verdiente seinen Lebensunterhalt als Wasserträger, war allerdings nicht sonderlich zuverlässig. »Er arbeitet nur so viel, wie er muss«, pflegte seine Frau zu sagen, »und keinen Augenblick länger.« Da pflichtete er ihr bei, denn seiner Ansicht nach war es das einzig Vernünftige. »Das Leben will gelebt werden«, lautete sein Wahlspruch. »Wenn man sich nicht mit einem Glas Wein hinsetzen könnte…«, sagte er und deutete mit einer Geste die Sinnlosigkeit aller sonstigen Tätigkeiten an. Nicht dass er übermäßig viel getrunken hätte. Aber er ruhte sich gern und ausgiebig aus. An diesem Morgen lief er barfuß und unrasiert durch die Wohnung und schien für einen Streit bereit zu sein. Doch seine Frau hatte keinen Sinn dafür und befahl ihrer Tochter Nicole, zu ihrer Tante zu laufen und nach Luc zu sehen. Dann, an ihren Ehemann gewandt, rief sie: »Frag die Nachbarn, ob sie deinen Sohn gesehen haben. Schämen solltest du dich!«, fügte sie wütend hinzu.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!