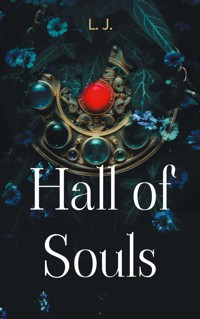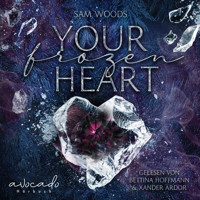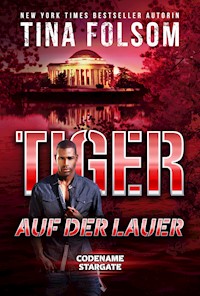3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein kaltes Herz
Eine alte Familienfehde
Ein Abenteuer beginnt
Als der Halbelf Scott seiner Schulkameradin aus Jugendtagen über den Weg läuft, weiß er sofort, dass es das Schicksal nicht gut mit ihm meint. Es gibt keine Zufälle. Aus ist es mit seinem ruhigen Leben im Quartier Latin in Paris! Denn nun begibt er sich zusammen mit Gwendolyn auf die Suche nach dem verlorenen Herzen. Ein Abenteuer, das sein Leben für immer verändern wird. Gleichzeitig müssen sich beide mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, die sich über fast 150 Jahre erstreckt.
Band 1 der Trilogie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Paris Underground
Das kalte Herz 1
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenImpressum
Copyright © 2022 Anja Stephan
Annagry, Donegal
Ireland
Cover: Grit Richter, Art Skript Phantastik Design
Lektorat: Lisa Helmus
Korrektorat: Melanie Vogltanz, Lektorat Vogltanz
Illustrationen:
Chat Noir: Christina F. Srebalus
Hexenküche Art Nouveau: Akaki Yevic (Fiverr)
Instagram: Grit Richter
Bibliothek: Lisa Santrau
Antiquariat: Helene Boppert:
Chibi Scott und Gwen: SleepyShib (Fiverr)
Graben: Anzai Lee (Fiverr)
Alle Rechte vorbehalten.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Content Notes
Content Notes
Diskriminierung, Bullying, Rassismus (gegen Halbelfen), Antisemitismus (erwähnt), Krieg (explizit), Tod (erwähnt), körperliche Verletzungen, Narben, PTSD, Depressionen, sexuelle Handlungen mit Konsens, unerfüllter Kinderwunsch, Fremdgehen, gesellschaftlicher Druck, Sexarbeit, Scheidung, psychischer Missbrauch, Übergewicht, Essstörungen (erwähnt), schwierige Familienbeziehungen
Akzeptanz verschiedener sexueller Orientierungen und Identitäten, wichtige non-binäre Nebenfigur, wichtige trans Nebenfigur, lange Freundschaften, vertrauensvolle und respektvolle Beziehungen, taktvoller Umgang mit Tod, Trauer und psychischen Störungen, Akzeptanz von körperlichen Behinderungen und Stigmata, Body Positivity, positive Lebenseinstellungen, Abbau von Vorurteilen, verdammt guter Kakao
Diese Listen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt, stellen jedoch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn den Lesenden Aspekte auffallen, die dringend in den Content Notes erwähnt werden sollten, trägt die Autorin (ich) natürlich gern noch entsprechende Begriffe nach.
Anmerkung
Der Charakter Bernadette in diesem Buch ist nicht-binär. In Frankreich gibt es zur Ansprache mehrere Möglichkeiten, unter anderem das Pronomen iel, das in diesem Buch verwendet wird. Es wird jedoch versichert, dass dies nicht den Lesefluss stört oder die Freude an der Geschichte hemmt. Nach eigener Erfahrung gewöhnt man sich sehr schnell daran.
Das Buch ist nach Möglichkeit in genderneutraler Sprache verfasst. Wenn den geneigten Lesenden hierbei ein Fehler auffällt, mögen sie bitte nicht zögern, mich (die Autorin) zu kontaktieren.
Inhaltsverzeichnis
Das Schicksal in Person
Es gibt keine Zufälle
Das schlechte Quarto
Das Porträt einer Madame
Von der Kunst, recht zu behalten
Ein Mann und eine Frau
Ein Mann aus bestem Hause
Die Prinzessin von Cleve
Der Tragödie erster Teil
Das fehlende Glied in der Kette
Leben und Zeit
Die Welt von gestern
Grabenkämpfe
Informationen zur Autorin
Information zu den Illustrator*innen
Danksagung
Das Schicksal in Person
Zufälle sind unvorhergesehene Ereignisse, die einen Sinn haben.[1]
Paris. Ausgangspunkt und Zentrum von Revolutionen, Modetrends und Epidemien. Eine illustre Kollektion von Architektur seit dem Mittelalter. Ein schier unüberschaubares Gewirr aus Straßen und Gassen, mit unzähligen Baustellen und Umleitungen. Wenn man jemandem aus dem Weg gehen wollte, brauchte man sich nicht viel Mühe zu geben. Scott McKenzie hatte sich an diesem Wintertag aus seinem Antiquariat herausgewagt, hinaus in die verschneite Stadt, um die Privatbibliothek eines kürzlich verstorbenen Kunden zu katalogisieren. Zusammen mit seiner Auszubildenden Bernadette hatte er den ganzen Tag zwischen Büchern verbracht, die seit Jahren niemand mehr angefasst hatte. Der Staub hatte sich auf seine Haut und in die Haare gesetzt. Nach dem Tod des alten Herren wollten nun seine Nachfahren wissen, was sich überhaupt in der unübersichtlichen Sammlung befand und ob es so viel wert war, dass man sich darüber streiten könnte.
Nachdem sie den letzten staubigen Einband des Tages begutachtet hatten, saßen Scott und Bernadette in der Metro und befanden sich auf dem Heimweg. Der Halbelf mochte den Winter. Abgesehen davon, dass er eher kälteunempfindlich war, gefielen ihm die Dunkelheit und die Ruhe, die mit ihr kam. Dunkelheit beruhigte die Sinne. Sie umfing ihn sanft und ließ ihn den Krach des Tages vergessen. Nachts hatte er sich noch nie einsam gefühlt und er freute sich schon auf sein Wohnzimmer, seinen Kamin und ein Buch aus seiner eigenen Bibliothek.
Bernadette teilte seine Vorfreude eher nicht. »Bah, ich hasse das so. Du stehst im Dunkeln auf und machst im Dunkeln Feierabend«, maulte iel und sah dabei nach draußen, obwohl es nichts zu sehen gab außer dem eigenen Spiegelbild in der Scheibe. Iel sah müde aus. Den ganzen Tag hatte iel mit ihm in der Bibliothek gehockt. Jetzt war iel noch blasser als sonst. Die blonden Haare waren zerzaust, aber iel schien sich wenig darum zu kümmern.
Scott schmunzelte und tippte auf dem Tablet durch die Datenbank des Kunden. Sie hatten sich schon zur Hälfte durch die Sammlung gearbeitet und es sah so aus, als würde demnächst ein Familienstreit ausbrechen, so wie sich die einzelnen Mitglieder benahmen. Mit den Jahren hatte er gelernt, die Schwingungen und Untertöne bei den Gesprächen zu deuten. Je höher der Wert der Bücher, desto schlimmer wurde es. Damit hatte er zum Glück nichts mehr zu tun. Er würde einen Katalog erstellen, Schätzungen abgeben und eine Rechnung für seine und Bernadettes Dienstleistung stellen. Und dann war er aus dem Schneider. Allenfalls würde er Angebote für einzelne Exemplare machen oder sie an seine Kolleginnen und Kollegen vermitteln. Wenn es zum Rechtsstreit kommen sollte, würde er vor Gericht seine Vorgehensweise und Einschätzungen darlegen müssen. Das war schon häufig vorgekommen. In solchen Situationen war er sehr dankbar dafür, dass er kaum noch Familienangehörige hatte, die sich über den Habseligkeiten von Verwandten zerfleischen konnten. Er hatte weder Frau noch Kinder, nur noch sein Vater und sein Bruder waren übrig. Die würden sich wohl bei einem unerwarteten Ableben seinerseits einig werden. Wenn alles nach seinem Plan lief, würde er das Antiquariat mit allem, was dazugehörte, an Bernadette weitergeben. Bis es dazu kam, sollten noch mindestens einhundert Jahre vergehen. Immerhin hatte Scott erst 150 Jahre seines langen Lebens hinter sich gebracht und wenn ihm das Schicksal gewogen war, würden es noch einige mehr werden.
Doch das Schicksal lacht über die Pläne der Einzelnen. Es fegt die Schachfiguren vom Brett und stellt sie neu, ganz nach Belieben.
Scott spürte einen eiskalten Hauch im Nacken. Das war jedoch nahezu unmöglich, immerhin trug er einen dicken Schal um den Hals und der Kragen seiner Jacke war hochgestellt. Unwillkürlich fasste er sich in den Nacken und drehte sich um. Es war auffällig unauffällig. Niemand saß hinter ihm. Er hatte gesehen, dass viele Personen in den Waggon gestiegen waren, immerhin war Feierabendverkehr, aber niemand hatte sich zu ihnen gesetzt. Die Fahrgäste scharten sich stattdessen um einen Platz im hinteren Teil der Metro. Weil Scott so in die Arbeit vertieft gewesen war, hatte er sich keine Gedanken darum gemacht.
Er erkannte sie sofort, obwohl er sie lediglich im Profil sah. Trotz ihrer furchtbaren Kleiderwahl. Noch nie hatte er so viele Farben auf einmal an einer Person gesehen. Er bevorzugte Schwarz. Damit konnte man nichts falsch machen.
Sie stand an eine Haltestange gelehnt und blickte nach unten. In ihren Ohren klemmten weiße Kopfhörer, das Kabel führte in die Tasche ihres grasgrünen Mantels, unter dem der Saum eines knallbunt geblümten Rockes hervorlugte. Dazu trug sie eine gelbe Strumpfhose und rote Stiefel mit Fellbesatz. Der überlange Schal und die Pudelmütze waren aus mehrfarbiger Wolle gestrickt und sahen selbstgemacht aus. Sie wippte mit dem Fuß.
Scott erkannte von seinem Platz aus die spitzen Ohren, die nur halb von der Mütze verdeckt wurden, die gerade Nase, die so typisch war für ihre Familie. Und dann der geflochtene Zopf aus backsteinrotem Haar, der sich über ihren Rücken schlängelte.
Die Menschen suchten die Nähe der Hochelfen. Sie taten es unbewusst. Es hieß, es läge an ihrer besonderen Aura, die sie von anderen magischen Wesen unterschied, von Hexen und Hexern, Magiern und Magierinnen und den Geschöpfen der Nacht. Gwendolyn von Cleve hatte offenbar eine ganz besonders anziehende Aura.
Scott spürte, wie ihm das Tablet aus den Fingern glitt, und konnte es gerade noch auffangen, bevor es auf den Boden fiel.
»Na, Meisterchen?« Bernadette reckte den Hals. »Abgelenkt?«
Scott warf iel einen tadelnden Blick zu. »Mehr Respekt, wenn ich bitten darf.« Meisterchen. Also ehrlich.
Doch Bernadette ignorierte ihn. Stattdessen setzte iel sich neben ihn und lugte über die Lehne des Sitzes. »Ist das etwa Gwendolyn von Cleve?«, flüsterte iel ehrfürchtig. Ungläubig riss iel die Augen auf und starrte ihn an.
Scott zog iel zu sich. »Starr da nicht so hin«, zischte er zwischen den Zähnen hindurch. Bernadette liebte es, sich mit der Klatschpresse zu befassen. Eine Schande für jede ehrbare Buchhändlerin. Iel wusste genau, wer mit wem verheiratet war oder geschieden wurde, kannte alle Details über mysteriöse Todesfälle, alte Fehden und missglückte Intrigen. Dabei hatte iel es immer bedauert, noch nie einer Person des öffentlichen Lebens begegnet zu sein. Scott dagegen hatte dies immer tunlichst vermeiden wollen. Gerade bei den von Cleves, die über ganz Europa verteilt lebten und mit denen seine Familie in einer seit Jahrhunderten andauernden Fehde lag, konnte er gern darauf verzichten. Den ursprünglichen Grund dafür kannte mittlerweile niemand mehr, aber das Vergehen seines Vaters war in die Geschichte beider Familien eingegangen und hatte ihm die Verbannung gebracht. Er hatte die Heirat mit einer von Cleve grandios platzen lassen und war mit einer menschlichen Frau durchgebrannt. Einer koreanischen Opernsängerin, die nicht einmal einen Adelstitel trug. Scott senkte den Blick. Bloß nicht hinschauen. Bloß keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Bernadette rückte näher zu ihm. »Auf den Fotos sieht sie anders aus«, flüsterte iel.
Scott vernahm die Enttäuschung in iels Stimme. »Das ist immer so.«
Die Metro fuhr in den nächsten Bahnhof ein. »L’Odéon«, flötete die weibliche Stimme aus dem Lautsprecher. Mit einem Ruck kam der Zug zum Stehen. Die Menschen im hinteren Teil des Wagens begannen, sich auf die Sitzplätze zu verteilen. Die Hochelfe musste ausgestiegen sein. Scott wagte es, den Kopf zu heben. In dem Moment ging sie auf dem Bahnsteig an ihm vorbei. Mit den Händen in den Manteltaschen eilte Gwendolyn von Cleve ein paar Schritte die Plattform entlang, blieb dann aber unvermittelt stehen. Langsam drehte sie den Kopf in seine Richtung und sah ihn über die Schulter hinweg verwundert an. Ihre Blicke trafen sich. Oh, verdammt. Genau das hatte er vermeiden wollen. Scott konnte genau den Moment ausmachen, in dem sie ihn erkannte. Ihre Verwunderung wich einem Ausdruck von Entsetzen. Scott hielt den Atem an. Dann fiel ihr Blick auf seine Gehilfin und sie verengte die Augen. Über ihr Gesicht huschte ein dunkler Schatten. Nur kurz, vielleicht eine Sekunde lang.
Es waren die Warnsignale der Metro, die ihn von Gwendolyn von Cleve befreiten. Der Zug fuhr langsam an. Erst, als der Wagen in den Tunnel einfuhr, atmete Scott erleichtert aus. Dennoch hatte er das Gefühl, die Madame würde ihnen nachsehen.
Neben sich vernahm er ein leises Wimmern. Bernadette versank im Sitz, iels Gesicht hatte eine ungesunde Farbe angenommen.
»Was ist?«
Seine Auszubildende legte den Kopf an seine Schulter und begann zu schluchzen. Was zum Henker?
»Das Leben ist so schrecklich, Monsieur.«
Vollkommen fassungslos sah er auf iel hinab. Was war denn in iel gefahren? Bernadette hatte eine grundsätzlich lebensbejahende und optimistische Persönlichkeit. Und dann leuchtete es ihm ein. Der Schatten auf dem Gesicht der Madame war der Böse Blick gewesen, der Bernadette von einer Sekunde auf die nächste in eine tiefe Verzweiflung gestürzt hatte. Zaghaft tätschelte er iels Hand.
»Ganz ruhig, Bernadette«, seufzte er. »Das kriegen wir schon wieder hin.« Aber dafür müssten sie noch einen Umweg zur Hexenküche machen, bevor sie nach Hause konnten. Das warme Wohnzimmer, der Kamin und das Buch würden noch eine Weile auf ihn warten müssen.
Die Begegnung mit Gwendolyn von Cleve sollte Scott den gesamten Abend nicht loslassen. Anstatt ihn zu verhexen, hatte sie seinen Lehrling angegriffen. Gegen ihn selbst hätte sie wahrscheinlich auch kaum etwas ausrichten können. Er verfügte über herausragende mentale Fähigkeiten. Dennoch hätte er absolut kein Verlangen nach einem geistigen Kräftemessen mit ihr gehabt.
Der Hexer in der Unterstadt von Paris besah Bernadette skeptisch mit seinen lilafarbenen Augen. Ganz würde er den Schaden nicht heilen können, jedenfalls nicht sofort, aber er konnte ihn mildern. Scott war schon oft bei Rémy gewesen, sozusagen als Stammkunde, weshalb dieser sich zur Behandlung bereit erklärte, obwohl er schon Feierabend hatte. Der Hexer braute ihm in der Regel alles Mögliche zusammen, von Holzpolitur bis hin zu Tränken gegen Rückenschmerzen oder Migräne. Und einmal im Monat besorgte Scott sich Herzenswärme.
»Iel hat die volle Breitseite abgekriegt«, sagte Rémy kopfschüttelnd und braute in seinem Kessel einen kräftigen Trank. »Sie müssen heute Nacht gut auf iel aufpassen. Die erste Nacht ist die schlimmste.«
Scott nahm sich vor, Bernadettes Familie anzurufen und iel dort abzuliefern, bis iel sich erholt hatte. Iel sollte sich ruhig ein paar Tage freinehmen.
Bernadette saß zusammengesunken auf einem Stuhl. »Ich bin Ihrer nicht würdig, Meister.«
Scott rollte mit den Augen. »Stimmt, da hast du recht.« Dennoch legte er den Arm um iel.
Rémy wedelte mit dem Kochlöffel in der Luft herum. »Wer iel das angetan hat, gehört bestraft, also ehrlich.« Er öffnete ein paar Gläser und Dosen und warf den Inhalt in den Kessel. Er wusste, was er tat, auch wenn es für Scott aussah, als würde er willkürlich irgendwas zusammenbrauen.
»Also, wer war das?«
»Kenne ich nicht«, log Scott. Auf keinen Fall wollte er sich Ärger einhandeln, bis die arme Bernadette wieder auf die Beine kam.
»Gwendolyn von Cleve.« Bernadette schluchzte sich an seiner Schulter aus. Verrat!
Der Hexer hielt kurz inne. »DIE Gwendolyn von Cleve?«
Scott seufzte zustimmend.
Rémy wandte sich einer Kollegin zu, die nebenan ihren Kessel schrubbte und dazu tief hineingekrochen war. »He, Nour! War die Gwendolyn von Cleve nicht heute bei dir?«
Nour streckte den Kopf aus dem Kessel, wobei zuerst ihr Afro zum Vorschein kam. Ihre Augen leuchteten wie dunkler Amethyst. »Ja, heute Nachmittag. Völlig durch den Wind, die Arme. Hab ihr was zur Beruhigung gegeben. Wieso fragst du?«
Rémy zeigte mit dem Kochlöffel auf Bernadette. »Hat nicht viel gebracht, Liebes. Schau, was sie der armen Bernadette angetan hat.«
Die Hexe kletterte aus dem Kessel, strich ihr fleckiges Shirt glatt und schritt auf iel zu. Aus der Nähe betrachtet sah Scott, wie jung sie war, ungefähr in Bernadettes Alter, vielleicht ein wenig älter. Sie musste ziemlich begabt sein, wenn sie jetzt schon in der Hexenküche arbeitete und eigene Mixturen verabreichen durfte. In den Händen knetete sie einen schmutzigen Lappen.
Nour legte den Kopf schief. »Oh«, sagte sie überrascht und zog eine Augenbraue hoch. »Sicher, dass es Gwen war? Das sieht ihr gar nicht ähnlich.«
Scott nickte betreten. Offenbar hatte Nour eine andere Gwendolyn von Cleve kennengelernt als er. Und sie schienen vertraut zu sein, sonst hätte die Hexe wohl kaum mit einem Spitznamen von der Madame gesprochen. Vielleicht war sie ihre Stammhexe? Man wechselte nicht einfach so seinen Hexer oder seine Hexe, wenn man einmal jemand Passendes gefunden hatte. Scott warf einen flüchtigen Blick auf das Regal, das ihrem Platz zugeordnet war. Neben der obligatorischen Glaskugel und den anderen Utensilien, die er auch bei Rémy gesehen hatte, fanden sich bei ihr jedoch auch noch andere Dinge, die Scott der afrikanischen Magie zuordnete: Voodoopuppen, Gläser mit Knochen, Steinen und Kräutern, die nicht in hiesigen Gefilden wuchsen, dazu Bücher und Poster mit arabischer Schrift. Magie war nicht universell, sondern von den Genen abhängig. Ihre Hexenmagie hatte Nour also ihrer Abstammung zu verdanken. Rémy entstammte einer alten französischen Familie. Er könnte sich anstrengen, wie er wollte, aber er würde nie in der Lage sein, eine andere Magie zu beherrschen als die europäische.
Nour sah zu ihrem Kollegen hinüber. »Ich hatte ihr extra eine höhere Dosis gegeben.«
»Ich hätte so gern mit ihr geredet«, jammerte Bernadette.
Rémy befüllte drei kleine Flaschen mit der leuchtend gelben Flüssigkeit aus seinem Kessel und schob sie in ein Lederetui. Dieses reichte er Scott, nachdem er von seinem Podest gestiegen war. »Fangen Sie mit dreimal am Tag fünf Tropfen an. Wenn es sich nicht schnell bessert, dann fünfmal am Tag. Keine Experimente, kein langes Warten.«
Scott nickte. Das würde er den Eltern mitteilen. Die Kosten würden sie auch nicht tragen müssen. Als Meister übernahm er die volle Verantwortung.
»Und das hier«, Rémy hielt ihm eine Schüssel mit der gelben Flüssigkeit hin, »sollte iel jetzt trinken, sofort.«
Mühsam rappelte sich Bernadette, gestützt von Scott, auf, nahm die Schüssel in die Hände und begann zu trinken.
Nachdem iel die gesamte Schüssel geleert hatte, machte iel einen weitaus besseren Eindruck. Seine Auszubildende atmete tief durch und wischte sich das Gesicht trocken. So würde er iel auch ihren Eltern präsentieren können, ohne diese in Angst und Schrecken zu versetzen.
»Danke, dass Sie sich noch Zeit für uns genommen haben, Rémy.« Er händigte dem Hexer die Gebühr aus und verabschiedete sich.
Nachdem er Bernadette zu iels Eltern gebracht hatte, war Scott endlich zu Hause angekommen. Er öffnete die Haustür im Hinterhof seines Antiquariats und fand einen Brief auf dem Boden. Er hatte das Haus verlassen, bevor die Post gekommen war. Noch im Mantel stand er da und starrte auf den Brief vor seinen Füßen. Der Umschlag war blassblau, wie die der Briefe, die die Obrigkeit verschickte. Ob Gwendolyn ihn schon angezeigt hatte? Weswegen? Wegen Anstarrens? Wohl eher nicht. Er hob den Brief auf. Das Siegel des Hochgerichts prangte auf der Rückseite. Hatte er sich etwas zu Schulden kommen lassen? Oder sein Vater? Er überlegte, den Brief schon im Flur zu öffnen, entschied sich dann aber dafür, ihn mit in seine Wohnung zu nehmen. Egal, was darin stand, er hatte den Verdacht, dass er den Inhalt lieber im Sitzen lesen sollte. Er ging die schmale Treppe hoch in das erste Obergeschoss, öffnete die Wohnungstür, zog sich Schuhe und Mantel aus, ging in die Küche und legte den blauen Brief auf den Tisch. Skeptisch beäugte er ihn.
Nachdem er sich einen grünen Tee gekocht hatte, feuerte er den Kamin an. Eine wohlige Wärme breitete sich in der Wohnung aus. Dann kam er auf die Idee, den Backofen zu reinigen. Und danach telefonierte er mit Bernadettes Eltern und erkundigte sich nach iels Befinden. Nachdem er sich versichert hatte, dass es iel schon viel besser ging und der Trank aus der Hexenküche hervorragend wirkte, setzte er sich auf seinen Stammplatz in der Küche. Es gab nur zwei Stühle: einen für ihn selbst, einen für seine Gehilfin. Der Brief lag immer noch auf dem Küchentisch und wartete darauf, geöffnet zu werden. Unerbittlich. Was hatte er sich vorgemacht? Dass er verschwinden würde?
Scott atmete einmal kräftig durch und nahm ihn in die Hand. Vielleicht sollte er ihn doch erst morgen aufmachen? Dann drehte er sich um und griff nach einer Schublade hinter sich. Seine Küche war so klein, dass er sie ohne Mühe erreichen und aufziehen konnte. Er nahm ein Messer heraus, schloss die Lade wieder und schlitzte den Umschlag auf.
Das Blatt darin war zweimal gefaltet. Noch ehe er es auseinanderklappen konnte, las er den Betreff, der fett gedruckt war: Ankündigung.
[1] Diogenes von Sinope, (um 400 - 323 v. Chr.), altgriechischer Philosoph und Satiriker
Es gibt keine Zufälle
Auch der Zufall ist nicht unergründlich – er hat seine Regelmäßigkeit.[1]
Gwendolyn stand vor der leeren Leinwand. Ihr Atelier befand sich im Dachgeschoss ihres Hauses am Montmartre. Sie hatte große Fenster in das Dach einbauen lassen, damit genug Licht in den Raum eindringen konnte. Aber jetzt war es dunkel und die Deckenlampen waren angeschaltet.
Sie begab sich in Angriffsposition. Ihr Atem ging schwer. Dieses beklemmende Gefühl, das ihre Brust zuschnürte, musste weg. Sie fixierte die Leinwand und schlich langsam auf sie zu, während sie den Pinsel bedächtig in der Farbschale drehte. Noch einen Schritt. Und noch einen. Dann stürzte sie sich auf die Leinwand. Der Pinsel flog über den Stoff und hinterließ blutige Streifen auf dem weißen Grund. Sie knurrte leise, schnaufte. Ein wildes Muster zeichnete sich ab. Noch war das Gefühl da. Aber sie spürte bereits, dass es schwächer wurde. Sie musste weitermachen, bis es sich auflöste. Sie tauchte den Pinsel in die Farbschale und setzte ihn erneut auf die Leinwand. In Kreisen fuhr sie darauf herum. Einatmen. Ausatmen. Und ihre Wut entlud sich. In Kreisen.
»Rot«, sagte ihr Bruder. »Ernsthaft?« Aus seinem Ton troff die Verachtung nur so heraus. Er hatte sie noch nie verstanden. Ihre Farben, ihr Gefühl, ihre Seele. Rot war Krieg. Rot war Blut und Kampf. Das war das, was sie empfand.
An anderen Tagen hätte sie sein Unverständnis weggelächelt, sich vielleicht darüber lustig gemacht, aber nicht heute. Sie sah über ihre Schulter. Gelassen saß Gilbert auf dem Stuhl neben ihrem Schreibtisch. Kurzerhand drehte sie sich um und schleuderte ihm den Pinsel entgegen. Er konnte nicht ausweichen und sie traf ihn mitten auf die Brust.
»Ey!«, schrie er und sprang auf. »Bist du verrückt geworden?« Er griff nach dem Pinsel und warf ihn zurück. Sie wich aus, doch er war schon damit beschäftigt, den Fleck auf seinem Hemd mit einem nicht mehr ganz astreinen Tuch zu verreiben. »Den krieg ich nie wieder raus.« Mit einem kurzen Blick auf sie setzte er hinzu: »Wieso bist du so scheiße drauf heute?«
»Ja, warum bin ich denn so scheiße drauf heute?« Gwendolyn funkelte ihren Bruder wütend an. »Vielleicht liegt es ja daran, dass mich unsere Mutter gefragt hat, ob ich nicht einen wildfremden Mann heiraten will, um eine beschissene Familienfehde beizulegen? Die 1850er haben geschrieben, sie wollen ihr Frauenbild zurück!« Demonstrativ verschränkte sie die Arme vor der Brust.
Gilbert pirschte sich vorsichtig an sie heran. Auf seinem T-Shirt prangte ein verschmierter Fleck, umrahmt von einigen Spritzern. Das Tuch hatte er auf den Schreibtisch geworfen.
»Es war doch bloß ein Vorschlag von ihr.« Behutsam legte er seine Hände auf ihre Schultern. »Es ist nur eine Möglichkeit von vielen. Du musst gar nichts.«
Sie sah ihn trotzig an. »Richtig. Einen Scheiß muss ich!«
Der blaue Brief war heute Morgen mit der Post gekommen. Noch ehe sie den Umschlag aufgerissen hatte, hatte sie schon den Anruf von ihrer Mutter erhalten. Ein absurder Vorschlag! Sie schüttelte Gilberts Hände ab und entfernte sich einen Schritt von ihm. »Den Scheiß mach ich nicht mit!«
»Ja, das ist auch in Ordnung.« Gilbert streckte seine Hände erneut nach ihr aus. Sie schlug danach.
»Lass das.« Ihr Blick war trotzig. »Sie wäre nie auf die Idee gekommen, dich zu fragen.«
Schuldbewusst klimperte er mit den Wimpern und ließ die Hände endlich in den Hosentaschen verschwinden. »Ich bin glücklich verheiratet und habe sieben Kinder.«
Gwendolyn drehte sich weg und stampfte geräuschvoll zu ihrem Arbeitstisch. »Oder jemand anderen.« Schließlich war sie nicht die einzige Person im heiratsfähigen Alter in ihrer Familie.
Gilbert lachte. »Na, wen denn?«
Sie griff nach den benutzten Pinseln und warf sie in das Wasserglas. »Fragt Tante Inge!« Sie wusste, dass ihre Tante nicht in Frage kam, aber sie war die Erste, die ihr einfiel.
»Tante …« Ihr Bruder krümmte sich vor Lachen. »Die ist mindestens 300 Jahre zu alt.« Nach kurzem Nachdenken fügte er hinzu: »Und außerdem würde ich die nicht einmal meinem ärgsten Feind ans Bein binden.«
»Aber deine Schwester gibst du freiwillig her, oder was?« Offenbar hatte auch ihre Mutter kein Problem damit.
Sie hörte die eilenden Schritte ihres Bruders hinter sich. »Nein, nein, nein.« Jetzt umarmte er sie von hinten. »Das war ´ne katastrophale Idee von ihr, ich geb es ja zu.«
Oh, welch ein Wunder. Normalerweise hielt er immer zu ihrer Mutter. Aber offenbar wollte auch er nicht seine Schwester an irgendeinen McKenzie verheiraten. Die Zeiten waren vorbei.
Gwendolyn hielt sich an ihrem Bruder fest. »Ich bin ihr so gleichgültig«, nuschelte sie und er seufzte.
Sie hatte nie ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter gehabt, mit ihrem Vater war das anders. Aber das heute war … Nein, es war nicht die Krönung. Die Krönung war gewesen, als sie enterbt worden war, weil sie sich von ihrem ersten Mann hatte scheiden lassen und auf den Montmartre gezogen war. 1871 hatte sie damit für den ersten Skandal von vielen gesorgt. Aber sie und ihre Mutter waren aus demselben Holz geschnitzt. Beide waren Sturköpfe. Es war ein Machtkampf gewesen. Die Niederlage hatte ihre Mutter nie akzeptieren können. Und nachdem Gwendolyn festgestellt hatte, dass sie es auch selbst durch harte Zeiten schaffen konnte, hatte sie sich gar nicht mehr reinreden lassen. Warum auch? Sie biss sich durch alles durch. Trotzdem schmerzte es.
»Ich war vorhin in der Hexenküche und hab mir was mixen lassen.« Sie hatte sich so dermaßen über ihre Mutter aufgeregt, dass sie Nour um eine stärkere Mischung gebeten hatte.
Gilbert strich ihr über den Rücken. »Hat nichts gebracht, was?«
Sie löste sich von ihm und stellte sich vor das rote Bild. »Ich habe es erst vorhin genommen. Nour hat gesagt, ich solle vorsichtig damit sein.« Sehr zum Leidwesen des armen Jungen, den sie mit dem Bösen Blick bedacht hatte.
»Ich habe Scott McKenzie in der Metro gesehen«, setzte sie hinzu. Von dem Bösen Blick sagte sie lieber nichts. Was hatte sie nur geritten? Ausgerechnet der Böse Blick. Das hätte sie niemals tun dürfen. Hoffentlich hatte sie dem Jungen nicht zu sehr zugesetzt.
Gilbert ließ sie sofort los und trat ein paar Schritte rückwärts. »DER Scott McKenzie?«
Sie runzelte die Stirn. »Kennst du noch einen?«
Er räusperte sich und legte zwei Finger an die Lippen. »Oha.«
Der blaue Brief hatte die Verhandlungen angekündigt, bei der die wichtigsten Familienmitglieder anwesend sein mussten. Und dann wurde sich gestritten. Sie wusste nicht mal, wann die letzten stattgefunden hatten, so lange war es schon her. Irgendwann nach dem Krieg, aber nach welchem?
Eine Norne hatte das Jahr der Einigung vorausgesagt und das Hohe Gericht hatte es verständlicherweise sehr eilig damit, die Prophezeiung zu erfüllen.
Eine mögliche Lösung des uralten Konfliktes sei es, wenn sich ein Paar aus zwei Mitgliedern der beiden Familien finden würde. Keine Familie hätte Probleme damit, Besitztümer, Ländereien und auch Aktien einem Paar zu überschreiben, das zur Hälfte aus einem eigenen Familienmitglied bestand. Die Familien hatten diese Strategie schon einmal versucht. Aber dann hatte Alasdair McKenzie ihre Mutter sitzen lassen und die Lage hatte sich verschlimmert. Und so wurde sich weiterhin um diese Besitztümer, Ländereien und Aktien gestritten. Gwendolyn war bei der letzten Verhandlung dabei gewesen. Eine Schlammschlacht. Sie hatte sich für ihre Familie in Grund und Boden geschämt. Am Ende hatten sich die gegnerischen Parteien mit Elementarzaubern beschossen und der Gerichtssaal musste von einem Sondereinsatzkommando geräumt werden. Die Kosten für die Renovierung waren den Verursachern aufgebrummt worden.
Der Termin für die nächste Verhandlung war auf den dritten Januar gelegt worden. In vier Wochen. Man wollte doch keine Norne enttäuschen. Hoffentlich liefen die Verhandlungen diesmal besser. Die Welt hatte die Schnauze voll von dem Kleinkrieg, den ihre Familie mit den McKenzies führte. Und sie auch.
»Ich raffe das nicht!« Gwendolyn drehte sich zu ihrem Bruder um und fasste sich an die Stirn. »Wir leben seit über hundert Jahren in Paris. Seit wir die Schule verlassen haben, sind wir uns nie wieder begegnet. Wieso ausgerechnet heute, nachdem der Brief kam?« Sie hatte Scott sofort erkannt. Sicher, sein Gesicht war kantiger geworden, er sah nicht mehr so jungenhaft aus wie früher. Dennoch hatte ein Blick genügt und sie hatte gewusst, wen sie vor sich gehabt hatte. Er sah gut aus, wenn auch ein bisschen blass. Das könnte sie auch dem grellen Licht in der Metro zuschreiben, oder seiner schwarzen Kleidung. Scotts dunkle Haare waren nicht mehr so lang wie früher, jedoch schien es, als hätte er seine Locken immer noch nicht vollends in den Griff bekommen. Und seine Augen. Er hatte immer noch dieselben Augen. Dunkel und voller Schmerz. So wie damals.
Gwendolyn hatte die Puzzleteile zusammengesetzt und Gilbert offenbar auch. »Das ist aber ein ziemlich merkwürdiger Zufall«, sagte er.
Gwendolyn stimmte ihm zu: Der blaue Brief, der Anruf ihrer Mutter mit diesem absurden Vorschlag, die Begegnung mit Scott McKenzie in der Metro. Das war kein Zufall. Zufälle gab es nicht. Und das machte ihr Angst. Mit den Fingerspitzen massierte sie ihre Nasenwurzel. »Da kommt was auf uns zu, Gilbert.« Und sie wusste nicht, ob sie die Nerven dafür hatte.
»Na ja, eigentlich scheint eher was auf dich zuzukommen, nicht auf mich oder unsere Familie allgemein.«
Sie giftete ihren Bruder an: »Ja, ist natürlich besser, wenn es nur Gwen erwischt. Um die ist es nicht schade.«
Ihr Bruder drehte ihr den Rücken zu und ging zur Tür. »Lass uns was essen gehen. Mit vollem Magen denkt es sich besser.«
Damit war sie einverstanden. Sie sah ihn schräg an. »Aber nur zum Istanbul-Grill.«
Er legte die Hand an die Türklinke und sah sie über die Schulter hinweg an. »Natürlich.«
Wenn sich Zufälle häuften, ging irgendetwas vor sich. Scott brauchte nur abzuwarten, was passierte. Und so sollte auch seine erste Begegnung mit Gwendolyn von Cleve in der Metro nicht die letzte gewesen sein.
Als sie wieder aufeinandertrafen, lief die Madame in Scotts Arme, als sie mit einem Kleidersack aus der Reinigung kam, in die er gerade eintreten wollte. Sein Mantel hatte eine Reinigung bitter nötig, nachdem Bernadette iels Krokodilstränen darauf vergossen hatte. Darüber hinaus hatte seine Lernende auch noch iels Nase an seiner Schulter abgewischt.
Gwendolyn drängelte sich an ihm vorbei und stieß ihn dabei an. Im ersten Moment erkannte er sie nicht einmal. Erst, als sie sich flüchtig bei ihm entschuldigte und, ohne ihn anzusehen, weiterging, wusste er, wer sie war. Der Madame musste es genauso gegangen sein. Ein paar Schritte weiter blieb sie abrupt stehen und drehte sich langsam um. Als sie ihn erkannte, sah sie ihn herausfordernd an. Ihr Blick war fest auf ihn gerichtet. Dann drehte sie sich um, ohne ein Wort zu sagen, und setzte ihren Weg – wohin auch immer – fort. Und er stand vor der Reinigung, mit dem Mantel in der Hand, und starrte ihr nach.
Immerhin wusste er nun, dass etwas vor sich ging. Er konnte ahnen, dass es mit den Verhandlungen zu tun hatte. Es war das erste Mal, dass er dazu eingeladen worden war, obwohl sein Vater ihm so oft davon erzählt hatte. Es musste dort furchtbar zugehen. Die Familien keiften sich an, beschuldigten sich gegenseitig irgendwelcher Taten, die niemand begangen hatte, und am Ende gingen die McKenzies ohne Errungenschaft aus dem Palais. Jedes Mal. Dass Scott jetzt die zweifelhafte Ehre hatte, diesem Schauspiel beiwohnen zu dürfen, hatte er dem Antidiskriminierungsgesetz von 1968 zu verdanken, das alle Wesen, egal welcher Abstammung, gleichstellte. Ob es ihm nun gefiel oder nicht, er musste am 3. Januar um neun Uhr im Petit Palais antanzen und den Verhandlungen beiwohnen. Ein neues Privileg, auf das er lieber verzichtet hätte.
Ein weiteres Mal begegneten sie sich auf der Straße in der Cité. Gwendolyn stand vor dem Schaufenster ihrer Galerie und betrachtete das Arrangement von Bildern, Fotos, Künstlerinneninformationen und Eventankündigungen. Marketingwirksam hieß das. Pollys Lebenswerk auszustellen, war eine Ehre. Viele Galerien hätten sich darum gerissen. Aber Polly hatte sie gefragt und sie hatte selbstverständlich zugesagt. Polly war eine Muse. Aber Gwendolyn hätte es auch getan, wenn sie es nicht gewesen wäre. Polly begleitete sie schon seit ihrer ersten Scheidung. Zunächst als Muse, dann als Agentin und schließlich als Freundin.
Gwen trat einen Schritt zurück, um das Gesamtbild des Schaufensters zu erfassen. Das Geschäftsleben wurde immer komplizierter. Früher hatte es ausgereicht, wenn sie den Namen ihrer Galerie halbwegs leserlich auf die Fensterscheibe gemalt hatte. Heute bedurfte es eines Internetauftritts mit Website im aktuellen Design, eines Social-Media-Konzeptes und ständiger Präsenz auf Netzwerktreffen und Feiern. Zum Glück hatte sie genug Geld, um sich diese unliebsamen Dienstleistungen einzukaufen. Und sie hatte weise gewählt. Laut ihrer Marketingagentur hatte sie mehr Follower als der Louvre, was ihr Genugtuung verschaffte. Sie hatte sogar Fanseiten. Aber das lag wohl auch daran, dass ihr Gesicht in jedem dritten Instagram-Post auftauchte. Die Leute wollten ein Gesicht, eine Persönlichkeit hinter dem Business. Das betonte ihre Agentur ständig und schickte sie auf Präsenzveranstaltungen wie Eröffnungen, Ausstellungen, Auktionen, Interviews, Fotoshootings, Messen und neuerdings auch in die Uni, um ihre Arbeit dort vorzustellen und den jungen Studierenden Tipps zu geben. Vieles davon gefiel ihr. Sie sprach gern mit anderen, lernte interessante Persönlichkeiten und vielversprechende Kunstschaffende kennen. Anderes verabscheute sie. Zum Beispiel die Unterhaltungen mit langweiligen Personen aus Politik und Wirtschaft, die lediglich über ihre eigenen Errungenschaften reden wollten. Nichts langweilte sie mehr als Geschichten darüber, wie man über die Beziehungen anderer Leute in Positionen gekommen war, für die man gar nicht qualifiziert war. Es machte sie wütend. Noch während der 68er-Aufstände hätte sie diesen Leuten einen Stein ins Auto geschmissen. Heute musste sie mit ihnen anstoßen und ihnen die Hände schütteln. Sie hatte schon oft überlegt, sich einfach komplett zurückzuziehen. Aber sie liebte ihre Arbeit zu sehr.
Gwen sah ihn aus dem Augenwinkel. Zunächst war er nur eine schwarze Gestalt, die zögerlich die Gasse hinunterging. Sie musterte ihn kurz, dann wurde ihr bewusst, dass sie sich erneut trafen. Zufällig. Schon zwei Tage zuvor war sie ihm in der Reinigung begegnet. Er hatte Schwarz getragen. So auch heute. Sie drehte sich so schnell und fahrig herum, dass sie den Schnee unter ihren Füßen aufwirbelte. Wut in Kreisen. Dabei konnte Scott McKenzie wohl am wenigsten für die Situation. Er kam näher. Sie trat an das Schaufenster heran. Die Gasse war breit genug. Er konnte bequem an ihr vorbeigehen, ohne sie anzurempeln. Es war ein Signal. Sie wahrte den Abstand. Er ebenso. Misstrauisch beäugte sie ihn, als er zögerlich auf sie zukam. Sie überlegte, in die Galerie zu flüchten, aber sie wollte nicht, dass er den Eindruck bekam, sie hätte Angst. Hatte sie auch nicht. Sie hatte Respekt vor dem Schicksal. Als er auf ihrer Höhe war, blieb er stehen und nickte ihr höflich zu. Sie erwiderte. Ein Mindestmaß an Höflichkeit. Sie hätte sich entschuldigen können, für den Bösen Blick. Aber sie bekam keinen Ton heraus. Dann ging er weiter und sie sah ihm hinterher. Er drehte sich nicht um.
Die vierte Begegnung ereignete sich in der Oper. Don Giovanni. Sehr klassisch. Genau nach Scotts Geschmack. Er hatte einen der begehrten Balkons ergattert und blickte ungeduldig auf die Besucher hinunter, als sich unerwartet – es war zwei Minuten vor Beginn – der Vorhang des Balkons ihm gegenüber bewegte. Gwendolyn von Cleve erschien in Begleitung eines hochgewachsenen dunkelblonden Mannes und einer zierlichen Frau mit kurzen schwarzen Haaren. Sie trug ein sonnengelbes Seidenkleid, das ihren Hautton unterstrich, und war über und über mit Schmuck behangen. Der Mann hatte nicht einmal ein Sakko an und sein Hemd war zerknittert, außerdem waren seine Haare ungekämmt. Gwendolyns Aufmachung lag irgendwo zwischen den beiden Extremen.
Sie ging zum Geländer und beugte sich leicht vor, um auf das Publikum hinunterzuschauen. Selbst von seiner Position aus hätte Scott ihr durch ihren Ausschnitt bis zum Bauchnabel schauen können, wenn er gewollt hätte. Bei seinen flüchtigen Blicken auf die Klatschblätter in den Kiosken hatte er schon festgestellt, dass sie eine Vorliebe für Kleidung zu haben schien, die gerade die nötigen Stellen bedeckte, um nicht als öffentliches Ärgernis zu gelten.
Als sie aufsah und ihn erblickte, versteinerten ihre Gesichtszüge. Sie richtete sich auf und besprach etwas mit ihrem Begleiter, der, so schien es, beschwichtigend auf sie einredete. Dann wandte sie sich wieder Scott zu und nickte höflich. Er nickte zurück. Die Frau zog Gwendolyn auf den Sitz herunter und reichte ihr ein Glas. Doch als das Licht gedimmt wurde, blickte sie lange zu seinem Balkon hinüber, ehe sie sich dem Geschehen auf der Bühne widmete. Scott versuchte vergeblich, sie zu ignorieren. Immer wieder war er verleitet, zu ihrem Balkon zu schauen. Und immer wieder trafen sich ihre Blicke. Was zum Henker ging hier vor? Die Oper konnte er so kaum genießen.
Gwendolyn stand mitten in seinem Antiquariat. Polly hatte ihr das Geschäft empfohlen. Aber wie hatte sie denn ahnen können, dass das Antiquariat Danton nicht Danton gehörte, sondern Scott McKenzie? Sie hätte vorher in das Register der Gilde schauen sollen, aber dafür hatte sie keinen Anlass gesehen.
Drinnen roch es nach Papier und Druckerschwärze, nach altem Leder und Holz. Überall stapelten sich Bücher. Nicht nur in den Regalen, sondern auch auf dem Boden, auf den Tischen, unter den Tischen, auf der Fensterbank, einfach überall.
Die junge erwachsene Person, die hinter dem Bücherregal auftauchte, wurde kreidebleich, als sie sie erblickte. Es war dieselbe Person, die Gwen in der Metro attackiert hatte. Jetzt stand sie vor ihr und brachte keinen Ton heraus. Und irgendwie hatte Gwendolyn den starken Verdacht, dass sie mit ihrer Einordnung, es handele sich um einen Jungen, daneben gelegen hatte. Das puppenhafte Gesicht hätte sie eigentlich schon in der Metro darauf bringen können.
Sie wollte sich umdrehen und rausgehen. Aber irgendwann musste sie sich dem Schicksal stellen. Es hinauszuzögern, machte die Sache nur noch schlimmer. Sie griff in ihre Tasche und beförderte das zerfledderte Buch zutage, wegen dem sie hier war. Ob das Schicksal nun wollte, dass sie ein Buch reparieren ließ, oder ob es einfach nur eine Begegnung forcierte, war im Prinzip egal. Es lief doch alles auf dasselbe hinaus.
»Ich habe einen Auftrag«, sagte sie und hielt die Ausgabe von ‚Romeo und Julia‘ hoch.
Die Person nickte nervös. »Ich hole den Meister. Er ist in seinem Büro.« Zunächst ging sie rückwärts, dann stolperte sie über ihre eigenen Füße, als sie eine schmale Treppe hochhastete. Meister. Aha. Dann war sie der Lehrling oder die Aushilfe.
»Hey?«, rief Gwendolyn und steckte die Ausgabe wieder ein.
Die Person hielt mitten auf der Treppe inne und griff fest an das Geländer. Gwen konnte die Panik in ihren Augen sehen. Meine Güte, sie musste ihr echt zugesetzt haben.
»Ich hoffe, dir geht es wieder gut.« Sie zeigte mit zwei Fingern auf ihre Augen. »Wegen dem … du weißt schon. Das … äh … Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen.« Sie holte tief Luft. »Wenn du irgendwelche Nachwirkungen oder Probleme dadurch hast, sag mir bitte Bescheid. Ich kümmere mich dann um eine passende Versorgung.«
Der Lehrling zögerte, nickte dann aber.
»Darf ich nach deinen Pronomen fragen?«
»Wie?« Unsicher blickte sie im Raum umher.
»Wie möchtest du angesprochen werden?«
»Oh.« Räuspern. »Das ist echt nett, dass Sie fragen.« Dann lächelte sie. »Ich bevorzuge iel oder die femininen Pronomen. Mein Name ist Bernadette.«
Gwendolyn neigte leicht den Kopf. »Gut.« Es war nicht einfach, in Frankreich neue Pronomen zu etablieren. Während das Antidiskriminierungsgesetz wie selbstverständlich stetig erweitert wurde, war die Sprache fast schon unantastbar.
Bernadette blickte zwischen ihr und dem Treppenabsatz im oberen Stockwerk hin und her, dann stieg iel weiter die Treppe hoch. Diesmal nicht mehr ganz so hastig.