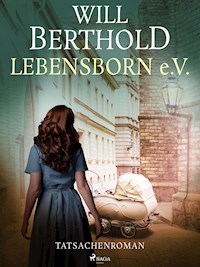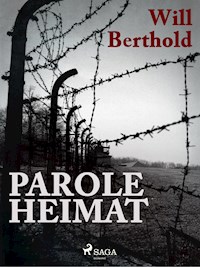
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Will Berthold ist ein eindringlicher Kriegsroman gelungen, bei dem er sich auf die 15bändige von namhaften Historikern erstellte Dokumentation der deutschen Bundesregierung, den Bericht des Roten Kreuzes und die Berichte der deutschen Kriegsgefangenen-Organisationen sowie von Augenzeugen stützt. Danach waren genau 11 092 287 deutsche Soldaten bei Kriegsende in den Händen der Sieger in Ost und West und damit ihrer Willkür, Menschlichkeit und Rachsucht ausgesetzt. Sie waren lebende Druckmittel, Arbeitskräfte zum Nulltarif. Je nachdem, wo sie hinter Gittern leben mussten, litten, froren, schwitzten, hungerten und verhungerten sie. "Parole Heimat" war das Motto, das die aller meisten Tag für Tag am Leben hielt. Für eineinhalb Millionen, die nicht mehr wiederkehren sollten, war es allerdings auch eine Illusion, die sich nicht erfüllte.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Will Berthold
Parole Heimat
Deutsche Kriegsgefangene in Ost und West
SAGA Egmont
Parole Heimat
Parole Heimat. Deutsche Kriegsgefangene in Ost und West
Genehmigte eBook Ausgabe für Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
Copyright © 2017 by Will Berthold Nachlass
represented by AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de).
Originally published 1979 by Hestia Verlag, Germany
All rights reserved
ISBN: 9788711727294
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt og Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Erster Teil
Sowjetunion
Der rundliche Obergefreite stieg über Leichen‚ aber er hob so vorsichtig die Beine‚ als könnte er ihnen noch weh tun. Sie waren neben der verschlossenen Waggontür aufgestapelt: zwei von gestern und drei von heute – aber der Tag war noch nicht zu Ende.
Mehr Mühe hatte Müller zwo mit den Lebenden. Sie lagen auf Stroh‚ in der eigenen Scheiße‚ vollgepißt bis obenhin. Geschlafen wurde in zwei Schichten. Nur die Plennys auf der rechten Seite des Waggons konnten die Beine ausstrecken. Die anderen hockten in diesem Pferch mit angezogenen Knien. Einige versuchten‚ an das Zwanzigzentimeterloch im Wagenboden – WC auf russisch – heranzukommen.
Die Eiligen kamen zu spät‚ weil ihnen noch Eiligere zuvorgekommen waren‚ denn durch diese lächerlich kleine Öffnung troff der Gegenwert von Salzheringen. Pausenlos. Der Andrang provozierte die Preisfrage aller Rußlandopfer: Wieso kann man leere Därme immer noch leeren?
Der Oberschnäpser Müller zwo‚ 41‚ Fleischwarenfabrikant aus Köln‚ verheiratet‚ Vater zweier Kinder‚ der gerade über die Leichen gestiegen war‚ wollte nicht aufs Lochklo. Er war an der Reihe. Gierig und verzückt starrte er auf die rostigen Eisenteile des Waggons. Er mußte noch warten‚ bis sie sich wieder mit Rauhreif überzogen.
Es dauerte jeweils an die dreißig Minuten‚ bis es soweit war‚ und so kam man bei vierzig Mann Besatzung – rein mathematisch – jeden Tag einmal mit der Zunge an das gefrorene Naß. Die Ausbeute war minimal‚ aber es waren immerhin zwei‚ drei Tropfen‚ und ein wenig löschte auch die Illusion den rasenden Durst. Solange man Durst hatte‚ lebte man noch‚ und nur das zählte.
Müller zwo stand an der Wand des Waggons und starrte unverwandt ein schmales‚ langes Eisenstück an‚ das zwei Bretter der Wand schlampig zusammenhielt. Seine Augen waren klein‚ sein Gesicht tollwütig vor Durst. Die Adern an seiner Stirn traten wie bizarre Schnüre hervor. Er verlängerte noch ein paar Minuten das Abwarten. Je länger er sich beherrschte‚ desto größer wurde die Eisschicht.
Dann schnappte er zu.
Sein Mund schien zu platzen. Seine Zunge schoß hervor. Sie wurde lang‚ lechzend. Sowie sie das Eisen berührte‚ fror sie an. Aber Müller zwo wartete nicht. Er riß sie los‚ leckte weiter‚ bis sie wieder anfror.
Während sich der Oberschnäpser die Zunge in Fetzen riß‚ schluckten die Umstehenden trocken mit.
Langsam löste er sich wieder. Sein Durst loderte weiter‚ überlagert von einem wütenden Schmerz. Aber seine Gesichtszüge wirkten wieder normal‚ glatt seine Schläfen.
»Und wenn ich verhungere«‚ stöhnte Müller zwo lallend‚ »ich fleß nie wieder Sal-Sal-Salheringe.« Er preßte sich die Hand auf den brennenden Mund. Und hinter ihm stand schon der nächste und wartete‚ bis sich auf Nieten und Beschlägen der Reif wieder kristallisierte.
Es gab verschiedene Methoden gegen den Durst:
Feldunterarzt Penzlau‚ etwa 28‚ Absolvent von sechs Semestern Medizin‚ kurz vor seiner Gefangennahme mit seiner Braut in Breslau ferngetraut‚ versuchte es mit Vernunft und Autosuggestion. Er aß keine Salzheringe und bildete sich ein‚ keinen Durst zu haben. Sein Kumpel Fährmann aus Frankfurt‚ 36‚ Dolmetscher und Junggeselle aus Überzeugung‚ stand Tag und Nacht an einer Ritze des Waggons und soff sich mit Luftfeuchtigkeit voll.
Der Berliner Kudritzky‚ 25‚ Abiturient‚ vom ersten Kriegstag an dabei und mehrfach verlobt‚ war‚ schlau wie immer‚ auf den einfachsten Trichter gekommen: Er durchsuchte sorgfältig einen von den Russen schon zu Lebzeiten gefilzten Zahlmops. Unter dem Mantelfutter des Toten fand er‚ an einem Geheimhaken aufgehängt‚ eine fast volle Feldflasche. Vielleicht war sie mit Tee oder mit Wasser oder mit Schnaps gefüllt. Mit Flüssigkeit in jedem Fall. Und was flüssig war‚ würde er aussaufen‚ und wär’s Benzin.
Der Junge mit den wirren Haaren und den lustigen Augen mußte damit noch warten‚ bis es dunkel wurde. Für alle reichte eine Feldflasche nicht‚ aber bei vieren konnte sie Wunder wirken. Kudritzky war ein anständiger Fledderer‚ der mit seinen bewährten Kumpels Penzlau‚ Fährmann und Müller zwo auf jeden Fall teilen würde.
»Komm mal her‚ Sauerbruch«‚ rief Fährmann aus der Sterbeecke des Waggons.
Penzlau‚ der Sechssemestermediziner‚ der aufgrund dieser Kenntnisse von seinen Kumpels zum »Professor« ernannt worden war‚ ruderte sich bis zu einem Leutnant mit einem alten Gesicht und ziemlich neuen Schulterstücken durch‚ beugte sich über ihn‚ fühlte den Puls‚ hob die Augenlider‚ richtete sich wieder auf.
»Hat einer’nen Spiegel?« rief er.
Keiner rührte sich.
»Einen Spiegel‚ verdammt noch mal«‚ fluchte Penzlau.
»Reg dich nicht auf‚ Sauerbruch«‚ sagte Kudritzky grinsend und reichte ihm einen Taschenspiegel. »Ich bin ja bei dir.«
Penzlau hielt den Spiegel an den offenen Mund seines Patienten‚ betrachtete ihn sorgfältig‚ nickte und wiederholte die Prozedur; er fand nur bestätigt‚ was er zuvor schon befürchtet hatte:
»Den könnt ihr auf die anderen legen«‚ stellte er müde fest und wies auf die fünf Toten neben der Waggontür.
Genausogut konnte er Amen sagen. Oder Exitus. Oder Sense – aber wer machte nach elftägiger Fahrt – die letzten vier Tage ohne Essen‚ die beiden letzten auch ohne Wasser – davon noch viel Aufhebens? Müller und Fährmann wuchteten den Verstorbenen auf den Totenstapel.
»Wie ist es eigentlich‚ Professor«‚ fragte Kudritzky‚ »sind die verhungert? Verdurstet? Oder erfroren?«
»Vielleicht am Mief erstickt«‚ giftete der Arzt. Müller zwo stand neben ihm und schnitt komische Grimassen.
»Was ist denn mit dir los?« fragte Penzlau.
»Wahnlinnige Schmelzen‚ Sauelbluch«‚ lallte der Kumpel.
»Mach den Mund auf«‚ befahl der Mediziner‚ zog ihn ans Licht‚ betrachtete sich die Bescherung.
»Du Arsch mit Ohren«‚ fluchte er. »Zunge im Eimer. Ab heute kannst du mit nem Strohhalm essen und trinken.«
»Slimm«‚ entgegnete Müller zwo. »Wenn’s was zum Flessen und Saufen gibt.«
Der Zug rollte und rollte und rollte. In die Richtung‚ in der die Sonne aufgeht und wo dem armseligen Haufen der Untergang drohte. Die vier Kumpels hatten zur 17. Panzerdivision gehört‚ die am 13. Januar 1945 von den Russen an der Weichsel überrollt worden war.
Sie hatten sich selbständig gemacht‚ waren getürmt und geschnappt worden. Zunächst einmal waren sie unter freiem Himmel‚ umgeben von Panzerrollen‚ wochenlang in einem riesigen Auffanglager verwahrt worden.
Der Tod hatte sie durchgekämmt‚ ziemlich oberflächlich zunächst‚ aber jeder vierte war bereits beim erstenmal an seinem Rechen hängengeblieben
Dabei waren die Russen viel besser als ihr Ruf. Jedenfalls hatten die vier‚ die eisern zusammengeblieben waren‚ damit gerechnet‚ gleich formlos umgelegt zu werden. Aber sie wurden nicht einmal mißhandelt und erhielten sogar was zu fressen.
Blutwenig zwar‚ aber immerhin mehr als die meisten russischen Zivilisten‚ und das war beachtlich viel in einem Land‚ in dem Anno 45 – und noch jahrelang – allenfalls die Wanzen‚ Mäuse und Bonzen satt wurden.
»Sicherlich war von sowjetischer Seite nicht beabsichtigt‚ die deutschen Kriegsgefangenen besonders zuvorkommend oder auch nur dem Genfer Kriegsgefangenen-Abkommen entsprechend zu behandeln. Die Schuld daran trug aber weniger die Sowjetunion als Hitler‚ der sogar einen Austausch von Gefangenenlisten ablehnte«‚ heißt es in der unveröffentlichten Dokumentation der Bundesregierung: »Zur Geschichte der deutschen Kriegsgefangenen des Zweiten Weltkriegs«‚ Band II‚ Seite 33: »Und zwar mit der Begründung‚ sotcb ein Abkommen würde die Angst der deutschen Soldaten vor sowjetischer Gefangenschaft mindern und das Reich unter der Hand zwingen‚ die hohen Sterbezifferp seiner sowjetischen Gefangenen zuzugeben. Es ist nicht unmöglich‚ daß die sowjetische Führung mit dem Gedanken der Vernichtung deutscher Kriegsgefangener‚ vor allem der Offiziere‚ gespielt hat. Es gibt aber keinerlei Beweise‚ daß eine Vernichtung geplant war‚ lediglich muß angenommen werden‚ daß sie mitunter‚ wie etwa nach dem Fall Stalingrads‚ mit in Kauf genommen wurde.
Dies schließt jedoch nicht aus‚ daß die deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion vom ersten bis zum letzten Tag unter dem drückenden Gefühl standen‚ ihre Vernichtung seigeplant. Ihre Erfahrungen und verschiedene Ereignisse der Bsowjetischen Geschichte mußten sie in diesem Glauben bestärken.«
»Will der Iwan uns eigentlich auf eine etwas umständliche Art umbringen?« Penzlau‚ kein Kind von Ängstlichkeit‚ wandte sich leise an Fährmann.
»Kaum«‚ antwortete der Dolmetscher. »In solchen Fällen ist er mehr für die primitive Methode.«
»Vielleicht müssen die Russen Munition sparen«‚ erwiderte Penzlau dumpf.
»Quatsch«‚ versetzte Fährmann derb. »Dann hätten sie uns ja schon im Weichselbogen verhungern lassen können.«
»Kluger Junge.« Penzlau spottete‚ um sich die Erleichterung nicht anmerken zu lassen. Fährmann war ein prima Ostspezialist. Er sprach ein besseres Russisch als die Rotarmisten‚ die den Transport bewachten. Als Sohn einer russischen Emigrantin und eines deutschen Vaters kannte er ihre Mentalität aus dem Effeff.
Er starrte unentwegt nachdraußen.
Wenn sich eine klägliche Sonne durch einen Wolkenriß zwängte‚ konnte man die ungefähre Richtung errechnen‚ in die der Transport rollte. Auch wenn die Insassen annahmen‚ daß er sich im Kreise drehte‚ fuhr er sturheil nach Osten. Er rollte quer durch eine Landschaft‚ deren Gesicht ein Vernichtungskrieg geprägt hatte:
Verwüstete Dörfer. Verbrannte Erde. Wälder mit zerschossenen Baumkronen. Geschwärzte Mauern‚ zwischen denen nur noch Ratten lebten.
Hitlers Überfall hatte in Rußland 13000 Brücken‚ 4100 Bahnhöfe und 65000 Kilometer Schienenstränge zerstört‚ 15 800 Lokomotiven waren zerschossen‚ 428 000 Eisenbahnwagen beschädigt‚ 6000 große Kraftwerke ebenso in die Luft gejagt oder demontiert worden wie 31850 Industriebetriebe. 45 Prozent der russischen Bevölkerung‚ über 88 Millionen‚ hatten unter den Knobelbechern gelebt. 67 Prozent der gesamten Anbaufläche mit der Hälfte des Viehbestandes waren von den Deutschen erobert und damit 52 Prozent der Kornernte und 86 Prozent des Zuckerrübenanbaus kassiert worden.
»Du lernst wohl den Weg auswendig‚ für den Fall‚ daß wir türmen«‚ sagte Kudritzky und schob sich an die Seite Fährmanns. »Mann‚ du kannst ja gar nichts sehen.« Wie ein Magier‚ der die weiße Taube aus dem Zylinder flattern läßt‚ kramte er eine Nagelfeile aus der Tasche: »Jetzt machen wir erst einmal ein schönes Guckloch.«
Es war eine Geduldsarbeit‚ mit einer kleinen Nagelfeile an den dicken Bohlen zu sägen. Sie wechselten einander ab‚ arbeiteten stundenlang. Zeit war das einzige‚ was sie hatten.
Sie konnten jetzt schon hinaussehen‚ ohne die Augen zuzukneifen. Die Landschaft lag unter einer unberührten Schneedecke. Ihre Kristalle funkelten in bunten Farben. Es war ein schöner‚ hundsgemeiner Anblick‚ denn wenn sie den nur wenige Meter entfernten Schnee anstarrten‚ schmolz er‚ rauschten ganze Wasserfälle. Es war eine ungeheure Verschwendung‚ wo doch schon ein einziger Schneeball sie von ihrem wahnsinnigen Durst erlöst hätte.
»Wo sind wir eigentlich?« fragte Kudritzky.
»Wenn wir in diesem Tempo weiterfahren‚ in zwei oder drei Tagen in Kiew«‚ erwiderte Fährmann.
»Hier«‚ Kudritzky schob dem Dolmetscher verstohlen die Feldflasche zu.
Zuerst starrte Fährmann ihn an wie den Schnee‚ aber dieser lag draußen‚ und die Feldflasche spürte er in seiner Hand.
»Zwei Schluck«‚ gestand ihm Kudritzky zu‚ »aber mittlere.«
Der Mann trank mit Bedacht und Disziplin‚ und er verzählte sich nicht: »Das ist ja…«
»Schnaps«‚ erwiderte Kudritzky und deutete auf den toten Zahlmops: »Da liegt der edle Spender.«
Vier Stunden später rollte der Transport in eine kleine‚ zerschossene Station ein. Der Zug hielt‚ aber die Waggontür blieb verschlossen. Auf einmal stand Penzlau neben Kudritzky und Fährmann‚ Müller zwo postierte sich auf der anderen Seite.
Man hörte die Stimmen von zwei Rotarmisten‚ die sich in ihrer gutturalen Sprache unterhielten.
»Könnt ihr nicht die Tür einen Spalt aufmachen‚ bitte?« rief Fährmann auf russisch. »Wir ersticken.«
Er erhielt keine Antwort.
»Du mußt ihnen was bieten«‚ rief Kudritzky.
»Ruka‚ ruka mojet«‚ rief der Dolmetscher.
»Was heißt das?« fragte Kudritzky.
»Eine Hand wäscht die andere«‚ erwiderte Fährmann.
»Da muß ich ja tief in meine Schatztruhe greifen«‚ grinste der Praktiker‚ öffnete seine Hose und fuhr sich mit zwei Fingern in den After‚ wo er seinen Verlobungsring versteckt hatte.
Die Tür öffnete sich einen winzigen Spalt‚ er war groß genug für den hinauskullernden Goldreif.
Vorsichtig‚ ganz langsam vergrößerten die Plennys den Spalt der Schiebetür. Am Bahndamm standen ein paar Zivilisten‚ ausgemergelte Gestalten mit eingefallenen Gesichtern.
»Los‚ faßt an«‚ zischte Penzlau.
Sie nahmen den obersten Toten vom Stapel‚ trugen ihn an die Tür und warfen ihn wie einen Sack hinaus. Er knallte hart auf den Boden‚ aber es tat ihm sowenig weh wie der Feuerstoß der Maschinenpistole‚ der in seinen starren Körper knallte.
Der Posten schoß noch auf die zweite Leiche‚ dann begriff er‚ daß man Tote nicht mehr töten kann.
In der Mitte des Zuges folgten die Insassen eines anderen Waggons Penzlaus Beispiel. Auch hier wurde geschossen. Es entstand ein heilloses Durcheinander. Aufgeregte Konvois wetzten auf dem Bahnsteig hin und her. Ein Zivilist fuchtelte wild. Man wußte nicht‚ ob er die Bewacher oder die Bewachten meinte.
Der Transportoffizier begriff‚ daß in den Güterwagen eine ganze Menge Toter sein mußte. Er ließ jetzt die Türen öffnen – auch die vernagelten – und die Leichen hinausschaffen. Je zwei Mann eines Waggons hatten es zu besorgen. Der Bahnsteig wurde mit toten Männern überschwemmt.
Es waren an die zweihundert‚ etwa zehn Prozent der Gefangenen dieses Zuges. An anderen Transporten gemessen noch eine recht bescheidene Quote. Kudritzky und Müller zwo trugen den toten Zahlmeister weg.
Ein Rotarmist schrie‚ fluchte und fuchtelte mit den Händen herum.
»Davaj bystro‚ davaj bystreje!« rief er. »Los schnell‚ los schneller!« Er schminkte sein eher gutmütiges Gesicht mit Brutalität.
Sie luden den toten Plenny ab‚ gingen zurück‚ um den nächsten zu holen. Aber so weit kam Müller zwo nicht.
Am Nachbargleis faßte eine Lokomotive Wasser. Der Tank war voll‚ und sie fauchte langsam weiter. Aus dem Schlauch floß Wasser in dickem Strahl.
Es war zuviel für Müller zwo. »Bleib stehen«‚ rief ihm Kudritzky zu.
Sein Kumpel hetzte los. Er schaffte zwei‚ drei Meter.
Dann bellte die MP auf. Müller zwo fiel kopfüber auf den Bahnsteig‚ und obwohl er innerlich ausgetrocknet war‚ wirkte er im Fallen wie ein Betrunkener.
Der Transport rollte weiter. Einer von Tausenden‚ die Millionen deutscher Landser in das weite‚ endlose Rußland schafften. Irgendwohin zwischen Nördlichem Eismeer und Kaukasus. Es gab Tausende von Lagern: Offizierslager‚ Schweigelager‚ Erholungslager‚ Waldlager‚ Prominentenlager‚ Todeslager‚ Straflager‚ Verpflegungslager‚ Politlager‚ Lager‚ die sich in die Kälte duckten und doch ihre Insassen verheizten.
Die Zeit war so beschissen wie die Güterwaggons der Transportzüge. Das einzige‚ was es fast zum Nulltarif gab‚ waren Menschenleben‚ und so wurde in den ersten Nachkriegsjahren eigentlich nur der Tod richtig satt.
Er kam als Bumerang. Oder auch als Revanchist: Die Roten verlängerten die Verbrechen der Braunen. Beide Seiten handelten nach dem stillen Motto: Hunger ist der beste Mord.
Aus dem Abstand vieler Jahre stellt allerdings die Bonner Dokumentation‚ Band III‚ Seite 12‚ fest: »Während die Höhe der gesamten Menschenverluste der Sowjetunion nicht genau bekannt ist‚ liegen genaue Zahlen über die sowjetischen Kriegsgefangenen vor‚ die in deutscher Hand während des Krieges gestorben sind. Man kann sich nicht mit dem Hunger der deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion und nicht mit der großen Zahl derer‚ die dort starben‚ befassen‚ ohne zuvor diese Zahlen in ihrem ganzen Gewicht auf sich wirken zu lassen.
Nach nationalsozialistischer Auffassung waren die sowjetischen Soldaten nur Untermenschen‚ die vernichtet werden mußten‚ soweit sie nicht als Arbeitskräfte unentbehrlich waren. Während man in Berlin herumstritt und die Armeen kämpften‚ starben die Gefangenen. Es gibt eine Fülle beredter Zeugnisse dafür‚ daß ganze Divisionen dem Verderben unter freiem Himmel preisgegeben wurden. Seuchen undKrankheiten räumten in den Lagern auf. Schläge und Übergriffe seitens der Wachmannschaften waren an der Tagesordnung. Millionen blieben wochenlang ohne Nahrung und Obdach. Wenn Gefangenentransporte an ihrem Bestimmungsort ankamen‚ gab es ganze Güterwagen voll von Toten. Angaben über die Höhe der Verluste schwanken beträchtlich‚ doch betrugen diese im Winter 1941/42 nirgendwo weniger als 30 vom Hundert‚ in manchen Fällen erreichten sie 95 vom Hundert.
Das Ergebnis dieser unmenschlichen Behandlung war‚ wie die amtlichen deutschen Akten ergeben‚ daß nach dem Stand vom I. Mai 1944 von mehr als fünf Millionen sowjetischer Kriegsgefangener in deutschem Gewahrsam über zwei Millionen gestorben waren und mehr als eine weitere Million vermißt‚ von denen der größte Teil gestorben oder exekutiert‚ eine kleine Zahl geflohen war. Die Zahl der zu diesem Zeitpunkt noch lebenden sowjetischen Gefangenen in deutschem Gewahrsam betrug wenig mehr als eine Million.«
Zahlen sind unmenschlich und grausam. Und ungerecht. Ihre Nullen umstellen menschliche Schicksale‚ und Unschuldige bezahlen die Blutzeche‚ wie zum Beispiel Müller zwo‚ niedergestreckt von einer MP-Garbe‚ weil er am Verdursten war.
Kudritzky hatte ihn in den Wagen zurückgeschleppt und behutsam an der Stelle abgesetzt‚ an der zuvor die Toten gestapelt worden waren.
Kurz vor der Weiterfahrt gab es schließlich für jeden Gefangenen noch eine dünne Suppe‚ ein Stückchen Brot‚ ein paar rohe Krautköpfe und Wasser. Auch der Anteil von Müller zwo wurde sichergestellt‚ obwohl der Schwerverletzte nichts mehr davon hatte.
»So ein Armleuchter«‚ fluchte Kudritzky. »Bringst du ihn durch‚ Sauerbruch?«
Der Arzt schwieg und sah an ihm vorbei.
Der Dicke war noch immer bewußtlos‚ und das erwies sich als das einzig Gute an dieser elenden Geschichte. Am linken Oberschenkel hatte es ihn gleich zweimal erwischt. Es schienen glatte Durchschüsse zu sein. Jedenfalls waren sie weit harmloser als die Verletzung am linken Oberarm; er hing nur noch an einem Knochen.
Der Waggon war jetzt mit 34 Leuten belegt. Die Toten hatten etwas Platz geschaffen‚ und die Verpflegung nebst Wasser hatte für die Wiederbelebung der Halbtoten gesorgt. Die Diskussion über die Heimkehr flammte wieder auf‚ die Parole Heimat zog von Waggon zu Waggon‚ die Pessimisten tippten auf ein bis zwei Jahre Rußland und wären von den Optimisten dafür beinahe zerrissen worden.
Daß man einen Schwerverletzten an Bord hatte‚ beeinträchtigte die Gespräche wenig: Schließlich waren schön sechs andere gestorben‚ ohne daß ein Hahn nach ihnen gekräht hätte.
Müller zwo erwachte aus der Bewußtlosigkeit‚ sah direkt in die Augen Penzlaus: »Slimm‚ Sauelbluch?«
»Keine Bange‚ Dicker«‚ log der. »Wir kriegen dich schon hin.«
Der Kumpel sackte wieder weg.
Penzlau wühlte sich auf die andere Seite des Waggons durch.
»Hoffnungslos?« fragte Fährmann.
Penzlau nickte.
»Nu sei doch nicht so stur‚ Professor«‚ fauchte Kudritzky ihn an. »Tu doch was!«
Es war jetzt Nacht. Der Transport rollte so zügig‚ als wollte er seine ständigen Verspätungen einholen. Um weitere unerwünschte Zwischenfälle an Bahnhöfen zu vermeiden‚ hatten die Iwans eine Patentlösung erfunden. Sowie der Zug auf freier Strecke hielt‚ mußten die Waggons ihre Verluste melden. Die Toten wurden dann herausgetragen und auf einen offenen Güterwagen gelegt‚ der als Leichensammler gleich an die Lokomotive angekoppelt worden war.
Für Penzlau war es nur eine Frage von Stunden oder Tagen‚ bis sich sein alter Kumpel Müller zwo unter die stummen Gäste dieses Geisterwaggons mischte.
»Dabei könnte man ihn mit einer anständigen Ausrüstung ohne weiteres durchbringen«‚ schimpfte er. »Amputation‚Transfusion … fertig ist die Laube.«
Als es hell wurde‚ untersuchte Penzlau seinen Patienten wieder: Müller hatte ein starkes Herz‚ und er war noch bei Kräften. Der untere Teil seines Arms verfärbte sich dunkel‚ er markierte den Brückenkopf‚ den der Tod bereits besetzt hielt.
»Der Arm muß weg«‚ sagte Kudritzky‚ gedämpfter als sonst‚ ein wenig biß auch er sich die Zähne aus‚ das Organisationsgenie‚ divisionsweit bekannt‚ seitdem er eine Kartoffelmiete‚ eine zerbeulte Badewanne und ein paar Ofenrohre in eine mittlere Schnapsfabrik verwandelt hatte.
»Es ist Wahnsinn‚ aber wenn ich ein Messer hätte … «‚ begann Penzlau zögernd.
»Kannste haben«‚ versprach Kudritzky großkotzig.
»Was sagst du da?« fragte Penzlau schnell.
»Nicht verzagen‚ Kudritzky fragen«‚ erwiderte der Allesbesorger und wühlte in seinem unerschöpflichen Mantelfutter. Er brachte ein mittelgroßes‚ feststehendes Messer mit scharfer Klinge zum Vorschein. Es. war ihm egal‚ daß auf diesen Waffenbesitz die Todesstrafe stand.
Penzlau verwünschte sich und seinen Beruf. Er nahm einen kleinen Schluck Schnaps. Dann entschloß er sich‚ eine der schauerlichsten medizinischen Großtaten zu riskieren‚ die je hinter Stacheldraht versucht worden waren.
Fährmann sammelte‚ ziemlich robust‚ sämtliche Taschentücher ein‚ während Penzlau dem delirierenden Müller gut zuredete: »Tut ’n bißchen weh‚ mein Junge‚ aber es ist gleich vorbei. Schließlich willst du ja wieder nach Hause. Oder?«
Auf einmal wurde es still in dem Waggon. Sie suchten den hellsten Platz als Operationstisch aus‚ etwas Stroh mit möglichst wenig Exkrementen als Unterlage. Die Männer mit den besten Nerven mußten‚ mit dem Gesicht zur Wand‚ den Schwerverwundeten als Sichtblende umstellen.
Als Narkosemittel diente eine von Kudritzky geklaute Suppenschöpfkelle aus Metall. Das sauberste der dreckigen Taschentücher stopfte Fährmann dem Patienten in den Mund‚ bevor er noch was sagen konnte.
Verstohlen betrachteten alle Penzlau‚ und jeder dankte Gott – ob er nun an ihn glaubte oder ihn längst zum Teufel gewünscht hatte –‚ daß ihm das Medizinstudium erspart geblieben war.
»Hör zu«‚ sagte Penzlau. »Er darf das Ding nicht sehen. Du haust ihn hier auf den Hinterkopf. Genau auf den Trigeminus. Kapiert?«
»Ja«‚ erwiderte Kudritzky; man sah ihm an‚ daß er nie wieder im Leben eine Schöpfkelle klauen würde.
»Wenn du zuwenig zuschlägst‚ nützt es gar nichts«‚ fuhr Penzlau fort. »Aber wenn du zu fest draufdrischst‚ zertrümmerst du ihm die Schädeldecke.«
»Mensch‚ wie soll ich denn …?« fragte Kudritzky gequält.
»Stell dir vor‚ es wär dein eigener Kopf«‚ erwiderte der Arzt‚ und sein Helfer machte sich fertig zur Holzhammernarkose.
Der Frost fraß sich mit minus 40 Grad durch die Ritzen des Waggons‚ aber als Kudritzky mit der Schöpfkelle ausholte‚ um seinen besten Kumpel bewußtlos zu schlagen‚ wurde es einen Atemzug lang dreiunddreißig abgerissenen‚ halbverhungerten Plennys heiß vor Angst.
Auf einmal sabberte keiner‚ fluchte keiner‚ betete keiner mehr. Man hörte nur noch‚ wie eine asthmatische Dampflok einen endlos langen Transportzug hinter sich herschleppte‚ quer durch das verschneite Rußland.
»Moment mal‚ Ku«‚ sagte der Feldunterarzt. Der Schmalspurmediziner kniete neben seinem 41jährigen Patienten: Müller zwo fieberte‚ von zu Hause‚ von seiner Frau‚ von seinen beiden Kindern. Doch die Angst‚ zu ersticken‚ brachte ihn wieder ganz zu sich‚ und er begriff allmählich‚ daß der Himmel Rußlands viel näher war als die Domtürme zu Köln.
»Gleich vorbei‚ Dicker«‚ tröstete ihn Penzlau. »Wir passen schon auf‚ daß du nicht erstickst.« Er nahm ihm das Taschentuch aus dem Mund und gab dem seitlich hinter dem Patienten kauernden Kudritzky einen Wink‚ weitere Diskussionen mit der Schöpfkelle zu beenden: »Das mit dem Taschentuch ist ’n alter Trick‚ damit du die Zähne und die Arschbacken besser zusammenkneifen kannst.«
Er verfolgte aus den Augenwinkeln‚ wie Kudritzky zum zweitenmal mit seinem Narkosewerkzeug ausholte‚ und schob dem Patienten den Taschentuchknebel schnell wieder in den Mund: »Nun sei ein braver Junge«‚ lullte er den Kumpel ein. »Mund auf‚ Augen zu.« Er wartete darauf‚ daß Kudritzky endlich zuschlagen würde.
Kudritzky starrte auf Müllers massiven Schädel‚ starrte auf die Stene‚ die er treffen mußte: Zuwenig war gar nichts‚ und zuviel war Mord. Er preßte den Stiel der Schöpfkelle so fest zusammen‚ daß er in die Haut schnitt. Ein Krampf fuhr durch seine Hand. Er konnte sie nicht rühren.
»Nu mach schon‚ du Schlappschwanz!« fuhr ihn Penzlau an.
Im nächsten Moment flog die Kelle durch die Luft. Sie landete mit lautem Krachen auf der Schädeldecke ihres Opfers.
Kudritzky lehnte sich an die Waggonwand. Er spürte‚ wie sich sein Magen mit Übelkeit beschlug‚ wie sie die Speiseröhre hochkletterte.
»Hab’ ich … hab’ ich ihn umgebracht‚ Sauerbruch?« fragte Kudritzky
»Quatsch«‚ versetzte Penzlau unsicher.
Er drehte‚ von Dolmetscher Fährmann unterstützt‚ den stummen Müller zwo auf die Seite‚ dem spärlichen Licht entgegen‚ tastete den Hinterkopf ab‚ spürte unter einem aufgehenden Bluterguß eine harte‚ vermutlich heile Schädeldecke »Vielleicht ein kleiner Riß«‚ sagte er‚ »der muß ja ’nen Kopf haben wie ’n Stahlhelm.«
Er beobachtete‚ wie Fährmann mit dem letzten Tropfen Schnaps das Messer desinfizierte‚ nickte seinem Hilfssanitäter noch mal zu und verfiel in die maschinelle Menschlichkeit‚ die er immer zeigte‚ wenn es darauf ankam.
Operation auf russisch: eine verdreckte Strohschütte als OP-Tisch. Verlauste Taschentücher als Tupfer. Eine geschmuggelte Nagelfeile als Knochensäge. Zwei undesinfizierte Gabeln als Klammern. Ein feststehendes Messer als Skalpell. Und ein junger Mediziner‚ dem noch ein paar Semester zum Staatsexamen fehlten‚ als Chirurg.
Penzlau säuberte die Schußwunde. Sie blutete sofort nach. Das Taschentuch färbte sich rot‚ so daß man nicht mehr sah‚ wie verdreckt es war. Der junge Arzt griff nach dem nächsten.
Noch hielt die hausgemachte Narkose vor. Vielleicht für zwei Minuten‚ vielleicht für zwei Stunden. Oder für die Ewigkeit.
»So mußt du das machen«‚ sagte Penzlau zu Fährmann und zog das zerschossene Fleisch des Oberarms von Müller zwo auseinander. Der Knochen lag frei. Er war zur Hälfte abgesplittert‚ und das war gut so.
Penzlau setzte das Messer an. Es war nur ein winziges Geräusch‚ als die Schneide den bloßen Knochen berührte‚ aber Kudritzky und Fährmann ging es durch und durch. Sie starrten entsetzt auf Müller zwo: Mußte der nicht davon aufwachen?
Der Zug ging in eine Kurve. Ein wenig zu schnell. Die Insassen des rollenden Pferchs purzelten durcheinander. Penzlau knallte mit dem Kopf gegen die Wand‚ ohne es zu spüren. Fährmann und Kudritzky lagen unter ihm‚ auf Müller zwo. Es sah aus‚ als hätten sich Lohnschlächter über einen losgerissenen Bullen geworfen.
Solcherlei Bilder narrten die verdreckten‚ verhungernden Kriegsgefangenen Tag und Nacht. Uber Wochen‚ Monate und Jahre hinweg‚ soweit sie diese überleben konnten – zwei Millionen neunhunderttausend von 3‚4 Millionen. Sowie der Durst‚ der ihre Körper ausgetrocknet hatte‚ ein wenig gelöscht war‚ fraß der Hunger sie auf.
Die Ouvertüre des Verhungerns hatte in den Sammellagern begonnen und setzte sich nunmehr in Tausenden von Transporten‚ die Hunderttausende von Menschenleben kosteten‚ fort. Die Nachschubzüge mit Waffen und Munition hatten den Vorrang‚ und auf den nicht rechtzeitig erreichten Bahnhöfen fielen ausgemergelte Zivilisten heißhungrig über den Plenny-Proviant her. Ersatz gab es nirgends. In dieser Zeit konnte man nur‚ ob Gefangener oder Zivilist‚ auf Kosten anderer satt werden.
»Im Gebiet der Kampfhandlungen wurden außer 1710 Städten mehr als 70000 ländliche Ortschaften‚ 98000 Kolchosen‚ 1876 Sowchosen und 2890 Maschinen-TraktorenStationen ganz oder nur teilweise zerstört«‚ stellt die Dokumentation der Bundesregierung (Band III‚ Seite 11) fest. »Nach dem Ende der Besatzung betrug der Bestand an Traktoren nur noch 50 Prozent‚ an Mähdreschern 58 Prozent der Vorkriegszahl‚ und diese Maschinen befanden sich zumeist in schlechtem Zustand. Ebenso waren die Viehbestände in diesen Gebieten erschreckend zusammengeschmolzen: Pferde auf 28 Prozent‚ Rinder auf 40 Prozent‚ Schafe und Ziegen auf 30 Prozent und Schweine auf 10 Prozent des Vorkriegsstandes.«
»Die Sowjetunion hatte bekanntlich erst 1936 das Rationierungssystem aufheben können‚ war jedoch sofort bei Kriegsbeginn 1941 zur Wiedereinführung gezwungen«‚ heißt es in einer dreibändigen Untersuchung des Deutschen Roten Kreuzes über die deutschen Kriegsgefangenen im Osten (Band II‚ Seite 45). »Es ist sicher‚ daß die sowjetischen Zivilisten während des Krieges nicht immer – wie die Kriegsgefangenen – 400 Gramm Brot am Tag‚ ein-oder zweimal einen halben Liter dünne Suppe und etwa 100 bis 150 Gramm Kascha (Brei) hatten. Damit soll keineswegs gesagt sein‚ den Gefangenen sei es gutgegangen. Die weitverbreitete hochgradige Unterernährung und die fast an allen Gefangenen in dieser Zeit beobachteten Hungerödeme sowie das Aussterben ganzer Lager während des Krieges (Frühgefangene!) sprechen dagegen.«
Die Gefangenen dieses namenlosen Transports zu einem unbekannten Ziel waren Todeskandidaten eines Hungers‚ der sie längst gezeichnet hatte. Die meisten wogen nur noch einen knappen Zentner. Ihre Körper hatten begonnen‚ sich selbst zu kannibalisieren‚ und so kam es den meisten auch nicht mehr auf einen Arm an‚ der einem ihrer Kameraden abgesäbelt werden sollte.
»Ich geh’ noch mal mit dem Messer ’ran«‚ sagte Penzlau. Er legte seine ganze Kraft in den Schnitt‚ aber er kam nicht durch. Da versuchte er es mit der Nagelfeile. Es gab ein zirpendes Geräusch‚ als Penzlau an Müllers stabilem Knochen sägte und wetzte. Gleichzeitig nagelte er mit dem linken Knie seinen Patienten am Waggonboden fest.
Wieder griff er zum Messer.
Kudritzky‚ der begriffen hatte‚ daß es jetzt oder nie geschehen würde‚ hielt mit beiden Händen Müllers Kopf fest. Seine Schneidezähne bohrten sich in die Unterlippe‚ als würde sein eigener Knochen durchgeschnitten.
Das Krachen wurde von einem furchtbaren Schrei überlagert‚ den kein Knebel mehr dämpfen konnte. Der Patient war wach und sein Arm war ab‚ aber das begriff er nicht‚ denn er fiel gleich wieder in Ohnmacht.
Aus den restlichen dreckverschmierten Taschentüchern fabrizierte Penzlau einen Notverband. Dann deckte er den Patienten sorgfältig zu. Er stand auf. Sein Gesicht wirkte erleichtert und erschöpft.
»Für so etwas würde man unter normalen Umständen Zuchthaus kriegen«‚ klagte sich der junge Arzt an.
»Mach dir nichts draus‚ Sauerbruch«‚ erwiderte Kudritzky‚ »bist ja schon im Zuchthaus.«
»Leider war’s vergebliche Liebesmüh«‚ sagte Penzlau. »Die Infektion kommt so sicher wie das Amen in der Kirche.« Und er setzte hinzu: »Bin ja nicht mal sicher‚ ob nicht auf der offenen Wunde Läuse herumkrabbeln.« Er reichte Kudritzky das blutige Messer: »Wirf es durchs Kloloch!« sagte er mit einem Seitenblick auf die anderen Plennys‚ und Kudritzky‚ der aufmucken wollte‚ begriff‚ daß es nicht anders ging.
Den abgetrennten Arm verbargen sie unter dem Stroh. Angewidert betrachtete Fährmann den Kochgeschirrdeckel mit der ekligen Brühe von Blut‚ Dreck und Wasser. Kudritzky wollte ihn ausleeren‚ aber Fährmann fragte zögernd: »Kann ich das haben?«
Der Durst schnürte ihnen selbst die Kehle zusammen‚ aber einen Moment lang‚ musterten sie Fährmann erschrokken. Ausgerechnet er‚ der sich in vorderster Stellung immer rasiert hatte‚ an dessen gepflegten Luxuskörper nicht einmal die Läuse herangekommen waren‚ hatte die Selbstbeherrschung verloren.
»Beim letzten Halt ist mein Kochgeschirr zurückgeblieben«‚ entschuldigte sich der Dolmetscher.
»Blödmann!« fuhr ihn Kudritzky an. »Dann sag doch was‚ bevor du hier eingehst wie ’ne Primel.« Er deutete auf den Bewußtlosen. »Wir haben seine Suppe als Reserve.«
»Daran vergreif’ ich mich nicht«‚ antwortete Fährmann.
Penzlau nahm den Kochgeschirrdeckel mit dem Blutwasser und schüttete ihn wütend aus‚ während Kudritzky im Stroh nach Müllers Verpflegung suchte.
»Der hat bestimmt nichts dagegen und im Moment sowieso andere Sorgen«‚ murmelte er vor sich hin‚ suchte weiter und griff ins Leere. Endlich begriff er‚ daß einer der Mitgefangenen die Operation benutzt haben mußte‚ um den Schwerverwundeten zu beklauen.
»Wer war denn diese miese Drecksau?« brüllte er und musterte seine Zufallskameraden.
Keiner gab eine Antwort. Einen Augenblick lang waren ihre Gesichter von der Angst uniformiert. Alle konnten sie die Wassersuppe nicht gestohlen haben; alle konnten sie auch nicht unschuldig sein. Wer war es gewesen‚ wer bloß? Kain sah aus wie Abel‚ und das konnte man wörtlich nehmen‚ denn nach der Augenzeugenaussage W-271 (Dokumentation Bundesregierung‚ Band II‚ Seite 64) »brachte es ein als Sanitäter eingesetzter Gefangener sogar fertig‚ seinen eigenen leiblichen Bruder verhungern zu lassen. Anstatt ihn mit besonderer Liebe und Sorgfalt zu pflegen‚ stahl er dem Kranken die Verpflegung … «
Als der Wahnsinn in den Waggons die Macht zu übernehmen drohte‚ hielt der Zug endlich auf einem kleinen‚ miesen Bahnhof mit den Fingerabdrücken des Kriegs. Er sah aus wie ein Denkmal der Trostlosigkeit.
Die Waggontüren wurden aufgerissen.
»Job twoju matj«‚ fluchte einer vom Konvoi und fuchtelte mit dem Seitengewehr herum. »Stoj‚ Kamerad‚ deutsches.« Er grinste breit über sein rundes Gesicht: »Gibt Wasser‚ gibt Kascha … gibt Rotte Armee‚ was hat.«
Das war den Elendsgestalten‚ die aus den Waggons quollen‚ schon zu oft versprochen worden‚ als daß sie noch einmal darauf hereingefallen wären.
Zivilisten betrachteten den offenen Leichenwaggon‚ der hinter der Lokomotive abgehängt wurde. Erst als sie die Lebenden sahen‚ erschraken sie‚ wiewohl auch ihnen der Hunger aus der Wäsche grinste. Eine alte Matka‚ ein dick vermummtes Mütterchen‚ hatte eine Kanne mit Milch in der Hand‚ die sie ständig schüttelte‚ damit sie nicht gefror.
Stumm und traurig reichte sie dem nächstbesten Plenny das Gefäß. Bevor er trinken konnte‚ versuchten ihm die anderen die Kanne zu entreißen.
»Hui s nim«‚ fluchte der Rotarmist und fuhr mit dem Gewehrkolben dazwischen. Das Gefäß polterte auf den Boden. Die Milch begann sofort auf dem Bahnsteig anzufrieren. Ein paar Gefangene legten sich auf die Erde und schleckten sie sauber auf.
Sie hatten gerade und vorläufig Verhungern und Verdursten noch einmal überlebt; aber als jetzt ein Lastwagen mit großen dampfenden Kübeln herankurvte‚ sah es aus‚ als würden sie in einem massierten Amoklauf direkt in den Tod hetzen.
Schüsse‚ Pfiffe. Die Vordersten mußten mit dem Seitengewehr zurückgetrieben werden.
Es gab Kapusta‚ Krautsuppe. Manche‚ die kein Kochgeschirr hatten‚ fuhren mit der hohlen Hand in die Kanne. Sie wurden brutal abgedrängt‚ diesmal von ihren eigenen Mitgefangenen. Sie schluckten und würgten mit herausquellenden Augen die Suppe in sich hinein. Erst als sie begriffen‚ daß sie nachfassen konnten‚ kamen die ersten wieder zur Besinnung.
Ein schlanker russischer Major ging mit hochgezogenen Schultern am Bahnsteig entlang und gab den Konvois Befehle. Er trug ein Kochgeschirr in der Hand‚ blieb vor dem Wagen stehen und rief: »Fährmann!«
Sein Akzent verballhornte den Namen. Kudritzky verstand ihn als erster. »Dein Typ wird verlangt«‚ sagte er erschrocken.
Der Dolmetscher meldete sich. Der Offizier ließ sich sein Soldbuch zeigen. Dann nickte er und überreichte dem Plenny ein mit Limonade gefülltes Kochgeschirr‚ auf dessen Deckel deutlich sichtbar mit der Gabel der Name »Fährmann« eingeritzt war.
»Haste Töne?« sagte Kudritzky. »Die klauen wie die Raben‚ und dann tragen sie dir noch die Schose nach.«
Die Willkür hatte auch ihre guten Seiten. Die Plennys sollten noch lange Zeit haben‚ sie in allen Spielarten kennenzulernen.
Sie konnten sich auf der Bahnstation auf einen längeren Aufenthalt einrichten. Sie durften auf und ab gehen‚ um sich vor dem Erfrieren zu schützen. Auf einmal waren sie wieder in Not. Die hinuntergeschlungene Verpflegung donnerte durch ihre ausgemergelten Leiber.
Fährmann wandte sich an den Posten und fragte‚ wo sie ihre Notdurft verrichten könnten. Der Rotarmist grinste und wies mit der Hand auf den Bahnsteig‚ auf dem sich immer mehr Zivilisten versammelt hatten.
»Dann nichts wie Hosen runter!« erwiderte Kudritzky. »Macht schnell‚ Kumpels‚ damit ihr euch nicht den Arsch abfriert.« Das Bild war kläglich und komisch zugleich.
Penzlau kümmerte sich um Müller zwo. Kudritzky hockte sich diesmal vorsichtshalber auf das gefüllte Kochgeschirr seines alten Kumpels.
»Sense«‚ raunte der junge Arzt Fährmann zu: »Wir haben die schönste Infektion … Wenn ich keine Sulfonamide bekomme oder so was ähnliches‚ geht er uns in den nächsten Stunden hops.«
Der Dolmetscher wandte sich an den ersten Posten‚ ging‚ als er keine Antwort erhielt‚ zum nächsten‚ sprach einen dritten an. Aber woher sollten die Konvois auf diesem gottverlassenen Bahnsteig Medikamente haben?