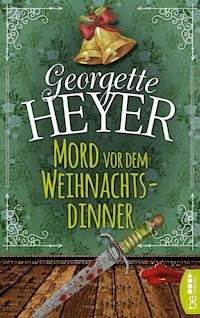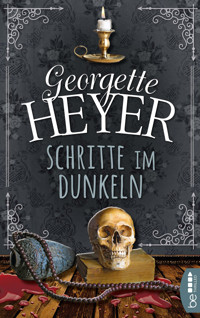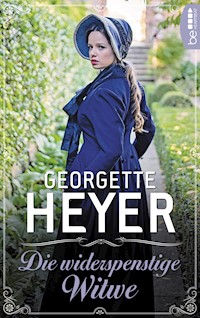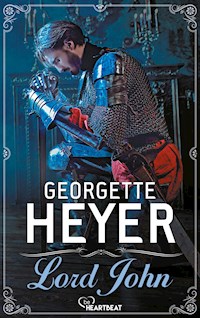6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die 17-jährige Penelope Creed ist Waise und Erbin eines großen Vermögens. Das wird ihr zum Verhängnis, denn ihre geldgierige Tante will sie zwingen, ihren unsympathischen und glupschäugigen Sohn Frederick zu heiraten. Das lässt sich das energische junge Mädchen nicht gefallen und beschließt zu fliehen. Durch Zufall begegnet sie dabei dem charmanten Earl Richard Wyndham, der ebenfalls eine ungewollte Ehe eingehen soll. Da die beiden das gleiche Los teilen, ersinnen sie einen spontanen Plan: Getarnt als Onkel und Mündel machen sie sich mit der Postkutsche auf den Weg zu einem alten Freund von Penelope. Aber so leicht kann man der Liebe nicht entfliehen ...
"Penelope und der Dandy" (im Original: "The Corinthian") ist ein vergnüglicher Gesellschaftsroman aus der Feder der unvergleichlichen Georgette Heyer - jetzt als eBook bei beHEARTBEAT. Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Leseprobe – Virginia
Über dieses Buch
Die 17-jährige Penelope Creed ist Waise und Erbin eines großen Vermögens. Das wird ihr zum Verhängnis, denn ihre geldgierige Tante will sie zwingen, ihren unsympathischen und glupschäugigen Sohn Frederick zu heiraten. Das lässt sich das energische junge Mädchen nicht gefallen und beschließt zu fliehen. Durch Zufall begegnet sie dabei dem charmanten Earl Richard Wyndham, der ebenfalls eine ungewollte Ehe eingehen soll. Da die beiden das gleiche Los teilen, ersinnen sie einen spontanen Plan: Getarnt als Onkel und Mündel machen sie sich mit der Postkutsche auf den Weg zu einem alten Freund von Penelope. Aber so leicht kann man der Liebe nicht entfliehen …
Über die Autorin
Georgette Heyer, geboren am 16. August 1902, schrieb mit siebzehn Jahren ihren ersten Roman, der zwei Jahre später veröffentlicht wurde. Seit dieser Zeit hat sie eine lange Reihe charmant unterhaltender Bücher verfasst, die weit über die Grenzen Englands hinaus Widerhall fanden. Sie starb am 5. Juli 1974 in London.
Georgette Heyer
Penelope und der Dandy
Aus dem Englischen von Luise Wasserthal-Zuccari
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2019
by Bastei Lübbe AG, Köln
Copyright © Georgette Heyer, 1940
Die Originalausgabe THE CORINTHIAN erschien 1940 bei William Heinemann.
Copyright der deutschen Erstausgabe:
© Paul Zsolnay Verlag GmbH, Hamburg/Wien, 1959.
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de unter Verwendung eines Motives © Richard Jenkins
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar
ISBN 978-3-7325-7326-4
Dieses eBook enthält eine Leseprobe des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes „Virginia“ von Alexandra Ripley.
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1994 Lafayette Hill, Inc.
Titel der amerikanischenOriginalausgabe: From Fields of Gold
Originalverlag: Warner Books, New York
Für die deutschsprachige Erstausgabe:
Copyright © der deutschen Übersetzung 1995 by Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © iStock: Opla | StevenGaertner
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Kapitel 1
Die Gesellschaft, die ein seine Missbilligung nicht verhehlender Butler in den Gelben Salon von Sir Richard Wyndhams Haus am St. James’s Square geleitete, bestand aus zwei Damen und einem widerstrebenden Herrn. Der Herr, nicht viel älter als dreißig Jahre, doch mit einer fatalen Neigung zur Korpulenz, schien des Butlers Missbilligung zu spüren, denn als dieses würdevolle Individuum die ältere der beiden Damen informierte, Sir Richard sei nicht zu Hause, warf er ihm einen flehentlichen Blick zu – keineswegs den Blick, mit dem ein englischer Pair einen Knecht misst, sondern den uralten Blick, den ein hilfloser mit dem andern wechselt – und sagte bittenden Tones: »Also, glauben Sie nicht, Lady Wyndham –? Louisa, sollten wir nicht doch lieber –? Ich meine, es hat doch keinen Sinn, weiterzugehen, meine Liebe, nicht wahr?«
Weder seine Gattin noch seine Schwiegermutter schenkten seiner eindringlichen Vorstellung die geringste Aufmerksamkeit. »Wenn mein Bruder ausgegangen ist, werden wir eben auf seine Rückkehr warten«, sagte Louisa energiegeladen.
»Dein armer Papa war stets außer Haus, wenn man ihn brauchte«, klagte Lady Wyndham. »Es greift mir außerordentlich ans Herz, zu sehen, wie Richard ihm von Tag zu Tag mehr gleicht.«
Ihre mehr und mehr abklingende Stimme war so weinerlich, dass man befürchten musste, die Dame würde sich auf der Türschwelle ihres Sohnes in Tränen auflösen. George, Lord Trevor, wurde mit Unbehagen eines Taschentuches in der schmalen, behandschuhten Hand gewahr, und nahm davon Abstand, weitere Einwände dagegen zu erheben, das Haus im Kielwasser der beiden Damen zu betreten.
Lady Trevor wies jeglichen Erfrischungstrunk zurück, geleitete ihre Mutter in den Gelben Salon, installierte sie bequem auf einem mit Satin überzogenen Sofa und tat ihre Absicht kund, wenn nötig auch den ganzen Tag auf dem St. James’s Square zu verbringen. George, der sich, von Sympathie bewegt, gut vorstellen konnte, welche Gefühle sein Schwager hegen würde, wenn er, rückkehrend, seinen Wohnsitz von einer Familiendeputation belagert sah, sagte unglücklich: »Weißt du, ich glaube, wir sollten das nicht tun, wirklich nicht! Mir gefällt die Sache gar nicht. Ich wünschte, du ließest diese Idee fallen, die ihr euch in den Kopf gesetzt habt.«
Seine Gattin warf ihm einen nachsichtig-verachtungsvollen Blick zu, während sie ihre lavendelfarbenen Glacéhandschuhe auszog. »Mein lieber George, sei versichert, dass, wenn du dich schon vor Richard fürchtest, ich dies keineswegs tue.«
»Ich mich vor ihm fürchten! Warum nicht gar! Aber ziehe doch bitte in Betracht, dass ein Mann von neunundzwanzig Jahren nun einmal keinen Gefallen daran findet, wenn andere sich in seine Angelegenheiten einmischen. Außerdem wird er sich höchstwahrscheinlich fragen, was das Ganze zum Teufel mit mir zu tun hat, und darauf weiß ich wirklich keine Antwort. Ich wollte, ich wäre nicht hergekommen.«
Louisa ignorierte diese Bemerkung, die sie einer Erwiderung für unwert befand – hielt sie doch ihren Herrn und Gebieter in eiserner Zucht. Sie war eine hübsche Frau; ihr Gesicht zeigte große Entschlusskraft und einen Anflug beißenden Humors. Sie war zwar nicht nach dem allerletzten Modeschrei gekleidet, demzufolge diesen Sommer die Schleiergewebe jedweden Reiz eines Frauenkörpers zu enthüllen hatten, doch mit großer Eleganz und Anstand. Da sie eine sehr gute Figur besaß, stand ihr die herrschende Mode mit den hochgegürteten Kleidern, tief ausgeschnittenen Leibchen und winzigen Puffärmeln ausgezeichnet: in der Tat, weitaus besser, als hautenge Pantalons und ein langschößiger Rock ihrem Gatten standen.
Die Mode meinte es mit George nicht gerade gut. Am besten sah er noch in wildledernen Reithosen und Stulpenstiefeln aus, doch unseligerweise war er dem Dandytum ergeben und schuf sowohl seinen Freunden wie Anverwandten viel Pein, indem er jede Extravaganz mitmachte, auf das Arrangement seines Halstuchs ebenso viel Zeit verwandte wie Mr. Brummell selbst und seinen Leib in enge Korsette zwängte, die bei jeder unbedachten Bewegung heftig zu krachen begannen.
Das dritte Mitglied der Gesellschaft – schlaff auf das Satinsofa zurückgesunken – war eine Dame, die über ebenso viel Entschlossenheit wie ihre Tochter, aber eine weitaus sachtere Art verfügte, ihre Wünsche durchzusetzen. Seit zehn Jahren Witwe, erfreute sich Lady Wyndham einer überaus zarten Gesundheit. Schon die leiseste Andeutung von Opposition war dem delikaten Zustand ihrer Nerven abträglich; und jedermann, der sie mit Taschentuch, Riechfläschchen und Hirschhorngeist, ihren ständigen Begleitern, hantieren sah, hätte in der Tat mit Blödheit geschlagen sein müssen, um deren düstere Bedeutung zu verkennen. In ihrer Jugend war sie eine Schönheit gewesen; in den mittleren Jahren schien alles an ihr verblasst zu sein: Haar, Wangen, Augen, ja selbst die Stimme, die klagend und so leise war, dass es schwerfiel, sie zu vernehmen. Wie ihre Tochter besaß Lady Wyndham einen ausgezeichneten Geschmack in Kleidungsdingen, und da sie glücklicherweise im Genuss eines sehr reichlich bemessenen Leibgedinges stand, war sie imstande, ihrem Hang nach kostspieligem Modeputz zu frönen, ohne dadurch ihre anderen Ausgaben irgendwie beschneiden zu müssen. Dies hinderte sie keineswegs, sich für überaus bedürftig zu halten; andererseits war sie imstande, sich in endlose Klagen über ihre beschränkten Verhältnisse zu ergießen, ohne Armut im leisesten zu spüren, und die Sympathien ihrer Bekannten zu erringen, indem sie sich traurig über die Ungerechtigkeit des Letzten Willens ihres Gatten ausließ, der seinen einzigen Sohn in den alleinigen Besitz seines unermesslichen Vermögens gesetzt hatte. Ihr Leibgedinge, so schlossen die Freundinnen vage, lieferte sie wohl bald dem Hungertod aus.
Lady Wyndham, die in einem reizenden Haus der Clarges Street wohnte, vermochte das Gebäude am St. James’s Square nie ohne Herzweh zu betreten. Es war nicht, wie man nach dem schmerzlichen Blick, den sie darauf zu werfen pflegte, vermuten konnte, ein Familiensitz, sondern erst vor einigen Jahren von ihrem Sohn erworben worden. Zu Lebzeiten Sir Edwards hatte die Familie in einem weitaus größeren und überaus ungemütlichen Haus am Grosvenor Square gewohnt. Nach Sir Richards Ankündigung, er beabsichtige einen eigenen Haushalt zu führen, wurde es aufgegeben, und Lady Wyndham war von da an in der Lage, seinen Verlust zu beklagen, ohne länger unter seinen Unannehmlichkeiten leiden zu müssen. Doch mochte sie ihr Heim in der Clarges Street noch so sehr lieben, konnte man nicht verlangen, dass sie ihren Sohn mit Gleichmut in einem weitaus größeren Haus am St. James’s Square wohnen ließ; wenn sich durchaus kein anderer Grund zum Klagen einstellen wollte, kam sie stets auf diesen Umstand zurück und sagte – wie eben jetzt – in gequältem Tonfall: »Es ist mir unfassbar, was er mit einem solchen Haus bezweckt hat!«
Louisa, die – außer einem Gut in Berkshire – ein stattliches eigenes Haus besaß, grollte ihrem Bruder nicht im mindesten wegen seines Wohnsitzes. Sie antwortete: »Nichts Besonderes, Mama. Er wird wohl nur an seine Ehe gedacht haben, als er es kaufte. Meinst du nicht auch, George?«
George fühlte sich durch diese Heranziehung zwar geschmeichelt, doch er war ein ehrlicher und gewissenhafter Mensch und konnte es nicht über sich bringen, der Äußerung zuzustimmen, dass Richard sich je mit Heiratsgedanken getragen habe, weder damals, als er das Haus kaufte, noch sonst wann.
Louisa war verstimmt. »Na schön!«, sagte sie mit einem resoluten Blick. »Dann muss er eben dazu gebracht werden, an die Ehe zu denken!«
Lady Wyndham setzte ihr Riechsalz in Aktion, um einzuwerfen: »Der Himmel weiß, ich würde meinen Jungen nie drängen, etwas ihm Widerstrebendes zu tun, aber seit Jahren besteht die Abmachung, dass er und Melissa Brandon die langwährende Freundschaft unserer beiden Familien durch das Band der Ehe besiegeln werden.«
George glotzte sie an und, wünschte sich ins Pfefferland.
»Wenn er Melissa nicht heiraten will, bin ich bestimmt die Letzte, ihren Anspruch zu unterstützen«, sagte Louisa. »Doch es ist höchste Zeit, dass er irgendjemanden heiratet, und wenn er kein anderes geeignetes junges Frauenzimmer im Auge hat, wird es eben doch Melissa sein müssen.«
»Ich weiß nicht, wie ich Lord Saar gegenübertreten soll«, wehklagte Lady Wyndham und hob abermals ihr Riechfläschchen an die Nase. »Oder der lieben armen Emily, die außer Melissa noch drei Mädchen zu versorgen hat, von denen keine mehr als passabel aussieht. Sophia hat noch dazu Sommersprossen.«
»Augusta halte ich für keinen hoffnungslosen Fall«, sagte Louisa unparteiisch. »Auch Amelia könnte sich noch embellieren.«
»Mit ihrem Schielen!«, rief George.
»Nur ganz leicht mit dem einen Auge«, korrigierte Louisa. »Damit haben wir jedoch nichts zu schaffen. Melissa ist ein ausnehmend hübsches Geschöpf. Das kann niemand leugnen!«
»Und welch wünschenswerte Verbindung!«, seufzte Lady Wyndham. »Wirklich mit einer der besten Familien!«
»Ich hab gehört, Saar wird’s keine weiteren fünf Jahre mehr machen, jedenfalls nicht, wenn er weiter so wirtschaftet wie jetzt«, sagte George. »Alles in Bausch und Bogen mit Hypotheken belastet, und Saar selbst säuft sich noch ins Grab! Man sagt, ganz wie sein Vater.«
Die beiden Damen betrachteten ihn mit Missfallen. »Hoffentlich willst du damit nicht andeuten, George, dass auch Melissa sich der Flasche verschworen hat?«, sagte seine Gattin.
»Ach nein, nein! Gott bewahre, das hab ich nie im Leben gemeint! Sie ist bestimmt ein ausgezeichnetes junges Frauenzimmer. Aber ich will nur folgendes sagen, Louisa: Ich tadle Richard keineswegs, wenn er sie nicht haben will!«, erklärte George herausfordernd. »Da könnte man genauso gut eine Statue heiraten!«
»Ich muss gestehen«, räumte Louisa ein, »dass sie vielleicht ein bisschen kühl ist. Aber du wirst mir zugeben, dass sie sich in einer sehr heiklen Position befindet. Seit beider Kindheitstagen ist es abgemacht, dass sie und Richard ein Paar werden, und sie weiß das genauso gut wie wir. Und nun benimmt sich Richard in der abscheulichsten Weise! Ich verliere wirklich langsam die Geduld mit ihm!«
George war seinem Schwager herzlich zugetan, doch er wusste, dass es tollkühn war, ihn in Schutz zu nehmen, und so hielt er den Mund. Lady Wyndham holte wieder ihre Leidensgeschichte hervor. »Da sei Gott vor, dass ich meinen einzigen Sohn in eine unerwünschte Ehe hineindränge, doch mich verfolgt stündlich das Schreckensbild, dass er irgendeine fürchterliche Person niederer Abkunft heimführt und erwartet, dass ich sie willkommen heiße.«
Vor Georges geistigem Auge erstand eine Vision seines Schwagers. Zweifelnd sagte er: »Also wissen Sie, Ma’am, das tut er, glaube ich, wirklich nicht.«
»George hat ganz recht«, verkündete Louisa. »Ich würde von Richard nur besser denken, täte er’s. Das ist mir ja so schrecklich, ihn so unempfänglich für jeglichen weiblichen Charme zu sehen! Es ist unsinnig von ihm, das andere Geschlecht abzulehnen, aber das eine ist sicher: mag er es auch ablehnen, so ist er doch seinem Namen verpflichtet, und heiraten muss er! Ich habe mir gewiss jede erdenkliche Mühe genommen, ihn sämtlichen heiratsfähigen Mädchen vorzustellen, denn ich bin keineswegs auf seine Ehe mit Melissa Brandon versessen. Nun gut! Da er sich aber keines ein zweites Mal ansehen wollte und bei dieser Einstellung verharrt, wird Melissa glänzend zu ihm passen.«
»Richard meint, sie wollen ihn alle nur um seines Geldes willen«, erdreistete George sich zu sagen.
»Das könnte wohl sein. Aber was hat das schon zu sagen, ich bitte dich? Du willst doch nicht behaupten, dass Richard romantisch ist!«
Nein, das musste George zugeben: Romantisch war Richard nicht.
»Wenn ich es erlebe, ihn standesgemäß verheiratet zu sehen, kann ich in Frieden sterben!«, sagte Lady Wyndham, die füglich erwarten konnte, noch weitere dreißig Jahre zu leben. »Sein gegenwärtiger Wandel erfüllt mein armes Mutterherz mit den schlimmsten Ahnungen!«
Georges Loyalitätsgefühl zwang ihn, dagegen aufzubegehren. »Nein, wirklich, Ma’am! Das geht zu weit! An Richard ist kein Fehl, nicht der geringste von der Welt, auf mein Wort!«
»Mir reißt die Geduld!«, sagte Louisa. »Ich bin ihm von Herzen zugetan, aber ich verachte ihn auch von Herzen! Ja, das tue ich, mag’s nur jedermann hören, mir ist es gleichgültig! Er sorgt sich um nichts als um den Sitz seines Halstuchs, den Glanz seiner Stiefel und die Mischung seines Schnupftabaks!«
»Vergiss seine Pferde nicht!«, bat George unglücklich.
»Oh, seine Pferde! Na schön! Wir wollen ihm seinen Ruhm, famos zu kutschieren, nicht schmälern. Er hat Sir John Lade im Wettfahren nach Brighton geschlagen. Eine schöne Großtat, fürwahr!«
»Er ist auch sehr gewandt in Sport und Spiel!«, röchelte George mit letzter Kraft.
»Dir steht es ja frei, einen Menschen zu bewundern, der Spielsalons wie Jackson’s Saloon oder Cribb’s Parlour frequentiert – ich bewundere ihn nicht!«
»Nein, meine Liebe«, sagte George, »nein, meine Liebe, das wirklich nicht!«
»Es ist mir wohlbekannt, dass du an seiner Leidenschaft für den Spieltisch nichts Verwerfliches siehst! Doch ich weiß aus einwandfreier Quelle, dass er an einem einzigen Abend bei Almack dreitausend Pfund verlor!«
Lady Wyndham stöhnte und betupfte ihre Augen. »Oh, sprich nicht weiter!«
»Ja, aber er ist so verdammt reich, dass das nichts ausmacht«, erwiderte George.
»Die Ehe«, erklärte Louisa, »wird derlei Liebhabereien ein Ende setzen.«
Das niederschmetternde Bild, das dieser Machtspruch heraufbeschwor, verdammte George zum Schweigen. Lady Wyndham sagte mit geheimnisumwitterter Stimme: »Nur eine Mutter kann meine Ängste ermessen. Er befindet sich in einem gefährlichen Alter, und tagaus, tagein verfolgen mich die schauerlichsten Vorstellungen dessen, was er tun könnte!«
George tat den Mund auf, erhaschte einen Blick seiner Gattin, schloss ihn wieder und zupfte unglücklich an seiner Halsbinde.
Die Tür ging auf; ein Dandy stand auf der Schwelle und musterte zynisch die Verwandtschaft. »Ich bitte tausendmal um Entschuldigung«, sagte der Dandy gelangweilt, aber höflich, »Ergebenster Diener, Ma’am. Desgleichen, Louisa. Mein armer George! Ach – habe ich euch eigentlich erwartet?«
»Offenbar nicht!«, schlug Louisa kratzbürstig zurück.
»Nein. Will sagen, die haben sich’s in den Kopf gesetzt – ich konnt es ihnen nicht ausreden!«, erklärte George heroisch.
»Sicher nicht«, sagte der Dandy, schloss die Tür und trat näher. »Aber mein Gedächtnis, wisst ihr, mein beklagenswertes Gedächtnis!«
George unterzog seinen Schwager mit geübtem Auge einer Begutachtung und rief aufgewühlt: »Bei Gott, Richard, das gefällt mir! Einen verdammt gut geschnittenen Rock hast du da, auf mein Wort! Wer hat ihn angefertigt?«
Sir Richard hob seinen Arm und blickte auf die Manschette. »Weston, George, bloß Weston.«
»George!«, rief Louisa mit furchterregender Stimme.
Sir Richard lächelte schwach und schritt auf seine Mutter zu. Sie hielt ihm ihre Hand entgegen, und er beugte sich mit müder Anmut darüber, sie gerade noch mit den Lippen streifend. »Ich bitte tausendmal um Entschuldigung, Ma’am«, wiederholte er. »Meine Leute haben doch hoffentlich für eure Bedürfnisse gesorgt – äh – ich meine für die Bedürfnisse von euch allen?« Sein Blick schweifte lässig durch den Raum. »Du lieber Himmel!«, sagte er. »George, du stehst in der Nähe – sei so gut und ziehe die Klingel!«
»Wir benötigen keine Erfrischung, danke, Richard«, sagte Louisa.
Das leise, süße Lächeln brachte sie rascher zum Schweigen, als es die Vorhaltungen ihres Gatten je vermocht hatten. »Meine Louisa, du irrst dich – du irrst dich bestimmt! George bedarf ganz dringend eines – äh – Stimulans. Ja, Jeffries, ich habe geläutet. Den Madeira, bitte, und – oh! ah! – etwas Ratafia, Jeffries!«
»Richard, du hast den schönsten Wasserfall, den ich je gesehen habe!«, rief George, und sein Blick heftete sich bewundernd auf das komplizierte Arrangement der Halsbinde des Dandy.
»Du schmeichelst mir, George, ich fürchte, du schmeichelst mir.«
»Possen!«, schnaubte Louisa.
»Stimmt, meine liebe Louisa«, gab Sir Richard liebenswürdig zu.
»Reize mich ja nicht, Richard!«, sagte Louisa warnend. »Ich will einräumen, dass deine Erscheinung in allem so ist, wie sie sein soll – bewundernswert sozusagen!«
»Man tut, was man kann«, murmelte Sir Richard.
Ihr Busen schwoll. »Richard, ich könnte dich ohrfeigen!«, erklärte sie.
Das Lächeln verstärkte sich, ließ einen Schimmer ausgezeichneter weißer Zähne aufblitzen. »Das glaube ich nicht, meine Liebe.«
George vergaß sich so weit, zu lachen. Der Blick seiner Tierbändigerin wandte sich ihm zu. »Schweige, George!«, herrschte ihn Louisa an.
»Ich muss gestehen«, verkündete Lady Wyndham, deren mütterlicher Stolz sich nicht länger unterdrücken ließ, »außer Mr. Brummell, selbstverständlich, gibt es niemanden, der so gut aussieht wie du, Richard.«
Er verbeugte sich, schien jedoch durch diese Elogen nicht ungebührlich aufgeblasen zu sein. Möglicherweise nahm er sie als den ihm zustehenden Tribut hin. Er war einer der angesehensten Dandys. Von seiner Windstoßfrisur angefangen (die von allen Haartrachten am schwierigsten zu bewerkstelligen war) bis zu den Spitzen seiner funkelnden Stiefel hätte er für das Musterbild eines Elegants Modell stehen können. Ein Rock von feinstem Tuch brachte seine schönen Schultern zur vollendeten Geltung; die Halsbinde, die Georges Bewunderung hervorgerufen, war von Meisterhänden drapiert worden; die Weste bestätigte einen raffinierten Geschmack; die biskuitfarbenen Pantalons wiesen nicht eine einzige Falte auf, und die mit eleganten Goldquasten verzierten Schaftstiefel waren nicht nur eigens für ihn von Hoby angefertigt, sondern, wie George argwöhnte, mit einer Mischung aus Schuhwichse und Champagner poliert worden. Ein Lorgnon hing an einem schwarzen Band um seinen Hals; in Taillenhöhe trug er an der Weste eine Uhrentasche und in der einen Hand eine Schnupftabakdose aus Sèvres-Porzellan. Seine Miene drückte unsagbare Blasiertheit aus; doch keine Schneiderkunst, nicht die betonteste Lässigkeit vermochten die Muskeln seiner Waden oder die Stärke seiner Schultern zu verbergen. Oberhalb der gestärkten Kragenspitzen seines Hemdes demonstrierte ein hübsches, müdes Gesicht die Illusionslosigkeit seines Trägers. Schwere Lider senkten sich über graue Augen, die verständig genug blickten, jedoch nur die Eitelkeiten dieser Welt gewahrten; das Lächeln, das um den entschlossenen Mund spielte, schien die Narrheiten von Sir Richards Zeitgenossen zu bespötteln.
Jeffries kehrte mit einem Tablett zurück, das er auf einen Tisch setzte. Louisa lehnte das Angebot einer Erfrischung ab, aber Lady Wyndham nahm an, und George griff, durch das Schwachwerden seiner Schwiegermutter kühn gemacht, nach einem Glas Madeira.
»Du fragst dich vermutlich«, sprach Louisa, »was uns hergeführt hat.«
»Ich vergeude meine Zeit niemals mit müßigen Betrachtungen«, erwiderte Sir Richard sanft. »Ich bin sicher, dass du es mir sagen wirst.«
»Mama und ich sind hergekommen, um mit dir über deine Heirat zu sprechen«, stürmte Louisa mit Todesverachtung vorwärts.
»Und worüber«, erkundigte sich Sir Richard, »wollte George mit mir sprechen?«
»Natürlich ebenfalls darüber!«
»Nein!«, verwahrte sich George eilends dagegen. »Du weißt ganz gut, dass ich sagte, ich wolle nichts damit zu schaffen haben! Ich wollte überhaupt nicht herkommen!«
»Schenk dir noch Madeira ein«, redete ihm Sir Richard gütlich zu.
»Oh danke, gern. Aber glaube bitte ja nicht, dass ich hier bin, um dich wegen etwas zu sekkieren, was mich nichts angeht – denn das ist nicht der Fall.«
»Richard!«, sagte Lady Wyndham eindringlich. »Ich wage Saar nicht mehr gegenüberzutreten!«
»Ist es schon so weit mit ihm gekommen?«, fragte Sir Richard. »Ich habe ihn in den letzten Wochen nicht gesehen, aber dies überrascht mich nicht. Bilde mir ein, ich hörte schon etwas dergleichen läuten – vergaß nur, von wem. Hat sich völlig dem Brandy ergeben, wie?«
»Manchmal«, sagte Lady Wyndham, »halte ich dich für gänzlich gefühllos.«
»Er will dich nur ein bisschen reizen, Mama. Du weißt ganz gut, was Mama meint, Richard. Wann beabsichtigst du um Melissa anzuhalten?«
Es trat eine kurze Pause ein. Sir Richard stellte sein leeres Weinglas nieder und schnippte mit seinem langen Zeigefinger die Blütenblätter von einer der Blumen auf dem Tisch. »Dieses Jahr, nächstes Jahr, irgendwann einmal – oder nie, meine liebe Louisa.«
»Ich bin ganz sicher, dass sie sich als mit dir verlobt betrachtet«, sagte Louisa.
Sir Richard hatte die Augen auf die Blume in seiner Hand geheftet, doch bei diesen Worten hob er sie mit einem sonderbar scharfen, schnellen Blick zu seiner Schwester empor. »Wirklich?«
»Wie denn nicht? Du weißt sehr gut, dass Papa und Lord Saar dies vor Jahren so abmachten.«
Seine Lider verschleierten von neuem die Augen. »Wie mittelalterlich von dir!«, seufzte er.
»Nein, Richard, versteh mich bitte nicht falsch! Wenn dir Melissa nicht gefällt, erübrigt sich jedes weitere Wort. Aber sie gefällt dir – oder wenn das nicht der Fall ist, hab ich’s dich jedenfalls nie sagen hören. Mama und ich – und auch George – meinen, dass es höchste Zeit für dich ist, einen Hausstand zu gründen.«
Ein schmerzlicher Blick traf vorwurfsvoll Lord Trevor. »Et tu, Brute?«, rief Sir Richard.
»Ich beschwöre, nie etwas dergleichen gesagt zu haben!«, erklärte George und verschluckte sich an seinem Madeira. »Nur Louisa war immer diejenige! Möglich, dass ich ihr einmal beigepflichtet habe. Du weißt ja, wie das ist, Richard!«
»Ich weiß es«, bestätigte Sir Richard seufzend. »Und du, Mama?«
»Oh, Richard, ich lebe nur für den Tag, da ich dich glücklich verheiratet und im Kreise deiner Kinderchen sehen kann!«, sagte Lady Wyndham mit zitternder Stimme.
Ein leichter, jedoch unverkennbarer Schauer durchlief den Dandy. »Im Kreise meiner Kinderchen ... Ja. So ist’s, Ma’am. Fahren Sie bitte fort!«
»Du schuldest es deinem Namen«, drang seine Mutter in ihn. »Du bist der Letzte der Wyndhams, denn es ist nicht anzunehmen, dass dein Onkel Lucius noch zu einem so späten Termin heiratet. Und da ist Melissa, das liebe Mädchen, genau die Richtige für dich! So hübsch, so distinguiert – bezüglich Geburt und Erziehung das Wünschenswerteste, das man sich vorstellen kann!«
»Ah – Verzeihung, Ma’am, aber beziehen Sie Saar und Cedric, von Beverley ganz zu schweigen, ebenfalls in diesen Sammelbegriff ein?«
»Genau das, was ich sage!«, platzte George heraus. »‹Alles recht schön und gut›, hab ich gesagt, ‹und wenn ein Mann durchaus einen Eisberg heiraten will, ist’s mir gleich, aber verdammt will ich sein, wenn du Saar als einen wünschenswerten Schwiegervater bezeichnen kannst! Und was die feinen Brüder des Mädels betrifft›, hab ich gesagt, ‹die werden Richard binnen einem Jahr ruiniert haben.›«
»Unsinn!«, sagte Louisa. »Es versteht sich von selbst, dass Richard anständige Leibrenten aussetzen würde. Was hingegen Cedrics und Beverleys Schulden betrifft, wüsste ich wirklich nicht, wieso er zu deren Bezahlung herangezogen werden könnte!«
»Das beruhigt mich, Louisa«, sagte Sir Richard.
Sie warf ihm einen Blick zu, der ihre warme Zuneigung nicht verkennen ließ. »Ich glaube, Richard, es wäre an der Zeit, aufrichtig zu sein. Demnächst werden die Leute sagen, dass du dich Melissa gegenüber nicht anständig verhältst, denn du musst wissen, euer Verlöbnis ist ein offenes Geheimnis. Hättest du dich vor fünf oder zehn Jahren entschlossen, eine andere zu heiraten, wäre es etwas anderes gewesen. Aber soviel ich weiß, hast du deine Zuneigung keinem einzigen Wesen zugewandt, und nun bist du nahe den Dreißig, mit Melissa Brandon so gut wie verlobt, und denkst noch immer nicht an einen Hausstand!«
Bei diesen Worten fühlte sich Lady Wyndham, mochte sie ihrer Tochter auch völlig beistimmen, bemüßigt, ihren Sohn in Schutz zu nehmen; sie tat dies, indem sie Louisa daran erinnerte, dass Richard schließlich erst neunundzwanzig sei.
»Mama, Richard ist in weniger als sechs Monaten dreißig Jahre alt. Denn ich«, erklärte Louisa, mit grimmiger Entschlossenheit, »bin über einunddreißig.«
»Louisa, ich bin bewegt!«, rief Sir Richard. »Nur tiefste schwesterliche Ergebenheit, dessen bin ich sicher, vermochte dir ein derartiges Geständnis zu entreißen.«
Sie konnte ein Lächeln nicht unterdrücken, sprach jedoch mit so viel Strenge, als sie aufzubringen imstande war: »Da gibt’s nichts zu lachen. Du stehst nicht mehr in der ersten Jugend, und du weißt ebenso gut wie ich, dass es deine Pflicht ist, ernsthaft an deine Verehelichung zu denken.«
»Wie seltsam«, sann Sir Richard, »dass Pflichten unweigerlich unangenehm sein müssen.«
»Wie wahr!«, sagte George mit einem tiefen Seufzer. »Wie sehr wahr!«
»Pah, Unsinn! Was für ein Aufhebens ihr doch um eine so simple Angelegenheit macht!«, sagte Louisa. »Wenn ich dich drängte, irgendeinen romantischen Backfisch zu heiraten, der fortwährend Liebesgeständnisse von dir erwartet und sich jedes Mal die Augen ausweint, wenn du deinen Vergnügungen außerhalb ihrer Gesellschaft nachgehst, dann hättest du ein Recht, zu klagen. Melissa jedoch – ja, sie ist ein Eisberg, George, wenn du willst, aber was ist schon Richard anderes, bitte sehr? –, Melissa, sage ich, wird dich nie solcherart belästigen.«
Sir Richards Augen weilten einen Augenblick lang mit einem unergründlichen Ausdruck auf ihrem Antlitz. Dann näherte er sich dem Tisch und goss sich von neuem Madeira ein.
Louisa suchte sich zu verteidigen: »Nun, du willst doch nicht, dass sie sich dir an den Hals hängt, nicht wahr?«
»Gewiss nicht.«
»Und du bist in keine andere verliebt, nicht wahr?«
»Nein.«
»Na also! Gewiss, wärst du gewohnt, dich immer wieder aufs Neue zu verlieben, würde das etwas anderes sein. Aber, geradeheraus gesagt, du bist das kälteste, gleichgültigste, egoistischste Geschöpf, das es gibt, Richard, und du wirst in Melissa eine bewundernswerte Partnerin finden.«
Ein unartikuliertes Glucksen von Seiten Georges, das wohl Protest andeuten sollte, veranlasste Sir Richard, auf den Madeira zu weisen. »Bediene dich, George, bediene dich.«
»Ich finde es höchst unfreundlich von dir, derart zu deinem Bruder zu sprechen«, sagte Lady Wyndham. »Allerdings, du bist ein Egoist, lieber Richard. Das habe ich oft und oft schon gesagt. Aber ist es nicht der Großteil der Menschheit? Wohin man sich wendet, nichts als Undank!«
»Habe ich Richard Unrecht getan, bitte ich ihn gern um Verzeihung«, sagte Louisa.
»Sehr anständig von dir, Schwesterchen. Du hast mir nicht Unrecht getan. Ich wollte, du sähst nicht so verzweifelt aus, George: Dein Mitleid ist an mir vergeudet, das versichere ich dir. Sag mir eines, Louisa: hast du einen Grund anzunehmen, dass Melissa meine – äh – Bewerbung erwartet?«
»Gewiss. Sie erwartete sie jede Stunde in den vergangenen fünf Jahren!«
Sir Richard blickte leicht bestürzt drein. »Armes Mädel!«, rief er. »Ich muss wirklich mit bemerkenswertem Stumpfsinn geschlagen gewesen sein!«
Seine Mutter und Schwester wechselten miteinander Blicke. »Heißt das, dass du ernstlich an eine Verehelichung denken willst?«, fragte Louisa.
Nachdenklich sah er auf sie herab. »Es wird wohl dahin kommen müssen.«
»Also«, rief George, seiner Gattin die Stirne bietend, »ich würde mich an deiner Stelle nach irgendeinem heiratsfähigen Frauenzimmer umsehen! Herrgott, die tummeln sich doch zu Dutzenden herum! Hab ich doch ich weiß nicht wie viele mit eigenen Augen nach dir angeln sehen! Hübsche auch noch dazu, aber du schenkst ihnen ja keine Aufmerksamkeit, du undankbares Biest!«
»Oh doch«, sagte Sir Richard, den Mund verziehend.
»Muss George unbedingt vulgär sein?«, fragte Lady Wyndham mit tragischem Augenaufschlag.
»Schweige, George! Und was dich betrifft, Richard, finde ich es im höchsten Grade unsinnig von dir, eine solche Haltung einzunehmen. Es ist nicht zu leugnen, du bist der fetteste Happen auf dem Heiratsmarkt – ja, Mama, auch das ist vulgär, und ich bitte dich um Entschuldigung –, aber du hast eine niedrigere Meinung von dir, als ich sie dir zubillige, wenn du annimmst, dass dein Vermögen das Einzige an dir ist, das dich zu einer heißbegehrten Partie macht. Du giltst allseits als gut aussehend – es könnte fürwahr niemand abstreiten, dass du einen guten Eindruck machst; und wenn du dich der Mühe unterziehst, verbindlich zu sein, gibt es nicht einmal für den Anspruchsvollsten etwas an deinen Manieren auszusetzen.«
»Diese Lobeserhebung, Louisa, raubt mir fast die Sprache«, sagte Sir Richard tief bewegt.
»Ich meine es völlig ernst. Ich war im Begriff hinzuzufügen, dass du oftmals alles durch deine wunderlichen Launen verdirbst. Ich weiß wirklich nicht, wie du erwarten kannst, die Zuneigung eines weiblichen Wesens zu erringen, wenn du den Frauen niemals die kleinste Aufmerksamkeit zuwendest! Ich sage nicht, dass du unhöflich bist, aber in deiner Haltung liegen so viel Interesselosigkeit und Reserviertheit, dass eine empfindsame Frau davon abgestoßen werden muss.«
»Ich bin wirklich ein hoffnungsloser Fall«, sagte Sir Richard.
»Wenn du auf meine Meinung Wert legst – was wahrscheinlich nicht der Fall ist –, so stimmt das nicht, Richard: Du bist einfach verwöhnt. Du besitzest zu viel Geld, hast alles getan, was du tun wolltest, bevor du die Zwanzigerjahre hinter dich gebracht hast; sämtliche Mamas, die Ehen stiften wollten, sind dir um den Bart gestrichen, Speichellecker sind vor dir auf dem Bauch gekrochen, alle Welt hat dich mit Nachsicht behandelt. Der Enderfolg davon ist, dass du dich zu Tode langweilst. So! Nun hab ich’s herausgesagt, und wenn du mir auch für meine Worte nicht danken magst, wirst du zugeben müssen, dass ich recht habe.«
»Vollkommen recht«, bestätigte Sir Richard, »schauerlich recht, Louisa!«
Sie stand auf. »Nun, ich rate dir, dich zu verheiraten und einen Hausstand zu gründen. Komm, Mama! Wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten, und du weißt, dass wir auf dem Nachhauseweg noch in der Brook Street vorsprechen müssen. George, kommst du mit uns?«
»Nein«, erwiderte George, »nicht, wenn ihr in die Brook Street geht. Ich werde mich wohl schon jetzt zu White in Bewegung setzen.«
»Wie du willst, mein Lieber«, sagte Louisa und streifte wieder ihre Handschuhe über.
Nachdem die Damen zu der ihrer harrenden Barutsche geleitet worden waren, begab sich George nicht sogleich in seinen Klub, sondern kehrte an der Seite seines Schwagers ins Haus zurück. Er bewahrte ein mitfühlendes Schweigen, solange die Dienerschaft sich noch in Hörweite befand, doch dann warf er Sir Richard einen überaus inhaltsschweren Blick zu und äußerte bloß die zwei Worte: »Diese Weiber!«
»Du hast recht«, sagte Sir Richard.
»Weißt du, was ich an deiner Stelle täte, mein Junge?«
»Ja«, sagte Sir Richard.
George war fassungslos. »Teufel, du kannst’s nicht wissen!«
»Du würdest genau dasselbe tun, was ich tun werde.«
»Und zwar?«
»Oh – natürlich um Melissa Brandon anhalten«, erwiderte Sir Richard.
»Also, das täte ich nicht«, erklärte George mit Bestimmtheit. »Ich würde Melissa Brandon nicht heiraten, und wenn ich fünfzig Schwestern hätte! Ich würde mir ein traulicheres Schätzchen suchen, meiner Seel!«
»Die Schätzchen, die ich kannte, wurden am traulichsten, wenn es darum ging, dass ich meinen Geldbeutel aufschnürte«, sagte Sir Richard zynisch.
George schüttelte den Kopf. »Schlimm, sehr schlimm! Zugegeben, so was muss jeden Mann verbittern. Trotzdem hat Louisa recht, weißt du: du solltest dich verheiraten. Solltest nicht den Namen aussterben lassen.« Plötzlich kam ihm eine Idee. »Was wär’s, wenn du ausstreuen ließest, du hast dein gesamtes Vermögen verloren?«
»Nein«, sagte Sir Richard, »das möchte ich nicht.«
»Hab irgendwo von einem Burschen gelesen, der sich an einen Ort begab, an dem er unbekannt war. War ein Teufelskerl: irgendwo ein fremdländischer Graf, glaub ich. Kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ein Mädel kam dabei auch vor, das sich in ihn verknallte, und so war ihm geholfen.«
»So etwas soll’s geben«, sagte Sir Richard.
»Das behagt dir auch nicht?« George rieb sich ein wenig niedergeschlagen die Nase. »Weiß der Teufel, was ich dir noch vorschlagen soll!«
Er war noch immer in den Fall vertieft, als der Butler den Besuch Mr. Wyndhams ankündigte und ein stattlicher, wohlbeleibter und Tafelfreuden sichtlich nicht abgeneigter Gentleman sich ins Zimmer wälzte, mit dem fröhlichen Ruf: »Hallo, George! Du hier? Ricky, mein Junge, deine Mutter war schon wieder bei mir, zum Kuckuck mit ihr! Hat mir das Versprechen abgerungen, dich aufzusuchen, obwohl es über meinen Horizont geht, dass sie sich dieser Sache wegen Hoffnungen macht, hol’s der Teufel!«
»Verschone mich!«, sagte Sir Richard erschöpft. »Ich habe soeben einen Besuch meiner Mutter hinter mir, von Louisa ganz zu schweigen.«
»Du tust mir wirklich leid, mein Junge, und wenn du auf mich hören willst, so heirate dieses Brandon-Mädel, und du hast’s überstanden. Was seh ich da? Madeira? Gib mir ein Gläschen.«
Sir Richard reichte ihm eines. Er ließ seinen gewichtigen Leib in einen geräumigen Fauteuil sinken, streckte die Beine aus und erhob das Glas. »Auf das Wohl des Bräutigams«, kicherte er. »Schau nicht so grämlich drein, Neffe! Denk an die Freude, mit der du Saars Lebensabend vergolden wirst!«
»Hol dich der Teufel«, sagte Sir Richard. »Wenn du je einen Funken Anstandsgefühl besessen hättest, Lucius, würdest du vor fünfzig Jahren geheiratet und eine Schar von Bälgern nach deinem Ebenbild großgezogen haben. Eine schauerliche Vorstellung, ich gebe es zu, aber zumindest wäre ich dann nicht ausersehen, auf dem Altar der Familie geopfert zu werden.«
»Vor fünfzig Jahren«, gab sein Onkel, völlig unberührt von diesen Insulten, zurück, »hab ich kaum die ersten Hosen getragen. Dieser Wein ist recht trinkbar, Ricky. Hab übrigens gehört, dass der junge Beverley Brandon bis über den Hals in Schulden steckt. Wenn du dieses Mädel heiratest, wirst du geradezu ein öffentlicher Wohltäter werden. Aber lass dich lieber von deinem Advokaten bei der Festsetzung der Leibrenten beraten! Ich wette gut und gern um fünfhundert Pfund mit dir, dass Saar trachten wird, dich bis zum Weißbluten auszupressen. Was ist los mit dir, George? Zahnschmerzen?«
»Mir ist das Ganze zuwider«, sagte George. »Das hab ich Louisa schon von Anfang an gesagt, aber du weißt ja, wie die Weiber sind! Ich würde Melissa Brandon nicht haben wollen, und wenn sie das einzige ledige Frauenzimmer auf der ganzen Welt wäre.«
»Was, sie ist doch am Ende nicht die Scheckige?«, fragte Lucius unruhig.
»Nein, das ist Sophia.«
»Na, dann ist doch alles in Ordnung! Heirate das Mädel, Ricky, sonst wirst du niemals Ruhe haben. Schenk dir nach, George, damit wir noch einen Trinkspruch ausbringen können!«
»Wem gilt er diesmal?«, erkundigte sich Sir Richard, indem er die Gläser nachfüllte. »Nur zu!«
»Der Schar Bälger nach deinem Ebenbild, Neffe: Hoch sollen sie leben!«, grinste sein Onkel.
Kapitel 2
Lord Saar wohnte mit seiner Gattin und seiner aus zwei Söhnen und vier Töchtern bestehenden Familie in der Brook Street. Sir Richard Wyndham, der vierundzwanzig Stunden nach der Unterredung mit seiner eigenen Familie zum Haus seines Schwiegervaters in spe kutschierte, war insofern vom Glück begünstigt, als er Saar nicht in seinem Heim antraf und Lady Saar, wie ihn der Butler informierte, mit Honourable Sophia nach Bath aufgebrochen war. Statt dessen lief er in die Arme des Honourable Cedric Brandon, eines liederlichen jungen Gentlemans mit beklagenswert schlechten Sitten und einem ungeheuerlichen Charme.
»Ricky, liebster Freund!«, rief Honourable Cedric und verschleppte Sir Richard in einen kleinen Salon im Hinterhaus. »Sag mir nicht, dass du um Melissa anhalten kommst! Man behauptet zwar, gute Nachrichten haben noch nie jemanden getötet, aber ich richte mich ja nicht nach dem allgemeinen Geschwätz! Vater sagt, wir stehen vor dem nackten Ruin. Borge mir Geld, lieber Junge, ich kauf mich in ein Regiment ein, und dann ab nach Spanien, verdammt noch mal! Aber hör doch zu, Ricky! Hörst du mir zu?« Er fixierte Sir Richard, schien dann zufriedengestellt und fuhr fort, feierlich den Finger erhebend: »Tu’s nicht! Kein Vermögen ist groß genug, um unsere kleinen Affären zu bereinigen, auf Ehre! Lass dich mit Beverley in ja nichts ein! Man sagt, Fox hat ein Vermögen verspielt, bevor er noch einundzwanzig war. Ich geb dir mein Wort, dass er gegen Bev ein Waisenknabe ist, der reinste Waisenknabe. Unter uns, Ricky, der Alte ist total versoffen. Pst! Kein Wort! Habe nichts Böses über Vater gesagt! Aber lauf, Ricky! Diesen Rat geb ich dir: Lauf, was du kannst!«
»Würdest du dich wirklich in ein Regiment einkaufen, wenn ich dir das Geld gäbe?«, fragte Sir Richard.
»Nüchtern, ja; betrunken, nein!«, antwortete Cedric mit einem völlig entwaffnenden Lächeln. »Jetzt bin ich vollkommen nüchtern, aber nicht mehr lang. Gib mir keinen Heller, lieber Junge! Und gib vor allem Bev keinen Heller! Der ist ein schlechter Kerl. Wenn ich nüchtern bin, bin ich ein guter Kerl – aber mehr als sechs Stunden von den vierundzwanzig bin ich nicht nüchtern, darum sieh dich vor! Jetzt geh ich aber. Ricky, ich hab mein Bestes für dich getan, denn ich hab dich gern, aber wenn du trotzdem in dein Verderben rennst, wasche ich meine Hände in Unschuld. Verdammt nochmal, bis ans Ende meines Lebens werde ich an dir schmarotzen! Stell dir nun folgendes vor, lieber Junge: Bev und dein gehorsamster Diener sechs von sieben Tagen auf deiner Schwelle – wütende Gläubiger – Drohungen – die Brüder der Gattin vor dem Ruin – leere Taschen – das Weib in Tränen – kein anderer Ausweg als zahlen! Tu’s nicht! Wir sind’s nicht wert, wirklich nicht!«
»Warte!«, sagte Sir Richard und stellte sich ihm in den Weg. »Wirst du nach Spanien gehen, wenn ich deine Schulden zahle?«
»Ricky, jetzt bist du nicht nüchtern. Geh nach Haus!«
»Bedenke, Cedric, wie gut du in Husarenuniform aussehen würdest!«
Ein teuflisches Lächeln tanzte in Cedrics Augen. »Warum nicht gar! Aber jetzt sehe ich weit besser im Hyde Park aus. Mir aus dem Weg, Junge! Hab eine überaus wichtige Verabredung: habe gewettet, dass eine Gans im Hundertmeterrennen gegen einen Truthahn gewinnen wird. Kann gar nicht verlieren! Größtes sportliches Ereignis der Saison!«
Mit diesen Worten war er gegangen, es Sir Richard überlassend, ob er wirklich seinem Rat folgen und davonlaufen oder dem Vergnügen einer Unterredung mit Honourable Melissa Brandon entgegensehen solle.
Sie ließ ihn nicht lange warten. Ein Diener kam ihn nach oben bitten, und er folgte ihm das geräumige Treppenhaus empor zum Besuchszimmer im ersten Stock.
Melissa Brandon war eine hübsche Brünette knapp über fünfundzwanzig. Ihr Profil galt allgemein als makellos, doch en face gesehen, erwiesen sich ihre Augen als etwas zu streng. Anfangs hatte es ihr nicht an Bewerbern gefehlt, doch keiner der Gentlemen, die von ihrem unleugbar guten Aussehen angezogen worden waren, hatte, um in der Hahnenkampf-Terminologie ihres rüden älteren Bruders zu sprechen, Federn gelassen. Als sich Sir Richard über ihre Hand beugte, entsann er sich Georges »Eisberg«, doch er verbannte das Wort sogleich aus seinem fügsamen Geist.
»Nun, Richard?«
Melissas Stimme war kühl und eher sachlich, ebenso wie ihr Lächeln mehr einer automatischen Höflichkeit als einer spontanen Freudenbezeigung entsprang.
»Ich hoffe Sie bei vollem Wohlbefinden anzutreffen, Melissa?«, sagte Sir Richard förmlich.
»Danke, durchaus. Bitte nehmen Sie Platz! Ich setze voraus, dass Sie gekommen sind, um die Frage unserer Heirat zu erörtern.«
Er betrachtete sie mit leicht erhobenen Augenbrauen. »Du lieber Himmel!«, sagte er dann sanft. »Da hat offenbar jemand ein bisschen aus der Schule geplaudert.«
Sie war mit einer Näharbeit beschäftigt und fuhr fort, ihre Nadel in völliger Gleichmut zu handhaben. »Wir wollen doch nicht auf den Busch klopfen!«, sagte sie. »Ich bin gewiss über das Backfischalter hinaus, und Sie gehören, glaube ich, zu den verständigen Männern.«
»Waren Sie je ein Backfisch?«, erkundigte sich Sir Richard.
»Ich glaube nicht. Ich habe für derlei Narrheiten nichts übrig, noch bin ich romantisch veranlagt. Diesbezüglich können wir wohl für gut zueinander passend gelten.«
»Wirklich?«, sagte Sir Richard und ließ sein goldgefasstes Lorgnon sachte hin und her schwingen.
Sie schien belustigt. »Gewiss! Sie sind doch hoffentlich nicht plötzlich in letzter Minute sentimental geworden? Das wäre ja abgeschmackt.«
»Das Greisenalter«, bemerkte Sir Richard nachdenklich, »hat oft Sentimentalität im Gefolge. Zumindest wurde ich dahingehend informiert.«
»Mit dieser Frage brauchen wir uns nicht zu befassen. Ich mag Sie recht gut leiden, Richard, nur neigen Sie ein wenig zum Unsinntreiben und pflegen alles ins Spaßhafte zu ziehen. Ich bin etwas ernsthafter veranlagt.«
»In dieser Beziehung können wir also als nicht gut zueinander passend bezeichnet werden«, bemerkte Sir Richard.
»Ich halte diesen Einwand nicht für unüberwindlich. Das Leben, das Sie bis jetzt zu führen für gut gehalten haben, war schließlich nicht danach geartet, ernsthafte Reflexionen zu begünstigen. Ich glaube annehmen zu können, dass Sie seriöser werden, denn es scheint Ihnen nicht an Verständigkeit zu mangeln. Dies müssen wir jedoch der Zukunft überlassen. Jedenfalls bin ich nicht so unvernünftig, die Unterschiedlichkeit unserer Naturen als ein unübersteigbares Heiratshindernis, zu betrachten.«
»Melissa«, sagte Sir Richard, »wollen Sie mir etwas sagen?«
Sie blickte auf. »Was wünschen Sie von mir zu hören, bitte?«
»Waren Sie je verliebt?«, fragte Sir Richard.
Sie errötete leicht. »Nein. Und von meiner Warte aus betrachtet, bin ich froh, dass ich es nie war. Personen, die unter dem Einfluss starker Gefühle stehen, haben etwas ausnehmend Vulgäres an sich. Ich sage nicht, dass dies etwas Unrechtes ist, doch ich halte mich für anspruchsvoller als die Mehrheit und finde derlei Subjekte äußerst geschmacklos.«
»Sie ziehen es also nicht in den Bereich der Möglichkeit«, fragte Sir Richard gedehnt, »sich künftig irgendwann einmal – äh – zu verlieben?«
»Mein lieber Richard! In wen denn, ich bitte Sie?«
»Zum Beispiel in mich?«
Sie lachte. »Jetzt sind Sie aber richtig abgeschmackt! Falls man es Ihnen als notwendig hingestellt hat, sich mir unter der Vorspiegelung des Verliebtseins zu nähern, wurden Sie schlecht beraten. Unsere Ehe würde eine reine Vernunftehe sein. Etwas anderes könnte ich gar nicht ins Auge fassen. Ich habe Sie recht gern, doch Sie gehören keineswegs zu jener Sorte Männer, die wärmere Gefühle in meinem Busen wachrufen. Doch ich sehe wirklich nicht ein, warum dies uns beiden zu schaffen machen sollte. Wären Sie romantisch veranlagt, würden die Dinge anders liegen.«
»Ich fürchte«, sagte Sir Richard, »recht romantisch zu sein.«
»Sie belieben wohl wieder einmal zu scherzen«, erwiderte sie mit einem leichten Achselzucken.
»Durchaus nicht. Ich bin so sehr romantisch, dass meine Phantasie mit der Vorstellung tändelt, eine – zweifellos der Fabelwelt angehörende – Frau könnte mich heiraten wollen, nicht weil ich sehr reich bin, sondern – verzeihen Sie bitte meine Vulgarität! – weil sie mich liebt.«
Sie blickte verächtlich drein. »Ich hätte gedacht, Richard, Sie müssten über das Alter, in dem man schwülstige Redensarten gebraucht, bereits hinaus sein. Ich sage nichts gegen die Liebe, aber Liebesheiraten scheinen mir, aufrichtig gestanden, denn doch ein wenig unter unserem Niveau zu liegen. Man könnte ja geradezu glauben, Sie stünden mit den Kreisen der Kleinstadtbourgeoisie auf vertrautestem Fuße! Ich vergesse keineswegs, dass ich eine Brandon bin. Ich erkühne mich zu sagen, dass wir sehr stolz sind; ich hoffe es sogar!«
»Dies«, versetzte Sir Richard trocken, »heißt die Situation aus einem Blickwinkel betrachten, der sich mir, ich gestehe es, bis jetzt noch nicht eröffnet hat.«
Sie war verblüfft. »Das hätte ich nicht für möglich gehalten! Ich stellte mir vor, jedermann wüsste, wie wir Brandons bezüglich unseres Namens, unserer Geburt und unserer Tradition fühlen!«
»Ich verletze Sie nur ungern, Melissa«, sagte Sir Richard, »doch das Schauspiel, wie sich eine Frau Ihres Namens, Ihrer Geburt und Tradition kaltblütig dem Höchstbietenden offeriert, ist nicht unbedingt dazu angetan, der Welt eine eindrucksvolle Vorstellung von Ihrem Stolz zu geben.«
»Das nenne ich wahrlich Bühnensprache!«, rief sie. »Meine Pflicht der Familie gegenüber verlangt, dass ich mich gut verheirate, doch seien Sie versichert, dass mich selbst das nicht so weit erniedrigen könnte, mich mit jemandem von minderer Lebensart zu verbinden.«
»Das nenne ich wahrlich Stolz!«, sagte Sir Richard leise lächelnd.
»Ich verstehe Sie nicht. Sie wissen doch, die Angelegenheiten meines Vaters sind derart beschaffen, dass in Kürze –«
»Es ist mir nicht unbekannt«, sagte Sir Richard sanft. »Ich nehme an, es soll mein Privileg sein, Lord Saars Angelegenheiten – äh – zu entwirren.«
»Selbstverständlich!«, erwiderte sie, ihre statuarische Ruhe aufgebend. »Keine andere Überlegung hätte es vermocht, mich Ihre Bewerbung annehmen zu lassen.«
»Die Sache«, sagte Sir Richard, nachdenklich in die Betrachtung seiner Stiefelspitzen versunken, »wird etwas delikat. Wenn Aufrichtigkeit an der Tagesordnung ist, meine liebe Melissa, muss ich Sie darauf aufmerksam machen, dass ich – äh – meine Bewerbung noch nicht vorgebracht habe.«
Sie ließ sich durch diese Abfuhr keineswegs aus der Ruhe bringen und erwiderte kühl: »Ich hätte mir nie und nimmer vorgestellt, Sie würden die unserer Stellung angemessenen Anstandsregeln soweit vergessen können, um Ihre Bewerbung mir zu unterbreiten. Zu solcherlei Leuten gehören wir doch wahrlich nicht. Sie werden ohne Zweifel eine Unterredung mit meinem Vater erstreben.«
»Meinen Sie?«, fragte Sir Richard.
»Das setze ich mit großer Bestimmtheit voraus«, gab die Dame zurück, indem sie an ihrem Seidenfaden schnipselte. »Ihre Umstände sind mir ebenso gut bekannt wie die meinen Ihnen. Um es freiheraus zu sagen: Sie können von Glück sprechen, dass Sie in der Lage sind, um eine Brandon zu freien.«
Er musterte sie nachdenklich, enthielt sich jedoch jeder Bemerkung. Nach einer Pause fuhr sie fort: »Was die Zukunft betrifft, wird gewisslich keiner von uns große Ansprüche an den Partner stellen. Sie haben Ihre Vergnügungen: Sie kümmern mich nicht, und mag mein Verstand noch so sehr Ihre Vorliebe für Faustkämpfe, Kabriolett-Rennen, vulgäre Kartenspiele –«
»Des Pharospiels nicht zu vergessen«, warf er ein.
»Nun gut, des Pharospiels – ist ja alles eins. Mag ich auch derlei Narrheiten noch so sehr ablehnen, wiederhole ich, so hege ich dennoch nicht den Wunsch, mich in Ihre Vorlieben einzumengen.«